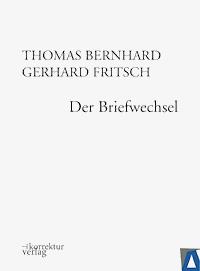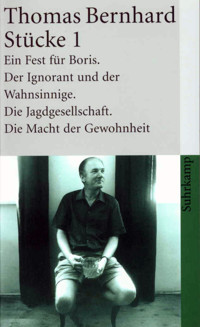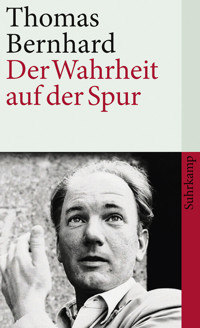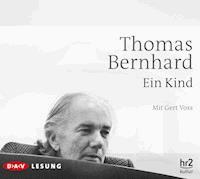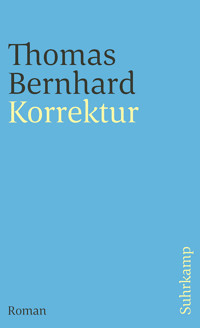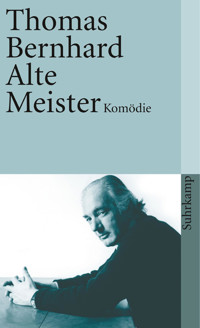9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Landarzt aus der Steiermark nimmt seinen Sohn auf Visite mit, einen Tag lang. Fälle präsentieren sich, wie eine Landpraxis sie bringt, Fälle, wie sich zeigt, die jenseits medizinischer Möglichkeiten erst beginnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thomas Bernhard
Verstörung
Verstörung
Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume macht mich schaudern.
Pascal, Penseé
Am 26. fuhr mein Vater schon um zwei Uhr früh zu einem Lehrer nach Salla, den er sterbend angetroffen und als Toten gleich wieder in Richtung Hüllberg verlassen hat, um dort ein Kind zu behandeln, das im Frühjahr in einen mit siedendem Wasser angefüllten Schweinebottich gefallen und jetzt schon wieder wochenlang, aus dem Spital entlassen, zu Hause bei seinen Eltern war.
Er ging gern zu dem Kind und ließ keine Gelegenheit aus, es aufzusuchen. Die Eltern waren einfach, der Vater als Bergmann in Köflach, die Mutter in einem Fleischhauerhaushalt in Voitsberg beschäftigt, das Kind aber doch nicht den ganzen Tag über allein, sondern in der Obhut einer Schwester der Mutter. An diesem Tag hat mein Vater so genau wie noch nie das Kind beschrieben und gesagt, er befürchte, daß es nur noch kurze Zeit zu leben habe. Mit Sicherheit könne er sagen, daß es den Winter nicht überstehen werde, und er werde es jetzt, so oft als ihm möglich, aufsuchen. Mir fiel auf, daß er von dem Kind wie von einem geliebten Menschen sprach, sehr ruhig und ohne sich die Wörter überlegen zu müssen; eine selbstverständliche Zuneigung zu dem Kind gestattete er sich, als er das Milieu, in welchem das Kind aufgewachsen und von seinen Eltern weniger erzogen als behütet worden ist, andeutete und seine Vermutungen, die Eltern und ihr Verhältnis zu dem Kind betreffend, mit der Kenntnis der Umwelt der Beschriebenen ausfüllte und erklärte. Er ging dabei in seinem Zimmer auf und ab und hatte bald nicht mehr das geringste Bedürfnis, sich noch einmal niederzulegen.
Er war jetzt der einzige Arzt in einem verhältnismäßig großen und außerdem »schwierigen« Gebiet, nachdem der zweite einen Ruf an die Grazer Universität angenommen hat und in die Landeshauptstadt verzogen ist. Die Aussicht auf einen neuen sei gering. Hier eine Praxis aufzumachen, grenze an Wahnsinn. Er sei es aber schon gewohnt, Opfer einer durch und durch kranken, zur Gewalttätigkeit sowie zum Irrsinn neigenden Bevölkerung zu sein. Er empfände es, wenn ich über das Wochenende zu Hause sei, als eine immer mehr notwendige Beruhigung. Er wirkte müde. Aber als uns die Ache blendete, nachdem ich die Fensterläden aufgemacht hatte, meinte er, er werde einen Spaziergang machen. »Geh mit«, sagte er, »komm.« Er sprach, während ich mich anzog, von einem »Naturphänomen«, von einem Kastanienbaum, der jetzt, Ende September, blühe und den er außerhalb der Ortschaft, an der Ache, entdeckt habe. Bei dieser Gelegenheit wolle er endlich mit mir sprechen, wahrscheinlich, dachte ich, über etwas mit meinen Studien in Leoben, mit dem Montanistischen, Zusammenhängendes. Jetzt sei, bevor er dann, den ganzen Tag über, seine Krankenbesuche zu machen habe, Zeit dazu. »Weißt du«, sagte er, »oft ist mir alles zuviel.«
Wir wollten meine Schwester nicht aufwecken und gingen möglichst geräuschlos ins Vorhaus hinunter, wo unsere Mäntel hingen. Als wir aber, angezogen, im Begriff waren, aus dem Haus zu gehen, läutete es, und vor der Tür stand ein mir Unbekannter, der, wie sich herausstellte, ein Gastwirt aus Gradenberg, meinen Vater aufforderte, sofort mit ihm zu kommen.
Und so fuhren wir in dem Wagen des Gastwirts nach Gradenberg, statt an die Ache zu gehen und uns zu besprechen, und von dem blühenden Kastanienbaum war keine Rede mehr, und wir hörten über die Frau des Gastwirts das Beunruhigendste.
Sie sei, sagte ihr Mann, bis zwei Uhr früh mit dem Bedienen von Bergmännern, die, bereits mehrere Stunden betrunken, sich als zwei feindliche Gruppen gegenübergesessen waren, beschäftigt, auf einmal von einem der Bergmänner völlig grundlos auf den Kopf geschlagen worden und im selben Augenblick ohnmächtig vor den Bergmännern auf dem Boden gelegen. Die entsetzten Bergmänner hätten sie sofort in das im ersten Stock des Gasthauses gelegene Schlafzimmer hinaufgetragen, wobei der Kopf der Frau mehrere Male gegen das Stiegengeländer gestoßen sei. Man habe die Frau in ihr Bett gelegt und ihrem Mann, der, als die Bergmänner die Schlafzimmertür aufdrückten, wach geworden, benommen aufgestanden und von den auf einmal ernüchterten Bergmännern von dem Vorfall unterrichtet worden war, nahegelegt, augenblicklich, noch in der Nacht, den Gewalttäter Größl, der, wenn auch flüchtig, ihnen doch allen bekannt sei, bei der Gendarmerie anzuzeigen. Die Gendarmen, auch der diensthabende, hätten alle geschlafen, meinte der Gastwirt, aber er habe sich durch Steinwürfe auf die Gendarmeriefenster schließlich Gehör und Einlaß in den Posten verschaffen können. Zuerst hätten ihm die Gendarmen geraten, am Vormittag wiederzukommen, um für ein Protokoll auszusagen, aber er bestand auf einer sofortigen Protokollierung und verlangte, daß wenigstens einer der Gendarmen mit ihm ins Gasthaus komme, dort liege seine bewußtlose Frau und dort warteten die Bergmänner, die, nach seiner Ansicht, ihre Aussagen sofort zu machen hätten. Es hat aber zu lange gedauert, bis er mit zweien von den Gendarmen ins Gasthaus zurückgekommen ist, die Bergmänner waren, bis auf einen, fort, als die Gendarmen mit ihm ins Schlafzimmer eintraten. Sofort habe er gedacht, daß er seine Frau nicht einen einzigen Augenblick hätte allein lassen sollen, wie er da plötzlich in den grauenhaftesten Vermutungen und Verdächtigungen vor ihr neben dem die ganze Zeit mit ihr zusammen gewesenen Bergmann Kolig stehen mußte, der ihm nicht näher, nur von unregelmäßigen Gasthausbesuchen bekannt war und nicht als einheimisch im Sinne von vertrauenswürdig galt, auch einen sich von dem in der Gegend gesprochenen unangenehm unterscheidenden steiermärkischen Dialekt sprach.
Obwohl der bei der Gastwirtsfrau zurückgebliebene Kolig so betrunken war, daß er wohl aufrecht stehen, aber keinen, nicht einmal kürzesten Satz sprechen konnte, sei er sofort von dem jüngeren der Gendarmen, der ihn gleich angewiesen habe, sich auf den in der Ecke stehenden Sessel zu setzen, einvernommen worden, während der ältere der beiden photographische Aufnahmen von der im Bett liegenden Bewußtlosen machte, als handele es sich um eine Tote. Was der einvernommene Kolig zu Protokoll gegeben hat, war tatsächlich unbrauchbar, und als er, weil er das Hinsetzen nicht vertragen hatte, nach vorn umzukippen drohte, packte ihn der mit ihm unzufriedene Gendarm und zog ihn und stieß ihn auf den Gang hinaus.
Der flüchtige Größl sei ein Mensch, der, sobald er ein Gasthaus betritt, so lange in einem solchen bleibt, bis er mit Sicherheit mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Es sei nicht schwierig, ihn ausfindig zu machen, sagten die Gendarmen, und sie hätten im Hinblick auf Größls einschlägige Vorstrafen von einer mehrere Jahre dauernden Kerkerstrafe gesprochen, denn der Tatbestand der schweren Körperverletzung sei durch den Faustschlag Größls auf den Kopf der Gastwirtsfrau, durch ihre Ohnmacht, gegeben. Kaum hatte der ältere Gendarm von der schweren Körperverletzung gesprochen, sei ihnen allen zu Bewußtsein gekommen, daß ein Arzt verständigt werden müsse. »Inzwischen sind ein paar Stunden vergangen«, sagte der Gastwirt.
Es war schon halb fünf, als wir, in Gradenberg angekommen, von dem Gastwirt sofort in das Schlafzimmer geführt wurden, in welchem die beiden Gendarmen standen. Mein Vater sagte, alle Männer sollten auf den Gang hinaus gehen. Während er drinnen die Frau untersuchte, die, in der kurzen Zeit, in welcher ich sie sah, auf mich den Eindruck gemacht hat, als wäre sie schon tot, äußerten sich auf dem Gang die beiden Gendarmen mir gegenüber abfällig über den auf dem Boden liegenden Kolig, den sie als stumpfsinnig, mehr und mehr gewissenlos seiner sechsköpfigen Familie gegenüber, bezeichneten. Sie wußten nicht, was anfangen mit ihm; als mein Vater aus dem Schlafzimmer herauskam, zogen sie den Kolig gerade an seinen Rockschultern von der Stiege weg, die er mit seinen Beinen zur Hälfte verlegt hatte, um sich dann nicht mehr um ihn zu kümmern.
Die Frau sei tatsächlich schwer verletzt und müsse sofort nach Köflach ins Spital, sagte mein Vater, die Gendarmen sollten sie vorsichtig hinuntertragen und in den Pritschenwagen legen.
Es war ein feuchtes, grünbraun gemustertes, mit billigen Weichholzmöbeln angefülltes und selbst beim hellsten Tageslicht verfinstertes Zimmer, aus welchem die Gendarmen die Gastwirtsfrau heraustrugen. Mein Vater schaute mich, an mir vorbei und hinter den Gendarmen, die die Frau vorsichtig trugen, die Stiege hinuntergehend, an, und ich dachte mir, daß das für die Gastwirtsfrau das Schlimmste bedeutet.
Während ich im Wagen neben dem chauffierenden Gastwirt Platz genommen hatte, saß mein Vater bei der auf der Pritsche Liegenden hinter uns.
Auf der ganzen Fahrt, die wir über Krennhof abkürzten, haben der Gastwirt und ich kein Wort gewechselt. Es war, wegen der frühen Tageszeit, leicht und schnell zu fahren. Lange bin ich nicht mehr in dieser Gegend gewesen, dachte ich, ich mußte weit in die allerfrüheste Kindheit zurückdenken, um mich da und dort am Gradnerbach zu sehen. Mir fiel auf, wie selten ich von meinem Vater auf seine Fahrten mitgenommen wurde und daß ich seit dem Tod meiner Mutter immer nur auf mich allein angewiesen bin. Meine Schwester muß das, denn es geht ihr nicht anders, in einem noch viel schmerzlicheren Grade empfinden.
Wohl der Stimmung entsprechend, sprach der Gastwirt, zum Unterschied von vorher, auf dem Weg nach Gradenberg, wo er so viel gesprochen hatte, auf dem Weg nach Köflach kein Wort. Mir wäre es auch unsinnig vorgekommen, ihn anzusprechen. Mir schien es, wenn ich meinen Vater richtig verstanden habe, gewiß, daß die Frau die Fahrt bis nach Köflach nicht überstehen würde, aber als die Spitalpfleger sie aus dem Wagen herauszogen, war sie nicht tot, starb aber noch, solange wir uns im Spital aufhielten. Sie war, noch bevor sie in das einzige im Spital vorhandene Operationszimmer, man kann nicht sagen Operationssaal, hineingekommen war, gestorben, und ihr Mann hatte das gefühlt und, während die Pfleger sie über den Gang schoben, ihre Hand gehalten und geweint. Man ließ ihn nicht bei der Toten, sondern führte ihn in den Hof hinunter, wo er, gänzlich sich selbst überlassen, eine halbe Stunde auf meinen Vater warten mußte. Ich ließ ihn allein und beobachtete ihn, so, daß er nicht sehen konnte, daß ich ihn beobachtete. Dann kam mein Vater und ging mit dem Gastwirt über den Hof und versuchte ihn zu beruhigen. Er sprach dem Manne von den Notwendigkeiten, die jetzt zu geschehen hätten, von Bestattungsangelegenheiten, Gerichtskommission, Anzeige gegen Größl wegen Totschlags. Für den Gastwirt sei es jetzt besser, sagte mein Vater, unter Menschen zu bleiben, sich nicht abzusondern in seiner Qual, in seine Qual, er, mein Vater, würde ihm verschiedene vorgeschriebene Wege, wie den zum Gericht, ersparen, andere, wie den allerersten zu seiner in der Prosektur liegenden Frau, schmerzlindernd mit ihm gemeinsam gehen. Er habe, sagte mein Vater, an der Verstorbenen eine in jedem Falle tödliche Blutung im Gehirn konstatiert und werde noch am frühen Vormittag vom Bezirksgerichtsarzt den genauen Befund bekommen. Daß er, mein Vater, von dem Gastwirt erst drei Stunden nach dem tödlichen Faustschlag von dem Vorfall verständigt worden sei, sei bedeutungslos. An eine Rettung sei nicht zu denken gewesen. Die Verstorbene war im zweiunddreißigsten Jahr und meinem Vater seit Jahren bekannt. Es erscheine ihm immer als eine ungeheuere Roheit der Gastwirte, daß sie ihre Frauen, während sie selber meistens schon früh, weil den ganzen Tag über durch ihre Fleischhauerei, ihren Viehhandel, ihre Landwirtschaft überanstrengt, ins Bett gehen, in den, weil ja nur an das Geschäft gedacht wird, bis in der Frühe offenen Gaststuben sich selbst und einer Männerwelt überlassen, die mit dem fortschreitenden Alkoholkonsum gegen den Morgen zu immer weniger wählerisch ist in den Mitteln ihrer Brutalität, sagte mein Vater, als wir uns für kurze Zeit von dem, wie es den Anschein hatte, um sein Bewußtsein gekommenen mit uns Gehenden abgesondert hatten.
»Alle in die Länge gezogenen Gasthausnächte enden ärgerlich«, sagte mein Vater, und »in dieser Gegend ein hoher Prozentsatz tödlich.« Nicht selten ist die von einem Gastwirt auf die widerwärtigste Weise zu den Besoffenen zu dem alleinigen Zweck, ihnen unter allen Umständen das Geld aus den Taschen herauszuziehen und den billigsten Brand in ihre widerstandslosen Därme hineinzupressen, auf verlängerte halbe und ganze Nächte, auch in ihrer ordinären Art hilflos in das Gastzimmer kommandierte eigene Frau das Opfer. Zu dem Gastwirt sagte mein Vater, als wir ihn wieder eingeholt hatten, daß es leicht sei, Größl zu finden. Die Gendarmerie sei von dem Totschlag verständigt, und wo Größl sich auch versteckt haben möge, es nütze ihm nichts. Aber je länger mein Vater auf den Mann, der, gerade weil er im Umgang mit dem Vieh, mit dem er handelte, im Umgang mit der Gastwirtewelt, die die seine ist, die Brutalität an sich auf die für die Bundscheckgegend so bezeichnende Weise verkörperte und dadurch rührte, wenn er weinte und gänzlich verloren war, einredete, desto unsinniger erschien es ihm offensichtlich, und er gab ihm, ich dachte mir, sehr einfach und leicht begreiflich, die notwendigsten Anweisungen, bevor wir ihn wieder mit sich selber allein ließen.
Mein Vater ging in die Prosektur und besprach sich mit dem Kollegen vom Gericht, während ich, gleichzeitig auch den Gastwirt beobachtend, wie er sich auf die einzige Bank im ganzen Spitalhof setzte, die Leiche seiner Frau in dem zweirädrigen Prosekturkarren, den ein junger Pfleger an mir vorbeischob, vermutete. Mir war der Anblick des Prosekturkarrens nichts Neues, denn oft auf dem Schulweg, der am Spital vorbeiführte, bin ich an der Stelle, wo man zwischen zwei Hollerbüschen auf die Prosektur durchschauen kann, stehengeblieben, um den Karren anzuschauen, der neben dem Eingang zur Prosektur Tag und Nacht, wenn er nicht gebraucht wird, in einem nach der Seite, von der ich ihn sehen konnte, offenen Schuppen steht. Dieser Prosekturkarren aus Blech hat schon immer eine grausige Faszination auf mich ausgeübt und ist oft in meinen Kindheitsträumen als ein schauerliches Hauptrequisit auf der Bühne gewesen. Der junge Pfleger, kaum schulentlassen, schob den Prosekturkarren zum Eingang der Prosektur und von dort hörte ich meinen Vater kommen. Mein Vater, dachte ich, als wir aus dem Spitalhof hinausgingen, rasch und an den Mauern entlang, um möglichst nicht mehr von dem unglücklichen, immer noch auf der Bank sitzenden Gastwirt gesehen zu werden, handelt doch nie, wie das immer gegen die Ärztlichkeit behauptet wird, da, wo er zu Hause ist, bei den Kranken und in den Spitälern, wie in einem riesigen unübersichtlichen Geschäft, sondern eher, wie mir gerade an diesem Tag schien, wie in einer mehr und mehr durchschaubaren Wissenschaft. Wohl gibt es viele Ärzte, wie ich immer wieder habe beobachten können, die, dachte ich, wenn auch durchaus wissenschaftliche Köpfe, nichts anderes als Geschäftsmänner sind und die auch wie Geschäftsleute sprechen und handeln; mein Vater aber gehört nicht dazu.
Es sei für mich eine fortgesetzte Traurigkeit, wenn ich ihn begleite, und aus diesem Grund zögere er auch die meiste Zeit, mich auf seine Krankenbesuche mitzunehmen, weil sich immer in allen Fällen zeige, daß alles, was er aufsuchen und anrühren und behandeln müsse, sich als krank und traurig erweise; gleich, um was es sich handle, bewege er sich fortwährend in einer kranken Welt unter kranken Menschen, Individuen; auch wenn diese Welt vorgebe, vortäusche, eine gesunde zu sein, sei sie doch immer eine kranke und die Menschen, Individuen, auch die sogenannten gesunden, immer krank. Er sei daran gewöhnt, mich könne das aber möglicherweise verstören, mich auf eine mir schädliche Weise nachdenklich machen; gerade ich neigte seiner Meinung nach immer dazu, mich von allem und jedem verstören zu lassen, über alles und jedes auf eine mich schädigende Weise nachzudenken. Und meine Schwester in einem noch viel gefährlicheren Maße. Es sei aber falsch, meinte er, sich der Tatsache, daß alles krank und traurig sei, er sagte tatsächlich krank und traurig, zu verschließen, und aus dem Grund sei er immer wieder in längeren oder kürzeren Abständen »dazu verführt«, mich oder meine Schwester auf die Krankenbesuche mitzunehmen. »Es ist immer ein Risiko«, sagte er. Am meisten fürchte er, daß einer von uns, meine Schwester oder ich, durch das Anschauen eines Kranken und seiner Krankheit für sein ganzes Leben geschädigt sein könne, wo er doch immer auf das Gegenteil an uns bedacht sei.
Wir gingen nach Köflach hinein. Er wollte auf die Bank und auf die Post, die aber noch geschlossen waren, und so nahm er mich zu einem ihm befreundeten Rechtsanwalt mit, mit dem er in Graz studiert hat und der mir von sommerlichen Besuchen bei uns bekannt ist, ein erfolgreicher Advokat in Grundstücksangelegenheiten.
Mein Vater erhoffte sich bei seinem Freund für uns beide ein Frühstück. Wir läuteten und es wurde uns aufgemacht und wir kamen in eine für eine Kleinstadt großzügig, wenn auch im einzelnen nicht geschmackvoll, so doch auf den ersten Blick gemütliche Wohnung, in welcher die vielen Sitzgelegenheiten zuerst auffielen. Wir waren von der jungen Frau des Advokaten empfangen und sofort in das Speisezimmer geführt worden. Es dauerte nicht lange, so kam der Advokat ins Zimmer. Mein Vater sagte, er habe nur kurze Zeit, dann müsse er mit mir wieder nach Hause. Während des Frühstücks, zu dem wir gerade recht gekommen waren und das so ausgiebig gewesen ist, wie ich noch keines gegessen habe, von meinem Platz aus konnte ich auf die Straße hinunterschauen und die Vorgänge, die sich da unten abspielten, beobachten, redeten wir von dem Totschlag, den Größl an der Gradenberger Gastwirtsfrau begangen habe. Es sei grauenhaft, meinte mein Vater, wie Menschen, wenn sie hemmungslos sind, vornehmlich in den Gasthäusern, aufeinander losgehen, ohne daß sie wissen, warum, denn, sagte er, auch der flüchtige Größl wisse nicht, warum er die Frau des Gastwirts erschlagen hat, »kann sein«, sagte mein Vater, »daß er überhaupt noch nicht weiß, daß er sie erschlagen hat«. Die Leute auf dem Land, die zuerst in die Brutalität und dann in die völlige Hilflosigkeit über ihre Brutalität ausarten, die immer in alles ausarten, in alles ausarten müssen, diese Leute seien heute erschreckend in der Mehrzahl.
Tatsächlich seien mehr Brutale und Verbrecherische auf dem Land als in der Stadt. Auf dem Land sei die Brutalität wie die Gewalttätigkeit das Fundament. Die Brutalität in der Stadt sei nichts gegen die Brutalität auf dem Land und die Gewalttätigkeit in der Stadt nichts gegen die Gewalttätigkeit auf dem Land. Die Verbrechen in der Stadt, die Stadtverbrechen, seien nichts gegen die Verbrechen auf dem Land, die Landverbrechen. Die städtischen Verbrechen seien lächerlich gegen die auf dem Land. Der Gastwirt, meinte er, sei der geborene Gewalttäter und Verbrecher. Alles an und in dem Menschen sei gewalttätig und verbrecherisch. Der Viehhändler, der er ist, der sei er in jedem Augenblick und in allen Situationen seines Lebens. »Wenn er auch jetzt heult«, sagte mein Vater, »so heult er doch um ein Vieh. Für einen Gastwirt ist die Frau nichts als ein Vieh.« Er fange sie eines Tages mit einem perversen Handgriff aus der unüberschaubaren Herde der unverheirateten Frauen heraus und ordne sie sich unter. Eine solche Gastwirtschaft sei, wie ein jedes Fleischhauer- oder Viehhändler- oder Bauernhaus unter dem Bundscheck, eine brutale Frauenzuchtanstalt. Wenn man genauer hinhöre, höre man, wann und wo man auf dem Land gehe, die von ihren Männern gezüchtigten Frauen in den Häusern. Er komme, sagte mein Vater, tagtäglich beinahe nur zu widerwärtigen Menschen, gehe, wenn er in diese Häuser hineingehe, in die Brutalität hinein, in die Gewalttätigkeit, im Grunde mit seiner Arzttasche immer nur in einer Verbrecherwelt hin und her. Und die Menschen unter der Gleinalpe und unter der Koralpe und im Kainach- und Gröbnitztal seien Musterbeispiele für eine von den Jahrmillionen und Jahrtausenden auf die ordinärsten Körperexzesse hin konstruierte Steiermark. Er erinnerte sich aber seines frühen Besuches bei dem Bergmannskind in Hüllberg und schilderte, wie er dort herzlich empfangen und eine Viertelstunde beruhigt und dann wieder genauso herzlich verabschiedet worden ist. Es sei aber ein Irrtum, zu glauben, meinte er, daß, was er über Leute wie den Gastwirt gesagt habe, nur auf die Wohlhabenden zuträfe; diese Kindeseltern und ihr Kind seien eine Ausnahme, »die Armen sind doppelt brutal, gemein und verbrecherisch und gerade sie, ihren Möglichkeiten entsprechend, in einem noch viel fürchterlicheren Maße«, sagte er.
Von dem Lehrer, den er als ersten hatte aufsuchen müssen, sprach er nicht, deshalb, schien mir, weil der ihm zu schnell, ohne daß er ihn eigentlich wahrgenommen hat, davongestorben ist. Ich dachte, daß er den Lehrer schon vergessen hat, denn nachdem er noch einmal von dem Kind und seinen Verbrennungen gesprochen und eine Schilderung der Sprechweise des Kindes gegeben hatte, kam er wieder auf den Gastwirt zurück. Der warte auf uns im Spital, sagte mein Vater, müsse uns in seinem Pritschenwagen zuerst wieder nach Gradenberg zurück, dann nach Hause fahren. Jetzt sei er wahrscheinlich schon in der Prosektur, wohin ihn mein Vater hatte begleiten wollen, was er aber wohl vergessen hat, und ich dachte, daß man jetzt in der Prosektur dem Gastwirt die Kleider seiner toten Frau gibt, und mit den zusammengebundenen Kleidern der Gastwirtsfrau unterm Arm erwartete uns der Gastwirt tatsächlich schon im Spitaleingang, nachdem wir, von dem Advokaten fort, auch noch auf der Post und auf der Bank gewesen waren.
Auf der Fahrt nach Gradenberg zurück zählte mein Vater die an diesem Tag zu besuchenden Kranken auf, er nannte die Namen Saurau, Ebenhöh, Fochler, Krainer.
Während mich, allein was ich in Zusammenhang mit dem Tod der Gastwirtsfrau erlebt habe, schon angegriffen hatte, bemerkte ich an meinem Vater jetzt nicht mehr die geringste Müdigkeit. Zu zweit neben dem chauffierenden Gastwirt sitzend, der den Wagen so ruhig lenkte, als wäre nichts ihn betreffendes Grauenhaftes vorgefallen, stellten wir uns beide, jeder für sich, die zu Besuchenden vor, und während der Gastwirt einmal bei einem Fleischhauer außerhalb Krennhof haltmachte und, sich entschuldigend, zu dem Zwecke eines Geschäftsabschlusses ausstieg und für ein paar Minuten nicht mehr zu sehen war, meinte mein Vater, daß ihm der Mensch, den er schon von Kindheit an kenne, daß ihm der, vor zehn Jahren noch ein Jüngling, heute sich immer noch mehr verfettende, die Umwelt abstoßende, in zunehmender Sexualschwerfälligkeit auf zwei O-Beinen Fortbewegende verhaßt sei. Als nicht weniger abstoßend habe er seine gerade verstorbene Frau bei jedem Besuch in Gradenberg empfunden. Die Kinderlosigkeit, die zwischen solchen Menschen wie den beiden Gradenberger Gastwirtsleuten herrscht, mache aus ihrer Ehe eine immer mehr sinnlose, schließlich und endlich in die perverse Niedrigkeit einmündende Ehe, an welcher sie, wenn sie nicht durch Gewalt, eben durch einen toll gewordenen Größl, getrennt werden, auf die miserabelste Weise zugrunde gehen.
Auf dem letzten Wegstück mußten wir über dem Gradnerbach einer Rinderherde ausweichen, und da sagte der Gastwirt mehrere Male, daß er, was geschehen sei, noch gar nicht begriffen habe. Er konnte sich die Wirklichkeit nicht vorstellen.
In Gradenberg angekommen, sahen wir viele Leute vor der Gastwirtschaft, in die kurz vorher die Gerichtskommission hineingegangen war. Als ich aus dem Wagen ausstieg, konstatierte ich überall aus kürzerer oder weiterer Entfernung herschauende Neugierige.
Mein Vater sagte, ich solle vor dem Gasthaus warten, er ginge rasch hinein, sich mit der Gerichtskommission besprechen, die im Gastzimmer versammelt war. Das Gasthaus war von unten bis oben von einer ununterbrochen murmelnden Amtlichkeit angefüllt, und im ersten Stock, in einem offenen Fenster, in dem Schlafzimmerfenster, entdeckte ich, weil ich hinaufschaute, zwei Gendarmenköpfe. Ich ging vor dem Gasthaus auf und ab, bis mein Vater mit dem Gastwirt herauskam, der uns nach Hause brachte. Im Gastzimmer befanden sich außer Kolig sämtliche Bergmänner, die Zeugen des Totschlags gewesen sind. Es war Samstag, das Bergwerk geschlossen. Die meisten konnten sich an den Vorfall nicht mehr erinnern, alle machten widersprüchliche Angaben, zwei von ihnen aber hatten Größl gesehen, als er die Gastwirtsfrau niedergeschlagen hat, das genügte ihnen. Tatsächlich sei, was mein Vater nicht für möglich gehalten hat, Größl noch immer flüchtig, halte sich wahrscheinlich in der nächsten Umgebung versteckt; niemand traute ihm eine Flucht auf größere Distanz zu, hat er auch so viel Geld, daß er ohne weiteres sogar ins Ausland könnte. Zu Hause stiegen wir sofort in unser Auto um. »Wir fahren nach Stiwoll«, sagte mein Vater.
Die Straße nach Graden zur Kainach war, auch wegen Größl, gesperrt, da man uns kannte, ließ man uns passieren. Ein solcher Fall, wie der Fall Größl, ist naturgemäß eine Sensation, und von der war auf einmal die ganze Gegend erfüllt, alles stand unter dem Eindruck des an der Gastwirtsfrau begangenen Totschlags, die Nachricht hatte sich über die Gendarmerieposten rasch verbreitet, was wir besonders in Afling merkten, wo wir bei meinem Onkel haltmachten. Mein Vater hatte für die Frau meines Onkels Medikamente mitgenommen. Wir gingen in das Haus hinein und riefen, gingen in die unteren Zimmer und in die Küche und stellten fest, daß kein Mensch in dem unversperrten Haus war. Mein Vater legte die Medikamente auf die Küchenkredenz, schrieb einen Zettel dazu, dann gingen wir wieder.
In Afling sei er, sagte mein Vater, ein Jahr vor ihrem Tod, mit meiner Mutter auf dem Begräbnis eines seiner Studienfreunde gewesen, und sie habe da andauernd von ihrem eigenen kurz bevorstehenden Tod gesprochen. Während er noch keinerlei Anzeichen ihrer Todeskrankheit an ihr entdeckt hatte, sei sie damals schon, das erkannte er erst viel später, von ihrer Todeskrankheit durchdrungen gewesen, eine ihm als Arzt noch vollkommen rätselhafte Veränderung sei, von dem Begräbnisbesuch in Afling an, an ihr festzustellen gewesen, ein zunehmend Melancholisches, das sich mehr und mehr über uns alle ausbreitete. Er erinnere sich an jedes einzelne ihrer Wörter, könne den Weg, den sie vor und nach dem Begräbnis gegangen waren, sehen, es sei diese Jahreszeit, Ende September, gewesen, ihm war alles mit dem Begräbnis in Afling Zusammenhängende so deutlich wie noch nie. Gerade an klaren Tagen, wo die Welt in alle Richtungen hinein als ein Atmosphärisches durchsichtig und allein durch ihre Ruhe eigentlich schöne Natur ist, sei die Traurigkeit der hinter einem lange toten Menschen Zurückgebliebenen eine doppelte.
Sind es auch immer die gleichen, wie jetzt den Södingbach entlang durch den spitzen Sonnenwinkel deutlich gewordenen, Farben, in welchen wir einen schon vollkommenen Herbst erkennen, die durch intensive Betrachtung entstandene Anschauung der Naturreflektion an sich selber fasziniert uns immer.
Das Wesentliche an einem Menschen komme erst dann, wenn wir ihn als für uns verloren anschauen müssen, in der Zeit, in welcher dieser Mensch nur noch von uns Abschied nimmt, zum Vorschein. Er könne auf einmal in allem, was an ihm nur noch Vorbereitung auf seinen endgültigen Tod sei, auf seine Wahrheit hin identifiziert werden.
Mein Vater sprach während der ganzen Fahrt durch das Södingtal von meiner Mutter, mehr und mehr beschäftige sie ihn in seinen Wachträumen, nicht in der Nacht, oft ihn gleichmäßig über längere, nach außen hin von seiner ärztlichen Tätigkeit in Anspruch genommene Perioden beruhigend, wodurch er zu einer klaren Anschauung des Naturgeschehens befähigt sei.
Jetzt erkenne er sie, die zu ihren Lebzeiten neben ihm von ihm zwar geliebt, aber niemals erkannt worden sei. Zusammen sei der Mensch mit einem geliebten andern endlich erst, wenn der betreffende tot, tatsächlich in ihm ist.
Von dem Begräbnistag in Afling an habe sie oft verlangt, er solle sie auf seine Krankenbesuche mitnehmen; ihm erscheine dieser ihr Wunsch heute nicht mehr unbegreiflich. Es sei ihr naturgemäß nicht möglich gewesen, die Leiden und die Qual in der Welt zu studieren, aber sie anzuschauen habe sie, von dem Begräbnis in Afling an, nicht mehr aufgehört. Er habe in dieser Zeit mit ihr oft über uns Kinder gesprochen, über die Schwierigkeit vor allem, aus einer Zuneigung unserer Eltern für uns eine Erziehung unserer Eltern für uns zu machen. Sie habe ihm oft gesagt, wir seien ihr mehr Kinder der Landschaft um uns als solche unserer Eltern. Zeitlebens in dieser Anschauung, habe sie uns, meine Schwester in noch höherem Maße als mich, als ausschließlich aus der Natur gekommene Geschöpfe empfunden, wodurch wir ihr immer fremd geblieben sind. Er habe, sagte mein Vater, weil wir drei zusammen nach ihrem Tod völlig hilflos und meine Schwester und ich, sie zwölf und ich siebzehn Jahre alt, in der gefährlichsten Entwicklungsphase gewesen sind, sofort nach dem Tod unserer Mutter, und er sagte jetzt, als wir Stiwoll schon vor uns sahen,»tatsächlich schon während des Begräbnisses« daran gedacht, sich wieder zu verheiraten; aber der Gedanke sei mehr und mehr von unserer Mutter in ihm zurückgedrängt worden.
Jetzt fiel mir der Brief ein, den ich vor ein paar Tagen meinem Vater geschrieben hatte und in welchem ich mich in der Beschreibung des unguten Verhältnisses zwischen uns dreien, zwischen ihm und mir und zwischen ihm und meiner Schwester und zwischen mir und meiner Schwester, bemüht habe. Ich hatte ihm in dem Wahn geschrieben, darauf eine Antwort zu bekommen, und wie deutlich sah ich jetzt, daß ich eine solche Antwort niemals bekommen kann.
Meine in dem Brief gestellten Fragen wird mein Vater nie beantworten können.
Unser Verhältnis ist ein durch und durch schwieriges, ja chaotisches, das zwischen ihm und meiner Schwester und zwischen mir und meiner Schwester ist das schwierigste, das chaotischste.
Meine von mir in den letzten Jahren gemachten Beobachtungen unser Verhältnis betreffend hatte ich in dem Brief in möglichst unscheinbaren, aber, wie mir scheint, allerwichtigsten Einzelheiten zu charakterisieren versucht. Dabei war ich mit der größten Vorsicht darauf bedacht gewesen, meinen Vater nicht zu verletzen. Niemanden zu verletzen. Auf Grund meiner jahrelangen Beobachtungen war es nicht schwierig, ein von allen Seiten als gleich wahr zu bezeichnendes Bild von uns zu entwerfen. Mein Brief war sehr ruhig abgefaßt, ich erlaubte mir in ihm keine, nicht die geringste Erregung, wenngleich ihm auch nicht die Höhepunkte, auf die ich in ihm abgezielt hatte, fehlten, solche als indirekte oder direkte Fragen in dem Brief stehenden Höhepunkte wie zum Beispiel, wen die Schuld an dem allerjüngsten Selbstmordversuch meiner Schwester oder an dem frühen Tod meiner Mutter treffe. Lange habe ich diesen Brief schreiben wollen und auch immer wieder dazu angesetzt, aber immer waren mir schon gleich zu Beginn Zweifel gekommen über die Zweckmäßigkeit eines solchen Briefes. Es war mir immer unmöglich gewesen, ihn zu schreiben. Die Peinlichkeit, in einem solchen Brief auf einmal auszusprechen, was jahrelang nur gedacht worden ist, Vermutungen zur Sprache zu bringen, war mir jedesmal sofort bewußt. Auch die Scheu, möglicherweise längst vergessenes Material für die in diesem Brief unerläßlichen Beweise meiner Anschauung von uns heranziehen zu müssen, vereitelte mein Vorhaben. Ich mußte ja aufrichtig und also rücksichtslos und doch auf alle Betroffenen achtgebend vorgehen, das machte einen solchen Brief so lange Zeit unmöglich.
Aber am vergangenen Montag fiel es mir auf einmal leicht, den Brief zu schreiben, in einem Zuge breitete ich, nicht über acht Seiten hinaus, meine Untersuchung aus, die in Fragen nach der Möglichkeit, uns unser aller Zustand klarzumachen, unser aller Verhältnis zueinander zu verbessern, gipfelte. Ich hatte diesen Brief am Ende mehrere Male gründlich studiert und nichts gefunden, was mich davon hätte abhalten können, ihn aufzugeben. Schon am Dienstagmorgen mußte ihn mein Vater bekommen haben. Er hatte ihn aber bis jetzt mit keinem Wort erwähnt, obwohl dazu die längste Zeit gewesen wäre und obwohl alles an ihm auf die Tatsache hindeutete, daß er den Brief nicht nur pünktlich bekommen, sondern auch mit der größten Aufmerksamkeit gelesen, studiert und nicht vergessen hat.
Auch in Stiwoll war mein Vater, das sah ich gleich als wir hineinfuhren, bestens bekannt.
Sein gutes Gedächtnis ermöglichte es ihm, alle Leute mit ihrem Namen anzusprechen. Auch kennt er die Verhältnisse jedes einzelnen genau.
Wenn ihm schien, daß mir einer, mit dem er einen Gruß oder auch ein paar Wörter gewechselt hatte, unklar geblieben war, charakterisierte er ihn mir.
Wir gingen rasch durch den Ort zu einem gewissen Bloch, Realitätenbürobesitzer. Der Mann gefällt ihm. Mit einer, wie Bloch selbst, fünfzig Jahre alten Frau verheiratet, lebe der Realitätenbürobesitzer aus freien Stücken mitten in einer ihm von Natur aus feindlich gesinnten stumpfsinnigen Gebirgsgesellschaft seinem Geschäftsvergnügen.
In Stiwoll, sagte mein Vater, sei ja auch ein Arzt, Bloch habe denselben aber von der Dauerschande, der er jahrelang in Stiwoll ausgesetzt war, weil er den Juden Bloch behandelte, befreit, indem er eines Tages meinen Vater konsultierte. Auch Blochs Vater sei schon in Stiwoll gewesen.
Zwischen Bloch und meinem Vater hat sich, über den Knobelberg und die Kaintalerhöhe weg, über gut fünfundzwanzig Kilometer, eine Freundschaft entwickelt, die, wie mein Vater sich ausdrückte, »ihr Philosophisches in sich hat«. Bloch bewohnt dasselbe Haus wie sein Vater, der von den Deutschen umgebracht worden ist.
Wie ich sofort sah, bewohnt er eines der schönsten Häuser von Stiwoll, in Fortsetzung des Hauptplatzes auf der rechten Seite, und, hatte mir auch schon die Fassade, gerade weil sie so verwahrlost, ihrem tatsächlichen Alter entsprechend grau und auch noch vom letzten Krieg mitgenommen ist, gefallen, bei unserem Eintreten in das Blochsche Haus, unter ein frisch gekalktes Gewölbe, war ich sofort der Überzeugung, daß Bloch einen guten Geschmack hat. Hierher komme er, sagte mein Vater, mindestens einmal in der Woche auf ein längeres Gespräch, auf einen abwechselnd von Bloch oder von meinem Vater gehaltenen Vortrag, hier würden, was man in Anbetracht der Zustände, die in Stiwoll zweifellos herrschen, nicht für möglich halte, »Autopsien an dem Körper der Natur« sowie »an dem Körper der Welt und ihrer Geschichte« vorgenommen, hier betreibe man »vergleichende politische Wissenschaften, angewandte Naturgeschichte, Literaturgeschichte« und da sei man »rücksichtslos gegen die Gesellschaft und genauso rücksichtslos gegen den Staat«. Im allgemeinen aber herrsche im Blochschen Haus das Politische, und von den Menschen sei auch mehr im Hinblick auf ihre politische Substanz als auf ihre private die Rede. Man leiste sich in einer über dem Vorhaus gelegenen Bibliothek ein auf der äußersten Geistesanstrengung fundiertes Durchschauen der Welt und gebe sich keinerlei Illusionen hin. Die Künste kämen die meiste Zeit zu kurz, aber Blochs Frau zuliebe öffne man sich auch ihnen zeitweilig.
Bloch saß in dem vom Vorhaus rechter Hand nur durch eine Glaswand getrennten Büro und diktierte, offensichtlich erregt, seiner Sekretärin ein, wie er später erwähnte, an den auch mir bekannten Voitsberger Geometer Rosenstingl gerichtetes Schreiben. Mein Vater klopfte an das Bürofenster und Bloch kam heraus. Er begrüßte uns freundlich und führte uns sofort in den ersten Stock hinauf, in die Bibliothek. Tatsächlich habe ich auf dem Land noch nie so viele Bücher auf einem Haufen gesehen wie in der Blochschen Bibliothek, und zwar, wie ich feststellte, lauter ständig in Gebrauch befindliche ohne den geringsten sogenannten bibliophilen Wert, in den man in den deutschsprachigen Ländern auf die lächerlichste Weise verliebt, ja vernarrt ist – wenn ich von einer lateinischen Ausgabe der Weltgeschichte des Nürnberger Arztes Schedel absehe, von der es auf der ganzen Welt nur ein paar Exemplare gibt.
Bloch fragte, was meinen Vater zu der ungewöhnlichen Vormittagszeit nach Stiwoll führe, und mein Vater sagte, er wolle ihm, weil er damit fertig sei, die Prolegomena des Kant und die Marxsche Dissertation zurückgeben; beide nahm er aus der Arzttasche heraus und legte sie vor uns auf den Tisch. Mitnehmen möchte er Nietzsches sämtliche Vorlesungen Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten und eine französische Ausgabe der Gedanken des Pascal sowie Diderots Mystifikation. Er müsse zu einer gewissen Ebenhöh auf dem Piberweg, sagte er. Bloch kannte sie nicht. Er schenkte uns, weil er nichts anderes im Haus hatte, zwei Gläser Weißwein ein, Klöscher. In der Frühe habe er, Bloch, wieder an seinem »entsetzlichen« Kopfschmerz gelitten, aber als er sich immer intensiver mit der geschäftlichen Korrespondenz beschäftigt habe, sei der Kopfschmerz verschwunden. Er nehme immer mehr von dem Kopfschmerzmittel, das ihm mein Vater wöchentlich verschreibt. Er habe schon vier oder fünf Tage nicht mehr geschlafen. Mein Vater warnte ihn, zu viel von dem vor allem der Niere schädlichen Mittel zu nehmen.
Kürzlich, sagte Bloch, sei es ihm gelungen, ein größeres Grundstück in der Nähe von Semriach zu kaufen. »Zwei Jahre hat es gedauert«, sagte er. Vor acht Tagen noch Acker- und jetzt durch seine Geschicklichkeit Baugrund, den er in über hundert Parzellen aufzuteilen gedenke; so ließe sich das Ganze rasch wieder abstoßen. »Man muß abwarten können, bis der Feind den Kopf verliert«, sagte er. Es sei sein größtes Geschäft in diesem Jahr, meinte Bloch. Er verlangte ein besseres Schlafmittel, mein Vater verschrieb es ihm. Bloch sagte: »Natürlich bin ich nicht beliebt«, und mein Vater stand auf, und die beiden verabredeten sich auf den kommenden Mittwoch. Seit zwei Jahren trifft er sich mit Bloch jeden Mittwoch. Zur Ebenhöh gingen wir zu Fuß.
Bloch beherrsche die Kunst, das Leben als einen in seinen wichtigsten Funktionen leicht zu durchschauenden Mechanismus je nach seinem persönlichen Bedürfnis auf eine schnellere oder langsamere, aber immer wieder von neuem brauchbare und also erträgliche Gangart einzustellen, und er sei ständig bemüht, seine Familie in diese Kunst, die ihm Vergnügen mache, einzuweihen. Im Grunde sei Bloch der einzige, mit dem er sich auf eine niemals peinliche Weise unterhalten könne, auch der einzige, dem er ganz vertraue. Er sei ihm ein Freund geworden über den andern verlorenen Freunden, seinen über das ganze intelligenzheuchelnde Land verstreuten, in tiefe sonnenarme Täler, Kleinstädte, stumpfsinnige Märkte und Dörfer hineinverbannten, sich längst auf eine ihn jahrelang, noch nach Studienende, schmerzende, jetzt nur noch abstoßende Weise in ihr monotones Doktorenschicksal fügenden Freunden. Ihren Höhepunkt hätten alle diese Leute mit dem Abschließen ihrer unvollkommenen Hochschulstudien überschritten, sagte er, entlassen in eine ihnen gegenüber katastrophal vertrauensselige Welt, würden sie vom grauenhaftesten Familiär- und Ordinationsstumpfsinn, gleich ob als Kliniker oder private Praxisinhaber, verschlungen. Die Rettungslosigkeit, mit welcher die Studienkollegen meines Vaters überall, wohin auch immer er noch vereinzelt völlig inhaltslose Briefe schreibe, untergingen, erschüttere ihn. Lebenslängliche Dilettanten, heirateten sie viel zu früh oder viel zu spät und würden von ihrer fortschreitenden Ideenlosigkeit, Phantasielosigkeit, Kraftlosigkeit, schließlich von ihren Frauen vernichtet.
Bloch sei er genau in dem Augenblick begegnet, in welchem er keine Freunde mehr gehabt habe, nur noch durch eine gemeinsame Jugend, Vertrauensseligkeit der Welt gegenüber ihm verbundene Briefempfänger.
Manchmal sehe er einen von den in der Zwischenzeit ganz in der ordinär-sexuellen Hierarchie