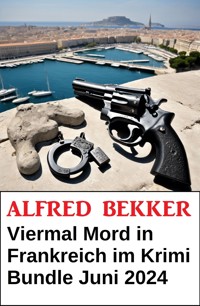Commissaire Marquanteur
schließt die Augen: Frankreich Krimi
von Alfred Bekker
Die Verhaftung eines Drogendealers zieht politische Kreise,
als sich herausstellt, dass auf seiner Kundenliste wichtige
Personen aus dem Sicherheitsbereich stehen. Als dann eine Drohne
bei einem Manöver die Programmierung durchbricht, wird ein
Schadvirus festgestellt. Hat jemand einen oder mehrere
Programmierer der handelnden Firma mit dem Drogenkonsum
erpresst?
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen,
Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb
er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry
Cotton, Cotton Reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica
Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Jack Raymond,
Robert Gruber, Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet
Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Ich saß mal wieder an der Kaimauer im Marseiller Hafen und
angelte. Manchmal brauche ich das zur Entspannung. Die großen
Schiffe, die Rufe der Möwen, die hinter ihnen herziehen und das in
der Sonne glitzernde Wasser – das alles hat in seiner
unvergleichlichen Kombination eine Art hypnotische, kontemplative
Wirkung auf mich.
Und ein bisschen Entspannung ab und zu muss in meinem Job
schon sein.
Mein Name ist Pierre Marquanteur. Ich bin Commissaire in
Marseille und gehöre zur Force spéciale de la police criminelle,
kurz FoPoCri, wie sich unsere Sonderabteilung nennt. Zusammen mit
meinem Kollegen François Leroc und all den anderen Angehörigen
unserer Abteilung kümmere ich mich um die besonderen Fälle.
Besonders im Sinne von besonders schwierig, meine ich
natürlich. Darunter fällt zum Beispiel alles, was mit organisierter
Kriminalität zu tun hat.
François und ich sind da schon ziemlich ehrgeizig.
Mein Ehrgeiz im Hinblick auf das Fangen von Fischen hielt sich
hingegen in ziemlich engen Grenzen.
Man könnte auch sagen: Er war eigentlich gar nicht
vorhanden.
Es kam nicht darauf an, wirklich etwas zu fangen. Es ging
darum, irgendwo einfach nur sitzen zu können und dabei mehr oder
weniger gar nichts zu tun. Aber das Gar-Nichts-Tun ist in unserer
Kultur irgendwie nicht so richtig gut angesehen. In der
Leistungsgesellschaft von heute ist man immer irgendwie tätig.
Man macht irgendetwas.
Einfach nur Faulenzen, das ist irgendwie nicht so richtig im
Plan drin.
Also braucht man eine Art Alibi-Beschäftigung, wenn man in
Wahrheit in aller Ruhe gar nichts tun will.
Angeln ist ein ganz typisches Beispiel dafür.
Und Angeln hat immerhin den Vorteil, dass es weniger
kompliziert ist, als andere Tätigkeiten, die auf die eine oder
andere Weise ebenfalls in die Rubrik solcher Schein-Tätigkeiten
fallen. Stricken zum Beispiel.
Das wäre nichts für mich.
Zu kompliziert.
Mit komplizierten Dingen habe ich ja schon beruflich genug zu
tun.
Ich hing so meinen Gedanken nach, überlegte für einen Moment,
was ich wohl machen würde, wenn tatsächlich ein Fisch so dumm war,
anzubeißen und dann geschah plötzlich etwas völlig
unerwartetes.
Etwas, das mich aus meiner erholsamen Kontemplation förmlich
herausriss.
Es sah aus wie ein Flugzeug-Absturz.
Aber es sah nur so aus, denn das Flugzeug war viel zu klein,
um wirklich ein Flugzeug sein zu können, auch wenn es Tragflächen
hatte.
Die waren allerdings nicht länger als die Armspannweite eines
durchschnittlich gewachsenen Mannes.
Das Ding stürzte direkt vor mir ins Wasser. Genau dorthin, wo
ich meine Angel hielt.
Der ganze Vorgang dauerte nur Sekunden.
Dann war die Drohne verschwunden.
Das Meerwasser hatte sie zugedeckt, und es war nichts mehr von
dem Ding zu sehen.
Ich bin nicht schreckhaft, aber das hatte mir dann doch einen
ziemlich großen Schrecken eingejagt.
Ein junger Mann mit lockigen Haaren kam auf mich zu. Die
Tatsache, dass er irgendein technisches Fernsteuerungsmodul in den
Händen hielt, sprach wohl dafür, dass diese Drohne ihm
gehörte.
»Bonjour«, sagte ich.
»Bonjour«, meinte er.
Er schien genauso geschockt zu sein wie ich – nur vermutlich
aus einem anderen Grund. Ich stellte mir vor, die Drohne hätte mich
treffen können. Er dachte vermutlich daran, dass sie teuer gewesen
war. Zumindest für seine Verhältnisse. Ein Killer, der so ein Ding
dafür benutzt, um Sprengstoff damit möglichst nahe an seinem Opfer
zur Explosion zu bringen, denkt darüber vielleicht etwas
anders.
»Merde«, meinte der junge Mann.
»Ich habe einen ganz schönen Schrecken gekriegt«, sagte
ich.
»Tut mir Leid.«
»Na, dann …«
Als ich die Angel hochziehen wollte, merkte ich dann, dass da
irgendetwas sehr Schweres dran war.
Schwerer als jeder Fisch, den man hier in Marseille überhaupt
je an die Angel kriegen kann.
Die Rute bog sich bedenklich.
»Ganz vorsichtig!«, meinte der junge Mann. »Sie haben das
Ding!«
»Ich hoffe, meine Angel geht nicht kaputt!«
»Ich dachte schon, die Drohne wäre verloren.«
»Haben Sie überhaupt eine Genehmigung, mit so etwas
herumzufliegen?«
»Sind Sie Polizist?«
»Zufällig ja.«
»Oh …«
Es entstand eine Pause. Und es war wohl nicht zu gewagt,
anzunehmen, dass er keine Genehmigung für die Drohne hatte.
Ich atmete tief durch. »Na, dann wollen wir mal sehen, ob wir
das Ding wieder aus dem Wasser kriegen. Angelschnur ist ja ziemlich
reißfest.«
»Danke.«
Wir schafften es schließlich.
Die Angel war allerdings hinterher hinüber.
Naja, mit solchen Drohnen kann noch weitaus Schlimmeres
passieren!
*
Auf einem Truppenübungsplatz … zur selben Zeit!
»Monsieur Lafontaine, sehen Sie sich das an!«
»Einen Moment!«
Die beiden Männer in den Uniform starrten auf den Laptop. Es
war ein Bild zu sehen, das die Perspektive einer Drohnenkamera
zeigte. Häuser, Gefechtsstände, Panzer, grüne Wiesen, ein
Waldstück. Daneben eine Kartenübersicht des Geländes mit
Positionsanzeige.
»Verdammt, was ist mit dem Ding los?«, fragte Commissaire
Lafontaine. Sein hageres, verkniffenes Gesicht wurde zu einer
verzerrten Maske. »Stoppen Sie das!«
Finger hackten über die Tastatur.
»Negativ, Chef! Keine Reaktion!«
»Kurskorrektur! Sofort!«
»Es geht nicht, Chef!«
Lafontaine griff zum Funkgerät. »Hier Colonel Lafontaine.
Sofort …«
Weiter kam er nicht. Das Detonationsgeräusch war selbst auf
eine Entfernung von einer halben Meile so ohrenbetäubend, dass es
nicht mehr möglich war, sich zu verständigen.
Lafontaine lief aus dem Zelt, in dem der Befehlsstand dieses
Übungsmanövers untergebracht war. Der Himmel war diesig. Hinter den
Hügeln stieg dunkler Rauch auf.
»Verdammt …«, murmelte er.
2
Ein Hinterhof in Pointe-Rouge.
Wir hatten das Gelände weiträumig umstellt. Insgesamt zwanzig
Kollegen vom Polizeipräsidium Marseille und außerdem noch Kräfte
der Bereitschaftspolizei waren an dieser Operation beteiligt.
Ich hatte die Dienstpistole in der Rechten und nickte François
Leroc zu. Mein Dienstpartner hatte gerade seine Kevlar-Weste etwas
zurechtgezogen. Die Dinger müssen richtig sitzen, sonst riskiert
man, dass man bei einer Schießerei doch mehr abbekommt, als
eigentlich nötig wäre.
Eine dunkle Limousine fuhr durch die Zufahrt in den Hinterhof,
in dem sich ansonsten noch ein paar überquellende Müllcontainer und
ein schrottreifer Ford befanden, dem man außer den Reifen nahezu
jedes andere Teil abgenommen hatte, für das es noch irgendeinen
Interessenten geben mochte.
Eine ganze Weile geschah gar nichts.
Wir waren angespannt.
Über mein Headset meldete sich der Kollege Fred Lacroix.
Ers sagte:
»Ein dunkler Van nähert sich.«
»Könnte das Chapitte sein?«, fragte ich.
Hervé Chapitte war ein Drogenhändler, hinter dem wir schon
seit längerem her waren. Er dealte mit Kokain. Aber da er
keineswegs eine der ganz großen Nummern in diesem üblen Geschäft
war, wäre er eigentlich eher ein Fall für die Drogenabteilung des
zuständigen Polizeireviers gewesen.
Trotzdem kümmerten wir uns darum.
Was Hervé Chapitte unter den anderen Drogendealern hervorhob,
war sein exquisiter Kundenkreis. Über einen Mittelsmann war uns
Chapittes Kundenliste in die Hände gefallen. Es waren auffällig
viele Personen aus dem militärisch-industriellen Komplex darunter
oder die sonst in sicherheitsrelevanten Bereichen wichtige
Schlüsselfunktionen erfüllten. Computerspezialisten, Programmierer,
Offiziere der Armee, die mit hochsensibler Waffentechnik zu tun
hatten. Die Tatsache, dass Chapitte seine Drogen aus einer Quelle
bezog, bei der es eine Verbindung zu einem iranischen Geschäftsmann
gab, vervollständigte das Bild.
Es war gut möglich, dass das Kokain nur Mittel zum Zweck war,
um an Personen heranzukommen, die in sicherheitsrelevanten
Bereichen Schlüsselstellungen einnahmen.
Wenn so ein Netzwerk erst einmal gesponnen war, konnte man
damit einiges anstellen. Zum Beispiel, indem man Chapittes Kunden
erpresste, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht mal
ihre Dienste brauchte. Das konnte der Download eines geheimen
Programms oder vielleicht auch nur eine brisante persönliche
Information sein.
Der Van, den unsere Kollegen ausgemacht hatten, traf jetzt
ein.
»Wir haben die Nummer überprüft«, meldete sich Fred Lacroix
noch einmal. »Das Nummernschild ist gefälscht. Wir können nicht
sagen, ob sich Chapitte wirklich im Inneren befindet!«
»Werden wir sehen«, meinte ich.
Chapitte war für seine Vorsicht bekannt. Es wäre nicht das
erste Mal gewesen, dass er Ermittler, die ihm auf den Fersen waren,
durch geschickte Täuschungsmanöver hereingelegt hatte.
Der Van hielt. Die Seitentür ging auf. Zwei Männer in dunklen
Anzügen stiegen aus. Sie waren mit Maschinenpistolen vom Typ Uzi
bewaffnet. Jetzt öffneten sich auch die Türen der Limousine.
Mehrere Männer stiegen aus. Alle in schwarzen Rollkragenpullovern
und Lederjacken. Auch sie waren gut bewaffnet. Pumpguns und
automatische Pistolen befanden sich in ihren Händen.
Was gesprochen wurde, bekamen wir über unsere Headsets mit.
Die Kollegen verfügten über Richtmikrofone.
Jetzt folgte Chapittes großer Auftritt. Er kam aus der
Limousine. Ein Mann im dreiteiligen Anzug und hohem Haaransatz. Man
hätte ihn für einen Banker oder Anwalt halten können. Das einzig
Auffällige an ihm waren die Cowboystiefel mit den Messingkappen an
den Spitzen. Die passten einfach nicht zu seinem Stil, aber sie
waren gewissermaßen Chapittes Markenzeichen. Chapitte trug eine
Brille mit flaschendicken Gläsern. Seine Bewegungen wirken
ruckartig. Er blickte sich um und schien nervös.
Der Kofferraum der Limousine wurde geöffnet.
»Bester Stoff, wie Ihre Kunden ihn bevorzugen«, meinte einer
der Kerle in Lederjacke. Er trug einen Vollbart, der ihm fast bis
unter die Augen reichte. Dafür hatte er so gut wie kein Haar mehr
auf dem Kopf.
»Das Geld!«, sagte Chapitte nur und schnippte mit den Fingern.
Einer seiner Leute holte den Geldkoffer.
Augenblicke später kam das Signal für den Einsatz.
3
»Hier spricht die Polizei! Waffen weg!«, ertönte eine
Megafonstimme. Der Rest des Textes ging im aufbrandenden Kugelhagel
unter. Die Uzischützen zögerten keine Sekunde. Sie feuerten wild um
sich. Chapitte warf sich zu Boden.
Wir feuerten ebenfalls.
Die Limousine, in deren Kofferraum noch das Kokain lagerte,
wurde gestartet. Der Fahrer trat das Gas voll durch. Der Motor
heulte auf. Alles ging ganz schnell. Schüsse trafen die
Frontscheibe aus Panzerglas und fingen die Kugeln auf. Die
Einschussstellen waren von spinnenartigen Splitterstrukturen
umgeben. Beinahe ohne Sicht und mit offenem Kofferraum raste der
Fahrer auf die Ausfahrt zu und prallte ungebremst gegen ein
Fahrzeug der Polizei, das sich ihm dort im letzten Moment in den
Weg gestellt hatte. Die Fahrt war damit zu Ende.
Von allen Seiten kamen jetzt die Einsatzkräfte aus der
Deckung. François und ich ebenfalls.
Es gab eine Reihe von Verletzten und mehrere Tote. In der
Ferne waren schon die Sirenen der Fahrzeuge der Notfallambulanz zu
hören.
Chapitte war unverletzt geblieben.
Wie wir feststellten, trug er eine Kevlar-Weste unter seiner
Kleidung.
»Ich will einen Anwalt!«, rief er.
»Den werden Sie auch bekommen«, versprach mein Kollege
François Leroc, der ihm Handschellen anlegte.
Bündel mit Hundert-Euronoten lagen auf dem Boden verstreut
herum. Viele waren blutbesudelt. Der Kofferraum der Limousine war
mit Kokain gefüllt, sorgfältig in Plastiktüten verpackt, von denen
jede schätzungsweise ein Pfund enthielt.
4
Zwei Stunden später waren François und ich zu unserem
Polizeipräsidium zurückgekehrt.
Wir gingen in unser Dienstzimmer. Mir knurrte der Magen, aber
um etwas zu essen, war zuerst keine Zeit gewesen. Und nach dem
Verlauf des Einsatzes auf Pointe-Rouge hatte ich den Appetit
verloren.
Chapitte war festgesetzt. Und das Beweismaterial, das dabei
durch Video- und Audioaufzeichnungen gesichert worden war, würde
ihn für sehr lange Zeit in den Knast bringen. Und das war das
Wichtigste.
Aber davon abgesehen konnte man es nicht als Erfolg werten,
wenn bei einem solchen Einsatz ein halbes Dutzend Schwerverletzter
und drei Tote zurückblieben. Die Zahl der Toten konnte sich
durchaus noch erhöhen, denn bei einigen der Verletzten war es
ungewiss, ob sie überleben würden. Darunter auch Claus Grimma, ein
Kollege der Polizei, der an dem Einsatz beteiligt gewesen war.
»Wir konnten das nicht verhindern«, sagte François, nachdem er
uns beiden einen Kaffee geholt hatte.
»Ich weiß«, sagte ich.
»Die haben einfach drauflos geschossen! Was hätten wir tun
sollen?«
»Das, was wir getan haben«, gab ich zurück. »Das, was unser
Job ist: Das Recht durchsetzen. Trotzdem – Zufriedenheit fühlt sich
anders an, François.«
»Wir wären schlechte Polizeibeamte, wenn wir uns nicht jedes
Mal fragen würden, was hätte besser laufen können?«
»Richtig!«
»Aber diesmal hatten wir das nicht in der Hand, Pierre. Nicht
einmal ein bisschen!«
Ich zuckte die Schultern. Ob ich François da wirklich
zustimmen konnte, hatte ich noch nicht entschieden.
Unser Kollege Fred Lacroix kam herein. Fred sah auch ziemlich
fertig aus.
»Ich komme gerade von Derek«, sagte er.
Derek Bajere war einer unserer Verhörspezialisten, und er
hatte Chapitte in den letzten anderthalb Stunden vernommen –
selbstverständlich in Anwesenheit seines Anwalts.
»Und? Ist irgendetwas dabei herausgekommen?«, fragte
ich.
»Er schweigt wie ein Grab. Ich weiß nicht, ob er damit
wirklich gut beraten ist«, sagte Fred.
»Was ist mit seiner Kundenliste? Ist die schon ins Spiel
gebracht worden?«, fragte ich.
»Ja, Derek hat Chapitte gegenüber durchblicken lassen, dass er
gute Chancen hätte, vergleichsweise glimpflich davonzukommen, wenn
er seine Kontakte zu diesem iranischen Geschäftsmann auspackt. Es
gibt nur Indizien dafür, dass hinter dem mehr steckt, als nur
Rauschgifthandel, also brauchen wir Chapittes Aussagen.«
Ich trank meinen Kaffee aus.
»Dass so ein Kerl am Ende mit ein paar Jahren weniger
davonkommt, gefällt mir ganz und gar nicht.«
»Du kennst doch das Spiel, Pierre«, meinte François.
Ich nickte. »Allerdings …«
»Dass Chapitte auf dieses Angebot nicht eingeht, kann
eigentlich nur bedeuten, dass er ziemlich große Angst vor seinen
Hintermännern hat«, meinte François.
Fred Lacroix zuckte mit den Schultern.
»Falls es diese Hintermänner auch wirklich gibt, könntest du
recht haben. Aber es kann auch sein, dass er einfach nur einen
schlechten Anwalt hat!«
Eine halbe Stunde später war eine Besprechung im Büro unseres
Chefs angesetzt.
Monsieur Jean-Claude Marteau, Chef unserer Abteilung in
Marseille, telefonierte gerade, als wir sein Büro betraten. Er
winkte uns herein, während er zweimal »In Ordnung« sagte und dann
das Telefongespräch beendete.
Außer uns waren noch Fred Lacroix sowie Josephe Kronbourg und
Léo Morell im Raum. Außerdem unser Innendienstler Maxime Valois aus
der Fahndungsabteilung, sowie ein Mann mit gelockten Haaren, den
ich nicht kannte.
Monsieur Marteau stand einen Augenblick mit nachdenklichem
Gesicht hinter seinem Schreibtisch und vergrub die Hände in den
weiten Taschen seiner Flanellhose. Dann begab er sich zu uns, blieb
aber als einziger im Raum stehen.
»Chapitte ist aus dem Verkehr gezogen. Was daraus jetzt wird,
müssen wir abwarten. Aber es könnte ein Zusammenhang zu einem Fall
bestehen, der die nationale Sicherheit betrifft und den unser
Polizeipräsidium gerade übernommen hat. Ich habe soeben mit dem
stellvertretenden Verteidigungsminister gesprochen, der sein volles
Vertrauen in die Fähigkeiten der Polizei setzt.« Monsieur Marteau
machte eine kurze Pause. Dann deutete er auf den Mann mit den
Locken, der mir bisher unbekannt war. »Ich darf Ihnen Arthur Jospin
vorstellen. Er ist Computerspezialist und neu beim
Erkennungsdienst.«
Arthur Jospin nickte uns kurz zu.
»Ich war vorher im Verteidigungsministerium beschäftigt und
habe deswegen noch ein paar gute Kontakte dorthin, die uns in
unserem Fall nützlich sein können.«
Offenbar wusste Arthur Jospin bereits mehr über die Sache, um
die es ging. Monsieur Marteau schien schon mit ihm darüber
gesprochen zu haben.
»Ich nehme an, jeder hier im Raum weiß, was eine Drohne ist«,
sagte Monsieur Marteau. »Einer dieser unbemannten Flugkörper hat
vor wenigen Tagen eine Katastrophe auf einem Truppenübungsplatz
verursacht. Diese Drohne ist aus zunächst unerfindlichen Gründen
von ihrem programmierten Kurs abgekommen, war anschließend nicht
mehr über die Fernsteuerung zu kontrollieren und ist in ein
Munitionsdepot eingeschlagen. Der Schaden ist immens. Es gab
mehrere Tote und Verletzte. Leider ist das nicht der einzige
Vorfall dieser Art in der letzten Zeit gewesen.«
»Allerdings muss man sagen, dass die Folgen in keinem anderen
Fall so schwerwiegend waren«, stellte Maxime Valois fest. »Ich habe
das Datenmaterial dazu bereits durchforstet.«
»Diese Drohnen sind ferngelenkte Flugkörper, die mit Waffen
oder Kameras ausgestattet sein können«, erklärte Monsieur Marteau.
»Sie werden in Afghanistan und an anderen Orten auf der Welt
eingesetzt – und es könnte Kriege auslösen und schwerste
diplomatische Verwicklungen nach sich ziehen, wenn sich einer
dieser Flugkörper plötzlich selbständig macht und ein anderes als
das vorgesehene Ziel angreifen würde.«
»Wie kann so etwas passieren?«, wollte unser Kollege Josephe
Kronbourg wissen.
»Wie üblich – ein Programmfehler«, erklärte Arthur Jospin.
»Man hat inzwischen penibel nach der Ursache gesucht und sie auch
gefunden. Es handelt sich um Schadsoftware, die in die
Datenspeicher der Drohnen gelangt und die Steuerung gestört
hat.«
»Ich habe immer gedacht, die Rechnersysteme des Militärs sind
gut abgeschirmt«, warf François ein.
»Das sind sie auch«, bestätigte Jospin. »Allerdings gibt immer
irgendwo undichte Stellen. In diesem Fall war es die Aktualisierung
der Kartensoftware für das GPS-System der Drohnen. Genau wie beim
Navigationssystem Ihres Wagens muss auch der Kartenspeicher einer
Drohne regelmäßig aktualisiert werden, sonst könnte auch das
verheerende Folgen haben. Die Aktualisierung der Karten übernahm
eine Softwarefirma hier aus Marseille. Sie heißt SUJET SPÈCIAL SARL
und hat ihre Büros in Saint Gabriel.«
Monsieur Marteau ergriff nun wieder das Wort.
»Inzwischen haben Spezialisten des Militärgeheimdienstes und
des Verteidigungsministeriums dieses Schadprogramm auf den Rechnern
von SUJET SPÈCIAL nachgewiesen. Die Frage ist allerdings, wie es
dort hingekommen ist. Die Firma besitzt einen exzellenten Ruf, und
Sie können sich denken, dass man SUJET SPÈCIAL auf Herz und Nieren
untersucht hat, bevor man dieses Unternehmen mit einem derart
sensiblen Auftrag betraut hat.«
»Es geht also darum, wer dahintersteckt«, stellte ich
fest.
»Die Besitzer und Mitarbeiter von SUJET SPÈCIAL waren sehr
kooperativ, und wir sollten deshalb auch weiterhin versuchen, die
Mitarbeit dieser Firma zu gewinnen. Es gibt bisher keinen
Anhaltspunkt dafür, dass man SUJET SPÈCIAL hätte misstrauen müssen
oder dass man dort irgendwelche Sicherheitsvorschriften missachtet
hat. Aber da werden noch weitere Ermittlungen nötig sein.«
»Ich leite die Untersuchungen der Rechner der SUJET SPÈCIAL
SARL«, erklärte Arthur Jospin. »Daher bin ich über den neuesten
Stand unterrichtet.«
»Fest steht also inzwischen, dass die Rechner der SUJET
SPÈCIAL SARL die Quelle der Schadsoftware sind«, ergriff Monsieur
Marteau wieder das Wort. »Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden,
wer eigentlich dahinter steckt. Das Problem tangiert die nationale
Sicherheit, denn das, was mit diesen Drohnen passiert ist, kann
jederzeit auch mit anderen elektronischen Steuersystemen
geschehen.«
»Gibt es schon irgendeine Ermittlungsrichtung, die sich
aufdrängt?«, fragte ich.
»Sie meinen, abgesehen von den üblichen Verdächtigen wie
Terrororganisationen oder ausländische Geheimdienste?«, gab
Monsieur Marteau zurück. Er schüttelte den Kopf. »Leider werden wir
unsere Ermittlungen breit anlegen und dabei sehr vorsichtig
vorgehen müssen. Sonst tauchen die Hintermänner unter, und wir
werden erst wieder von ihnen hören, wenn sie das nächste Mal
zuschlagen.«
»Möglicherweise ergeben sich noch Hinweise auf Grund unserer
Untersuchungen an den Programmen der Firmenrechner und der Analyse
der Schadsoftware selbst«, ergriff Arthur Jospin das Wort. »Aber
das braucht etwas Zeit. In der Zwischenzeit laufen natürlich auch
in den Streitkräften und überall sonst, wo Kartensoftware der Firma
SUJET SPÈCIAL eingesetzt wurde, die Untersuchungen auf Hochtouren.«
»Es gibt einen interessanten Zusammenhang zu dem Fall
Chapitte«, stellte Monsieur Marteau fest. Er ging zum Schreibtisch
und nahm einen mehrseitigen Computerausdruck in die Hand. »Auf der
exquisiten Kundenliste von Chapitte taucht der Name Didier Chaveau
auf. Er war bis vor Kurzem Programmierer bei SUJET SPÈCIAL.«
»Dann werden wir ihm wohl ein paar Fragen stellen müssen«,
sagte ich.
»Tun Sie das, Pierre! Und ansonsten werden wir jeden, der
irgendwie in Zusammenhang mit SUJET SPÈCIAL steht, durchleuchten
müssen.«
5
François und ich fuhren zu dem kastenförmigen Gebäude in Saint
Gabriel, in dem SUJET SPÈCIAL untergebracht war. Das Firmengelände
lag auf einer alten Industriebrache und gehörte ganz sicher nicht
zu den Spitzenadressen in Marseille. Das fünfstöckige Bürogebäude
war ein preiswert und schnell hochgezogener Plattenbau. Die Fassade
hatte sichtlich gelitten: Man hatte offenbar die preiswerte
Bausubstanz von Gebäuden übernommen, die zu einem in Insolvenz
gegangenen Logistik-Unternehmen gehört hatten. Teilweise sah man
noch die alten Firmenschilder. SUJET SPÈCIAL war offensichtlich so
schnell gewachsen, dass man sich für solche Äußerlichkeiten keine
Zeit genommen hatte.
Ich stellte den Wagen auf den Parkplatz. Wir stiegen aus.
Zehn Minuten später trafen wir uns mit den drei Besitzern von
SUJET SPÈCIAL in einem Konferenzraum im fünften Stock. André
Valmont war ein schweigsamer, dunkelhaariger Mann, schlaksig und
Mitte dreißig. Norbert Bouman war ungefähr gleichaltrig, hatte aber
außer einem Kranz in Ohrhöhe kaum noch Haare auf dem Kopf und war
ziemlich groß. Er überragte mich fast um einen Kopf. Jean-Baptiste
Bisson war der älteste Herr in diesem Trio. Er war Mitte vierzig,
hatte grau durchwirktes Haar und einen Oberlippenbart.
Bisson schien von allen dreien der Kommunikativste zu sein. Er
ergriff gleich das Wort.
»Sie können sich denken, dass hier im Moment alles rotiert,
Monsieur Marquanteur. Und die Tatsache, dass unsere wichtigsten
Auftraggeber – und dazu gehört natürlich auch das Militär – bis auf
Weiteres alle Aufträge storniert haben, trägt natürlich nicht
gerade dazu bei, dass wir hier gute Laune haben.«
»Als wir gerade auf Ihren Parkplatz gefahren sind …«, begann
ich, aber Jean-Baptiste Bisson unterbrach mich sofort.
»Ich kann mir schon denken, was Sie sagen wollen!«
»So?«
»Sie haben wahrscheinlich mehr erwartet. Aber wissen Sie,
dieses Gebäude war schon ein Fortschritt gegenüber der alten
Fabrikhalle, in der wir davor waren. Von Norberts Garage, in der
alles angefangen hat, mal ganz abgesehen.«
»Wir hatten ein Gebäude in Le Baumettes in Aussicht, das auch
deutlich größer ist«, erklärte Bouman. »Wir haben außerdem
Büroräume hier in Saint Gabriel angemietet, weil bei uns alles aus
den Nähten platzt und wir eigentlich dringend mehr Raum bräuchten.
Aber im Moment stehen uns wohl ganz andere Probleme bevor.«
»Das heißt, diese Pläne sind erst einmal auf Eis gelegt?«,
fragte ich.
Jean-Baptiste Bisson nickte. »Wir werden Ihre Ermittlungen in
jeder Form unterstützen, darauf können Sie sich verlassen.
Schließlich hängt das Überleben unserer Firma davon ab. Das
Vertrauen muss wieder hergestellt werden, sonst können wir
dichtmachen. Da nützt es auch nichts, dass wir die besten
sind.«
Ich spürte, dass zwischen den Inhabern von SUJET SPÈCIAL
irgendeine Art von tiefer gehender Spannung in der Luft lag.
Vielleicht lag es an dem leicht verächtlichen Zug, der sich bei
Boumans letzten Worten um die Mundwinkel von André Valmont gebildet
hatte. Es war übrigens überhaupt die erste Regung, die ich in
seinen Zügen erkennen konnte.
Und Bouman und Bisson wandten sich immer wieder voneinander
weg und drehten sich die Schulter auf eine Weise zu, die eigentlich
ziemlich eindeutig war. Man musste kein Experte für Körpersprache
sein, um zu sehen, was da los war.
Ob die Differenzen zwischen den dreien für unseren Fall
relevant waren, musste sich erst noch zeigen. Ich vermutete, dass
wir wohl kaum um die Notwendigkeit herum kamen, jeden der drei noch
einmal ausführlich und vor allem ohne Beisein der anderen zu
befragen.
»Wir brauchen Listen aller Mitarbeiter der letzten drei
Jahre«, sagte François. »Und vor allem müssen wir wissen, wer
Zugang zu den sicherheitsrelevanten Daten hatte.«
»Wieso in den letzten drei Jahren?«, fragte Bouman. »Die
Schadsoftware ist auf unsere Rechner aufgespielt worden, das steht
inzwischen fest. Aber es steht auch fest, dass das erst vor Kurzem
geschehen sein kann. Maximal im letzten halben Jahr! Das werden
Ihnen die Computerexperten bestätigen, die bei uns jedes Kilobyte
einzeln unter die Lupe genommen haben.«
»Korrekt«, sagte Valmont plötzlich auf eine Weise, dass man
unwillkürlich an den Charme eines Roboters erinnert war.
»Wir müssen trotzdem den Zeitraum etwas großzügiger ansetzen«,
beharrte François. »Wir wissen ja nicht, ob nicht jemand von langer
Hand in Ihre Firma eingeschleust wurde.«
»Aber vor drei Jahren waren wir noch nicht in der Liga, dass
wir für ausländische Geheimdienste, Industriespione oder
Terroristen, oder an wenn Sie da sonst noch denken mögen,
interessant gewesen wären.«
»Wenn Ihre Kartensoftware so gut ist, wie Sie sagen, dann war
es doch nur eine Frage der Zeit, wann auch das Militär auf Sie
zukommen würde«, gab François zu bedenken.
»Ich gebe zu, dass gerade die erste Zeit bei uns sehr
chaotisch war und wir vielleicht auch nicht immer so sorgfältig mit
den Sicherheitsüberprüfungen waren«, gab Jean-Baptiste Bisson zu.
»Seitdem wir die Großaufträge vom Militär bekommen, hat sich hier
sowieso alles verändert.«
»Und nicht zum Besseren«, sagte Valmont. Seine Stimme klang
schneidend.
»Wollen Sie genauer erläutern, was Sie damit gemeint haben?«,
fragte ich.
Valmont machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Nicht so wichtig«, meinte er. Er grinste breit. »War nur ein
Witz«, behauptete er. »Wir sind hier alle sehr glücklich und
arbeiten in einem fantastischen, dynamischen Team mit super
Workflow.« Valmont sagte das auf eine Weise, die fast ironisch
klang. Er sah mich direkt an, nachdem er die ganze Zeit über meinem
Blick mehr oder weniger ausgewichen war. »Ist noch irgendetwas? Ich
hätte nämlich auch noch etwas anderes zu tun!«
»Es wäre nett, wenn Sie noch einen Moment Zeit für uns
hätten«, sagte ich etwas irritiert. »Es geht um einen ehemaligen
Mitarbeiter Ihrer Firma.«
»Um wen?«, fragte Bisson.
»Didier Chaveau.«
»Monsieur Chaveau hat unsere Firma vor geraumer Zeit
verlassen.«
»Was war der Grund dafür?«, hakte ich nach.
Bisson suchte den Blickkontakt zu seinen Partnern. Valmont sah
fast demonstrativ zur Seite. Norbert Bouman zuckte mit den
Schultern und ergriff schließlich das Wort.
»Didier war ein genialer Programmierer«, sagte er. »Und seine
Arbeit hat großen Anteil am Aufstieg von SUJET SPÈCIAL. Wir waren
schon gut, bevor er dabei war, aber mit ihm hatten wir sozusagen
das Tüpfelchen auf dem I, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Aber Sie haben ihn ersetzen können?«
Bouman zuckte erneut die Schultern. »Ging ja nicht anders.
Abgesehen davon – ein so überragendes Genie war er jetzt auch
nicht. Außerdem hatte er andere Defizite.«
»Welche?«
Bouman verengte die Augen und zögerte mit der Antwort.
»Ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen sollte.«
»Meinen Sie Chaveaus Kokain-Konsum?«, mischte sich François
ein.
Die drei Teilhaber von SUJET SPÈCIAL wirkten überrascht.
»Sie wissen es also«, stellte Bouman fest.
»Ich sagte doch, wir können offen reden«, fuhr Valmont
ziemlich gereizt auf. Er tippte nervös mit den Fingerkuppen auf dem
Tisch herum.
»Wir haben Chaveaus Name auf der Kundenliste eines
Drogendealers namens Hervé Chapitte gefunden, der vor kurzem
verhaftet wurde«, erklärte ich. »Da es sich bei den Kunden dieses
Dealers um auffällig viele Personen aus dem sicherheitsrelevanten
Bereich handelt, besteht der Anfangsverdacht, dass hier
möglicherweise gezielt auf Leute Einfluss genommen werde sollte,
die an wichtigen Schaltstellen sitzen.«
»Chaveau hat Kokain genommen«, gab Bouman zu. »Das hat hier
auch jeder gewusst, und alle, die was anderes behaupten, die
lügen.«
»Da war er auch nicht der Einzige«, warf Valmont ein und
erntete dafür einen ziemlich ärgerlichen Blick von Bisson.
Bouman versuchte die Wogen etwas zu glätten.
»Wir sind in einer Branche tätig, wo man täglich
Höchstleistungen erbringen muss. Wer nicht topp ist, der ist ganz
schnell weg vom Fenster. So schnell wie SUJET SPÈCIAL entstanden
ist, so schnell kann der Stern auch wieder sinken.«
»Wir sind auch in einem Job tätig, bei dem wir täglich bis an
unsere Grenzen gehen müssen – und manchmal auch darüber hinaus«,
warf François ein. »Aber deswegen sind wir noch lange nicht auf
Kokain angewiesen.«
Bouman lächelte breit und geschäftsmäßig.
»So sind die Menschen eben verschieden, Monsieur Leroc.«
»Ich nehme an, die Kokain-Sucht war nicht der Grund dafür,
dass Chaveau die Firma verlassen hat«, stellte ich fest. Ich hatte
nämlich das Gefühl, dass man an diesem Tisch genau über diesen
Punkt nicht so gerne reden wollte. Aber deshalb konnte das
interessant für uns sein.
»Du kannst es ruhig offen sagen, Norbert«, wandte sich Valmont
an Bouman. »Tiefer in der Scheiße als SUJET SPÈCIAL jetzt schon
drinsteckt, geht es sowieso nicht mehr.«
»Es ging bei Didier Chaveau um Folgendes«, sagte schließlich
Bisson, nachdem Bouman nur herumdruckste. »Er war ein genialer
Programmierer, aber er hat sein Talent nicht immer so eingesetzt,
wie wir uns das gewünscht hätten.«
Ich hob die Augenbrauen.
»Was meinen Sie genau damit?«
»Chaveau hat seine Position bei uns ausgenutzt, um Kundendaten
zu sammeln, die er dann offenbar weiterverkauft hat.«
»Wir hatten keine andere Wahl, als ihn rauszuschmeißen«,
ergänzte Bouman.
»Sie haben keine Anzeige erstattet«, stellte ich fest.
»Natürlich nicht«, sagte Bouman. »Wenn das an die
Öffentlichkeit gekommen wäre, dann wären wir am Ende
gewesen.«
»Und ich nehme an, das Verteidigungsministerium hätte Ihnen
dann wohl kaum den Auftrag gegeben, die Kartensoftware von Drohnen
zu liefern«, stellte François fest.
Bouman sah ihn mit einem durchdringenden Blick an.
»Nein, das ist wohl wahr«, gab er zu.
6
Wir führten noch eine Reihe Gespräche mit allen
Abteilungsleitern von SUJET SPÈCIAL. Als wir zum Parkplatz
zurückkehrten, hatte sich dort der Bestand an Pkws deutlich
gelichtet. Inzwischen war der Großteil der Mitarbeiter nicht mehr
im Büro.
Ich sah zurück. Es war ein diesiger Tag, an dem die Dämmerung
früh einsetzte. In der obersten Etage des SUJET SPÈCIAL Building
war das Licht an, und man konnte selbst aus der Entfernung Norbert
Bouman sehen, wie er mit ausholenden Gesten mit jemandem sprach.
»Scheint, als hätte die Führungsetage der Firma heute
Überstunden zu machen«, meinte François.
Ich nickte.
»Ich bin überzeugt davon, dass sie uns mehr verschwiegen als
offenbart haben.«
»Dieser Valmont ist interessant, Pierre.«
»Weil er offensichtlich der Außenseiter in diesem Dreigestirn
ist?«
François grinste.
»Ja, so könnte man es ausdrücken.«
»Ich wüsste auch zu gerne, was zwischen denen eigentlich los
ist«, gestand ich.
7
Wir suchten am Abend noch die letzte Adresse auf, die wir von
Didier Chaveau hatten. Er wohnte im westlichen Teil von Saint
Gabriel. Das Apartmenthaus war ein für Marseille typisches Haus. Es
gab eine Tiefgarage in der Nähe. Dort stellten wir den Wagen ab.
Fast fünf Minuten mussten wir zu Fuß gehen, bis wir den Eingang des
Apartmenthauses erreichten.
Didier Chaveau wohnte im sechsten Stock.
Das Haus hatte keinerlei besonderen Komfort oder gar gehobene
Sicherheitstechnik, wie sie inzwischen in vielen Apartmenthäusern
eingesetzt wird. Es gab eine Überwachungskamera im Eingangsbereich
mit einem Hinweisschild, das behauptete, die Anlage sei direkt mit
einem Security Service verbunden. Vielleicht stimmte das sogar.
Aber wenn die in ihrer Einsatzzentrale saßen und mitbekamen, dass
hier irgendetwas geschah, was ihr Eingreifen erforderte, kamen sie
selbst dann zu spät, wenn sich die Zentrale der
Security-Mitarbeiter nur ein paar Straßen weiter befand.
An der Verwaltung und Instandhaltung schien man ebenfalls zu
sparen. Von den drei Aufzügen waren zwei defekt, und in der dritten
Liftkabine waren die Wände mit Graffiti vollgeschmiert.
»Ein hoch bezahltes Genie wie Chaveau sollte sich eigentlich
eine bessere Wohnung leisten können«, meinte François.
»Wer weiß, ob er nach dem Rauswurf bei SUJET SPÈCIAL überhaupt
noch einen Job bekommen hat.«
»Aber die Führung von SUJET SPÈCIAL hat doch alles getan, um
die Angelegenheit unter der Decke zu halten, Pierre«, gab François
zu bedenken.
»Offiziell ja – aber du weißt doch auch, wie so etwas
läuft.«
Wir standen vor Chaveaus Tür. Die Klingel war defekt. An
Chaveaus Namen fehlten die letzten drei Buchstaben.
François klopfte. Keine Reaktion.
»Was erwartest du? Er hat schon nicht reagiert, als wir unten
die Sprechanlage betätigen wollten«, sagte ich.
»Wer weiß, ob die nicht auch defekt ist – wie so vieles andere
hier«, erwiderte François. Er klopfte noch einmal, diesmal
heftiger. »Monsieur Chaveau, machen Sie auf, hier ist die
Polizei!«
Eine Tür auf der anderen Seite des Flurs öffnete sich. Ein
Mann mit Halbglatze und grauem Dreitagebart wankte in den Flur. Er
trug ein Unterhemd und eine Jeans, aber keine Schuhe. Er lehnte
sich gegen den Türrahmen. In der Linken hielt er eine Flasche. Sein
Kopf war hochrot.
»Der Typ ist nicht gut drauf«, sagte er, nachdem François ein
weiteres Mal geklingelt hatte.
Ich drehte mich zu ihm um.
»Pierre Marquanteur, FoPoCri! Wer sind Sie?«
»Ich heiße Germaine Effort.«
»Was haben Sie gerade mit Ihrer Bemerkung gemeint?«, hakte ich
nach.
François hatte mir allerdings schon vorher einen
kopfschüttelnden Blick zugeworfen, der nicht mehr, aber auch nicht
weniger bedeutete als: Lass es!
Germaine Effort blinzelte mich an, dann verlor er den Halt an
der Wand und stand anschließend so schwankend da, dass es nur eine
Frage der Zeit schien, wann er einfach zu Boden fallen würde.
»Der Kerl, zu dem Sie wollen, ist auf Drogen«, sagte Effort.
»Ist ein übler Typ. Spielt den ganzen Tag diese
Ballerspiele.«
»Sie kennen ihn näher?«
Effort zuckte mit den Achseln, nahm einen Schluck aus seiner
Flasche und wandte uns den Rücken zu.
»Sie müssen mir ja nicht glauben. Aber wenn er nicht aufmacht,
dann hat das immer denselben Grund!«
In diesem Moment öffnete sich die Tür. Ein deutlich
übergewichtiger Mann mit schulterlangen Haaren sah uns an.
»Hat Ihnen der Kerl von gegenüber schon ein paar nette Märchen
über mich erzählt?«, fragte er.
François hielt ihm seinen Ausweis hin.
»François Leroc, FoPoCri, dies ist mein Kollege Pierre
Marquanteur. Sind Sie Didier Chaveau?«
»Steht doch an der Tür! Na ja – größtenteils zumindest!«
»Wir müssen mit Ihnen sprechen, und ich glaube, es ist das
Beste, wenn wir das nicht hier im Flur erledigen.«
Chaveau musterte uns skeptisch und unterdrückte dann ein
Gähnen.
»Kommen Sie rein!«, sagte er. »Aber beschweren Sie sich nicht
darüber, dass ich nicht auf Besuch eingestellt war!«
»Danke.«
Er führte uns in sein Apartment. Das sah aus wie ein
Warenlager. Überall standen Kisten herum. »Ja, wundern Sie sich
nicht darüber, wie es hier aussieht! Ich verdiene etwas Geld mit
ein paar Geschäften im Internet.«
»Und was sind das für Geschäfte?«
»Sehen Sie doch. Das sind Restposten von Marken-T-Shirts oder
so etwas. Ich habe auch Computerspiele und Espresso-Tassen im
Angebot.«
»Ein sehr individuelles Angebot«, fand François.
»Was wollen Sie von mir? Habe ich falsch geparkt, oder sind
Sie hier, um mir zu erzählen, dass ich Teil irgendeiner
Verschwörung bin?« Er grinste. »Oder will mir irgend so ein Sack
was anhängen?«
»Meinen Sie damit vielleicht Ihren Nachbarn Monsieur Effort?«,
fragte ich.
Chaveau machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Dachte ich es mir doch! Dieser Blödmann! Hat sich das Hirn
weggesoffen und verbringt seine Tage jetzt damit, andere Leute zu
terrorisieren. Der lebt nach der Devise: Mir geht’s schlecht, und
deswegen soll es auch niemand anderem gut gehen.«
»Was haben Sie denn mit Monsieur Effort für
Schwierigkeiten?«
»Wenn ich nachts mal ein paar Kisten durch den Flur schleppe
oder Besuch habe oder die Musik mal etwas lauter ist, ruft der
gleich die Polizei und behauptet, ich würde randalieren, oder er
hätte Kampfgeräusche und Schreie aus meiner Wohnung gehört. Das
letzte Mal wollte mir die Feuerwehr schon die Tür eintreten, weil
angeblich Brandgeruch auf dem Flur zu bemerken war.«
Wir hatten inzwischen den Raum betreten, den Chaveau
vermutlich als sein Wohnzimmer ansah. Er war genauso vollgestellt
wie der Rest der Wohnung. Auf dem niedrigen Glastisch lag eine
angebissene Pizza neben einer Dose Energy Drink. Auf der Couch
lagen noch eingeschweißte Flachbildschirme eines
No-Name-Herstellers.
»Wenn’s länger dauert und Sie sitzen wollen, räume ich was
frei«, bot er an.
»Lassen Sie nur, wir sitzen selber viel zu viel«, meinte
François.
Mir fielen ein Computer und Laptop auf, die beide in Betrieb
waren und auf einem Schreibtisch in der Ecke standen. Die
Bildschirmschoner auf beiden Geräten hatten dasselbe, sehr ins Auge
fallende Motiv. Ein Mann im dunklen Ledermantel und
Maschinenpistole. Das Gesicht war grotesk verzerrt. In einer
Sprechblase stand in Großbuchstaben MEIN IST DIE RACHE. Eine
Animation sorgte dafür, dass der martialische Kerl die Zähne
bleckte und aus seiner Waffe im Abstand von fünf bis sechs Sekunden
Mündungsfeuer herausblitzte.
»Es geht um Ihre Zeit als Programmierer bei SUJET SPÈCIAL,
Monsieur Chaveau«, sagte François.
»Wollen mir Bouman und Bisson wieder was anhängen? Ich habe
die Firma durch meine Arbeit eine entscheidenden Schritt nach vorn
gebracht, aber seit ich nicht mehr da bin, machen die mich für
alles, was da nicht richtig läuft, verantwortlich. Nur weil diese
Idioten ihren Laden nicht in den Griff bekommen, brauchen sie nicht
dauernd einen ihrer Lakaien vorzuschicken, um bei mir nachzufragen,
wie man dieses oder jenes richtig machen muss.«
Ich runzelte die Stirn.
»Die Firma hat nach Ihrer Entlassung noch Kontakt zu Ihnen
aufgenommen?«, hakte ich nach.
»Nervensägen waren das. Ich habe die SUJET SPÈCIAL-Nummern
inzwischen in meinem Handy blockiert.«
François und ich sahen uns überrascht an. Irgendetwas passte
hier nicht zusammen.
»Die Geschäftsführung von SUJET SPÈCIAL hat uns das etwas
anders dargestellt«, sagte ich.
»Ach, ja?«, gab Chaveau mit ätzendem Unterton zurück. »Warum
wundert mich das nicht? Ist doch typisch für diese
Kleingeister.«
»Sie hätten Kundendaten verkauft, und man hat nur deswegen auf
eine Anzeige verzichtet, um das Image der Firma nicht zu
beschädigen.«
»Ja, so sind die!«, nickte Chaveau. »Nur ja eine glatte
Fassade, und was dahinter ist, interessiert niemanden. So sieht es
auch in deren Programmdatenbanken aus. Sie kennen sich mit so etwas
wahrscheinlich nicht gut genug aus, um das nachvollziehen zu
können, aber die tun immer so, als wäre alles, was die machen, so
supersicher und das Beste überhaupt. In Wahrheit können die froh
sein, dass ich ihre Systeme von ein paar groben Mängeln befreit
habe.«
»Und die Sache mit den Kundendaten?«
»Die wollten sich die Abfindung sparen. Das Ganze hatte
persönliche Gründe. Leute wie Bouman und Bisson sind Alpha-Tiere,
die vertragen es nicht, wenn in ihrer Nähe noch andere Sterne
glänzen. Und abgesehen davon gab es Differenzen, weil SUJET SPÈCIAL
meiner Ansicht nach die Sicherheit der Systeme vernachlässigt
hat.«
»Und Sie haben sich das gefallen lassen?«, fragte ich. »Ich
meine, das mit der Abfindung.«
Er grinste.
»Wer sagt denn, dass ich nichts gekriegt habe?«, fragte er.
»Wir haben uns geeinigt, und damit war der Fall für mich
abgeschlossen.«
»Ich hatte den Eindruck, dass dort niemand mehr mit Ihnen
etwas zu tun haben wollte, und Sie sagen uns jetzt, die hätten bei
Ihnen andauernd angerufen.«
Chaveau atmete tief durch.
»Offiziell stimmt das so, wie man es Ihnen gesagt hat. Aber
wenn es dann Probleme gab, haben die Mathieu Beaulieu vorgeschickt.
Der ist mein Nachfolger bei SUJET SPÈCIAL gewesen. Aber sagen Sie,
warum fragen Sie das alles?«
»Schadsoftware, die bei der Aktualisierung der
Navigationssysteme von Drohnen aufgespielt wurde, hat dafür
gesorgt, dass einige dieser künstlichen Flugkörper außer Kontrolle
gerieten«, stellte ich fest.
Chaveau schien nicht überrascht.
»Ich habe davon gelesen. Stand auf der Homepage des Marseiller
Abendblattes. Böse Sache für SUJET SPÈCIAL.«
»Allerdings«, nickte ich.
»Und da kommen Sie zu mir?«
»Sie stehen auf einer uns zugespielten Kundenliste von Hervé
Chapitte«, fuhr ich fort. »Er war Ihr Kokain-Dealer.«
»Ja, verdammt, wollen Sie hier jetzt eine Drogen-Razzia
veranstalten? Wer will mich denn hier fertigmachen? Der blöde Typ
von gegenüber oder SUJET SPÈCIAL?« Er lief dunkelrot an. »Okay, ich
habe Kokain genommen, als ich bei SUJET SPÈCIAL war. Heute könnte
ich mir das auch gar nicht mehr leisten. Und denken Sie ja nicht,
ich wäre der einzige dort gewesen, der das gebraucht hätte, um bei
gewissen Großaufträgen für ein paar Monate mit drei Stunden Schlaf
täglich auszukommen! Sehen Sie sich doch mal Boumans Nase genauer
an! Der hat keinen Schnupfen, die ist immer so gereizt und wird
auch nie wieder gesund werden, weil er sich mit dem Stoff die
Nasenschleimhäute ruiniert hat. Aber mich scheißen die jetzt an –
oder was soll ich davon halten?« Er machte eine ausholende
Handbewegung. »Sehen Sie sich gerne um, stellen Sie alles auf den
Kopf und zerstören Sie die sensible Ordnung, die hier herrscht! Sie
werden nicht ein Gramm Schnee finden. Nicht ein Gramm! Und wenn Sie
es ganz genau wissen wollen. Ich habe eine Entgiftung gemacht und
bin von dem Zeug los. Mir war nämlich irgendwann klar, dass ich als
Junkie enden würde, wenn ich keinen anderen Kurs einschlage.« Er
ging zu seinem Schreibtisch, riss eine Schublade auf, wühlte in
einem Stapel von Papieren herum, von denen die meisten wie
Rechnungsbelege aussahen. Er schien seine ganz persönliche Form der
Buchführung gefunden zu haben. Dann kam er mit ein paar zerknickten
Blättern auf mich zu und hielt sie mir hin.
»Hier!«, sagte er.
»Was ist das?«
»Meine Untersuchungsergebnisse. Blut, Urin und so weiter. Ich
nehme an einem Drogenentzugsprogramm teil und werde regelmäßig
überprüft, damit es keine Ausflüchte und keinen Selbstbetrug
gibt.«
Ich nahm die Blätter, glättete sie etwas. Die Adresse einer
Marseiller Suchtklinik stand oben rechts.
»Monsieur Chaveau, es geht uns nicht darum, Ihnen etwas
anzuhängen und Ihren Weg in ein neues Leben zu behindern. Aber auf
der Kundenliste von diesem Chapitte stehen weitere Personen aus
sicherheitsrelevanten Bereichen. Wir nehmen an, dass Chapitte mit
Leuten zusammengearbeitet hat, die gezielt Druck auf solche
Personen ausüben sollten.«
»Sie denken, ich wäre vielleicht von irgendeinem Geheimdienst
dazu erpresst worden, Schadsoftware auf die Rechner von SUJET
SPÈCIAL aufzuspielen, damit diese Software dann irgendwann in den
Drohnen der Armee landet?«
»So ähnlich«, bestätigte ich.
Er schüttelte entschieden den Kopf.
»In meiner Zeit hatten wir diesen Big Deal mit der Armee noch
nicht. Und auf mich ist nie Druck ausgeübt worden – abgesehen von
dem Druck, den ich mir selbst gemacht habe.«
»Eine Frage hätte ich noch«, mischte sich François wieder ein.
»Wieso haben Sie bisher keinen Job mehr in Ihrer Branche gefunden?
Sie waren doch ein Spitzenmann. Das gibt man sogar bei SUJET
SPÈCIAL zu.«
»Ich wäre vor die Hunde gegangen«, sagte Chaveau. »Ich musste
etwas ändern, nicht nur, was das Kokain betrifft. Das war doch nur
ein Symptom.«
8
»Glaubst du ihm die Geschichte?«, fragte François, als wir
Chaveaus Wohnung verlassen hatten und auf dem Weg zurück zu unserem
Wagen waren. »Dass Chaveau nur deshalb keinen Job mehr in seiner
Branche angenommen hat, weil er sein Leben ändern wollte, erscheint
mir doch reichlich hergeholt.«
»Ich würde eher sagen, er hat nichts mehr gekriegt«, meinte
ich. »Wenn jemand Kundendaten verkauft, verbreitet sich das doch.
Ein paar Telefongespräche hier, ein paar Andeutungen dort. Selbst
wenn der Verdacht nie gerichtlich überprüft wurde, bleibt da doch
so viel hängen, dass sich jede Firma zweimal überlegen wird, ob sie
so jemanden einstellt.«
»Warum erzählt er uns dann so etwas?«
»Verletzter Stolz. Vielleicht ist es einfach leichter zu
sagen, ich fange ein neues Leben an, als zuzugeben, dass man das
nur deswegen tut, weil man in dem Bereich, in dem man sich vorher
getummelt hat, auf Jahre hinaus ohne Chance sein wird.«
»Möglich«, gab François zu.
»Wir können uns in der Klinik erkundigen, ob die Sache mit
seiner Entgiftung stimmt«, schlug ich vor. »Und vielleicht macht
Hervé Chapitte ja auch eine Aussage darüber, wann er Chaveau
zuletzt beliefert hat.«
Wir gingen an einer Snack-Bar vorbei. Ich blieb stehen,
François sah mich kurz, und wir waren uns einig. Unsere Mägen
knurrten schon seit geraumer Zeit laut genug. Eigentlich hatten wir
ohnehin längst Feierabend. Also genehmigten wir uns einen Hot Dog
und Kaffee. Der Kaffee war ziemlich dünn und wirklich kein
Vergleich mit Melanies Gebräu.
»Chaveau hat zwar einen Riesenhass auf seine alten
Arbeitgeber, aber ich glaube nicht, dass er irgendetwas mit dieser
Schadsoftware zu tun hat«, sagte François kauend.
»Es ist noch zu früh, irgendeine Ermittlungsrichtung
auszuschließen«, meinte ich.
»Trotzdem. Irgendetwas ist in dieser Firma faul, und ich
glaube, dass Chaveau uns noch lange nicht alles gesagt hat, was für
uns interessant sein könnte.«
François trank seinen Kaffee leer.
»Vielleicht haben Arthur Jospin und seine Kollegen ja
inzwischen etwas mehr herausgefunden.«
»Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er überhaupt nicht über
Valmont gesprochen hat?«, fragte ich.
»Darauf habe ich nicht so geachtet«, ab François zu.
»Er hat über Bouman und Bisson geschimpft wie ein Rohrspatz –
aber nicht über Valmont.«
Wir fuhren nach dem Essen mit dem Wagen zurück nach
Marseille-Mitte. Wir stellten fest, dass die Klinik, die Chaveau
angegeben hatte, auf unserem Weg lag. François rief dort während
der Fahrt an.
»Wir haben Glück«, sagte er wenig später. »Eine Ärztin, bei
der Chaveau in Behandlung ist, wird mit uns sprechen.«
Wenig später erreichten wir die Klinik. Es handelte sich um
die Sylvain-Klinik. Dort gab es eine große Abteilung, die auf
Suchtkranke spezialisiert war.
Dr. Josephine Patés war eine schlanke, dunkelhaarige
Enddreißigerin mit ernstem Gesicht und markanter Brille.
»Pierre Marquanteur, FoPoCri«, stellte ich mich vor. »Mein
Kollege Leroc hat gerade mit jemandem aus der Klinik
telefoniert.«
»Ja, und das klang für die Ohren meiner Mitarbeiterin ziemlich
dramatisch. Aber wenn es um die Sicherheit Frankreichs geht, dann
will man dem nicht im Wege stehen – ich muss Sie allerdings darauf
hinweisen, dass die ärztliche Schweigepflicht auch in …«
»Wie kommen Sie jetzt auf die Sicherheit Frankreichs?«, fragte
ich überrascht. Ich hatte das kurze Gespräch schließlich mitgehört,
das François geführt hatte.
Dr. Patés lächelte auf eine Art, die etwas gezwungen wirkte,
und strich sich eine Strähne aus ihrem Gesicht.
»Entschuldigen Sie, das hatte ich Ihnen ja noch nicht
gesagt.«
»Was bitte?«
»Es geht doch um den Patienten Didier Chaveau, der früher bei
einer Firma gearbeitet hat, die mit diesen fehlgeleiteten Drohnen
zu tun hatte, über die jetzt in den Nachrichten immer mal wieder
berichtet wurde.«
»Ja«, nickte ich.
Josephine Patés wandte sich François zu.
»Kurz bevor Sie hier angerufen haben, hat sich Monsieur
Chaveau gemeldet und die Klinik mündlich ermächtigt, über seine
Therapie Auskunft zu geben.«
»Sie haben selbst mit ihm gesprochen?«, wunderte ich
mich.
»Ja, ich habe ihm zu erklären versucht, dass wir dazu eine
schriftliche Erklärung brauchen – aber das hatte ihm auch schon
meine Mitarbeiterin erklärt, die er dafür dann ziemlich übel
beschimpft hat. Wissen Sie, psychische Veränderungen sind oft
Spätfolgen einer Drogenabhängigkeit.«
»Wir wollen nur Folgendes wissen: Wann hat Monsieur Chaveau
seine Therapie begonnen, war sie erfolgreich, und gibt es
irgendwelche Hinweise darauf, dass er rückfällig wurde?«
»Die Antwort auf die erste Frage werde ich in den Unterlagen
noch genau nachsehen, aber ich würde sagen, circa vor einem halben
Jahr. Und was die Beantwortung Ihrer anderen Fragen betrifft: Er
ist ein Musterpatient und keine der Kontrolluntersuchungen hat
irgendein Anzeichen dafür ergeben, dass er rückfällig geworden
ist.«
»Danke«, sagte ich.
»Mehr kann ich Ihnen allerdings nicht sagen, das würde
…«
»… gegen Ihre Vorschriften verstoßen«, vollendete François
ihren Satz. »Aber das ist auch nicht nötig, wir wollten das nur
bestätigt haben.«
»Ehrlich gesagt, hoffe ich, dass Monsieur Chaveau nicht
irgendwie in Schwierigkeiten kommt«, bekannte Dr. Patés.
Ich horchte auf.
»Das klingt fast so, als hätten Sie eine persönliche
Beziehung.«
»Ich engagiere mich im Missionswerk Christen gegen Drogen der
Martin-Lafitte-Stiftung. Dort arbeite ich ehrenamtlich in meiner
Freizeit. Vor einem halben Jahr tauchte Chaveau in einem der
Gesprächskreise auf, die ich dort leite. Damals war er ziemlich
verzweifelt – körperlich am Ende, drogensüchtig, von seiner Firma
gefeuert. Ich habe ihm geraten, sich in der Drogenabteilung dieser
Klinik zu melden.«
9
André Valmont stellte seinen blauen Mercedes am Straßenrand ab
und stieg aus. Der Parkplatz lag nicht weit entfernt vom
Fischmarkt. Man war nah genug, um die Lichter von Marseille zu
sehen. Zumindest, wenn kein Nebel aufzog. Valmont schlug die Kapuze
seines Parkas über den Kopf und vergrub die Hände in den Taschen.
Ihm war kalt. Die Nässe, die vom Meer herüberzog, ging einem durch
und durch.
Ich muss verrückt gewesen sein, so spät noch hierherzukommen!,
ging es ihm durch den Kopf. Er sah auf die Uhr.
Sein Handy klingelte. Er nahm das Gerät aus der
Jackentasche.
Francine ruft an, stand im Display.
Jetzt nicht, dachte er und drückte sie weg.
Ein Wagen kam jetzt von der Schnellstraße herunter und fuhr
heran. Die Lichter waren aufgeblendet. Valmont versuchte
vergeblich, sich gegen den grellen Schein zu schützen und außerdem
noch zu erkennen, was für ein Wagen das war und wer drin saß.
Eine Tür ging auf.
Eine Gestalt – nicht mehr als ein Schatten – kam auf ihn
zu.
»Monsieur Valmont?«
»Ich kann Sie nicht sehen.«
»Ich Sie dafür umso besser.«
»Wer sind Sie?«
Das Geräusch, das nun folgte, erinnerte an einen Schlag mit
einer Zeitung oder kräftiges Niesen. Mündungsfeuer blitzte am Ende
eines Schalldämpfers auf. Die erste Kugel traf Valmont in der
Herzgegend, ließ ihn zwei Meter zurücktaumeln und ziemlich
ungläubig dreinblicken. Der zweite Treffer erwischte ihn im Bauch.
Ein Ruck ging durch seinen Körper. Valmont krümmte sich. Blut quoll
durch die Hände, die er sich gegen den Leib presste. Der letzte
Schuss ging genau zwischen seine Augen. Er fiel der Länge nach hin
und blieb rücklings liegen. Seine Augen starrten in den diesigen
Himmel.
Die Gestalt kam näher.
Ein Schatten, der sich gegen das helle Licht der Scheinwerfer
abhob, kniete kurz nieder. Behandschuhte Finger glitten über das
starr gewordene Gesicht des Toten und schlossen ihm die
Augen.
»Zeit, schlafen zu gehen«, sagte eine Stimme, die so kalt
schneidend war wie die feuchte Luft in dieser Nacht.
10
Ich holte François am Morgen an der bekannten Ecke ab.
Wir waren kaum die Hälfte der Strecke bis zum Polizeipräsidium
gefahren, da meldete sich bereits Monsieur Marteau per Telefon.
François hörte die Stimme unseres Chefs über die
Freisprechanlage.
»Guten Morgen. Unser Fall hat eine dramatische Wende bekommen.
In der Nähe des Markts in Pointe-Rouge wurde André Valmont tot auf
einem Parkplatz gefunden. Er hatte mehrere Kugeln im Körper. Die
Einsatzkräfte der örtlichen Polizei sind vor Ort.«
»Dann fahren wir dort am besten als Nächstes hin«, schlug ich
vor.
»Tun Sie das bitte«, bestätigte Monsieur Marteau. »Warten Sie,
ich gebe Ihnen noch die genaue Lage des Parkplatzes durch.«
Als wir den Parkplatz erreichten, befanden sich dort bereits
einige Dienstfahrzeuge der Polizei und des
Gerichtsmediziners.
Es war ein diesiger kalter Tag. Nebel hatte sich am Ufer
gebildet und verhinderte sogar, dass man das Wasser oder die
Schiffe nur undeutlich sehen konnte. Normalerweise hätte man von
dieser Position aus freie Sicht auf Marseille-Zentrum gehabt, aber
von der Silhouette der Stadt waren jetzt nur ein paar graue
Schatten zu sehen.
»Marquanteur, FoPoCri«, sagte ich und hielt einem
uniformierten Kollegen der Polizei meinen Ausweis hin. »Dies ist
mein Kollege François Leroc.«
»Commissaire Bonnet leitet den Einsatz hier. Er wartet schon
auf Sie.« Der Beamte streckte die Hand aus. »Das ist der Mann mit
dem grünen Schlips!«
»Danke.«
Wir gingen an ihm vorbei.
Commissaire Bonnet stand links von dem Toten, über den sich
gerade jemand anderes gebeugt hatte – vermutlich der
Gerichtsmediziner.
Wir stellten uns Bonnet kurz vor. Seine grüne Krawatte hing
ihm wie ein Strick um den Hals. Er war Mitte vierzig, hatte grau
durchwirktes Haar und trug einen buschigen Schnauzbart, der die
Lippen fast vollständig verbarg. Er begrüßte uns erst, wurde dann
durch ein Telefongespräch abgelenkt, bei dem er ziemlich
angestrengt wirkte. Als er sein Handy wieder in die Tasche seines
Mantels gesteckt hatte, meinte er: »Sie wurden mir gerade
angekündigt!«
»Wissen Sie schon irgendetwas?«, fragte ich.
»Der Mann heißt André Valmont und wurde irgendwann in der
Nacht von mehreren Kugeln getroffen. Das Opfer wurde nicht beraubt.
In seinem Portemonnaie waren 500 Euro, aber für die schien sich der
Täter genauso wenig zu interessieren, wie für die Rolex am
Handgelenk.«
Der Gerichtsmediziner erhob sich jetzt. Er war ein kleiner,
rundlicher Mann. Commissaire Bonnet stellte ihn uns als Dr. Georges
Danglard vor.
Danglard nickte uns knapp zu und wandte sich dann an Bonnet.
»Hat irgendeiner Ihrer Leute dem Kerl eigentlich die Augen
geschlossen?«
»Nicht, dass ich wüsste!«, sagte Bonnet. »Ist das so
wichtig?«
»Das ist sehr wichtig«, sagte Danglard. »Dem Toten waren die
Augen geschlossen worden.«
»Halten Sie es nicht für möglich, dass das Opfer sie selbst
geschlossen hat?«
»Haben Sie schon einmal einen Horrorfilm gesehen, Monsieur
Bonnet?«
»Für so etwas habe ich keine Zeit«, sagte Bonnet.
»Angesicht des ultimativen Schreckens reißt man die Augen auf
und schließt sie nicht«, erklärte Danglard. »Der Mensch hat immer
noch das genetische Programm eines Fluchttiers, das schaut, wohin
es vor dem Raubtier wegrennen kann – und das läuft ziemlich
automatisch ab. Die Augen zu schließen, wäre eine
Willensanstrengung, zu der das Opfer nicht mehr in der Lage gewesen
sein kann. Dass der Mann dem Täter relativ nahe gegenüberstand,
legen doch schon die Fußabdrücke und Schmauchspuren nahe, wie Sie
selbst mir gesagt haben.«
»Was für Fußabdrücke?«, fragte ich.
Bonnet deutete ungefähr fünf Meter weiter. Ich sah allerdings
nur den Rücken einer Mitarbeiterin des Erkennungsdienstes der
Polizei. Zumindest stand das auf ihrem weißen Overall.
»Dort hat er gestanden?«, fragte François.
Der Parkplatz war unbefestigt. Nur die Einfahrt war
asphaltiert, die eigentlichen Parkflächen nicht. Es gab hier nur
rote Asche, wie auf einem Tennisplatz. Man hatte einen Parkplatz
geplant, ihn halb fertigstellen lassen und dann nicht mehr die
Mittel gehabt, ihn auch zu beenden. Das war typisch, aber dieser
Umstand kam uns natürlich zugute.
Frische Fußabdrücke hielten sich darin ganz gut. Zumindest bei
feuchter Witterung, und die hatten wir ja. Wenn man allerdings eine
Weile auf so einem Untergrund zu tun hat, sind die Schuhe ruiniert.
»Der Täter hatte zwei verschieden große Füße«, erklärte
Commissaire Bonnet. »Rechts Größe zweiundvierzig, links mindestens
vierundvierzig, vielleicht auch fünfundvierzig.«
»Kein Mensch ist völlig symmetrisch gewachsen«, mischte sich
Dr. Danglard ein. »Eine Schuhgröße Unterschied zwischen rechtem und
linkem Fuß ist keine Seltenheit. Es gibt Menschen, die sich
grundsätzlich Schuhe verschiedener Größen anziehen.«
»Aber eine derart große Differenz müsste die Identifizierung
des Täters erheblich erleichtern«, glaubte Commissaire
Bonnet.
»Aber nochmal zu den Augen«, sagte François. »Ich schlage vor,
auf den Augenlidern nach Fingerabdrücken zu suchen und außerdem
noch mal alle am Einsatz beteiligten Beamten zu befragen, ob
vielleicht nicht doch jemand von denen die Augen geschlossen
hat.«
Danglard nickte.
»Unbedingt!«, gab er François recht.
Commissaire Bonnet seufzte. Er war nicht so begeistert von
diesem zusätzlichen Aufwand und schien ihn auch für überflüssig zu
halten. Aber er verkniff sich eine Bemerkung dazu.
»Ganz wie Sie wollen«, meinte er.
»Wer hat den Toten überhaupt entdeckt?«, fragte ich.
»Ein Ehepaar, das auf dem Rückweg aus dem Urlaub in Frankreich
war und Tag und Nacht durchgefahren ist.« Er deutete mit der Hand
auf einen Ford in grau-metallic ganz am Ende des Parkplatzes.
»Wir sollten die auch befragen«, schlug ich vor.
»Ja, fragt sich nur, ob Sie viel aus denen herausbekommen«,
meinte Bonnet. »Die beiden stehen unter Schock. Ich habe einen Arzt
gerufen. Weiß der Himmel, warum der noch nicht hier ist!«
»Das heißt, es hat sich noch keiner um die beiden gekümmert?«,
vergewisserte ich mich.
»Ich habe auch nur zwei Hände und ein Telefon«, verteidigte
sich Commissaire Bonnet.
»Wenn die Leiche fortgeschafft ist und Ihr Arzt dann noch
nicht hier ist, sehe ich nach den beiden«, versprach Dr. Danglard.
»Auch wenn ich weder Spezialist für Schockzustände oder psychische
Probleme bin und seit meiner Zeit im Krankenhaus nur noch an Toten
herumgeschnitten habe!«
11
Wir gingen zu dem metallicfarbenen Ford.
Der Mann saß hinter dem Steuer, seine Frau auf dem
Beifahrersitz. Ich schätzte die beiden auf Anfang dreißig. Sie
sahen beide fix und fertig aus. Dicke Augenringe unterstrichen das.
Und das Erlebnis, einen Toten gefunden zu haben, hatte ihre
Gesichter tief gezeichnet. Man brauchte kein Arzt zu sein, um sehen
zu können, wie tief dieser Schock sitzen musste.
Und doch konnten wir sie jetzt nicht einfach in Frieden
lassen. Möglicherweise hatten sie irgendeine Beobachtung gemacht,
die für unsere Ermittlungen am Ende von zentraler Bedeutung war. In
den Jahren, die ich nun schon bei der FoPoCri bin, habe ich das oft
genug erlebt.
Ich hielt meinen Ausweis empor. Der Mann wurde auf mich
aufmerksam. Die Frau sah weiterhin starr vor sich hin. Die Tür des
Ford öffnete sich. Der Mann stieg aus.
»Marquanteur, FoPoCri. Die ist mein Kollege François Leroc«,
stellte ich uns vor. »Es tut mir leid, wenn wir Sie jetzt noch mal
ansprechen müssen, wo Sie vermutlich schon den Kollegen der Polizei
Rede und Antwort stehen mussten.«
»Das ist schon in Ordnung«, sagte der Mann und fuhr sich mit
der flachen Hand über das Gesicht, so als hoffte er darauf, dass
ihn das etwas wacher machen würde. »Mein Name ist Pascal Malpasse,
und im Wagen sitzt meine Frau Gabrielle. Wir waren auf der
Rückreise vom Urlaub und wollen eigentlich nur ein oder zwei
Stunden hier Pause machen.«
»Wohin müssen Sie denn?«
»Wir kommen aus Toulon.«
»Da haben Sie ja noch ein ganz schönes Stück vor sich.«
»Sie sagen es. Aber im Moment zittern mir so die Knie, dass
ich nicht einmal das Gaspedal treten könnte. Glauben Sie’s mir!« Er
atmete tief durch und verschränkte die Arme vor der Brust. »Aber
für Sie ist so was ja wahrscheinlich Routine – ich meine der
Anblick von jemanden, der von Kugeln zerfetzt wurde.«
»Nein, so etwas wird nie Routine«, versicherte ich ihm.
»Warum sind Sie eigentlich nicht geflogen?«, fragte
François.
»Flugangst«, sagte Pascal Malpasse. »Also ich nicht, aber
meine Frau. Wenn sie ein Flugzeug besteigt, kriegt sie
Schweißausbrüche und Angstzustände.« Und in etwas gedämpfterem
Tonfall fügte er hinzu. »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie
jetzt nicht mit ihr sprechen würden. Sie ist vollkommen neben der
Spur.«
»Wann sind Sie hierhergekommen?«
»Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber es war gerade
richtig hell geworden. Meine Frau hatte die letzte Tour übernommen.
Wir haben uns alle zweihundert Kilometer am Steuer abgewechselt.
Aber es war klar, dass wir jetzt dringend eine Pause brauchten. Wir
sind hier auf den Parkplatz abgebogen und haben ziemlich schnell
gesehen, was los ist. Danach habe ich mit dem Handy die Polizei
verständigt. Wann genau, müssten Ihre Kollegen registriert
haben.«
»Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Oder irgendjemand?«, hakte
ich nach. »Ganz gleich, wer oder was es auch sein könnte, uns kann
am Ende vielleicht jede Kleinigkeit bei der Aufklärung des Falles
helfen.«
Malpasses Blick wurde nachdenklich und nach innen gekehrt.
Dann schüttelte er den Kopf. »Nein.«
»Und haben Sie irgendetwas verändert oder …«
»… dem armen Kerl die Augen geschlossen?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil mir das seltsam vorkam, als ich ihn da so liegen sah. Er
sah fast friedlich aus. In den Krimis im Fernsehen haben die immer
die Augen weit aufgerissen. Ich dachte dann: Ist eben doch
anscheinend in der Wirklichkeit etwas anders als in der Glotze.
Aber …«
»Ja?«
»Eigenartig war es schon.«
»Das heißt, Sie beide haben ihm definitiv nicht die Augen
geschlossen!«
»Nein.«
12
Inzwischen traf der Arzt ein, von dem Commissaire Bonnet
gesprochen hatte. Er war ein groß gewachsener Mann mit Halbglatze
und sehr spitzer Nase. Er trug Krawatte zu einer braunen
Lederjacke, wobei die Krawatte sehr hastig und irgendwie nicht ganz
richtig gebunden zu sein schien. Beiläufig hörte ich ihn gegenüber
Commissaire Bonnet von einem Unfall mit entsprechendem Stau auf
einer der Hauptverkehrsachsen durch Marseille reden. Das musste
wohl der Grund für seine Verspätung sein.
Ich nahm mir vor, auf dem Rückweg nach Marseille daran zu
denken und den Bereich zu umfahren, damit wir nicht auch in diese
Blechfalle gerieten.
Wir überließen die Malpasses der Fürsorge des Arztes.
Inzwischen gab es neue Erkenntnisse.
»Also, es hat definitiv keiner meiner Leute dem Toten die
Augen geschlossen«, berichtete Commissaire Bonnet. »Und wenn die
beiden es nicht getan haben, die auf die Leiche gestoßen sind, dann
muss es der Täter gewesen sein.«
»Es ist ganz sicher der Täter gewesen«, war jetzt eine
weibliche Stimme zu hören. Sie gehörte der Erkennungsdienstlerin
des örtlichen Polizeireviers, die mir zuvor schon aufgefallen war.
Sie hatte offenbar unsere Unterhaltung mit Commissaire Bonnet
gehört.
Ich wandte mich ihr zu. Sie hatte kinnlanges rotes Haar und
Sommersprossen.
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte ich.
»Ich habe auf den Augenlidern nach Fingerabdrücken gesucht.
Die gerade dort zu finden, wäre schon ein extremer Glücksfall
gewesen.«
»Sie haben nichts gefunden?«
»Nein. Aber stattdessen etwas anderes. Schmauchspuren. Ganz
eindeutig. Und dafür gibt es eigentlich nur eine mögliche
Erklärung.«
»Der Täter trug Handschuhe, hat zuerst geschossen und
anschließend mit dieser Hand die Augen geschlossen«, reimte ich mir
zusammen, worauf das alles hinauslief.
Sie nickte. »Exakt!«
»Könnte es sein, dass er das schon von Anfang an vorgehabt
hatte?«, fragte François.
»Dem Opfer die Augen schließen?«, fragte Bonnet.
»Sicher!«, sagte François.
»Wir sollten auf jeden Fall mal sehen, ob wir über SIS
jemanden ermitteln können, für den ein derartiges Vorgehen typisch
ist«, schlug ich vor.
13
Auf der Rückfahrt nach Marseille-Mitte aktivierte François den
TFT-Bildschirm in unserem Wagen und ließ den Bordrechner
hochfahren.
Über das zentrale, landesweit allen Polizeibehörden zur
Verfügung stehende Datenverbundsystem SIS fand er heraus, dass es
tatsächlich einen professionellen Killer gab, zu dessen
Besonderheiten es gehörte, seinen Opfern die Augen zu schließen. Es
schien eine Art persönlicher Handschrift zu sein, mit der er sich
wohl einen besonderen Nimbus hatte verschaffen wollen. Aber
vielleicht hatte er auch banalere Beweggründe dafür. Menschen, die
dem Tod beruflich besonders nahe sind, neigen entweder zum Zynismus
oder zu besonderer Religiosität. Das galt für Ärzte und Bestatter
genauso wie für Soldaten und Lohnkiller. Vielleicht war dieser
Täter jemand, der tief in seinem Inneren doch Skrupel hatte und sie
mit irgendeinem Ritual betäuben musste. Er wäre nicht der erste
gewesen …
»Wir wissen noch nicht einmal sicher, ob es wirklich ein Profi
war«, meinte François. »Und die Tatsache, dass dieses eine
Tatmerkmal übereinstimmt, muss nicht ausschließen, dass André
Valmonts Ermordung das Resultat irgendeiner persönlichen Tragödie
ist.«
»Nein, ausschließen muss es das nicht«, gab ich zu.
»Ich schlage vor, wir warten den Bericht der Ballistiker ab.
Vielleicht wurde dieselbe Waffe ja schon mal benutzt.«
»Patronen wurden jedenfalls am Tatort nicht gefunden«, stellte
ich fest. Und auch das sprach für einen Profi. »Was ist mit den
unterschiedlich großen Füßen? Wenn du dieses Merkmal zusätzlich
eingibst, kriegst du vielleicht irgendein Ergebnis, mit dem sich
etwas anfangen lässt.«
François versuchte es.
»Nichts«, sagte er schließlich. »Es gibt massenweise Täter mit
unterschiedlich großen Füßen, aber keinen, der im Verdacht steht,
seinen Opfern die Augen zu schließen.«
»Mit welchen Morden wird der Augenschließer denn in Verbindung
gebracht?«, fragte ich.
»Morde im Drogenmilieu im gesamten Süden Frankreichs. Nie
aufgeklärte Taten, alle unter der Rubrik Konkurrenzkampf unter
Verbrechern. In der Wahl seiner Waffen scheint er allerdings
variabel zu sein. Ich rufe mal Maxime an.«
Er stellte über die Freisprechanlage unseres Wagens eine
Verbindung zu unserem Innendienst-Kollegen Maxime Valois her, damit
der diese Sache etwas weiterverfolgen konnte. Vielleicht ergaben
sich da ja noch irgendwelche anderen Bezüge, die uns weiterbrachten
und bei einer SIS-Schnellrecherche nicht sofort offenbar wurden.
14
Unser Weg führte uns als Nächstes nach Les Lucs. André Valmont
hatte sich dort vor Kurzem eine Eigentumswohnung in einem Gebäude
gekauft. Der wachsende Erfolg von SUJET SPÈCIAL hatte das wohl
möglich gemacht.
Als wir vor seiner Wohnungstür standen, machte uns eine junge
Frau mit langen blonden Haaren auf. Sie trug Jeans und einen
Kurzmantel. Es war offensichtlich, dass sie die Tür nicht
unseretwegen geöffnet hatte, da wir uns noch gar nicht bemerkbar
gemacht hatten, sondern gerade gehen wollte.
»Was machen Sie vor meiner Tür?«, fragte die junge Frau
irritiert – vor allem, nachdem sie bemerkt hatte, dass François den
Wohnungsschlüssel in der Hand hielt, der auf dem Parkplatz bei
Valmonts Sachen gewesen war.
»Sie wollten einfach in die Wohnung?«
»Nein …«, begann François, kam aber nicht zu Wort.
»Woher haben Sie Andrés Schlüssel? Den Anhänger erkenne ich
wieder!« Sie machte eine ruckartige Bewegung und griff dabei in
ihre Handtasche.
»Pierre Marquanteur, FoPoCri«, stellte ich mich vor und hielt
ihr meinen Ausweis hin. »Dies ist mein Kollege Leroc. Und was immer
Sie da auch in ihrer Handtasche verbergen, sollten Sie da stecken
lassen!«
Sie erstarrte mitten in der Bewegung und ließ sich
widerstandslos die Handtasche abnehmen. In der Tasche steckte ein
Elektroschocker.
»Was ist passiert?«, fragte sie schließlich, nachdem ein
weiterer Blick auf François’ Ausweis sie davon überzeugt hatte,
dass wir tatsächlich Commissaires waren – und keine Gangster.
»Darf ich zunächst erfahren, wer Sie sind?«, fragte ich.
»Ich heiße Mireille Asponge und wohne hier.«
»Zusammen mit Monsieur André Valmont?«
»Wir sind vor drei Wochen hier zusammen eingezogen.«
»Lassen Sie uns reingehen«, schlug ich vor.
Wir folgten ihr in ein großzügig und sehr modern
eingerichtetes Wohnzimmer. An der Wand hing ein gewaltiger
Multimedia-Flachbildschirm, der das beherrschende
Einrichtungselement darstellte, um das sich alles andere
gruppierte. Der Bildschirm zeigte im Ruhezustand ein Bild von Van
Gogh. Über Geschmack kann man eben nicht streiten.
Mireille Asponge setzte sich in einen der aus einem bespannten
Metallgestänge bestehenden Sessel. Sie war bleich wie die Wand
geworden und ahnte wohl, dass wir ihr keine erfreuliche Nachricht
überbringen konnten.
Ich wechselte einen kurzen Blick mit François.
Was ich gegenüber Pascal Malpasse darüber geäußert hatte, dass
es für manche Dinge einfach keine Routine gibt, war keineswegs nur
so dahergesagt gewesen.
»Monsieur André Valmont wurde heute Morgen auf einem Parkplatz
in der Nähe des Fischmarkts ermordet aufgefunden«, sagte ich. »Es
tut mir sehr leid, aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir alles
tun werden, um den oder die Täter zu finden.«