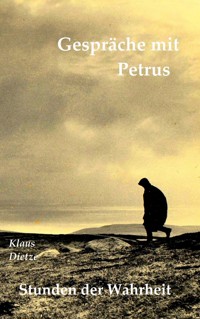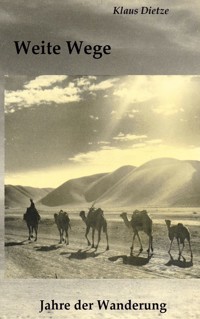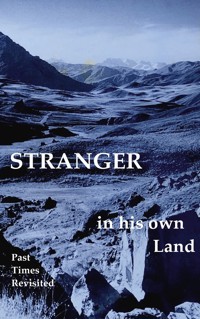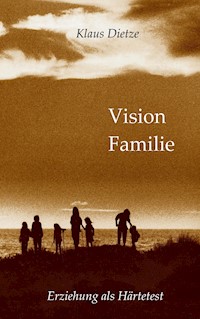
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kinder aufwachsen zu lassen in einer sich verändernden Welt mit ihren wechselnden Herausforderungen, ist nicht unbedingt ein Erfolgserlebnis. Außer man macht es zu einem - in der Routine des Alltags und in Zeiten hereinbrechender Turbulenzen. Eine Aktion, die Jahrzehnte überspannt und deren Gelingen andere beurteilen. Aktuell geht es um das Leben mit sieben Kindern. Dass dieses Leben alleine gestemmt werden muss, erschwert die Angelegenheit, doch man tut, was man kann. Bis zu guter Letzt die Aufgabe getan ist und die Hände in den Schoß gelegt werden können. Denkt man. Aber die Sache setzt sich fort, indem man sich einlässt auf eine neue Runde des Spiels. Erziehung bleibt weiterhin gefragt, nicht zuletzt die eigene. Man macht dabei seine Erfahrungen: Über den Umgang mit Geld und Materie, mit Kochtöpfen und mit Kindern, deren große und kleine Wehwehchen getröstet werden wollen. Antworten sind gefordert; ob es dann immer die richtigen sind und ob man den richtigen Tonfall trifft, ist eine andere Frage. Das Pflichtenheft umfasst die Existenzsicherung geradeso wie die Begleitung in Extremsituationen hereinbrechender Krankheit. Grenzen wollen gezogen werden, um nicht Veranlagungen im Äußerlichen zerflattern zu lassen statt sie zu bündeln. Wege sind zu finden in Zeiten einer Medienpräsenz, die geeignet ist, kindliche Seelen mit digitalen Truggebilden zu verdrehen. Der eigene Standort ist zu bestimmen in einer Welt zunehmender Sexualisierung, Drogenmissbrauchs und ungezügelter Lustprinzipien, sollen Heranwachsende vor Fallstricken und Stolpersteinen bewahrt werden. Im Idealfall, denn es gibt keine Garantien ... Die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Bis man irgendwann zurückschauen kann auf seine Bemühungen und was sie gebracht haben. Eine neue Generation stellt sich in die Welt und macht ihre eigenen Erfahrungen. Ob es die sind, die man sich für sie vorgestellt hat, ist dabei weniger von Belang, als dass man ihnen, so gut es ging, geholfen hat, ihren Platz im Leben zu finden. Sie werden das Gleiche zu tun haben bei ihrem Nachwuchs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Kinder aufwachsen zu lassen in einer sich verändernden Welt mit ihren wechselnden Herausforderungen, ist nicht unbedingt ein Erfolgserlebnis. Außer man macht es zu einem – in der Routine des Alltags und in Zeiten hereinbrechender Turbulenzen. Eine Aktion, die Jahrzehnte überspannt und deren Gelingen andere beurteilen. Aktuell geht es um das Leben mit sieben Kindern. Dass dieses Leben alleine gestemmt werden muss, erschwert die Angelegenheit.
Man macht dabei seine Erfahrungen: Über den Umgang mit Geld und Materie, mit Kochtöpfen und mit Kindern, deren große und kleine Wehwehchen getröstet werden wollen. Antworten sind gefordert; ob es dann immer die richtigen sind und ob man den richtigen Tonfall trifft, ist eine andere Frage. Aber man lernt…
Der Autor
ist dankbar, in Zeiten und an Orten gelebt zu haben, an denen er unbehelligt von obrigkeitlichen Eingriffen seine Kinder aufziehen konnte. Und auch heute, da Heranwachsende auf neue Denkrichtungen und Lebensgefühle getrimmt werden, würde er versuchen, seinen Weg zu gehen im Vertrauen auf die unwandelbaren Entwicklungsgesetze, die dem menschlichen Sein die Form geben. Seine Wurzeln hatte er in Deutschland, jetzt lebt er in der Schweiz.
Inhalt
Migration ins Abseits
Lektionen im Schnee
Passion eines Mädchens
Schranken und Grenzen
Dauerthema Medien
Eigene Wege
Notbremse am Küchentisch
Räder und Karossen
Mitten ins Nirgendwo
Fernsicht und Ausblicke
1. Migration ins Abseits
„Wie seid ihr eigentlich zu so vielen Kindern gekommen,“ hatten uns Menschen gefragt.
Wir hatten dankbar angenommen, was uns geschenkt worden war und es nie bereut. Wenn wir von der Vorsehung für würdig befunden wurden, das Leben weiterzugeben, wollten wir selber auch nicht kleinlich sein. Wo Platz gewesen war für vier, war auch Platz für fünf, wo fünf waren, konnten sechs leben und so fort. Wir hatten unsere Bestimmung im irdischen Dasein gefunden.
Aber dann hatte das Schicksal uns einen Weg geführt, den wir gehen mussten, auch wenn wir nicht wollten. Wir hatten anzunehmen, was auf uns zukam und danach war ich alleine mit sieben Kindern im Alter von zwei bis vierzehn Jahren und der Frage, wie weiter.
Die Erinnerungen daran lagen in meinem Gedächtnis herum wie ein Haufen Baumaterial auf einem Bauplatz, alles noch durcheinander. Es musste erst Ordnung hineinkommen, sollte daraus ein Haus werden. Ordnung schaffen und zusammenzubringen, was auseinanderfiel, war ohnehin für mich ein Dauerauftrag des Lebens gewesen.
Anfangs hatten uns noch Angebote erreicht zu helfen. Es war um die Trauer-Arbeit gegangen; es gab sogar vorgedruckte Leitlinien. Was tun mit ihnen? Schmerzliche Erinnerungen aufarbeiten oder den Ofen damit anfeuern? Dann rief eine ältere Dame an von einer gemeinnützigen Institution, sie hätte von uns gehört und bot Unterstützung. Das klang nobel. Allerdings entwickelte sie gleich ein ganzes Konzept am Telefon.
Als Mann würde man nicht im Stande sein, sich um sieben Kinder zu kümmern, also wäre meine Sache der volle Einstieg in den Beruf, um die finanzielle Basis zu schaffen für die Anstellung einer kompetenten Erzieherin und Haushälterin. Es gäbe seriöse Agenturen zu dem Zweck und man würde einen Beitrag leisten. Das Auflegen des Hörers geschah etwas heftig.
Später kam von anderer Seite die Rückmeldung, warum ich so unkooperativ wäre. Aber wussten sie in ihren Amtsstuben nicht, wie es auf dem Arbeitsmarkt aussah, wenn man schon jenseits der Lebensmitte war? Und kompetente Frauen ‒ hatten die nicht Gehaltserwartungen, die jedes Budget sprengten und außerdem gerade immer dann ihre freie Zeit, wenn kleine Kinder mit großem Kummer mitten in der Nacht getröstet werden wollten?
Die einzige Kompetenz, die mir bekannt war, erstreckte sich über 24 Stunden rund um die Uhr und das jahrein jahraus. Und mein Bild von Frauen umfasste viel mehr, als dass ich sie in unserer innersten Privatphäre hätte jobben sehen wollen.
Das Angebot war wenig hilfreich. Was getan werden musste, war meine eigene Aufgabe, auch wenn ich sie niemals mit dieser bedingungslosen Liebe erfüllen konnte wie die, von der ich sie übernommen hatte.
Die Situation wurde nicht besser dadurch, dass wir umziehen wollten, aber keine Wohnung fanden. Wohnungssuche für sieben Kinder war simpel ausgedrückt ein Kopfschmerz. Wer hatte schon sieben Kinder? Wohnungen wurden heutzutage gebaut für Singles. Doch meldete sich ein Herr mit sonorer Stimme am Telefon, er hätte genau das Richtige für uns.
Wie sich herausstellte, war es ein Stück Beton in einer größeren Betonanhäufung mit einer handtuchbreiten Grünfläche zu einem Mietpreis vom Doppelten meines Einkommens. Als ich ablehnte, wurde er laut und ausfallend: Es gäbe doch schließlich Sozialämter! Man musste nur genügend Druck machen, dann würden sie schon helfen bei der Finanzierung! Der Handel kam nicht zustande.
Schlussendlich ergab sich doch etwas Passendes. Es war ein Schmuckstück von einem Haus an zentraler Lage. Alles wurde abgemacht auf Treu und Glauben und der Umzug in die Wege geleitet. Der Möbelwagen stand schon bereit, als die Sache doch platzte. Eigner war eine Erbengemeinschaft und eine Partei hatte in letzter Minute quergeschossen über einen Anwalt. Da nützte alle Sympathie der anderen für uns nichts.
Zum Glück gab es wohlgesonnene Menschen, die zwar unser Problem nicht lösen konnten, doch jeder für sich ein Stück davon. Bei den einen ließ sich ein Teil des Hausrates unterstellen, andere wollten liebgewordene Gegenstände für uns aufbewahren, bis wir sie wieder abholten. Einige der Mädchen hatten ein vorläufiges Unterkommen in Familien ihrer Kameradinnen und eine der Patentanten wollte gleich mehrere bei sich aufnehmen.
Das Größte aber war, dass wir für den anstehenden Winter ein Ferienhaus nutzen durften hochoben in den Bergen, das wir schon von früher kannten. Wir hatten dort glückliche Zeiten erlebt, als die Familie noch heil gewesen war, und uns nützlich gemacht, indem wir Brennholz schlugen für den offenen Kamin oder das Dach reparierten, wenn im Winter die Schneelast die Ziegel eingedrückt hatte. Das war die Option, die uns am meisten zusagte, und als alles geregelt war, zogen wir um in die Berge.
Im Flachland war alles noch grün gewesen. Als die Strasse zu steigen anfing, wurde es weiß und als wir oben waren, lag mehr als ein halber Meter Schnee. Die Zufahrt zu unserem neuen Domizil war ein Stück weit geräumt, so dass es überhaupt zu erreichen war. Die Kleinen mussten allerdings beim Fahrzeug warten, sonst hätten sie bis an den Bauch im Schnee gesteckt.
Beim Haus waren alte Skier und Seile zu finden, aus denen sich ein provisorischer Lastschlitten machen ließ. Wir luden unsere Habseligkeiten und die Vorräte auf und ächzten mit der guten Hilfe der älteren Töchter los zum Haus. Eines von den Kleinen fiel in eine Schneewehe, war halb verschwunden und wurde wieder ausgegraben.
Im Haus war es das Erste, ein großes Feuer in Gang zubringen im offenen Kamin, der im Raum eine zentrale Lage einnahm. Ein Vorrat von Holzkloben ganzer Stämme und knorriger Wurzeln war aufgeschichtet und es ging nicht lange, bis sich die Wärme wohlig verbreitete.
Die Töchter kümmerten sich derweilen um unseren Jüngsten, der sich einen Katarrh eingefangen und Ohrenweh hatte. Sie setzten ihn in den Schaukelstuhl, vergruben ihn in Polster, stülpten ihm Ohrenwärmer über und rückten ihn ans Feuer. Später bekam er noch einen Zwiebelwickel auf die Ohren und die Entzündung war weg ein für allemal.
Alle fanden, das Leben wäre gar nicht so schlecht hier oben und begaben sich in die Kochecke, um Gemüse zu schnippeln für den nahrhaften Eintopf, der dampfend auf den rustikalen Tisch kam, um den herum wir saßen und es uns schmecken ließen nach unserer Reise ins Abseits.
Der Ordnung halber rief ich am nächsten Tag beim Einwohnermeldeamt der ehemaligen Wohngemeinde an. Unser alter Wohnsitz wäre passé und den neuen anzumelden etwas schwierig, was tun? Am anderen Ende der Leitung wurde tief durchgeatmet: Ob wir nicht wüssten, dass wir uns ohne ordentliche Anmeldung außerhalb der Legalität bewegten? Wir sollten einen „richtigen“ Wohnsitz nachweisen! Für den Moment erschien uns der Wohnsitz zwar richtig genug, aber ob sie denn einen noch richtigeren wüssten? Pause bei der Gegenseite. Sie waren überfordert mit der Frage. Wohnungssuche gehörte nicht zu ihrem Ressort. Jedoch sollten wir so schnell wie möglich zur gesetzlichen Normalität zurückkehren! Das konnte versprochen werden.
Und was überhaupt mit der Schule wäre? Da war so weit alles in Ordnung und geregelt. Ich hatte mit den Lehrern gesprochen. Sie fanden unsere Aktion zwar nicht optimal, aber woher eine passende Wohnung nehmen, hatten sie natürlich auch nicht gewusst. So teilten sie den Unterrichtsstoff für die nächsten Monate mit verbunden mit der Hoffnung, er würde einigermaßen vermittelt werden. Auch das ließ sich versprechen.
Es betraf ohnehin nur die mittlere Fraktion der Familie; die älteren Töchter hatten ein Generalabonnement, die landesweit gültige BahnCard der Schweizer Bahnen, mit der sie die 200 km zur Schule fahren und dort bei Bekannten bleiben wollten, um am Wochenende wieder bei uns zu sein.
Sie fanden das machbar und blieben unter der Woche weg. Die Bahn- und Busverbindungen waren so, dass sie am Freitagabend erst in der Dunkelheit zurück sein konnten. Dann lauschten wir draußen vor der Haustüre in die Nacht hinaus auf das Knirschen von Schritten im Schnee.
Endlich waren sie da mit von der Kälte geröteten Gesichtern und umweht von einem Hauch frischer Gebirgsluft, kamen herein an Wärme und Licht und konnten sich gleich an den Tisch setzen, auf dem Töpfe und Pfannen etwas Gutes zum Essen versprachen. Wir waren wieder eine große Familie, bis auf die Eine, die Unersetzliche, die die Mitte unseres Lebens gewesen war und uns jetzt aus anderen Sphären begleitete.
„Also, was dran wäre, sind die Grundrechenarten, kriegen Sie das hin?“, hatte der Lehrer gesagt. Ich war zuversichtlich, hatte bei unseren Vorräten eine Kiste mit Orangen und stellte mir vor, damit das richtig Arbeitsmaterial zur Hand zu haben zum Thema Plus und Minus, Malnehmen und Teilen.
„He! Moment mal – wohin des Weges?“, waren die, für die das alles gedacht war, gerade soeben noch zu fassen zu kriegen in voller Schneemontur, „Wir haben Schule! Das war abgemacht.“
Die Begeisterung hielt sich allerdings in Grenzen; draußen auf dem Hang vor dem Haus wartete eine perfekt festgetretene Piste, wenn von mir schon kein Geld locker zu machen war für die Skilifte unten im Dorf. Im Geräteschuppen hatten sie passende Skier gefunden und sogar Snowboards. Snowboards! Whau! Für einen Lehrer waren das erschwerte Bedingungen.
„Also passt mal auf!“, fing ich an. „Wenn das hier 3 x 11 Orangen sind, und wir tun davon 8 Stück auf die Seite, für schlechte Zeiten sozusagen, und wenn 4 Kinder genau gleichviel bekommen sollen, wieviele kriegt jeder und was bleibt dann übrig, für den Lehrer, sagen wir mal, der nämlich Orangen auch gerne hat … “
Am Gesichtsausdruck meiner Schülerinnen war nicht recht auszumachen, ob sie sich davon über- oder unterfordert fühlten, aber sehr genau war zu sehen, dass sie dachten: Mensch! Draußen ist so schönes Wetter, wann lässt du uns endlich springen? Recht hatten sie ja eigentlich; der Zeitpunkt war nicht optimal. Die Frage war, ob er es jemals sein würde, und wenn ja, ob dann die Orangen nicht schon längst aufgegessen sein würden.
Während die Älteren sich übten auf ihrer selbstgebauten Slalomstrecke, hatten die Kleinen inzwischen Schaufeln und Spaten gefunden und fingen an, Löcher zu graben. Es waren rechte Schneemengen gewesen, die im Laufe des Winters gefallen waren, und um die Zugänge um das Haus herum offen zu halten, war der Schnee immer auf eine Seite geschaufelt worden.
Dort lag er zwei Meter hoch und die lieben Kleinen gruben sich begeistert vor ins Innere des Schneehaufens. Sie waren auch noch motiviert, als sie am Abend einschliefen und ebenso, als sie am Morgen erwachten und gleich weitermachen wollten.
Dagegen war nichts einzuwenden. Kinder, die sich begeistern können, waren doch etwas Erfreuliches! Sie gruben und gruben und mein Bereich waren derweilen die Kochtöpfe. Ab und zu trat ich vor die Haustür und beobachtete das Treiben mit einem Schmunzeln. Das Schmunzeln blieb auch noch am späten Nachmittag beim Betrachten der emsigen Aktivitäten. Aber dann plötzlich – was machten die da eigentlich? – fuhr mir etwas durch den Kopf. Die Angelegenheit wurde bedenklich.
Ich rief: „Kinder kommt schnell rein, es gibt etwas Leckeres!“ Es war eine Art Nationalgetränk, jedenfalls für die Altersstufe, das für sie aus den Tassen dampfte, süß und schmackhaft. Hinterher waren sie dann wohlig müde, die Dunkelheit brach schon früh herein und der Tag war gelaufen.
Am nächsten Morgen, als die Schaufelei weitergehen sollte, war das Schneebauwerk leider eingestürzt. So ein Pech! Dass dabei ein bisschen nachgeholfen worden war, musste man ja nicht an die große Glocke hängen. „Wirklich Pech“, ließ sich das bedauern, als wir uns die Misere zusammen anschauten. „Allerdings“, versuchte ich zu trösten, „ist das ja ganz gut, dass das nicht auf euch draufgefallen ist. Ich hätte euch richtig wieder ausbuddeln müssen.“
Ah ja, fanden sie, das stimme hingegen auch und waren nicht weiter betrübt. Sie schauten aus nach anderen Betätigungen für den neuen Tag. Mir aber sollte die Sache eine Lehre sein; aus dem harmlosen Spiel, eine immer komfortablere Wohnhöhle zu bauen, hätte auch ein Unglück werden können, wenn tragende Außenwände zu dünn geworden wären für die Schneelast darüber.
Die Kleinen suchten ihre „Füddlibob“ hervor und liefen zu ihren älteren Geschwistern auf die Piste. Mundartlich ist ein „Füddli“ unser menschliches Hinterteil und der Bob dazu ein Plastikteller mit einem Griff zum Darunterschieben. Qietschend vor Vergnügen sausten sie abwärts und manchmal schaute man lieber nicht zu genau hin, wenn sie hart an einem Baum vorbeirauschten.
Ein Unglück hätte auch hier geschehen können, aber wäre es sinnvoll gewesen, sie deshalb in Watte zu packen? Die älteren Mädchen natürlich erst recht nicht, die auf Skiern und Snowboards an ihrer Fahrtechnik feilten.
Mich selber hätte man schon eher in Watte packen sollen, denn würde mir etwas passieren, wären die Probleme nicht mehr weit. Töchter können sehr wohl mit einem Gips im Bett liegen oder herumhumpeln und sich von Schulkollegen interessante Autogramme darauf schreiben lassen. War man aber der, bei dem alle Fäden zusammenliefen, ließ man es besser nicht auf Hals- und Beinbruch ankommen, wenn es weitergehen sollte.
Obschon, manchmal hatte es auch mich gejuckt. Als Flachlandbewohner hatte ich zwar nie auf Skiern gestanden, es aber doch einmal versucht unter den kritischen Augen und wohlmeinenden Kommentaren eines Freundes. Alles war ins Rotieren gekommen, Arme, Beine, Bretter, Stöcke, mal oben, mal unten.
Zum Schluss die Abfahrt durch eine enge Waldschneise, recht und links Bäume und Gebüsch und es wurde immer schneller … Hilfe, wo war bloß die Bremse? Ich hatte vorher den Könnern zugeschaut bei ihren eleganten Schwüngen und versuchte in höchster Not das Gleiche. Die Schneewolke, aus der sie mich hervorkrabbeln sahen, war enorm, aber wenigstens war es kein Baum gewesen.
Familie war wichtiger als Spaß im Schnee. Mochten sich andere die Knochen brechen! Die Töchter waren anderer Ansicht und demzufolge hatten sie in späteren Zeiten auch Gelegenheit, sich Autogramme auf ihren Gips schreiben zu lassen. Ich hatte nicht immer dastehen wollen als Knauser und Geld herausgerückt für die großen Skilifte und Pisten. Da war es dann turbulenter zugegangen als vor der eigenen Hütte.
Es knisterte. Manchmal waren es kleine Glutstücke, die sich absprengten von den Holzkloben oder Wurzelstöcken, die im offenen Kamin brannten. Dann flogen sie ein Stück weit in den Raum, aber es gab nichts, an dem sie Schaden hätten anrichten können. Lärchenholz verhielt sich so, wenn es brannte, und es waren in der Hauptsache Lärchen, die im weiten Umkreis der Hütte standen. Einmal hinaus in den Wildwuchs an einem schönen Herbsttag mit der Motorsäge und es langte für manche Winternacht. Das Holz musste nicht einmal besonders trocken sein, der Anteil an Harz sorgte von alleine dafür, dass es gerne brannte.
Die kleineren Kinder lagen in ihren Betten, nachdem sie noch eine Gutenacht-Geschichte gehört hatten. Alles musste immer echt passiert und natürlich gut ausgegangen sein und mit einem zufriedenen Seufzer schliefen sie ein mit rosigen Backen. Die älteren, wenn sie nicht in der Schule waren, lagen gemütlich auf dem Bauch und steckten die Nase in ein Buch.
In der Schule, die sie besuchten, hatte das Eintrichtern von Verstandeswissen in den ersten Jahren nicht im Vordergrund gestanden und bis in die 4. Klasse hinein hatten sie nie richtig gelesen. Das war durchaus in Ordnung, weil sie dafür ein Menge anderer Dinge gelernt hatten. Dann aber, praktisch über Nacht, hatten sie alles nachgeholt und wurden zu wahren Leseratten.
Was sie an Büchern erwischten, wurde verschlungen und es war ratsam, die Augen offen zu halten, um das ein bisschen zu steuern. Gebrauchte Bücher konnten sie fast umsonst haben, und wenn die vom Niveau her nicht besonders aufbauend waren, ließ man sie irgendwann unauffällig verschwinden in Richtung Kamin. „He, hat jemand mein Buch gesehen?“, tönte es vielleicht dann aus einer Ecke. Aber man wusste von nichts: „Keine Ahnung. Wo du auch immer dein Zeug rum liegen lässt!“
Dabei hatte das Zeug schon längst geholfen, die Temperatur in der Hütte angenehm warm zu halten. Später dann aber würde einmal ein ganzes Regal an schönen Büchern bereitstehen, die uns schon in der eigenen Jugend begleitet und begeistert hatten. Im Moment waren sie noch in Kartonschachteln verpackt und bei lieben Menschen untergestellt.
Zu später Stunde saß ich allein und schaute in das erlöschende Feuer. Wenn man etwas blinzelte, ließ einen die Fantasie abenteuerliche Formen in der verglimmenden Glut entdecken, Abgründe des Erdinneren und lavabrütende Vulkane. Draußen, vor den Fenstern, ging der Blick in die Weite der Nacht. Matte Lichtinseln der Dörfer in den Bergen der anderen Talseite schimmerten herüber wie entfernte Galaxien in der Unendlichkeit des Universums. Es war die Zeit der Rückbesinnung auf das Vergangene.
War ich zufrieden mit dem Leben? Natürlich nicht! Hatte man zusammengelebt mit dem liebsten Menschen der Welt, war alles andere nur ein Abglanz des Früheren. Doch das sollte kein Undank gegenüber dem Schicksal sein, denn alle waren gesund und munter. Anfangs unlösbare Probleme hatten sich auf geheimnisvolle Weise geglättet und auch für die Zukunft konnten wir darauf vertrauen, dass uns weitergeholfen würde.
Gab es noch offene Wünsche und Erwartungen, Ziele, die ich anstreben wollte? Eigentlich nicht. Immer wieder war es so gewesen, dass man sich endlos hatte abmühen können und doch war nichts in Bewegung geraten. Dafür taten sich Türen auf an anderer Stelle, die vorher nicht da gewesen waren. Das Schicksal selber wies den Weg und die Aufgabe war, die Richtung zu erkennen.
Materielle Glücksgüter? Warum? Einmal zu viel Gas gegeben und das Traumauto war ein Schrotthaufen, das Traumhaus konnte abbrennen (Vorsicht beim Kamin übrigens, waren die Holzvorräte weit genug weg gelagert?), und das dicke Bankkonto war nur dick bis zum nächsten Crash. Meine Vorfahren hatten auch geglaubt, das gebe es gar nicht, bis sie dann vor den Trümmerhaufen der Geschichte gestanden hatten.
Und Versicherungen? Was hatten sie gebracht in all den Jahren, in denen wir versucht hatten, naturverbunden zu leben, und doch war das Leben vorbei gewesen mit 41 Jahren. Eine