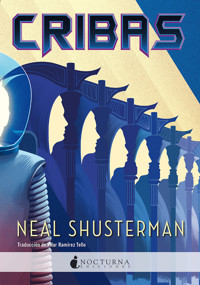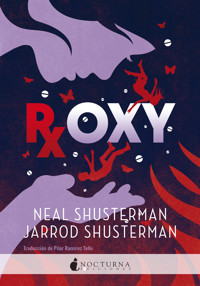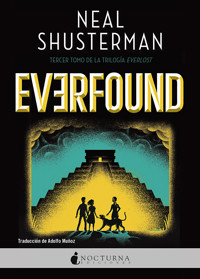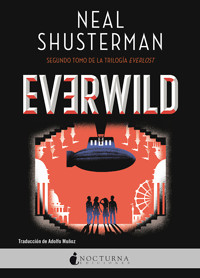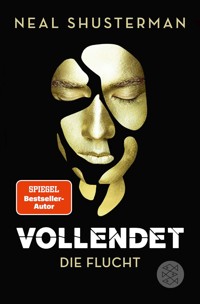
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Vollendet
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Sie sagen, dass du weiterlebst. Sie lügen. Connor, 16 Jahre alt und ständiger Unruhestifter, hat es längst geahnt, doch nun steht es fest: Er soll umgewandelt werden. Seine Eltern haben seinen Körper vollständig zur Organspende freigegeben. Und zwar nicht erst nach seinem Tod. Sondern sofort. Risa ist in einem Waisenhaus aufgewachsen und darf nicht länger auf Kosten des Staates leben. Auch sie soll umgewandelt werden. Als ihre Wege sich unerwartet treffen, müssen Connor und Risa sich blitzschnell entscheiden - Flucht oder Umwandlung? Können sie dem System entkommen, das Jagd auf Menschen wie sie macht? Band 1 der brisant-brillanten »Vollendet«-Serie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Ähnliche
Neal Shusterman
Vollendet
Die Flucht
FISCHER E-Books
Inhalt
Der Erinnerung an Barbara Seranella gewidmet.
»Wenn sich mehr Menschen zur Organspende bereit erklärt hätten, dann hätte es die Umwandlung nie gegeben.«
Der Admiral
Charta des Lebens
Der Zweite Bürgerkrieg, auch bekannt als »Heartland-Krieg«, war ein langer, blutiger Konflikt um eine einzige Streitfrage.
Um den Krieg zu beenden, wurden mehrere Zusätze zur Verfassung verabschiedet: die »Charta des Lebens«.
Beide Streitmächte, die Abtreibungsgegner und die Abtreibungsbefürworter, erklärten sich mit der Charta einverstanden.
Nach der Charta des Lebens ist das menschliche Leben von der Empfängnis bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Kind dreizehn Jahre alt wird, unantastbar.
Im Alter zwischen dreizehn und achtzehn Jahren können Eltern ein Kind rückwirkend »abtreiben« …
… unter der Bedingung, dass das Leben des Kindes »streng genommen« nicht endet.
Der Vorgang, mit dem das Leben eines Kindes abgeschlossen wird, das Kind aber dennoch am Leben bleibt, wird Umwandlung genannt.
Die Umwandlung ist inzwischen eine gängige Praxis in der Gesellschaft.
Teil einsIn dreifacher Ausfertigung
»Aus mir wäre ohnehin nicht viel geworden, jetzt habe ich statistisch gesehen eine Chance, dass wenigstens ein Teil von mir irgendwo in der Welt große Bedeutung erlangt. Ich wäre lieber teilweise bedeutend als vollkommen nutzlos.«
Samson Ward
1.Connor
»Du kannst dich verstecken«, sagt Ariana. »Wer so clever ist wie du, hat gute Chancen, bis achtzehn zu überleben.«
Connor ist sich da nicht so sicher, aber wenn er in Arianas Augen blickt, verfliegen seine Zweifel, wenigstens für einen Moment. Ihre Augen sind von einem tollen Violett, mit grauen Einsprengseln. Sie macht jede Mode mit, lässt sich immer die neuesten Pigmente spritzen, sobald sie in sind. Connor hat sich für so etwas nie interessiert. Seine Augenfarbe ist noch immer so, wie sie von Anfang an war – braun. Nicht einmal tätowieren ließ er sich, als er klein war, wie die vielen anderen Kinder. Die einzige Farbe auf seiner Haut kommt von der Sommersonne, aber jetzt im November ist die Bräune längst verblasst. Er will nicht daran denken, dass er nie wieder einen Sommer erleben wird. Wenigstens nicht als Connor Lassiter. Nicht zu fassen, dass ihm mit sechzehn Jahren sein Leben genommen werden soll.
In Arianas violetten Augen glitzern Tränen, die ihr über die Wangen kullern, wenn sie blinzelt. »Es tut mir so leid, Connor.« Sie nimmt ihn in den Arm, und einen Moment lang scheint alles in Ordnung, als wären sie beide die einzigen Menschen auf der Welt. In diesem Augenblick kommt sich Connor unbesiegbar und unangreifbar vor … aber sie lässt ihn los, der Augenblick ist vorbei, und die Welt um ihn herum kehrt zurück. Die Autobahn unter ihm vibriert, wenn Autos vorbeifahren, deren Insassen nicht wissen oder die es nicht kümmert, dass er hier sitzt. Und er ist einfach wieder ein Junge eine Woche vor der Umwandlung.
Die leisen, hoffnungsvollen Worte, die Ariana ihm zuflüstert, helfen nicht mehr. Er kann sie kaum verstehen wegen des lärmenden Verkehrs. Über diesen Ort, an dem sie sich vor der Welt verkriechen, schütteln Erwachsene den Kopf, dankbar, dass ihre eigenen Kinder nicht so dumm sind, auf dem Sims einer Autobahnüberführung herumzulungern. Für Connor geht es nicht um Dummheit, nicht einmal um Aufbegehren, sondern darum, das Leben zu spüren. Hier auf diesem Sims, verborgen hinter einem Schild mit der Aufschrift »Ausfahrt«, fühlt er sich wohl. Klar, ein falscher Schritt und er klebt auf dem Asphalt. Doch das Leben am Abgrund ist für Connor nichts Neues.
Kein anderes Mädchen hat er jemals mit hierhergebracht, aber das hat er Ariana nicht erzählt. Er schließt die Augen und spürt die Vibrationen des Verkehrs, als würden sie zu ihm gehören und durch seine Venen pulsieren. Hier konnte er immer Abstand gewinnen, wenn er mit seinen Eltern gestritten hatte oder einfach gefrustet war. Jetzt geht es nicht mehr um Frust, und auch nicht um Streit mit seiner Mom oder seinem Dad. Es gibt nichts mehr, worüber sie streiten könnten. Seine Eltern haben die Verfügung unterzeichnet; die Sache ist beschlossen.
»Lass uns abhauen«, sagt Ariana. »Ich hab so genug von allem. Von meiner Familie, von der Schule, einfach von allem. EA – und nicht mehr zurückschauen.«
Connor denkt darüber nach. Die Vorstellung, das ganz allein durchzuziehen, erschreckt ihn. In der Schule gibt er sich ziemlich cool, als hätte er vor nichts und niemandem Angst, aber alleine abhauen? Hätte er den Mut dazu? Doch wenn Ariana mitkäme, wäre das etwas anderes. Dann wäre er nicht allein. »Meinst du das ernst?«
Ariana schaut ihn mit ihren magischen Augen an: »Na klar. Natürlich meine ich das ernst. Ich würde mitkommen – wenn du mich darum bittest.«
Das bedeutet viel. Zusammen mit einem Wandler abzuhauen ist echte Hingabe. Dass sie das tun würde, rührt ihn. Weil er keinen Ton herausbringt, küsst er sie. Und trotz allem, was in seinem Leben gerade passiert, kommt er sich auf einmal vor wie der glücklichste Junge der Welt. Er umarmt sie, vielleicht ein bisschen zu fest, denn sie sträubt sich. Da will er sie noch fester halten, aber er unterdrückt den Drang und lässt sie los. Sie lächelt ihn an.
»EA … Was heißt das überhaupt?«, fragt sie.
»Das ist ein alter Ausdruck aus dem Militär oder so«, sagt Connor. »EA steht für ›eigenmächtig abwesend‹.«
Ariana denkt darüber nach und grinst. »Hmmm, vielleicht eher für ›einfach abhauen‹.«
Connor nimmt ihre Hand und bemüht sich sehr, sie nicht zu fest zu drücken. Sie hat gesagt, sie würde mit ihm gehen, wenn er sie fragt. Erst jetzt merkt er, dass er das eigentlich noch gar nicht getan hat.
»Willst du mit mir kommen, Ariana?«
Ariana nickt lächelnd: »Ja, klar will ich.«
Arianas Eltern mögen Connor nicht. Er kann sie förmlich hören: »Wir haben schon immer gewusst, dass er irgendwann umgewandelt wird. Du hättest dich nie mit diesem Lassiter-Jungen einlassen sollen.« Für sie war er nie »Connor«, sondern nur »dieser Lassiter-Junge«. Sie glauben, sie dürften über ihn urteilen, weil er immer mal wieder in Erziehungsanstalten war.
Trotzdem bringt er Ariana an diesem Nachmittag fast bis zur Haustür und versteckt sich hinter einem Baum, während sie hineingeht. Bevor er sich auf den Weg nach Hause macht, kommt ihm der Gedanke, dass es für sie beide bald alltäglich sein wird, sich zu verstecken.
Zuhause.
Wie kann er diesen Ort Zuhause nennen, wenn er daraus entfernt werden soll – nicht nur aus seinem Zimmer, sondern auch aus den Herzen derer, die ihn eigentlich lieben sollten?
Sein Vater sitzt im Sessel und schaut Nachrichten, als Connor hereinkommt.
»Hi, Dad.«
Sein Vater zeigt auf ein Blutbad auf dem Bildschirm. »Klatscher. Schon wieder.«
»Was haben sie diesmal in die Luft gejagt?«
»Einen Old-Navy-Laden im Akroner Einkaufszentrum.«
»Hmmm«, murmelt Connor. »Man sollte eigentlich meinen, sie hätten einen besseren Geschmack.«
»Ich finde das nicht besonders lustig.«
Connors Eltern ahnen nicht, dass ihr Sohn von seiner bevorstehenden Umwandlung weiß. Eigentlich wollten sie es vor ihm geheim halten, aber er war schon immer gut darin, Geheimnisse aufzuspüren. Als er vor drei Wochen auf dem Schreibtisch seines Vaters einen Tacker gesucht hatte, waren ihm Flugtickets für die Bahamas in die Hände gefallen. Über Thanksgiving wollten sie alle gemeinsam Urlaub machen. Aber Connor fand nur drei Tickets – für seinen Vater, für seine Mutter und für seinen jüngeren Bruder. Kein Ticket für ihn. Zuerst vermutete er es irgendwo anders, aber je länger er darüber nachdachte, desto verdächtiger kam ihm die ganze Sache vor. Deshalb schaute er ein bisschen genauer nach, als seine Eltern mal nicht zu Hause waren. Und da fand er die Umwandlungsverfügung. Sie war ganz altmodisch in dreifacher Ausfertigung unterzeichnet worden. Die weiße war schon weg, bei den Behörden. Die gelbe würde Connor bis zu seinem Ende begleiten, und die pinkfarbene würde bei seinen Eltern bleiben, als Beweis dafür, was sie getan hatten. Vielleicht würden sie sie einrahmen und neben das Foto von seinem ersten Schultag hängen.
Die Verfügung war auf den Tag vor dem Abflug auf die Bahamas datiert. Er würde abgeholt und umgewandelt werden, während seine Familie in die Ferien fuhr, um sich abzulenken. Vor lauter Ungerechtigkeit hätte Connor am liebsten etwas zerschlagen. Am allerliebsten hätte er sehr viel zerschlagen, aber er beherrschte sich. Ausnahmsweise zügelte er seinen Zorn, und abgesehen von ein paar Schlägereien in der Schule, in die er mehr oder weniger unverschuldet geriet, behielt er seine Gefühle für sich. Und auch sein Wissen. Eine Umwandlungsverfügung ist unumkehrbar, schreien und toben würde rein gar nichts ändern. Außerdem verlieh es Connor sogar eine gewisse Macht, dass er das Geheimnis seiner Eltern kannte. Zum Beispiel als er seiner Mutter Blumen mitbrachte, und sie danach stundenlang weinte. Oder die Zwei plus im Chemietest – die beste Note, die er je in Chemie geschrieben hatte. Er reichte den Test seinem Vater, der ganz bleich wurde, als er ihn sah. »Schau mal, Dad, meine Noten werden besser. Bis zum Ende des Schuljahrs schaffe ich vielleicht sogar noch eine Eins in Chemie.«
Eine Stunde später saß sein Vater im Sessel, den Test immer noch umklammert, und starrte mit leerem Blick an die Wand.
Connors Beweggründe waren einfach: Sie sollten leiden. Sie sollten ihr Leben lang daran denken, was für einen schrecklichen Fehler sie begangen hatten.
Aber auch jetzt, nachdem er ihnen das drei Wochen lang vor Augen geführt hat, geht es ihm nicht besser. Seine Rache verschafft ihm keine Genugtuung. Im Gegenteil, seine Eltern tun ihm leid, und er hasst sich für solche Gefühle.
»Habt ihr schon gegessen?«
Sein Vater wendet den Blick nicht vom Fernseher. »Deine Mutter hat dir was hingestellt.«
Connor geht in Richtung Küche, aber auf halbem Weg hört er: »Connor?«
Er dreht sich um. Sein Vater schaut ihn an. Er schaut ihn nicht nur an, sondern starrt geradezu.
Jetzt sagt er’s mir, denkt Connor. Jetzt sagt er mir, dass sie mich umwandeln lassen, und dann bricht er in Tränen aus und beteuert, wie schrecklich leid es ihm tut. Und dann würde Connor die Entschuldigung vielleicht sogar annehmen. Vielleicht würde er ihm sogar vergeben und ihm sagen, dass er nicht zu Hause sein würde, wenn die JuPos ihn abholten.
Aber dann sagt sein Vater nur: »Hast du abgeschlossen?«
»Mach ich gleich.«
Connor schließt die Haustür ab und geht in sein Zimmer. Der Hunger, auf was immer seine Mutter für ihn aufgehoben hat, ist ihm vergangen.
Um zwei Uhr morgens zieht sich Connor schwarze Sachen an und packt die Dinge in seinen Rucksack, die ihm etwas bedeuten. Danach hat er immer noch Platz für genug Kleidung zum Wechseln. Er ist überrascht, wie wenige Gegenstände er wirklich mitnehmen möchte. Hauptsächlich sind es Erinnerungen an eine Zeit, bevor alles so falsch gelaufen ist zwischen ihm und seinen Eltern. Zwischen ihm und dem Rest der Welt.
Connor späht vorsichtig zu seinem Bruder hinein, überlegt kurz, ob er ihn wecken soll, um sich zu verabschieden, verwirft den Gedanken aber gleich wieder. Leise schlüpft er in die Nacht hinaus. Sein Fahrrad kann er nicht nehmen. Er hat eine Peilsender-Diebstahlsicherung eingebaut. Damals konnte er ja nicht damit rechnen, dass er es vielleicht selber einmal stehlen würde. Ariana hat Fahrräder für sie beide.
Normalerweise braucht Connor zu Fuß zwanzig Minuten bis zu Arianas Haus. Aber in Ohio verlaufen die Straßen in den Vororten nie ganz gerade, deshalb nimmt er den direkten Weg durch den Wald und ist in zehn Minuten da.
Das Haus ist dunkel. Das hat er erwartet. Ihre Eltern wären misstrauisch geworden, wenn Ariana die ganze Nacht aufgeblieben wäre. Besser, sie tut so, als ob sie schläft. Connor hält Abstand zum Haus. Die Lampen im Garten und auf der vorderen Veranda haben Bewegungsmelder und schalten sich ein, wenn sich in ihrem Umfeld etwas rührt. Das soll wilde Tiere und zwielichtige Gestalten abschrecken. In den Augen von Arianas Eltern trifft beides auf Connor zu.
Er holt sein Handy heraus und wählt Arianas Nummer. Von seinem Standort im dunklen hinteren Teil des Gartens hört er es in ihrem Zimmer klingeln. Connor legt rasch auf und zieht sich noch weiter ins Dunkle zurück, falls ihre Eltern aus dem Fenster schauen. Was sollte das denn? Wieso hat sie ihr Handy nicht auf Vibration gestellt?
Connor schlägt einen großen Bogen um den Garten, immer auf Distanz zu den Bewegungsmeldern. Ein Licht leuchtet zwar auf, als er die vordere Veranda betritt, aber nur Arianas Zimmer hat ein Fenster in diese Richtung. Ein paar Augenblicke später kommt sie zur Tür, öffnet sie aber nicht weit genug, dass sie heraus oder er hinein gehen könnte.
»Hi, bist du fertig?«, fragt Connor. Offensichtlich nicht: Sie trägt einen Morgenmantel über ihrem Satinpyjama.
»Hast du es etwa vergessen?«
»Nein, nein, ich hab’s nicht vergessen …«
»Dann beeil dich! Je schneller wir hier wegkommen, desto mehr Vorsprung haben wir.«
»Connor«, sagt sie, »die Sache ist …«
Und die Wahrheit liegt in ihrer Stimme, darin, wie schwer es ihr fällt, nur seinen Namen auszusprechen, an dem entschuldigenden Zittern, das wie ein Echo in der Luft schwebt. Sie muss nichts weiter sagen, er weiß Bescheid, aber er lässt sie dennoch reden. Denn es fällt ihr schwer, und er möchte, dass es ihr schwerfällt. Es soll ihr schwerer fallen als alles, was sie je im Leben getan hat.
»Connor, ich würde wirklich gern abhauen, echt? … Aber gerade jetzt ist es total schlecht. Meine Schwester heiratet, und du weißt ja, ich bin Trauzeugin. Und dann die Schule.«
»Du hasst die Schule. Du hast gesagt, du schmeißt sie, sobald du sechzehn bist.«
»Ich hab gesagt, ich lege eine Befreiungsprüfung ab«, sagt sie. »Das ist was völlig anderes.«
»Dann kommst du nicht mit?«
»Ich würde gerne, echt … Aber ich kann nicht.«
»Also war alles, worüber wir gesprochen haben, gelogen?«
»Nein«, sagt Ariana. »Es war ein Traum. Die Wirklichkeit ist dazwischengekommen. Das ist alles. Und abhauen löst keine Probleme.«
»Abhauen ist der einzige Weg, mein Leben zu retten«, zischt Connor. »Ich soll umgewandelt werden, falls du das vergessen hast.«
Sie berührt sanft sein Gesicht. »Ich weiß. Aber ich nicht.«
Da geht oben an der Treppe ein Licht an, und Ariana schiebt die Tür reflexartig noch ein Stück weiter zu.
»Ari?«, hört Connor ihre Mutter. »Was ist los? Was machst du an der Tür?«
Connor tritt ein paar Schritte zurück, um außer Sicht zu sein, und Ariana dreht sich zur Treppe um. »Nichts, Mom. Ich dachte, ich hätte einen Kojoten gesehen, und wollte sichergehen, dass die Katzen nicht draußen sind.«
»Die Katzen sind oben, Liebes. Mach die Tür zu, und geh wieder ins Bett.«
»Ein Kojote bin ich also«, murmelt Connor.
»Pssssst.« Ariana schließt die Tür bis auf einen schmalen Spalt. Er sieht nur noch die Konturen ihres Gesichts und ein violettes Auge. »Du schaffst es, ich weiß, dass du es schaffst. Ruf mich an, wenn du in Sicherheit bist.« Dann drückt sie die Tür ins Schloss.
Connor bleibt noch eine ganze Weile stehen, bis das Licht ausgeht. Allein zu sein war nicht Teil des Plans gewesen, aber schließlich dämmert ihm, dass es so richtig ist. Seit seine Eltern dieses Papier unterzeichnet haben, ist er allein.
Mit Bus oder Bahn kann er nicht fahren. Genügend Geld hätte er, aber vor dem frühen Morgen fährt nichts, und da werden sie schon an allen Stationen und Haltestellen nach ihm suchen. Ständig hauen irgendwelche Wandler ab, und es gibt ganze Teams von JuPos, die hinter ihnen her sind. Im Aufspüren von Flüchtlingen sind sie mittlerweile ziemlich perfekt.
In einer Großstadt könnte er untertauchen, dort gibt es so viele Menschen, dass man nie dasselbe Gesicht zweimal sieht. Oder auf dem Land, wo es nur wenige Menschen gibt, die dazu noch weit voneinander entfernt leben; er könnte sein Lager in einer alten Scheune aufschlagen, und niemand würde auf die Idee kommen, dort nach ihm zu suchen. Andererseits hat die Polizei diese Möglichkeit garantiert auch auf dem Schirm. Wahrscheinlich hat sie jede alte Scheune in eine Mausefalle verwandelt, die zuschnappt und Jugendliche wie ihn fängt. Vielleicht leidet er auch an Verfolgungswahn. Nein, seine Situation rechtfertigt jede Vorsicht – nicht nur heute Nacht, sondern die nächsten zwei Jahre. Mit achtzehn ist Connor in Sicherheit. Danach können sie ihn natürlich ins Gefängnis stecken und ihm den Prozess machen, aber sie dürfen ihn nicht mehr umwandeln. Jetzt muss er nur noch so lange überleben …
Unten an der Autobahn ist ein Rastplatz, auf dem Lastwagenfahrer übernachten können. Da geht Connor hin. Vielleicht kann er hinten auf die Ladefläche eines Sattelschleppers schlüpfen. Aber er stellt rasch fest, dass die Fahrer ihre Ladung unter Verschluss halten. Er verwünscht sich, weil er das nicht bedacht hat. Vorausplanen war noch nie seine Stärke. Sonst wäre er nicht in die Situationen geraten, die ihm in den letzten Jahren Probleme gemacht und ihn als »schwierig« oder »gefährdet« und schließlich als »Wandler« abgestempelt haben.
Ungefähr zwanzig Lastwagen parken auf dem Rastplatz, außerdem gibt es einen hell erleuchteten Imbiss, in dem vielleicht ein Dutzend Fahrer sitzt. Es ist halb vier am Morgen. Offenbar haben Lastwagenfahrer ihre eigene biologische Uhr. Connor beobachtet die Umgebung und wartet. Gegen Viertel vor vier biegt ein Streifenwagen der Polizei in den Rastplatz ein, ohne Blaulicht und Sirenen. Langsam umkreist er den Platz wie ein Hai. Connor will sich gerade verstecken, als ein zweiter Streifenwagen folgt. Alles ist hell erleuchtet, Connor findet keine dunkle Ecke. Wegrennen kann er auch nicht, im hellen Licht des Mondes wird er sofort gesehen. Der erste Streifenwagen dreht am anderen Ende des Rastplatzes um. Gleich werden seine Scheinwerfer Connor erfassen. In letzter Sekunde wirft er sich unter einen Lastwagen und betet, dass die Polizisten ihn nicht gesehen haben.
Langsam rollen die Räder des Streifenwagens an ihm vorbei. Auf der anderen Seite passiert der zweite Streifenwagen den Sattelschlepper in entgegengesetzter Richtung.
Vielleicht ist es nur eine Routinekontrolle. Vielleicht suchen sie ja gar nicht nach mir.
Je länger Connor darüber nachdenkt, desto überzeugter ist er. Sie können noch gar nicht wissen, dass er abgehauen ist. Sein Vater schläft wie ein Stein, und seine Mutter schaut nachts nicht mehr nach ihm.
Trotzdem patrouillieren die Streifenwagen nach wie vor über den Parkplatz.
Von seinem Versteck aus sieht Connor, dass die Fahrertür eines anderen Sattelschleppers offen steht. Nein, es ist gar nicht die Fahrertür, sondern die Tür zu der kleinen Schlafkabine hinter dem Führerhaus. Ein Fahrer klettert heraus, streckt sich und steuert die Toiletten an. Die Tür lässt er offen.
Im Bruchteil einer Sekunde trifft Connor eine Entscheidung, springt aus seinem Versteck und rennt über den Parkplatz zu dem Sattelschlepper, dass der lose Kies unter seinen Füßen aufspritzt. Er hat keine Ahnung, wo die Streifenwagen gerade sind, aber das ist egal. Er hat sich für diesen Weg entschieden, also muss er ihn bis zum Ende gehen. Kurz bevor er die Tür erreicht, sieht er Scheinwerfer, die einen Bogen beschreiben und ihn gleich erfassen werden. Er packt den Haltegriff, hievt sich hinein und zieht die Tür hinter sich zu.
Auf der schmalen Liege ringt er nach Atem. Was soll er als Nächstes tun? Der Fahrer wird zurückkommen. Connor hat ungefähr fünf Minuten, wenn er Glück hat, eine, wenn nicht. Er späht unter das Bett. Platz genug, um sich zu verstecken, aber dort liegen zwei Reisetaschen. Er könnte sie vorziehen, sich hineinzwängen und dann die Taschen wieder an ihren Platz zerren. Der Lastwagenfahrer würde ihn niemals bemerken. Doch bevor er die erste Tasche unter der Liege hervorziehen kann, geht die Tür auf. Connor erstarrt, unfähig zu reagieren, als der Fahrer ihn am Revers seiner Jacke packt.
»Hoppla! Wen haben wir denn da? Was zum Teufel hast du in meinem Laster zu suchen?«
Hinter ihm fährt langsam ein Streifenwagen der Polizei vorbei.
»Bitte«, sagt Connor, und seine Stimme ist auf einmal ganz piepsig, wie vor dem Stimmbruch. »Bitte verraten Sie mich nicht. Ich muss hier weg.« Er greift nach seinem Rucksack, fasst tastend hinein und zieht ein Bündel Scheine aus seinem Portemonnaie. »Möchten Sie Geld? Ich habe Geld. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe.«
»Ich will dein Geld nicht«, sagt der Lastwagenfahrer.
»Okay, was dann?«
Selbst in dem schummrigen Licht muss der Lastwagenfahrer die panische Angst in Connors Augen sehen, aber er sagt nichts.
»Bitte«, wiederholt Connor. »Ich tu alles, was Sie wollen …«
Der Lastwagenfahrer schaut ihn noch einen Moment lang schweigend an. »Tatsächlich?«, sagt er endlich. Dann kommt er herein und zieht die Tür hinter sich zu.
Connor schließt die Augen und wagt nicht, darüber nachzudenken, was er sich gerade eingebrockt hat.
Der Lastwagenfahrer setzt sich neben ihn. »Wie heißt du?«
»Connor.« Zu spät fällt ihm ein, dass er einen falschen Namen hätte sagen sollen.
Der Lastwagenfahrer kratzt sich die Bartstoppeln und denkt einen Augenblick nach. »Ich will dir was zeigen, Connor.« Er greift über ihn hinweg und zieht zu Connors Erstaunen ein Kartenspiel aus einem kleinen Beutel, der neben dem Bett hängt. »Hast du so was schon mal gesehen?« Der Lastwagenfahrer nimmt die Karten und mischt sie geschickt mit einer Hand. »Ziemlich gut, was?«
Connor weiß nicht, was er sagen soll, und nickt einfach.
»Wie wär’s damit?« Der Lastwagenfahrer nimmt eine einzelne Karte und lässt sie verschwinden. Dann greift er in die Brusttasche von Connors Hemd und zieht die Karte hervor. »Gefällt dir das?«
Connor stößt ein nervöses Lachen aus.
»Weißt du, die Sache ist … ich beherrsche die Tricks eigentlich nicht.«
»Wie … wie meinen Sie das?«
Der Lastwagenfahrer krempelt den Ärmel hoch: Der Arm, mit dem er die Kartentricks vorgeführt hat, wurde am Ellbogen transplantiert.
»Vor zehn Jahren bin ich am Steuer eingeschlafen«, erzählt er. »Schwerer Unfall. Hab einen Arm, eine Niere und noch so manch anderes verloren. Aber ich hab alles neu bekommen und überlebt.« Er betrachtet seine Hände, und Connor erkennt, dass die Kartenspielerhand ein bisschen anders aussieht. Die Finger sind dünner, die Haut ein wenig heller.
»Ach so«, sagt Connor. »Sie haben eine neue Hand gewonnen.«
Der Lastwagenfahrer lacht, dann schweigt er einen Augenblick und betrachtet seine Ersatzhand. »Diese Finger hier können Dinge, die der Rest von mir nicht kann. Muskelgedächtnis nennt man das. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, was für unglaubliche Dinge der Typ konnte, dem dieser Arm gehörte, bevor er umgewandelt wurde … Wer immer er war.«
Der Lastwagenfahrer steht auf. »Zum Glück bist du an mich geraten«, sagt er. »Da draußen gibt es Trucker, die würden alles nehmen, was du ihnen anbietest, und dich trotzdem ausliefern.«
»Und Sie sind nicht so?«
»Nein, bin ich nicht.« Er streckt die Hand aus – die andere Hand –, und Connor ergreift sie. »Josias Aldridge«, stellt er sich vor. »Ich fahre Richtung Norden. Du kannst bis zum Morgen mitfahren.«
Vor lauter Erleichterung ist Connor wie gelähmt. Nicht einmal ein »Danke« bringt er heraus.
»Das Bett ist zwar nicht das bequemste der Welt«, fährt Aldridge fort, »aber es erfüllt seinen Zweck. Ruh dich ein bisschen aus. Ich muss kurz noch einen abseilen, und dann geht’s los.« Er schließt die Tür, und seine Schritte entfernen sich in Richtung Toiletten. Endlich lässt Connors Anspannung nach, und er spürt seine Erschöpfung. Der Lastwagenfahrer hat ihm kein Ziel genannt, nur eine Richtung, aber das ist okay. Norden, Süden, Osten, Westen – völlig egal, nur weg von hier. Und dann? Nun, erst muss Connor diesen Schritt zu Ende bringen, bevor er darüber nachdenkt, was danach kommt.
Eine Minute später ist Connor schon dabei, einzudösen, als er jemanden laut rufen hört: »Wir wissen, dass du da drin bist! Komm sofort raus, dann passiert dir nichts!«
Connor gerät in Panik. Josias Aldridge hat offenbar noch einen Taschenspielertrick auf Lager – er hat Connor für die Polizei sichtbar gemacht – Abrakadabra! Seine Reise ist vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Connor schiebt die Tür auf und sieht drei JuPos mit erhobenen Waffen.
Aber sie zielen nicht auf ihn.
Sie stehen sogar mit dem Rücken zu ihm.
Gegenüber geht die Tür des Sattelschleppers auf, unter dem Connor sich nur wenige Minuten zuvor versteckt hatte, und hinter dem leeren Fahrersitz kommt mit erhobenen Händen ein Junge hervor. Connor erkennt ihn sofort. Andy Jameson geht auf dieselbe Schule wie er.
Oh Gott, soll Andy etwa auch umgewandelt werden?
In Andys Gesicht steht die Angst geschrieben, aber darunter verbirgt sich etwas noch viel Schlimmeres: absolute Verzweiflung. In diesem Augenblick bemerkt Connor, wie dämlich er sich verhält. Vor lauter Überraschung darüber, was hier gerade passiert, steht er wie festgenagelt in der Tür der Schlafkabine, vollkommen ungeschützt und für alle sichtbar. Die Polizisten sehen ihn natürlich nicht. Andy schon. Er erkennt Connor, hält seinen Blick nur einen Moment lang fest … und in diesem Moment geschieht etwas Bemerkenswertes.
Die Verzweiflung auf Andys Gesicht weicht einer eisernen Entschlossenheit, die fast an Triumph grenzt. Er schaut rasch in eine andere Richtung und läuft ein paar Schritte – weg von Connor, damit die Polizisten ihm weiterhin den Rücken zukehren.
Andy hat ihn gesehen, aber er hat ihn nicht verraten! Wenn Andy nach diesem Tag nichts mehr zu erwarten hat, dann bleibt ihm doch wenigstens dieser kleine Sieg.
Connor lehnt sich zurück in die Dunkelheit des Lastwagens und zieht langsam die Tür zu. Während die Polizisten Andy abführen, legt sich Connor wieder hin, und seine Tränen kommen so plötzlich wie ein sommerlicher Schauer. Er weiß nicht genau, um wen er weint – um Andy, um sich selbst, um Ariana –, und das lässt die Tränen nur noch heftiger fließen. Statt sie wegzuwischen, lässt er sie einfach laufen wie früher als kleiner Junge, als die Dinge, über die er weinte, unbedeutend und am nächsten Morgen wieder vergessen waren.
Der Lastwagenfahrer schaut nicht zu ihm herein. Connor hört nur, wie der Motor anspringt, und spürt, wie der Lastwagen anrollt. Das sanfte Schaukeln wiegt ihn in den Schlaf.
Das Klingeln seines Handys reißt Connor aus seinen Träumen. Er wehrt sich dagegen aufzuwachen. Er möchte weiterträumen, von einem Ort, an dem er sicher schon einmal gewesen ist, auch wenn er sich nicht genau erinnert, wann. Er weiß nur noch, dass es vor der Geburt seines Bruders gewesen sein muss.
Er war zusammen mit seinen Eltern in einer Hütte am Strand. Auf der Veranda brach er mit dem Fuß durch ein morsches Brett und landete in dicken Spinnweben, die sich wie Baumwolle anfühlten. Vor Schmerz, aber auch aus Angst vor den gigantischen Spinnen, die ganz bestimmt seinen Fuß abfressen würden, schrie er wie am Spieß. Und doch war das ein guter Traum, eine gute Erinnerung, denn sein Vater war da, um ihn zu befreien. Er trug ihn hinein, verband sein Bein und setzte ihn neben den Kamin. Dann gab er ihm Apfelsaft, der so lecker war, dass er den Geschmack beim bloßen Gedanken daran heute noch auf der Zunge hat. Sein Vater erzählte ihm eine Geschichte, an die er sich nicht mehr erinnert, aber das ist in Ordnung. Nicht die Geschichte war wichtig, sondern der Klang seiner Stimme, ein weicher, grummelnder Bariton, der so beruhigend wirkte wie Wellen, die an eine Küste rollen. Der kleine Connor trank seinen Apfelsaft und tat dann, an seine Mutter gelehnt, so, als wäre er eingeschlafen. In Wahrheit ging er in diesem Augenblick auf, versuchte ihn für immer festzuhalten. Im Traum war ihm das gelungen. Sein ganzes Sein floss in das Saftglas, und seine Eltern stellten es vorsichtig auf den Tisch, dicht an den Kamin, wo es für immer und ewig warm bleiben würde.
Blöde Träume. Sogar die guten sind schlecht, denn sie machen einem bewusst, wie mies die Wirklichkeit dagegen abschneidet.
Wieder klingelt sein Handy und verjagt die letzten Fetzen des Traums. Fast nimmt Connor ab. In der Schlafkabine des Lastwagens ist es sehr dunkel, und er merkt erst gar nicht, dass er nicht in seinem Bett liegt. Weil er sein Handy nicht findet, will er das Licht anschalten, und das rettet ihn. Als er eine Wand berührt, dort, wo eigentlich sein Nachttisch sein sollte, stutzt er. Schon wieder klingelt das Handy. Da fällt ihm alles wieder ein, und er erinnert sich, wo er ist. In seinem Rucksack findet er sein Telefon. Das Display zeigt die Nummer seines Vaters.
Also wissen seine Eltern jetzt, dass er abgehauen ist. Glauben sie wirklich, er würde abnehmen? Er wartet, bis die Mailbox anspringt, und schaltet das Handy aus. Es ist halb acht. Connor reibt sich den Schlaf aus den Augen und versucht abzuschätzen, wie weit sie gekommen sind. Der Lastwagen bewegt sich nicht mehr, aber sie sind bestimmt mindestens zweihundert Kilometer gefahren, solange er geschlafen hat. Das ist ein guter Anfang.
Es klopft an der Tür. »Komm raus, Junge. Deine Fahrt ist vorbei.«
Connor kann sich nicht beschweren. Der Lastwagenfahrer ist ausgesprochen großzügig gewesen, und er wird ihn um nichts mehr bitten. Er stößt die Tür auf und will dem Mann danken. Aber nicht Josias Aldridge steht vor ihm. Der steht mit Handschellen gefesselt ein paar Meter entfernt. Vor Connor baut sich ein Polizist auf, ein JuPo mit einem Grinsen so breit wie ein Scheunentor. Zehn Meter weiter sieht Connor seinen Vater, der immer noch das Handy in der Hand hält, mit dem er gerade angerufen hat.
»Es ist vorbei, mein Sohn.«
Wut brodelt in Connor hoch. Ich bin nicht dein Sohn!, möchte er schreien. Ich bin nicht mehr dein Sohn, seit du die Verfügung unterschrieben hast! Aber der Schreck des Augenblicks macht ihn sprachlos.
Wie hat er nur so dumm sein können, das Handy anzulassen? Auf diese Weise hatten sie ihn natürlich leicht aufspüren können. Wie viele andere Jugendliche werden wohl gefasst, weil sie diesen blöden Fehler machen? Aber Connor wird nicht denselben Weg gehen wie Andy Jameson. Mit einem schnellen Blick macht er sich ein Bild von seiner Situation. Der Lastwagen ist von zwei Autobahnstreifenwagen und einer Jugendpolizeieinheit auf den Seitenstreifen gezwungen worden. Autos rasen mit hundert Stundenkilometern vorbei, blind für das Drama, das sich auf dem Seitenstreifen abspielt. Im Bruchteil einer Sekunde trifft Connor eine Entscheidung. Er sprintet los, stößt den Polizisten gegen den Lastwagen und rennt über die volle Autobahn. Würden sie einem unbewaffneten Jugendlichen in den Rücken schießen? Oder würden sie auf seine Beine zielen und die lebenswichtigen Organe schonen? Die Autos auf der Straße weichen ihm hupend aus, aber er rennt weiter.
»Connor, bleib stehen!«, ruft sein Vater. Dann fällt ein Schuss.
Connor spürt den Einschlag, aber nicht auf seiner Haut. Das Geschoss bleibt in seinem Rucksack stecken. Er dreht sich nicht um. Als er den Mittelstreifen erreicht, hört er noch einen Schuss, und ein kleiner blauer Klecks breitet sich auf der Mittelplanke aus. Sie schießen mit Betäubungsmunition. Sie wollen ihn nicht ausschalten, sondern nur kampfunfähig machen. Wahrscheinlich haben sie wesentlich weniger Hemmungen, mit Betäubungspatronen um sich zu schießen als mit scharfer Munition – Verkehr hin oder her.
Connor springt über die Mittelplanke und gerät vor einen Cadillac. Das Auto weicht ihm aus, und es ist pures Glück, dass Connor von seinem eigenen Schwung wenige Zentimeter aus der Bahn des Caddys getragen wird. Der Seitenspiegel kracht ihm schmerzhaft in die Rippen, bevor das Auto quietschend zum Stehen kommt. Der beißende Geruch von verbranntem Gummi steigt Connor in die Nase. Während er sich die schmerzende Seite hält, sieht er, dass ihn durch ein offenes Seitenfenster jemand vom Rücksitz aus anschaut. Ein Junge, ganz in Weiß gekleidet. Der Junge hat Angst.
Die Polizisten sind schon fast am Mittelstreifen, und Connor, der dem verängstigten Jungen in die Augen schaut, weiß, was er zu tun hat. Wieder muss er im Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen. Er reißt die Tür auf.
2.Risa
Risa geht hinter der Bühne auf und ab und wartet darauf, dass sie sich endlich ans Klavier setzen darf.
Sie könnte die Sonate im Schlaf spielen, das weiß sie, und oft tut sie es auch. In vielen Nächten wacht sie auf, weil ihre Finger auf der Bettdecke spielen. Sie hört in ihrem Kopf die Musik, sogar noch einen Moment nach dem Aufwachen, bis sie wieder in der Nacht verschwindet. Nur die auf die Decke trommelnden Finger bleiben.
Sie muss die Sonate spielen können. Sie muss ihr so leichtfallen wie das Atmen.
»Das ist kein Wettbewerb«, erzählt Mr. Durkin ihr immer. »Bei einem Konzert gibt es weder Sieger noch Verlierer.«
Aber Risa weiß es besser.
»Risa Ward«, ruft der Inspizient. »Du bist dran.«
Sie lässt die Schultern kreisen, rückt die Spange in ihren langen braunen Haaren zurecht und tritt auf die Bühne. Der Applaus des Publikums ist höflich, nicht mehr. Zum Teil ehrlich, denn sie hat Freunde dort draußen und Lehrer, die ihr Erfolg wünschen. Aber überwiegend ist es der Applaus eines Publikums, das beeindruckt werden möchte.
Auch Mr. Durkin sitzt dort unten. Seit fünf Jahren ist er ihr Klavierlehrer – und gleichzeitig eine Art Ersatzvater. Sie hat Glück. Nicht jeder im Staatlichen Waisenhaus Nummer 23 in Ohio hat einen Lehrer, von dem er das sagen könnte. Die meisten Waisenhaus-Kids hassen ihre Lehrer, weil sie in ihnen eher Gefängniswärter sehen.
Risa versucht ihr steifes Konzertkleid zu vergessen und setzt sich ans Klavier, einen Steinway-Flügel – schwarz wie die Nacht und ebenso lang.
Konzentrier dich.
Sie richtet den Blick auf den Flügel und zwingt so das Publikum ins Dunkle zurück. Jetzt zählen nur das Instrument und die wunderbaren Töne, die sie ihm entlocken wird.
Einen Augenblick lang lässt sie ihre Finger über den Tasten schweben, dann beginnt sie mit genau dem richtigen Maß an Leidenschaft. Bald tanzen ihre Finger nahezu mühelos, alles scheint so einfach. Sie lässt das Instrument singen … Aber dann rutscht ihr linker Ringfinger unglücklich von einem B ab und landet auf dem H.
Ein Fehler.
Er passiert so rasch, dass er unbemerkt bleiben könnte – aber nicht von Risa. Sie hält im Kopf an dem falschen Ton fest, und obwohl sie weiterspielt, klingt er in ihr nach, schwillt immer lauter an und raubt ihr die Konzentration, bis sie wieder eine falsche Taste trifft und dann, zwei Minuten später, einen ganzen Akkord verhaut. Ihre Augen füllen sich mit Tränen, die ihr die Sicht nehmen.
Du musst nicht sehen können, redet sie sich ein. Du musst nur die Musik spüren. Sie kann diese Bruchlandung noch abwenden, oder? Die Fehler, die in ihren Ohren so schrecklich klingen, sind kaum zu bemerken.
»Ganz ruhig«, würde Mr. Durkin sagen. »Niemand beurteilt dich.«
Vielleicht glaubt er das wirklich – andererseits kann er es sich leisten, das zu glauben. Er ist nicht fünfzehn Jahre alt, und er war niemals ein Mündel des Staates.
Fünf Fehler.
Jeder einzelne ist unbedeutend, kaum zu bemerken, aber trotzdem ein Fehler. Es wäre in Ordnung gewesen, wenn die Auftritte der anderen mittelprächtig gelaufen wären, aber sie hatten brilliert.
Dennoch strahlt Mr. Durkin übers ganze Gesicht, als er Risa beim Empfang begrüßt. »Du warst wunderbar! Ich bin stolz auf dich.«
»Ich hab’s verbockt.«
»Unsinn. Du hast eines der schwersten Stücke von Chopin gewählt. Nicht einmal Profis kommen da ohne ein, zwei Fehler durch. Du bist dem Stück gerecht geworden!«
»Das reicht mir nicht.«
Mr. Durkin seufzt, aber er widerspricht nicht. »Du entwickelst dich gut. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich diese Hände in der Carnegie Hall spielen sehe.« Sein Lächeln ist warm und ehrlich, wie die Glückwünsche der anderen Mädchen. Ihre Wärme lässt sie in dieser Nacht entspannt schlafen und gibt ihr Hoffnung, dass sie der Sache vielleicht, ganz vielleicht, doch zu viel Bedeutung beimisst und unnötig streng mit sich ist. Beim Einschlafen überlegt sie, was sie als Nächstes spielen könnte.
Eine Woche später wird sie ins Büro des Direktors gerufen.
Drei Personen erwarten sie. Ein Tribunal, denkt Risa. Die drei Erwachsenen sitzen zu Gericht wie die drei Affen: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.
»Setz dich bitte, Risa«, sagt der Direktor.
Sie will anmutig Platz nehmen, aber ihre weichen Knie knicken unter ihr ein und sie plumpst ungeschickt auf einen Stuhl, der für ein Verhör viel zu plüschig ist.
Risa kennt die beiden Personen neben dem Direktor nicht, aber sie sehen sehr offiziell aus. Gleichzeitig wirken sie entspannt, als wäre das hier heute nichts Besonderes für sie.
Die Frau links vom Direktor stellt sich als Sozialarbeiterin vor, die mit Risas »Fall« betraut ist. Bis zu diesem Augenblick wusste Risa nicht, dass sie ein »Fall« ist. Der Name der Frau dringt gar nicht erst bis in Risas Bewusstsein vor. Sie blättert so beiläufig in der Akte über Risas fünfzehnjähriges Leben wie in einer Tageszeitung.
»Also … du bist von Geburt an ein Mündel des Staates. Das sagt ja schon dein Nachname ›Ward‹. Dein Verhalten war vorbildlich. Deine Noten waren ordentlich, aber nicht ausgezeichnet.« Die Sozialarbeiterin schaut auf und lächelt. »Ich habe deinen Auftritt neulich gesehen. Du warst sehr gut.«
Gut, denkt Risa, aber nicht ausgezeichnet.
Sie blättert noch ein paar Sekunden lang in dem Ordner, aber Risa ist klar, dass sie eigentlich nicht liest. Was immer hier vor sich geht, war lange entschieden, bevor Risa den Raum betreten hat.
»Warum bin ich hier?«
Die Sozialarbeiterin klappt den Ordner zu und schaut nacheinander den Direktor und den Mann in dem teuren Anzug neben ihm an. Der Anzug nickt, und die Sozialarbeiterin wendet sich mit einem freundlichen Lächeln wieder an Risa. »Meinem Eindruck nach sind deine Möglichkeiten hier ausgeschöpft«, sagt sie. »Direktor Thomas und Mr. Paulson sind ebenfalls dieser Meinung.«
Risa wirft dem Anzug einen Blick zu. »Wer ist Mr. Paulson?«
Der Anzug räuspert sich und sagt fast entschuldigend: »Ich bin der Rechtsbeistand der Schule.«
»Ein Rechtsanwalt? Warum ist ein Rechtsanwalt hier?«
»Das ist Vorschrift«, erklärt Direktor Thomas. Er ruckelt an seinem Kragen, als ob sich seine Krawatte auf einmal in eine Schlinge verwandelt hätte. »An unserer Einrichtung erfordern diese Vorgänge grundsätzlich die Anwesenheit eines Anwalts.«
»Und was ist das hier für ein Vorgang?«
Die drei schauen sich an, aber keiner möchte als Erster antworten. Schließlich ergreift wieder die Sozialarbeiterin das Wort. »Weißt du, Plätze in staatlichen Waisenhäusern sind heutzutage sehr knapp, und von den Haushaltskürzungen sind wir alle betroffen.«
Risa schaut sie aus kalten Augen an: »Mündeln des Staates ist ein Platz in einem staatlichen Waisenhaus garantiert.«
»Das ist korrekt, aber die Garantie gilt nur, bis sie das Alter von dreizehn Jahren erreicht haben.«
Dann reden auf einmal alle gleichzeitig:
»Das Geld reicht nicht länger«, sagt der Direktor.
»Die Bildungsstandards sind gefährdet«, sagt der Anwalt.
»Wir wollen nur das Beste für dich und all die anderen Kinder hier«, sagt die Sozialarbeiterin.
Und so geht es hin und her wie bei einem Pingpongspiel mit drei Spielern. Risa sagt nichts, sondern hört nur zu.
»Du bist eine gute Musikerin, aber …«
»Wie ich bereits sagte, deine Möglichkeiten hier sind ausgeschöpft.«
»Mehr kannst du hier nicht erreichen.«
»Wenn du vielleicht ein weniger umkämpftes Hauptfach gewählt hättest …«
»Nun, das ist alles Schnee von gestern.«
»Uns sind die Hände gebunden.«
»Täglich kommen unerwünschte Babys zur Welt, und nicht alle werden gestorcht.«
»Wir sind verpflichtet, diese Babys aufzunehmen.«
»Wir müssen Raum schaffen für neue Mündel.«
»Also müssen wir die Zahl der Bewohner, die das Teenageralter erreicht haben, um fünf Prozent reduzieren.«
»Das verstehst du doch, oder?«
Risa will ihnen nicht länger zuhören, deshalb bringt sie die Erwachsenen zum Schweigen und spricht aus, was sie nicht wagen: »Ich soll umgewandelt werden?«
Stille. Das ist eindeutiger als jedes »Ja«.
Die Sozialarbeiterin greift über den Schreibtisch nach Risas Hand, aber Risa zieht die Hand zurück, bevor sie sie zu fassen bekommt. »Es ist schon in Ordnung, dass du Angst hast. Veränderung ist immer beängstigend.«
»Veränderung?«, schreit Risa auf. »Was meinen Sie mit ›Veränderung‹? Sterben ist ein bisschen mehr als Veränderung.«
Die Krawatte des Direktors verwandelt sich wieder in eine alles Blut abschnürende Schlinge. Der Anwalt öffnet seine Aktentasche. »Bitte, Miss Ward. Sie werden nicht sterben, und uns allen hier wäre bedeutend wohler, wenn Sie sich nicht so unangebracht übertrieben ausdrückten. Sie werden zu einhundert Prozent weiterhin am Leben sein, nur eben in einzelnen Teilen.« Dann greift er in seine Aktentasche und reicht ihr einen bunten Flyer. »Das ist eine Broschüre vom Ernte-Camp ›Zwei Seen‹.«
»Es ist wunderschön dort«, sagt der Direktor. »Diese Einrichtung ist unsere erste Wahl für unsere Wandler. Mein Neffe wurde dort umgewandelt.«
»Schön für ihn.«
»Veränderung«, wiederholt die Sozialarbeiterin, »mehr nicht. Wie Eis zu Wasser wird und Wasser zu Wolken. Du wirst leben, Risa. Nur in einer anderen Form.«
Aber Risa hört nicht mehr zu. Panik steigt in ihr auf. »Ich muss nicht unbedingt Musikerin sein. Ich kann auch etwas anderes tun.«
Direktor Thomas schüttelt traurig den Kopf. »Ich fürchte, dafür ist es zu spät.«
»Nein, ist es nicht. Ich könnte trainieren und in eine Eliteeinheit gehen. Das Militär braucht immer Nachwuchs!«
Der Anwalt seufzt genervt auf und schaut auf die Uhr. Die Sozialarbeiterin beugt sich vor. »Risa, bitte. Ein Mädchen muss bestimmte körperliche Voraussetzungen erfüllen, außerdem viele Jahre hart trainieren.«
»Habe ich denn gar keine Wahl?« Sie wirft einen Blick zur Tür, und die Antwort ist klar. Zwei Wachen stellen sicher, dass sie ganz bestimmt keine Wahl hat. Als sie weggebracht wird, muss sie an Mr. Durkin denken und lacht bitter auf. Vielleicht geht sein Wunsch doch noch in Erfüllung. Vielleicht sieht er tatsächlich eines Tages ihre Hände in der Carnegie Hall. Aber der Rest von Risa wird dann leider nicht dort sein.
Nicht einmal in ihren Schlafsaal darf sie zurückkehren. Sie muss nichts packen, sie braucht nichts mehr. So ist das bei Wandlern. Nur ein paar Freunde schleichen hinunter, umarmen sie verstohlen und vergießen ein paar Tränen, immer in Alarmbereitschaft, um ja nicht erwischt zu werden.
Mr. Durkin kommt nicht. Das schmerzt Risa ganz besonders.
Sie schläft im Gästezimmer im Empfangsbereich des Waisenhauses. Im Morgengrauen wird sie mit anderen Mädchen und Jungs in einen Bus verfrachtet, der sie von dem riesigen Komplex wegbringt. Ein paar Gesichter sind ihr vertraut, aber richtig kennen tut sie keinen.
Auf der anderen Seite des Gangs sitzt ein ziemlich gutaussehender Junge – dem Anschein nach ein Soldat – und lächelt sie an. »Hallo«, sagt er und flirtet mit ihr, wie nur die Jungs aus den Eliteeinheiten es können.
»Hallo«, antwortet Risa.
»Ich wechsle zur Staatlichen Marineakademie«, sagt er. »Und du?«
»Ich?« Sie schaut in die Luft, während sie nach einer eindrucksvollen Antwort sucht. »Miss Marple’s Akademie für Hochbegabte.«
»Sie lügt«, sagt ein dürrer, blasser Junge, der auf der anderen Seite von Risa sitzt. »Sie ist ein Wandler.«
Der junge Soldat rückt auf einmal von ihr ab, als ob sie eine ansteckende Krankheit hätte. »Oh«, sagt er. »Ach … äh …schade. Bis denn!« Damit steht er auf und setzt sich zu ein paar anderen Kameraden nach hinten in den Bus.
»Danke«, blafft Risa den dürren Jungen an.
Er zuckt nur die Achseln. »Ist doch sowieso egal.« Dann hält er ihr die Hand hin. »Samson«, sagt er. »Ich bin auch ein Wandler.«
Risa muss fast lachen. Samson. So ein starker Name für so einen blassen Jungen. Sie ergreift seine Hand nicht, denn sie ist immer noch wütend, weil er sie vor dem gutaussehenden Jungen bloßgestellt hat.
»Was hast du angestellt? Warum wandeln sie dich um?«, fragt Risa.
»Es ist nicht, was ich getan habe, sondern was ich nicht getan habe.«
»Und was hast du nicht getan?«
»Alles«, antwortet Samson.
Risa versteht was er meint. Nichtstun ist ein schneller Weg zur Umwandlung.
»Aus mir wäre ohnehin nicht viel geworden«, sagt Samson, »jetzt habe ich statistisch gesehen eine Chance, dass wenigstens ein Teil von mir irgendwo in der Welt große Bedeutung erlangt. Ich wäre lieber teilweise bedeutend als vollkommen nutzlos.«
Dass seine verdrehte Logik fast Sinn ergibt, macht Risa noch wütender. »Na dann viel Spaß im Ernte-Camp.« Damit steht sie auf und sucht sich einen anderen Platz.
»Bitte setzt euch!«, ruft die Begleitperson von vorne im Bus, aber niemand hört auf sie. Die Kids laufen alle hin und her, um bekannte Gesichter zu finden oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Risa sucht sich einen Fensterplatz, den sie für sich alleine hat.
Die Busfahrt ist nur die erste Etappe ihrer Reise. Man hat ihr und all den anderen erklärt, sie würden zunächst zu einem zentralen Sammelplatz gebracht. Dort würden sie mit Mädchen und Jungs aus vielen Dutzend anderen staatlichen Waisenhäusern auf verschiedene Busse verteilt, die sie zu ihren Zielorten bringen würden. In Risas nächstem Bus würden lauter Samsons sitzen. Klasse. Sie hat kurz überlegt, sich in einen anderen Bus zu schmuggeln, aber wegen der Barcodes auf den Armbändern wird das kaum möglich sein. Alles ist perfekt organisiert und narrensicher. Dennoch plant und verwirft Risa während der Fahrt die verschiedensten Fluchtszenarien.
Plötzlich sieht sie durchs Fenster den Tumult ein Stück weiter die Straße entlang. Auf dem Seitenstreifen der anderen Fahrbahn stehen Polizeiwagen, und als der Bus die Spur wechselt, erkennt sie zwei Gestalten auf der Straße: Zwei Jungs rennen zwischen den Autos hindurch. Einer hat den anderen im Schwitzkasten und zieht ihn praktisch mit sich. Und beide laufen direkt vor den Bus.
Risas Kopf wird gegen das Fenster geschleudert, als der Bus auf einmal nach rechts zieht, um den beiden Jungs auszuweichen. Viele Kids schreien auf, Risa fliegt in den Gang, als der Bus schleudernd zum Stehen kommt. Ihre Hüfte schmerzt, aber nicht schlimm. Nur eine Prellung. Rasch rappelt sie sich auf und blickt um sich. Der Bus neigt sich zur Seite, er ist von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Die Windschutzscheibe ist zersplittert und voller Blut – viel Blut.
Die Kids um sie herum checken sich gegenseitig. Wie sie ist niemand schwer verletzt, auch wenn einige mehr Theater machen als andere. Die Begleitperson versucht, ein hysterisches Mädchen zu beruhigen.
Und in dem ganzen Durcheinander wird Risa auf einmal etwas klar:
An diese Möglichkeit hat niemand gedacht.
Das System hat eine Million Eventualitäten berücksichtigt, wie sich staatliche Mündel aus ihrem Schicksal raustricksen könnten, aber für einen Unfall gibt es keinen Plan. In den nächsten paar Sekunden ist alles möglich.
Risa richtet den Blick auf die vordere Tür des Busses, hält die Luft an und rennt los.
3.Lev
Es ist ein großes Fest, es ist teuer und es ist seit Jahren geplant.
Mindestens zweihundert Menschen bevölkern den Ballsaal des Country Clubs. Lev durfte die Band aussuchen, er durfte das Essen auswählen, und er durfte sogar die Farbe der Dekoration bestimmen: rot und weiß, wie die Cincinnati Reds, und sein Name Levi Jedediah Calder ist in Gold auf die silbernen Servietten geprägt, die alle Gäste zur Erinnerung mit nach Hause nehmen dürfen.
Das Fest ist für ihn ganz allein. Nur um ihn geht es. Und er ist wild entschlossen, die Party seines Lebens zu feiern.
Die Erwachsenen sind überwiegend Verwandte, Freunde der Familie und Geschäftspartner seiner Eltern, aber mindestens achtzig Gäste sind Levs Freunde: aus der Schule, aus der Kirchengemeinde und aus seinen verschiedenen Mannschaften. Einigen Freunden war die Einladung natürlich komisch vorgekommen.
»Ich weiß nicht, Lev«, hatten sie gesagt. »Irgendwie ist es merkwürdig. Ich meine, was für ein Geschenk soll ich mitbringen?«
»Ihr braucht gar nichts mitzubringen«, hatte Lev geantwortet. »Bei einem Zehntopferfest gibt es keine Geschenke. Kommt einfach und feiert. Ich werde es garantiert tun!«
Und so ist es.
Er fragt jedes Mädchen, ob sie mit ihm tanzen will, und nicht eine gibt ihm einen Korb. Er lässt sich sogar auf einem Stuhl sitzend durch den Saal tragen, das hatte er bei der Bar-Mizwa eines jüdischen Freundes gesehen. Seins ist zwar ein ganz anderes Fest, aber schließlich feiern sie auch seinen dreizehnten Geburtstag, und deshalb wird er ja wohl auf einem Stuhl getragen werden dürfen!
Das Essen wird viel zu früh serviert. Lev schaut auf die Uhr. Zwei Stunden sind schon rum. Warum vergeht die Zeit so schnell?
Bald schnappen sich einzelne Gäste das Mikrofon, sie erheben Gläser mit Champagner und trinken auf Levs Wohl. Seine Eltern bringen einen Toast aus. Seine Großmutter auch. Und sogar ein Onkel, den er nicht einmal kennt.
»Auf Lev: Es war eine Freude, dich zu einem hübschen jungen Mann heranwachsen zu sehen, und ich weiß tief in meinem Herzen, du wirst Großartiges erwirken für alle, die du in dieser Welt berührst.«
Es fühlt sich wunderbar und merkwürdig zugleich an, dass so viele Menschen so viele nette Dinge über ihn sagen. Eigentlich ist das alles viel zu viel, aber irgendwie auch nicht genug. Es müsste mehr sein. Mehr Essen. Mehr Tanz. Mehr Zeit. Sie tragen schon die Geburtstagstorte herein. Und jeder weiß doch, wenn die Torte gegessen ist, ist die Party vorbei. Warum bringen sie jetzt die Torte? Feiern sie wirklich schon seit drei Stunden?
Dann kommt noch ein Toast. Und dieser macht beinahe den ganzen Abend kaputt.
Von Levs Brüdern und Schwestern ist Marcus den ganzen Abend lang am schweigsamsten. Das passt nicht zu ihm. Lev hätte wissen müssen, dass etwas im Busch ist. Von den zehn Geschwistern ist Lev mit seinen dreizehn Jahren der Jüngste, Marcus mit achtundzwanzig der Älteste. Er ist durch das halbe Land geflogen, um an Levs Zehntopferfest teilzunehmen, und doch hat er kaum getanzt oder geredet oder gefeiert. Dafür ist er betrunken. Lev hat Marcus noch nie betrunken gesehen.
Nachdem die offiziellen Toasts ausgebracht sind und die Torte angeschnitten und verteilt ist, stellt sich Marcus neben ihn.
»Glückwunsch, kleiner Bruder«, sagt er und nimmt ihn fest in die Arme. Lev riecht den Alkohol in Marcus’ Atem. »Ab heute bist du ein Mann. Irgendwie.«
Ihr Vater sitzt ein paar Schritte entfernt am Kopf der Tafel und stößt ein nervöses Kichern aus.
»Danke … irgendwie«, antwortet Lev. Er schaut zu seinen Eltern hinüber. Sein Vater wartet ab, was als Nächstes geschieht, und seine Mutter sieht so verhärmt aus, dass sich in Lev alles zusammenkrampft.
Marcus mustert Lev mit einem Lächeln, dem jedes Gefühl abgeht. »Wie findest du das alles?«, fragt er Lev.
»Toll.«
»Na klar! So viele Menschen, und alle sind nur wegen dir hier! Ein erstaunlicher Abend. Wirklich erstaunlich!«
»Ja«, sagt Lev. Er weiß nicht genau, wohin das Gespräch führen soll, aber ihm ist klar, dass Marcus auf etwas Bestimmtes hinauswill. »Es ist die beste Party meines Lebens.«
»Und das ist verdammt richtig so! Die beste Party deines Lebens! Musst all die wichtigen Ereignisse, alle Partys in einer unter ein Dach bringen: Geburtstage, Hochzeit, Beerdigung.« Dann wendet er sich an ihren Vater. »Sehr effizient, was?«
»Es reicht«, sagt der Vater leise, aber Marcus wird nur noch lauter.
»Was? Ich darf nicht darüber sprechen? Ach so, richtig, das ist ja eine Party. Hab ich fast vergessen.«
Lev will, dass Marcus aufhört, aber irgendwie auch nicht.
Mom steht auf und sagt, lauter als Dad: »Marcus, setz dich hin. Du machst dich lächerlich.«
Inzwischen sind alle im Ballsaal aufmerksam geworden und haben sich dem Familiendrama zugewandt, das sich vor ihren Augen abspielt. Als Marcus das merkt, ergreift er ein herrenloses halb leeres Glas Champagner und erhebt es: »Auf meinen Bruder Lev. Und auf unsere Eltern! Die immer das Richtige getan haben. Das Angemessene. Die immer großzügig gespendet haben. Die immer den zehnten Teil von allem unserer Kirche gegeben haben. He, Mom, gut, dass du zehn Kinder hast und nicht fünf. Sonst hätten wir Lev womöglich halbieren müssen.«
Die Anwesenden stöhnen auf und schütteln den Kopf; wie kann sich ein ältester Sohn nur so danebenbenehmen?
Plötzlich kommt Dad und packt Marcus fest an der Schulter. »Schluss jetzt! Setz dich hin.«
Marcus schüttelt den Arm ab. »Oh, jetzt hab ich aber Angst!« Als sich Marcus wieder an Lev wendet, hat er Tränen in den Augen. »Ich hab dich lieb, Bruder … und heute ist ein besonderer Tag für dich, das weiß ich. Aber ich kann dabei nicht mitmachen.« Er wirft das Champagnerglas gegen die Wand. Es zerspringt, Kristallsplitter regnen auf das Büfett herab. Dann dreht er sich um und stürmt mit erstaunlich sicheren Schritten hinaus. Lev wird klar, dass er gar nicht betrunken ist.
Levs Vater gibt der Band ein Zeichen, und sie beginnt eine Tanznummer, noch bevor Marcus den großen Raum verlassen hat. Menschen füllen die Tanzfläche und bemühen sich, die unbehagliche Stimmung zu vertreiben.
»Tut mir leid, Lev«, sagt sein Vater. »Möchtest du … möchtest du vielleicht tanzen?«
Aber Lev möchte nicht mehr tanzen. Der Wunsch, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, ist zusammen mit seinem Bruder verschwunden. »Ich würde gern mit Pastor Dan sprechen, wenn das in Ordnung ist.«
»Natürlich.«
Pastor Dan war schon vor Levs Geburt ein Freund der Familie. Mit ihm kann er leichter als mit seinen Eltern über Themen sprechen, die Geduld und Klugheit erfordern.
Im Festsaal ist es zu laut und zu voll, deshalb gehen sie nach draußen auf die Terrasse, von der aus man über den Golfplatz des Country Clubs blicken kann.
»Bekommst du es mit der Angst zu tun?« Pastor Dan weiß immer, was in Levs Kopf vor sich geht.
Lev nickt. »Ich dachte, ich wäre vorbereitet.«
»Das ist ganz normal. Mach dir keine Gedanken.«
Aber Lev ist trotzdem enttäuscht von sich selbst. Sein ganzes Leben lang konnte er sich vorbereiten. Das sollte doch reichen. Seit Kindertagen weiß er, dass er ein Zehntopfer ist. »Du bist etwas ganz Besonderes«, haben seine Eltern ihm immer gesagt. »Dein Leben dient Gott und der Menschheit.« Wie alt er war, als er herausfand, was genau das für ihn bedeutete, weiß er nicht mehr.
»Haben deine Mitschüler dich geärgert?«
»Nicht mehr als sonst«, sagt Lev. Und das stimmt. Manche hatten es ihm übel genommen, dass Erwachsene ihn als etwas Besonderes behandelten. Es gab nette Kids und es gab grausame. So war das im Leben. Aber es verletzte ihn, wenn sie ihn als »dreckigen Wandler« beschimpften. Als hätten auch seine Eltern eine Verfügung unterzeichnet, um ihn loszuwerden. Das trifft auf Lev nun wirklich nicht zu. Er ist der Stolz und die Freude seiner Familie: nur Einsen in der Schule, bester Spieler seiner Baseballmannschaft. Dass er umgewandelt wird, macht ihn noch lange nicht zu einem Wandler.
An seiner Schule gibt es natürlich noch ein paar andere Zehntopfer, aber sie gehören anderen Glaubensgemeinschaften an, deshalb hat sich Lev ihnen nie verbunden gefühlt. Die Party heute Abend zeigt, wie viele Freunde Lev hat, aber sie sind nicht wie er. Sie werden ihr Leben fortsetzen, ohne umgewandelt zu werden. Ihr Körper und ihre Zukunft gehören allein ihnen. Lev hat sich Gott immer näher gefühlt als seinen Freunden, sogar näher als seiner Familie. Er fragt sich oft, ob ein Erwählter immer so allein ist. Oder stimmt mit ihm etwas nicht?
»Ich habe in letzter Zeit viele falsche Gedanken«, erzählt er Pastor Dan.
»Es gibt keine falschen Gedanken, sondern nur Gedanken, an denen man arbeiten und die man überwinden muss.«
»Na ja … ich bin einfach eifersüchtig auf meine Brüder und Schwestern. Ich muss dauernd daran denken, wie sehr ich meiner Mannschaft fehlen werde. Ein Zehntopfer zu sein ist eine Ehre und ein Segen, aber ich denke trotzdem ständig darüber nach, warum ausgerechnet ich eins sein muss.«
Pastor Dan, der anderen Menschen normalerweise so gut in die Augen schauen kann, wendet den Blick ab. »Das war lange vor deiner Geburt beschlossen. Es hängt nicht damit zusammen, was du getan oder nicht getan hast.«
»Die Sache ist nur, ich kenne viele große Familien …«
Pastor Dan nickt. »Ja, das ist heutzutage durchaus üblich.«
»Und viele geben gar kein Zehntopfer, auch Familien in unserer Gemeinde nicht, und niemand macht ihnen deshalb einen Vorwurf.«
»Es gibt auch Familien, die ihr erstes, zweites oder drittes Kind als Zehnten geben. Jede Familie muss die Entscheidung für sich selbst treffen. Deine Eltern haben lange gewartet mit der Entscheidung, dich zu bekommen.«
Lev nickt widerstrebend, denn er weiß, dass das stimmt. Er ist ein echtes Zehntopfer. Mit fünf leiblichen Geschwistern, einem adoptierten und drei, die »vom Storch« gebracht worden sind, ist Lev genau der Zehnte. Seine Eltern haben ihm immer eingeredet, das mache ihn zu etwas ganz Besonderem.
»Ich will dir was sagen, Lev«, sagt Pastor Dan und sieht ihm dabei endlich in die Augen. Wie bei Marcus schimmern Tränen darin, als würde er gleich anfangen zu weinen. »Ich habe all deine Brüder und Schwestern aufwachsen sehen, und obwohl ich normalerweise keine Lieblinge habe, bist du für mich der Herausragendste, und zwar in so vielerlei Hinsicht, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen sollte. Und genau darum bittet Gott, weißt du. Nicht um die ersten Früchte, sondern um die besten.«
»Danke, Sir.« Pastor Dan weiß immer, was er sagen muss, damit es Lev besser geht. »Ich bin bereit.« Und als er es ausspricht, erkennt er, dass er trotz seiner Ängste und Befürchtungen wirklich bereit ist. Nur dafür hat er gelebt. Und trotzdem geht sein Zehntopferfest viel zu schnell zu Ende.
Am Morgen müssen die Calders im Esszimmer frühstücken. Der Tisch ist ganz ausgezogen, denn nur so haben Levs Brüder und Schwestern alle Platz. Eigentlich wohnen nicht mehr alle zu Hause, aber heute sind sie zum Frühstück hergekommen – alle außer Marcus.
Dennoch ist es für eine so große Familie ungewöhnlich still am Tisch, und das Klirren des Bestecks auf dem Porzellan macht noch deutlicher, dass niemand spricht.
Lev isst in seiner weißen Zehntopferkleidung aus Seide ganz vorsichtig, damit er sich nicht bekleckert. Nach dem Frühstück verabschieden sie sich mit vielen Umarmungen und Küssen. Das ist der schlimmste Teil. Lev wünschte, sie würden ihn einfach gehen lassen.
Pastor Dan trifft ein – das hat Lev so gewollt –, und sobald er da ist, geht es mit dem Abschiednehmen schneller. Niemand will die wertvolle Zeit des Pastors verschwenden. Lev ist als Erster draußen im Cadillac seines Vaters, und obwohl er sich nicht umdrehen will, kann er sich nicht beherrschen: Langsam verschwindet sein Elternhaus hinter ihm.
Nie wieder werde ich dieses Zuhause sehen. Aber dann schiebt er diesen Gedanken weg, denn er ist unergiebig, nutzlos und egoistisch. Pastor Dan neben ihm auf dem Rücksitz schaut ihn lächelnd an.
»Es ist schon in Ordnung, Lev«, sagt er. Und allein, weil er es sagt, ist es das auch.
»Wie weit ist es bis zum Ernte-Camp?«, fragt Lev.
»Ungefähr eine Stunde«, antwortet seine Mutter.
»Und … machen sie es dann gleich?«
Seine Eltern sehen sich an. »Es gibt bestimmt Einführungsveranstaltungen«, meint sein Vater schließlich.
Sie wissen also auch nicht mehr als Lev.
Als sie auf die Autobahn auffahren, lässt er das Fenster herab, um den Fahrtwind auf dem Gesicht zu spüren. Er schließt die Augen.
Dafür wurde ich geboren. Dafür habe ich mein ganzes Leben gelebt. Ich bin erwählt. Ich bin gesegnet. Und ich bin glücklich.
Plötzlich steigt sein Vater in die Bremsen.
Der Gurt schneidet in Levs Schulter und er öffnet die Augen. Sie stehen mitten auf der Autobahn und um sie herum leuchten die Blaulichter von Polizeifahrzeugen auf. Und – hat er etwa gerade einen Schuss gehört?