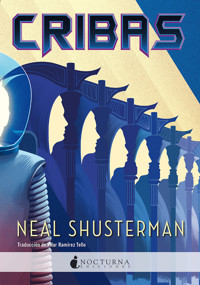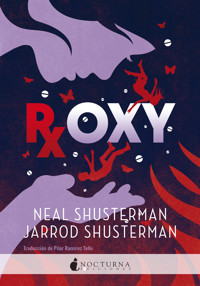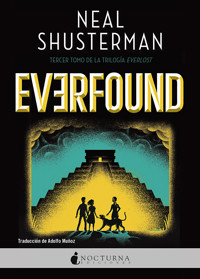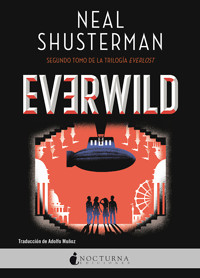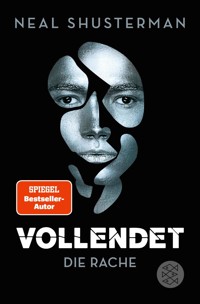
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Vollendet
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Sie sagen, dass du weiterlebst. Sie lügen. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat Connor Hoffnung. Endlich sieht er eine Chance, die Umwandlung, die unerwünschte Teenager in ihre einzelnen Teile zerlegt und somit zu sofortigen Organspendern macht, für immer abzuschaffen. Doch dafür muss er an den Ort zurück, der ihn zu einem Helden für alle Wandler gemacht hat und den er am liebsten nie wieder betreten würde – nach Hause. Band 3 der brisant-brillanten »Vollendet«-Serie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Ähnliche
Neal Shusterman
Vollendet – Die Rache
Band 3
Über dieses Buch
Sie sagen, dass du weiterlebst. Sie lügen.
Zum ersten Mal seit langer Zeit hat Connor Hoffnung. Endlich sieht er eine Chance, die Umwandlung, die unerwünschte Teenager in ihre einzelnen Teile zerlegt und somit zu sofortigen Organspendern macht, für immer abzuschaffen. Doch dafür muss er an den Ort zurück, der ihn zu einem Helden für alle Wandler gemacht hat und den er am liebsten nie wieder betreten würde – nach Hause.
Band 3 der brisant-brillanten »Vollendet«-Serie
Biografie
Neal Shusterman, geboren 1962 in Brooklyn, USA, ist in den USA ein Superstar unter den Jugendbuchautoren. Er studierte in Kalifornien Psychologie und Theaterwissenschaften. Alle seine Romane sind internationale Bestseller und wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem National Book Award.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Für Jan, Eric & Robby, Keith & Thresa, Chris, Patricia, Marcia, Andrea, Mark und alle meine Freunde, die da waren, als ich sie dringend gebraucht habe.
Teil eins
Flugunfähig
»Die neue medizinische Technologie wird uns eher befreien als zu Sklaven machen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass das Mitgefühl des Menschen größer ist als seine Gier. Deshalb gründe ich hiermit das Proaktive Bürgerforum. Es soll unerschütterlich darüber wachen, dass Nerventransplantationen nur ethisch korrekt durchgeführt werden. Ich bin zuversichtlich, dass Missbrauch die Ausnahme sein wird und nicht die Regel.«
Janson Rheinschild
»Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten.«
J. Robert Oppenheimer
Die Rheinschilds
»Sie haben unterschrieben. Der Heartland-Krieg ist vorbei.«
Janson Rheinschild zieht die Tür zu, wirft seinen Mantel auf die Couch und sinkt kraftlos in einen Sessel, als hätte sein Körper keine Gelenke mehr. Als wäre er von innen nach außen umgewandelt worden.
»Das ist nicht dein Ernst«, sagt Sonia. »Niemand, der bei Verstand ist, würde seine Unterschrift unter dieses abscheuliche Umwandlungsabkommen setzen.«
In seinem Blick liegt eine Bitterkeit, die nicht ihr gilt, aber kein anderes Ziel findet. »War in den letzten neun Jahren überhaupt jemand bei Verstand?«
Sie setzt sich auf die Armlehne der Couch, ganz dicht neben ihn, und nimmt seine Hand. Er greift so verzweifelt danach, als könnte nur diese Hand ihn vor dem Sturz in den Abgrund bewahren.
»Der neue Vorsitzende vom Proaktiven Bürgerforum, dieser narzisstische Betrüger Dandrich, hat mich angerufen, bevor sie eine offizielle Erklärung abgegeben haben. Er wollte mich informieren, dass das Abkommen unterzeichnet ist. ›Aus Respekt‹ sollte ich es als Erster erfahren, hat er gesagt. Aber du weißt so gut wie ich, dass er es nur aus Schadenfreude getan hat.«
»Quäl dich nicht, Janson. Das hat keinen Sinn. Du trägst keine Schuld, und du kannst es nicht ändern.«
Er zieht die Hand weg und schaut sie finster an. »Du hast recht, es ist nicht meine Schuld. Es ist unsere Schuld. Wir haben das zusammen getan, Sonia.«
Sie reagiert, als hätte er sie ins Gesicht geschlagen. Sie wendet sich nicht nur ab, sondern steht auf und geht im Zimmer auf und ab. Gut, denkt Janson. Soll sie ruhig ein bisschen von dem spüren, was ich spüre.
»Ich habe nichts Falsches getan«, beharrt sie, »und du auch nicht!«
»Wir haben es überhaupt erst möglich gemacht! Das Umwandeln basiert auf unserer Technologie! Auf unserer Forschung!«
»Aber man hat sie uns gestohlen!«
Janson steht auf. Er kann es nicht ertragen, nur einen Moment länger sitzen zu bleiben. Sitzen fühlt sich an wie Zustimmung. Wie das Eingeständnis seines Scheiterns. Als Nächstes sinkt er womöglich noch mit einem Drink in der Hand in den Sessel zurück, schwenkt das Glas, dass das Eis klirrt, und spürt, wie der Alkohol ihn betäubt und er aufgibt.
Nein, so ist er nicht. So wird er nie sein.
Auf der Straße ertönt Geschrei. Er schaut aus dem Wohnzimmerfenster und sieht ein paar randalierende Jugendliche aus der Nachbarschaft. »Streuner« werden sie heutzutage in den Nachrichten genannt. Brutale Teenager. »Man muss etwas gegen die brutalen Jugendlichen unternehmen, die dieser Krieg hervorgebracht hat«, blöken die Politiker in ihren parlamentarischen Pferchen. Aber was hatten sie erwartet, wenn alles Geld für den Krieg ausgegeben wurde statt für die Bildung? Wussten sie nicht, dass das öffentliche Bildungssystem scheitern würde? Was hatten sie erwartet? Dass diese Kids etwas anderes mit ihrer freien Zeit anfangen würden, als Ärger zu machen, so ganz ohne Schule und Arbeit?
Der Mob auf der Straße – wenn man die vier oder fünf Jugendlichen überhaupt schon als Mob bezeichnen kann – passiert das Haus ohne Zwischenfall. Sie hatten noch nie Ärger vor ihrem Haus gehabt, obwohl es als einziges in der Straße weder Gitter vor den Fenstern noch ein eisernes Sicherheitstor hat. Andererseits sind schon viele Sicherheitstore in der Straße beschädigt worden. Diesen Kids mangelt es seit den Schulschließungen vielleicht an Bildung, aber dumm sind sie nicht. Sie sehen das Misstrauen, das ihnen überall entgegenschlägt. Und das treibt sie nur noch mehr dazu an, ihrem Zorn freien Lauf zu lassen. »Was fällt euch ein, uns zu misstrauen?«, signalisiert ihre Gewalttätigkeit. »Ihr kennt uns doch gar nicht.« Aber die Menschen sind so in ihre ängstlichen Sicherheitsvorkehrungen vertieft, dass sie es nicht hören.
Sonia tritt jetzt von hinten an ihn heran und schlingt die Arme um ihn. Er möchte ihren Trost annehmen, aber er kann es nicht. Er ist untröstlich und wird erst Frieden finden, wenn er seinen schrecklichen Fehler wiedergutgemacht hat.
»Vielleicht ist es wie damals im Kalten Krieg«, sagt Sonia.
»Wie meinst du das?«
»Sie haben eine neue Waffe«, erklärt sie. »Die Umwandlung. Vielleicht reicht schon die Drohung damit aus. Vielleicht werden sie sie nie wirklich einsetzen.«
»Bei einem Kalten Krieg sind wenigstens die Kräfte gleichmäßig verteilt. Aber was haben diese Kids den Behörden, die sie umwandeln, entgegenzusetzen?«
Sonia seufzt, weil sie ihn endlich versteht. »Nichts. Nicht das Geringste.«
Jetzt kann er sich ein bisschen damit trösten, dass sie ihn versteht. Dass nicht er allein die finsteren Abgründe sieht, die sich durch das neue Gesetz auftun könnten.
»Noch ist es nicht geschehen«, erinnert sie ihn. »Noch wurde kein einziger Streuner umgewandelt.«
»Klar«, antwortet Janson. »Weil das Gesetz erst um Mitternacht in Kraft tritt.«
Und so verbringen sie den restlichen Abend zusammen und halten einander fest, als wäre es der letzte Abend der Zivilisation. Denn genaugenommen ist er es auch.
1.Connor
Es beginnt mit einem überfahrenen Tier – einem so zufälligen und lächerlichen Ereignis, dass man kaum für möglich hält, welche Folgen es hat.
Connor hätte anhalten und schlafen sollen, vor allem in einer so windigen Nacht. Am Morgen hätte er bestimmt viel besser reagiert. Doch das brennende Verlangen, mit Lev zusammen endlich Ohio zu erreichen, treibt ihn jeden Tag stärker an.
Nur noch eine Ausfahrt, sagt er sich. Aber obwohl er eigentlich bereits in Kansas anhalten wollte, war er auch an diesem Schild vorbeigefahren. Schon vor einer halben Stunde. Lev, der Connor sonst sehr gut zur Vernunft bringen kann, ist heute Nacht keine Hilfe, denn er schläft tief und fest im Beifahrersitz.
Eine halbe Stunde nach Mitternacht springt die bedauernswerte Kreatur in den Lichtkegel von Connors Scheinwerfern. Connor nimmt nur vage Umrisse wahr, bevor er bei dem verzweifelten Versuch, einen Zusammenstoß zu verhindern, das Steuer herumreißt.
Es kann unmöglich das sein, wonach es aussieht …
Obwohl er ausweicht, stürzt sich das blöde Viech wieder direkt vor das Auto, als suche es den Tod.
Der »geborgte« Charger kracht in das Tier, und es rollt wie ein Findling über die Kühlerhaube. Die Windschutzscheibe zersplittert in Millionen kleiner Scherben aus Sicherheitsglas, der Körper verkeilt sich im Rahmen, und ein verbogenes Wischerblatt bohrt sich durch seinen schlanken Hals. Connor verliert die Kontrolle über das Lenkrad. Der Wagen kommt von der Straße ab und schlingert wild durch das Unterholz am Straßenrand.
Connor schreit und flucht, während das Tier, das sich immer noch ans Leben klammert, mit seinen Krallen Stoff und Fleisch aus seiner Brust reißt. Endlich kommt er so weit zur Besinnung, dass er voll auf die Bremse steigt. Das grässliche Tier löst sich von der Windschutzscheibe und wird nach vorn geschleudert. Das Auto neigt sich wie ein sinkendes Schiff und kommt in einem Graben abrupt zum Stehen. Endlich platzen auch die Airbags auf wie fehlerhafte Fallschirme, die sich erst beim Aufprall öffnen.
Die nachfolgende Stille fühlt sich an wie die luftlose Leere des Weltraums. Nur der Wind seufzt ohne jedes Mitgefühl.
Lev, der im Augenblick des Zusammenstoßes aufgewacht ist, sagt nichts, sondern ringt nach Luft, die der Airbag aus ihm herausgepresst hat. Connor weiß inzwischen, dass Lev jedes Mal wie ein Opossum erstarrt, wenn er in Panik gerät.
Während Connor die letzten zehn Sekunden seines Lebens verarbeitet, untersucht er die Wunde: Unter seinem zerrissenen Hemd verläuft ein ungefähr fünfzehn Zentimeter langer, klaffender Schnitt schräg über seine Brust. Merkwürdigerweise ist er erleichtert. Nichts Lebensbedrohliches. Mit Fleischwunden wird man fertig. Wie Risa immer gesagt hatte, als sie den Sanitätsflieger auf dem Friedhof leitete: »Ein paar Stiche sind das kleinste Übel.« Diese Wunde bräuchte ungefähr ein Dutzend. Das einzige Problem besteht darin, herauszufinden, wo ein angeblich toter, flüchtiger EA, ein eigenmächtig Abwesender, medizinisch versorgt werden kann.
Er und Lev steigen aus und klettern aus dem Graben, um das überfahrene Tier zu untersuchen. Connors Beine sind schwach, und seine Knie zittern, aber das möchte er sich nicht eingestehen. Deshalb schiebt er das Zittern auf das viele Adrenalin in seinem Körper. Er betrachtet seinen Arm, den mit dem Hai-Tattoo, und ballt die Hand zur Faust, um die brutale Kraft dieses gestohlenen Arms für seinen restlichen Körper nutzbar zu machen.
»Ist das ein Strauß?«, fragt Lev, als sie den großen toten Vogel betrachten.
»Nein«, blafft Connor, »das ist der verdammte Road Runner.«
Das war tatsächlich Connors erster, absurder Gedanke gewesen, als der riesige Vogel im Licht seiner Scheinwerfer aufgetaucht war. Der Strauß, der vor einer Minute noch so lebendig gewesen war, dass er mit den Krallen Connors Brust aufreißen konnte, ist jetzt mausetot. Sein zerfetzter Hals ist grotestk verdreht, und seine glasigen Augen starren sie durchdringend an, als wäre er ein Zombie.
»Vogelschlag.« Lev scheint nicht mehr beunruhigt zu sein, sondern spricht einfach aus, was er wahrnimmt. Vielleicht, weil er nicht selbst gefahren ist. Vielleicht aber auch, weil er viel schlimmere Dinge gesehen hat als einen überfahrenen Laufvogel. Connor beneidet Lev darum, wie ruhig er in schwierigen Situationen bleibt.
»Warum zum Teufel ist hier ein Strauß auf der Autobahn?«, fragt Connor. Das Klappern eines Zauns in einer plötzlichen Windbö beantwortet seine Frage. Die Scheinwerfer vorbeifahrender Autos beleuchten den im Sturm herabgestürzten Ast einer Eiche, der so schwer war, dass er ein Stück aus dem Maschendrahtzaun herausgerissen hat. Hinter dem Zaun bewegen sich langhalsige Schatten. Ein paar Strauße sind bereits durch das Loch geschlüpft und streben der Straße zu. Hoffentlich haben sie mehr Glück als ihr Kamerad.
Connor hat davon gehört, dass Straußenfarmen immer beliebter werden, seit die Preise für anderes Fleisch angestiegen sind, aber er hatte nie eine gesehen. Ihm schießt die absurde Frage durch den Kopf, ob der Tod des Vogels wohl Selbstmord war. Lieber überfahren als gegrillt werden.
»Hast du gewusst, dass sie früher Dinosaurier waren?«, fragt Lev.
Connor holt tief Luft und merkt erst jetzt, wie flach er geatmet hat. Wegen des Schocks, aber auch wegen der Schmerzen. Er zeigt Lev seine Wunde. »Was mich betrifft, sind sie es immer noch. Das Ding wollte mich anscheinend ›umwandeln‹.«
Lev verzieht das Gesicht. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Alles gut.« Connor zieht seine Jacke aus, und Lev hilft ihm, sie als provisorischen Druckverband fest um seinen Brustkorb zu binden.
Sie drehen sich zu ihrem Auto um. Wenn sie mit einem Lastwagen zusammengestoßen wären statt mit einem flugunfähigen Vogel, hätte der Schaden auch nicht größer sein können.
»Na ja, du wolltest die Karre doch sowieso in ein oder zwei Tagen irgendwo stehen lassen, oder?«
»Ja, aber nicht total demoliert.«
Die Kellnerin, die ihnen freundlicherweise ihr Auto überlassen hatte, wollte es erst in ein paar Tagen als gestohlen melden. Connor kann nur hoffen, dass sie mit dem Geld von der Versicherung glücklich wird.
Ein paar Autos fahren vorbei. Das Wrack ist weit genug von der Straße entfernt, dass es unbemerkt bleibt, wenn jemand nicht genau hinschaut. Aber es gibt Menschen, deren Job es ist, genau hinzuschauen.
Ein Wagen fährt vorbei, wird nach ein paar hundert Metern langsamer und wendet auf dem unbefestigten Mittelstreifen. Dabei wird er von den Scheinwerfern eines anderen Wagens angestrahlt: Es ist ein schwarzweißes Patrouillenfahrzeug der Autobahnpolizei. Vielleicht hat der Polizist sie gesehen, vielleicht auch nur die Strauße – jedenfalls sind ihre Möglichkeiten auf einmal sehr eingeschränkt.
»Lauf!«, ruft Connor.
»Die sehen uns!«
»Erst wenn sie den Suchscheinwerfer anstellen. Lauf!«
Der Streifenwagen hält am Straßenrand, und Lev streitet nicht länger. Er dreht sich um und rennt los, als Connor ihn am Arm packt. »Nein, hier lang.«
»Zu den Straußen?«
»Vertrau mir!«
Der Suchscheinwerfer flammt auf. Doch er richtet sich auf einen der Vögel, der sich der Straße nähert, nicht auf sie. Connor und Lev erreichen das Loch im Zaun. Um sie herum stieben Vögel auseinander – noch mehr bewegte Ziele für den Polizeischeinwerfer.
»Durch den Zaun? Bist du verrückt?«, flüstert Lev.
»Wenn wir am Zaun entlangrennen, kriegen sie uns. Wir müssen verschwinden. Und das ist der einzige Weg.«
Mit Lev an seiner Seite quetscht Connor sich durch den kaputten Zaun und rennt wie schon so oft in seinem Leben blind in die Dunkelheit.
ES FOLGT EIN BEZAHLTER POLITISCHER WERBESPOT
Vergangenes Jahr verlor ich meinen Mann an einen Einbrecher. Er kam einfach durchs Fenster. Mein Mann stellte sich ihm entgegen und wurde erschossen. Er wird niemals wieder zu mir zurückkommen, aber jetzt steht ein Vorschlag zur Abstimmung, der dafür sorgt, dass Verbrecher für ihre Taten büßen. Auge um Auge.
Indem wir die Umwandlung von Verbrechern legalisieren, entlasten wir nicht nur die überfüllten Gefängnisse, sondern sorgen auch für mehr lebensrettendes Gewebe für Transplantationen. Außerdem ermöglicht das Gesetz der Körperlichen Gerechtigkeit, dass ein Teil der Einnahmen aus den Organverkäufen direkt an die Opfer von Gewaltverbrechen und ihre Familien fließt.
Stimmen Sie für die Gesetzesinitiative 73. Zusammen sind wir stark, geteilt haben Verbrecher keine Chance.
Finanziert von Nationales Bündnis von Opfern für Körperliche Gerechtigkeit
Auf der Straußenfarm können sie nicht bleiben. Im Farmhaus brennt Licht. Höchstwahrscheinlich wurde der Besitzer über die Probleme auf der Autobahn informiert, und bald wird es hier von Polizisten und Helfern, die die Vögel zurücktreiben, nur so wimmeln.
Auf einem unbefestigten Weg, ungefähr einen halben Kilometer von der Farm entfernt, stoßen sie auf einen verlassenen Wohnwagen. Darin ist ein Bett mit einer Matratze, die so verschimmelt ist, dass sie lieber auf dem Boden schlafen.
Connor schläft trotz allem nach wenigen Minuten ein. Er träumt verschwommen von Risa, die er viele Monate lang nicht gesehen hat und vielleicht nie wieder sehen wird. Und er träumt von dem Kampf auf dem Flugzeugfriedhof. Gegen das Räumkommando. In seinen Träumen probiert Connor Dutzende verschiedene Taktiken, um die vielen hundert Jugendlichen, die in seiner Obhut stehen, vor der Behörde zu retten. Keine einzige funktioniert. Es endet immer gleich: Die Kids werden entweder getötet oder in Transporter zum nächsten Ernte-Camp verfrachtet. Sogar Connors Träume sind ohne jede Hoffnung.
Als er aufwacht, ist es Morgen. Lev ist nicht da, und seine Brust schmerzt bei jedem Atemzug. Er lockert den Druckverband. Die Wunde blutet nicht mehr, aber sie ist immer noch rot und entzündet. Dann legt er den provisorischen Verband aus seiner blutverschmierten Jacke wieder an, bis er etwas anderes findet, um die Wunde abzudecken.
Lev ist draußen und erkundet die Umgebung. Und es gibt viel zu erkunden. Was in der Nacht wie ein einsamer Wohnwagen aussah, entpuppt sich als das zentrale »Gebäude« eines Schrottplatzes: So weit das Auge reicht verrostete Autos, Küchengeräte und sogar ein Schulbus, der so alt ist, dass nichts von seiner ursprünglichen Farbe erkennbar und kein einziges Fenster mehr ganz ist.
»Was das wohl für ein Mensch war, der hier lebte«, überlegt Lev.
Als Connor sich umschaut, kommt ihm alles verstörend vertraut vor. »Ich habe über ein Jahr auf einem Flugzeugschrottplatz gelebt«, erinnert er Lev. »Jeder hat seine Gründe.«
»Friedhof, nicht Schrottplatz«, korrigiert Lev.
»Gibt’s da einen Unterschied?«
»Beim einen geht es um ein würdiges Ende. Beim andern um, na ja … Schrott eben.«
Connor schaut auf den Boden und kickt gegen eine verrostete Dose. »Unser Ende auf dem Friedhof hatte nichts mit Würde zu tun.«
»Hör auf«, sagt Lev. »Dein Selbstmitleid wird langsam langweilig.«
Aber es geht nicht um Selbstmitleid, das müsste Lev wissen. Es geht um all die Jugendlichen, die verloren sind. Von mehr als siebenhundert Kids, für die Connor verantwortlich war, starben über dreißig, und ungefähr vierhundert wurden in Ernte-Camps transportiert und umgewandelt. Vielleicht hätte niemand das verhindern können, aber es geschah unter Connors Führung. Er trägt die Verantwortung.
Connor schaut Lev lange an. Der scheint für den Augenblick vollkommen zufrieden damit zu sein, einen Cadillac ohne Räder, ohne Kühlerhaube und ohne Dach zu inspizieren, der innen und außen so von Unkraut überwuchert ist, dass er aussieht wie ein Blumentopf.
»Er hat seine eigene Schönheit, verstehst du?«, meint Lev. »So ähnlich wie gesunkene Schiffe, die am Ende Teil des Korallenriffs werden.«
»Wie kannst du nur so verdammt fröhlich sein?«
Lev antwortet, indem er seine lange blonde Mähne schüttelt und übertrieben fröhlich grinst. »Vielleicht, weil wir leben und weil wir frei sind«, sagt er. »Vielleicht, weil ich im Alleingang deinen Arsch vor einem Teilepiraten gerettet habe.«
Jetzt muss auch Connor unwillkürlich grinsen. »Hör auf. Deine Selbstgefälligkeit wird langsam langweilig.«
Connor kann es Lev nicht zum Vorwurf machen, dass er so fröhlich ist. Er hat seine Mission mit Glanz und Gloria erfüllt. Er war in eine ausweglose Schlacht gezogen und hatte nicht nur einen Ausweg gefunden, sondern auch Connor vor Nelson gerettet, einem in Ungnade gefallenen Jugendpolizisten, sogenannter JuPo, der eine Rechnung mit Connor offen hatte und darauf brannte, ihn auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
»Nach dem, was du getan hast«, sagt Connor zu Lev, »will Nelson bestimmt deinen Kopf.«
»Und andere Teile auch, da bin ich sicher. Aber zuerst muss er mich finden.«
Erst jetzt färbt Levs Optimismus langsam auf Connor ab. Ja, sie sind in einer grässlichen Situation, aber es könnte schlimmer sein. Leben und frei sein zählen schließlich schon was. Und dass sie ein Ziel haben, ein Ziel, an dem sie möglicherweise einige wichtige Antworten bekommen, fügt dem allem noch einen Funken Hoffnung hinzu.
Connor hebt die Schulter. Die Bewegung reizt seine Wunde und erinnert ihn daran, dass sie so bald wie möglich versorgt werden sollte. Diese Komplikation kommt mehr als ungelegen. Keine Klinik oder Notaufnahme wird sich um ihn kümmern, ohne Fragen zu stellen. Aber wenn er die Wunde sauber hält und gut verbindet, bis sie in Ohio sind, wird Sonia für die notwendige medizinische Behandlung sorgen.
Falls sie das Antiquitätengeschäft noch hat.
Falls sie überhaupt noch lebt.
»Kurz bevor wir den Vogel umgenietet haben, kam ein Hinweisschild auf eine Stadt«, sagt Connor zu Lev. »Ich organisiere ein Auto und hol dich dann ab.«
»Nein, ich bin quer durchs ganze Land gefahren, um dich zu finden. Ich lass dich nicht aus den Augen.«
»Du bist schlimmer als ein JuPo.«
»Vier Augen sehen mehr als zwei.«
»Aber wenn sie einen von uns kriegen, kann der andere sich immer noch nach Ohio durchschlagen. Wenn wir zusammenbleiben, riskieren wir, dass sie uns beide schnappen.«
Lev öffnet den Mund, um etwas zu sagen, schließt ihn aber gleich wieder. Connors Logik ist unangreifbar.
»Mir gefällt das ganz und gar nicht«, sagt Lev schließlich.
»Mir auch nicht, aber es ist das Beste, was wir tun können.«
Connor verzieht den Mund zu einem schiefen Grinsen. »Werde Teil des Korallenriffs.«
Der Weg ist weit, vor allem, wenn man Schmerzen hat. Bevor Connor aufgebrochen war, hatte er in dem Wohnwagen ein paar »saubere« Tücher und einen Vorrat an billigem Whiskey gefunden, der sich perfekt zum Reinigen einer Wunde eignete. Das war zwar sehr schmerzhaft, aber wie alle Sporttrainer der Welt sagen: »Schmerz bedeutet, dass die Schwäche den Körper verlässt.« Connor hat Trainer schon immer gehasst. Sobald das Brennen aufgehört hatte, legte er einen festen Verband an, den er jetzt unter einem verwaschenen Flanellhemd trägt, das dem letzten Bewohner des Wohnwagens gehört hat. Das Hemd ist eigentlich zu warm bei der Hitze, aber etwas Besseres hat er nicht gefunden.
Schwitzend und mit schmerzender Wunde zählt Connor die Schritte auf dem unbefestigten Weg, bis er eine asphaltierte Straße erreicht. Noch hat er kein Auto gesehen, aber das ist in Ordnung. Je weniger Augen ihn sehen, desto besser. Einsamkeit bedeutet Sicherheit.
Außerdem hat Connor keine Ahnung, was ihn in der kleinen Stadt erwartet. Großstädte und Vorstädte sind seiner Erfahrung nach ziemlich ähnlich, nur die Geographie ändert sich. Ländliche Gegenden allerdings sind sehr verschieden. Manche Kleinstädte sind Orte, aus denen man kommen und in die man schließlich zurückkehren möchte: warmherzige, einladende Gemeinschaften, die die amerikanische Lebensart atmen, wie der Regenwald Sauerstoff ausstößt. Und dann gibt es Kleinstädte wie Heartsdale, Kansas.
Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Connor sieht sofort, dass Heartsdale wirtschaftlich am Boden liegt. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Damit eine Stadt den Geist aufgibt, genügt es heutzutage, dass eine wichtige Fabrik schließt oder ihre Röcke rafft und mit billigen Arbeitskräften einen internationalen Walzer tanzt. Heartsdale ist jedoch nicht nur wirtschaftlich am Ende, sondern es ist einfach abgrundtief hässlich. Und zwar in jeder Hinsicht.
Die Hauptstraße wird von niedrigen, langweiligen Gebäuden gesäumt, die in verschiedenen Beigetönen gestrichen sind. Connor ist zwar an vielen, offensichtlich gutlaufenden Farmen vorbeigekommen, die im üppigen Grün unter der Julisonne liegen, aber im Zentrum der Stadt gibt es außer dem Unkraut in den Rissen des Straßenbelags überhaupt kein Grün. Eine wenig einladende Kirche ist aus einheitlichen senfgelben Ziegelsteinen gebaut. Die Predigtbotschaft auf der Anschlagtafel lautet: wer w rd für deine S nden büßen? B ngo immer fre tags.
Das attraktivste Gebäude der Stadt ist ein neues, dreistöckiges Parkhaus, aber es ist geschlossen. Wie Connor feststellt, liegt das an dem leeren Bauplatz daneben. Ein Plakat zeigt ein modernes Bürogebäude, das hier erstellt werden soll und für das eines Tages drei Parkdecks notwendig sein könnten, aber der traurige Zustand des Bauplatzes verrät, dass das Bürogebäude bestimmt schon seit zehn Jahren geplant ist und wahrscheinlich niemals gebaut werden wird.
Der Ort ist eigentlich keine Geisterstadt. Viele Menschen gehen ihren morgendlichen Geschäften nach, aber es drängt Connor, sie zu fragen: »Warum macht ihr das überhaupt? Was bringt das?« Doch in so einer Stadt ist jeder, der auch nur einen Funken Überlebensinstinkt in sich spürt, längst abgehauen, vielleicht in eine der vielen anderen Kleinstädte, in denen ein Leben möglich ist und die das Herz haben, das Heartsdale fehlt. Zurückgeblieben ist nur der Bodensatz, der unten im Topf klebt. Und genau das ist das Problem.
Connor gelangt an einen Supermarkt. Ein Publix. Auf dem asphaltierten Parkplatz flirrt die Luft vor Hitze. Wenn er ein Auto stehlen möchte, dann gibt es hier genügend Auswahl, aber alle Autos stehen unter freiem Himmel, so dass er Gefahr läuft, entdeckt zu werden. Eigentlich hofft er, einen Langzeitparkplatz zu finden, wo ein gestohlenes Auto erst nach einem oder mehr Tagen vermisst wird. Selbst wenn es ihm gelänge, einen Wagen von diesem Parkplatz zu entwenden, wäre er innerhalb einer Stunde als gestohlen gemeldet. Aber er braucht sich nichts vorzumachen. Ein Langzeitparkplatz bedeutet, dass die Besitzer der geparkten Autos irgendwohin mussten. Die Leute in Heartsdale sehen nicht so aus, als müssten sie irgendwohin.
Doch der Hunger treibt ihn in den Supermarkt, schließlich hat er schon ewig nichts mehr gegessen. Da er mehr als zwanzig Dollar in der Tasche hat, spricht nichts dagegen, etwas einzukaufen. Und in einem Supermarkt fünf Minuten lang anonym zu bleiben, ist ein Kinderspiel.
Als sich die automatische Tür öffnet, trifft ihn ein kalter Luftstrom. Zuerst fühlt er sich erfrischt, aber dann kleben seine schweißnassen Kleider kalt an seinem Körper. Der Verkaufsraum ist hell erleuchtet und voller Kunden, die sich langsam durch die Gänge schieben. Wahrscheinlich wollen sie nicht nur einkaufen, sondern auch der Hitze entrinnen.
Connor schnappt sich belegte Sandwiches und ein paar Getränkedosen und geht dann zur Selbstbedienungskasse, aber sie ist geschlossen. Keine Chance heute, menschlichen Kontakt zu vermeiden. Vorsichtshalber wählt er einen Kassierer aus, der desinteressiert und unaufmerksam wirkt. Er ist wahrscheinlich nur ein oder zwei Jahre älter als Connor, dünn, mit strähnigen schwarzen Haaren und einem Babyflaum-Schnauzer, der unmöglich aussieht. Der Kassierer greift nach Connors Waren und zieht sie über den Scanner.
»Haben Sie sonst noch einen Wunsch?«, fragt er abwesend.
»Nein.«
»War alles in Ordnung für Sie?«
»Ja, kein Problem.«
Als er zu Connor aufschaut, erwidert er seinen Blick einen Augenblick zu lang, aber vielleicht hat er ja die Anweisung, Kunden in die Augen zu schauen, ebenso wie er standardmäßig seine Routinefragen stellen muss.
»Brauchen Sie Hilfe beim Raustragen?«
»Nein, das schaff ich schon.«
»Okay, Mann. Bewahren Sie einen kühlen Kopf. Draußen ist es affenheiß.«
Connor verlässt den Supermarkt ohne weiteren Zwischenfall. Er hat den Parkplatz schon zur Hälfte überquert, als er gerufen wird:
»He, warten Sie!«
Connors Körper spannt sich an, seine rechte Hand ballt sich reflexartig zur Faust. Als er sich umdreht, sieht er den Kassierer, eine Geldbörse schwenkend, auf sich zukommen.
»Hey, Mann! Sie haben das hier an der Kasse liegen lassen.«
»Tut mir leid«, sagt Connor. »Gehört mir nicht.«
Der Kassierer öffnet die Geldbörse und betrachtet den Führerschein. »Wirklich nicht? Aber …«
Der Angriff kommt so plötzlich, dass Connor völlig überrumpelt ist. Keine Chance, den Schlag abzuwehren. Ein Tritt zwischen die Beine, ein Schock, dem eine anschwellende Woge scheußlicher Schmerzen folgt. Connor schlägt auf seinen Angreifer ein, und Rolands Arm lässt ihn nicht im Stich. Er landet einen kräftigen Stoß gegen den Kiefer des Kassierers und holt mit seinem natürlichen Arm aus, aber inzwischen ist der Schmerz so übermächtig, dass in dem Fausthieb keine Kraft mehr steckt. Auf einmal ist der Angreifer hinter Connor und nimmt ihn in den Würgegriff. Connor wehrt sich immer noch. Er ist größer als dieser Typ und stärker, aber der Kassierer weiß, was er tut, und Connor reagiert wie in Zeitlupe. Der Arm des Angreifers drückt auf seine Luftröhre und Halsschlagader. Ihm wird schwarz vor Augen. Gleich wird er ohnmächtig sein. Das einzig Gute daran ist, dass er dann die unerträglichen Schmerzen in seinem Bauch nicht mehr spürt.
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Früher habe ich mich über Klatscher lustig gemacht, aber dann haben drei meine Schule angegriffen und sich in einem überfüllten Flur in die Luft gesprengt. Wer hätte gedacht, dass eine einfache Handlung wie Klatschen so viel Leid verursachen kann? Ich habe an diesem Tag viele Freunde verloren.
Wenn du denkst, du kannst nichts tun, um die Klatscher zu stoppen, dann liegst du falsch. Zeige verdächtige Jugendliche aus deiner Nachbarschaft an, denn die meisten Klatscher sind unter zwanzig. Achte auf Menschen, die viel zu warm gekleidet sind, denn Klatscher polstern sich oft mit dicken Kleiderschichten, damit sie nicht versehentlich detonieren. Achte außerdem auf Menschen, die übervorsichtig gehen, so, als ob jeder Schritt ihr letzter sein könnte. Und denk dran, dich in deiner Gemeinde für ein Applausverbot bei öffentlichen Veranstaltungen einzusetzen.
Gemeinsam können wir den Klatschern ein für alle Mal ein Ende bereiten. Unsere Hände gegen ihre.
Finanziert von Hände auseinander für den Frieden®
Connor erwacht mit einem Ruck. Er ist sofort voll bei Bewusstsein und hellwach. Keine trüben Augenblicke der Ungewissheit. Er weiß: Er wurde angegriffen und steckt in Schwierigkeiten. Die Frage ist nur, wie groß diese Schwierigkeiten sind.
Die Wunde auf seiner Brust schmerzt, sein Kopf pocht, aber er verdrängt es und inspiziert rasch seine Umgebung. Mauern aus Betonschalsteinen. Schmutziger Fußboden. Das ist gut. Er ist also nicht in einem Gefängnis oder einer Arrestzelle. Eine einsame Glühbirne, die über seinem Kopf baumelt, ist die einzige Lichtquelle. An der Wand zu seiner Rechten stapeln sich Lebensmittelvorräte und Kisten mit Wasserflaschen. Links von ihm führt eine Betontreppe zu einer Luke nach oben. Vielleicht ist er in einem Sturmkeller? Das würde die Notvorräte erklären.
Er will sich bewegen, aber seine Hände sind hinter seinem Rücken an einen Pfosten gefesselt.
»Endlich!«
Connor wendet den Kopf. In der dunklen Ecke bei den Lebensmittelvorräten sitzt der Supermarktkassierer mit den fettigen Haaren. Jetzt, wo er entdeckt ist, rutscht er nach vorne ins Licht. »Dieser Würgegriff setzt einen normalerweise zehn, vielleicht auch zwanzig Minuten außer Gefecht, aber du warst fast eine ganze Stunde weg.«
Connor schweigt. Jede Frage, jede Äußerung ist ein Zeichen von Schwäche. Er will diesem Loser nicht mehr Macht geben, als er ohnehin schon hat.
»Wenn ich dich zehn Sekunden länger festgehalten hätte, wärst du tot. Oder hättest zumindest einen Hirnschaden. Du hast keinen Hirnschaden, oder?«
Connor schweigt weiter und schaut ihn nur kalt an.
»Als ich dich angeschaut habe, wusste ich sofort, wer du bist«, sagt er. »Die Leute sagten, der Flüchtling aus Akron wäre tot, aber ich wusste, dass sie lügen. ›Habeas Corpus‹, habe ich gesagt. ›Bringt mir seine Leiche‹. Aber das konnten sie nicht, weil du nicht tot bist!«
Jetzt ist es um Connors Beherrschung geschehen. »Habeas Corpus heißt doch was ganz anderes, Idiot.«
Der Kassierer kichert, zieht sein Handy heraus und macht ein Foto. Das Blitzlicht löst ein Pochen in Connors Kopf aus. »Hast du eine Ahnung, wie cool das ist, Connor? Ich darf dich doch Connor nennen, oder?«
Connor schaut nach unten. Die Wunde auf seiner Brust ist inzwischen mit richtigem Verbandsmull und Pflaster neu versorgt. Erst jetzt merkt er, dass er kein Hemd trägt.
»Was hast du mit meinem Hemd gemacht?«
»Hab ich dir ausgezogen. Als ich das Blut gesehen habe, musste ich nachschauen. Wer hat dich verletzt? Ein JuPo? Hast du so gut ausgeteilt, wie du eingesteckt hast?«
»Ja«, sagt Connor. »Er ist tot.« Und sein darauffolgender böser Blick sagt hoffentlich: Und du bist der Nächste.
»Das hätte ich gern gesehen!«, sagt der Kassierer. »Du bist mein Held. Das weißt du, oder?« Und dann verliert er sich in einer abstrusen Schwärmerei. »Der Flüchtling aus Akron jagt das Ernte-Camp ›Happy Jack‹ in die Luft und entkommt, bevor er umgewandelt werden kann. Der Flüchtling aus Akron betäubt einen JuPo mit seinem eigenen Betäubungsgewehr. Der Flüchtling aus Akron verwandelt ein Zehntopfer in einen Klatscher!«
»Das habe ich nicht getan.«
»Ja, gut, aber den Rest. Und das reicht.«
Connor muss an Lev denken, der draußen auf dem Schrottplatz auf ihn wartet, und ihm wird schlecht.
»Ich habe deine Karriere verfolgt, Mann, bis sie gesagt haben, dass du tot bist. Aber ich habe das nie geglaubt, nicht eine Minute. Ein Typ wie du lässt sich nicht so leicht kleinkriegen.«
»Es war keine Karriere.« Connor finde die spezielle Art der Heldenverehrung dieses Jungen widerlich, aber der scheint ihm gar nicht zuzuhören.
»Du hast die Welt aufgerüttelt. Ich könnte das auch, weißt du? Brauche bloß die Gelegenheit dazu. Und vielleicht einen Komplizen, der weiß, was er tut. Der weiß, wie man sich mit denen da oben angelegt. Du kapierst, worauf ich rauswill, oder? Klar kapierst du das, du bist schlau genug. Mir war immer klar, dass wir Freunde wären, wenn wir uns begegnen würden. Wir passen zusammen, Gleichgesinnte und so.« Dann lacht er. »Der Flüchtling aus Akron in meinem Sturmkeller. Kann kein Zufall sein. Das ist vom Schicksal bestimmt, Mann! Vom Schicksal bestimmt!«
»Du hast mir in die Eier getreten. Das war nicht Schicksal, sondern dein Fuß.«
»Ja, tut mir leid. Aber versteh doch. Ich musste was tun, sonst wärst du einfach abgehauen. Es tut weh, ich weiß, aber es ist nicht wirklich was kaputt. Du nimmst mir das doch nicht krumm, oder?«
Connor kann sich ein bitteres Lachen nicht verkneifen. Ob wohl jemand gesehen hat, wie er angegriffen wurde? Falls ja, war es ihnen egal. Oder wenigstens so egal, dass sie den Angriff nicht verhinderten.
»Freunde fesseln einander nicht«, gibt Connor zu bedenken.
»Ja, tut mir auch leid.« Aber er macht keine Anstalten, ihn loszubinden. »Das ist das Dilemma. Du weißt, was ein Dilemma ist, oder? Klar weißt du das. Schau mal, wenn ich dich losbinde, haust du wahrscheinlich ab. Also muss ich dir klarmachen, dass ich ein Supertyp bin, ein anständiger Kerl, obwohl ich dich niedergeschlagen und gefesselt habe. Ich muss dir klarmachen, dass du einen Freund wie mich in dieser Scheißwelt nicht so leicht findest und dass du genau hier sein willst. Du musst nicht mehr weglaufen. Weißt du, in Heartsdale sucht niemand nach irgendwem.«
Sein Kidnapper steht auf und geht gestikulierend auf und ab. Seine Augen weiten sich beim Sprechen, als ob er am Lagerfeuer eine Geschichte erzählen würde. Er schaut Connor nicht einmal mehr an, während er seine kleine Phantasterei vor sich hin spinnt. Connor lässt ihn einfach reden. Vielleicht finden sich in seinem Geplapper ja ein paar Informationen, die Connor gebrauchen kann.
»Ich hab schon alles geplant«, fährt der Typ fort. »Wir färben dir die Haare so dunkel wie meine. Und ich kenne jemanden, der dir für wenig Geld Pigmente in die Augen spritzt, damit sie dunkelbraun werden wie meine. Obwohl dein eines Auge ein bisschen anders ist als das andere. Aber wir kriegen das schon hin, dass sie zusammenpassen, was? Dann sagen wir den Leuten, dass du mein Cousin aus Wichita bist, schließlich wissen alle, dass ich Familie in Wichita habe. Mit meiner Hilfe verschwindest du einfach, und kein Mensch erfährt, dass du nicht tot bist.«
Der Gedanke daran, auch nur im Entferntesten so auszusehen wie dieser Typ, ist fast so unangenehm wie ein Tritt in die Eier. Und in Heartsdale verschwinden? Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht werden. Dennoch zaubert Connor das freundlichste Lächeln auf sein Gesicht, das er zustande bringt.
»Du sagst, wir sollen Freunde sein, aber ich weiß nicht mal deinen Namen.«
Der Kassierer sieht gekränkt aus. »Er stand auf meinem Namensschild im Supermarkt. Erinnerst du dich nicht?«
»Ich habe es nicht bemerkt.«
»Bist nicht besonders aufmerksam, was? Ein Typ in deiner Situation sollte aufmerksamer sein.« Und dann fügt er hinzu: »Nicht hier natürlich. Ich meine deine Situation da draußen.«
Connor wartet ab, bis sein Kidnapper endlich sagt: »Argent. Wie Sergeant, nur ohne s. Das französische Wort für Geld. Argent Skinner, zu Diensten.«
»Von den Skinners aus Wichita.«
Argent sieht ein bisschen erschrocken aus, fragt aber dann argwöhnisch: »Du hast von uns gehört?«
Connor überlegt, ob er mit ihm spielen soll, aber Argent würde das sicher nicht besonders gut aufnehmen, sobald er es herausgefunden hat. »Nein, du hast das vorhin erwähnt.«
»Ach ja.«
Jetzt schaut Argent ihn einfach grinsend an, bis die Luke aufschwingt und jemand die Treppe herunterklettert. Die Frau sieht ein bisschen aus wie Argent, ist aber ein paar Jahre älter, größer und ein bisschen korpulenter, nicht fett, aber ein bisschen teigig und unförmig. Altbacken, wenn man eine so junge Frau altbacken nennen kann. Ihr Gesichtsausdruck wirkt noch dümmlicher als der von Argent, wenn das überhaupt möglich ist.
»Ist er das? Darf ich ihn sehen? Ist er es wirklich?«
Schlagartig ändert sich Argents Verhalten. »Du hältst deine verdammte Klappe!«, schreit er. »Soll die ganze Welt wissen, wer bei uns zu Besuch ist?«
»’tschuldigung, Argie.« Ihre breiten Schultern sinken unter dem Verweis regelrecht zusammen.
Connor hält sie für Argents ältere Schwester. Sie muss 22 oder 23 Jahre alt sein, obwohl sie sich benimmt, als wäre sie viel jünger. Der abwesende Ausdruck auf ihrem Gesicht verrät eine Dummheit, für die sie nichts kann, obwohl Argent sie offensichtlich dafür verantwortlich macht.
»Wenn du uns Gesellschaft leisten willst, dann setz dich in die Ecke und sei still.« Argent wendet sich wieder an Connor. »Grace hat ein Problem damit, ihre Stimme auf Zimmerlautstärke zu benutzen.«
»Wir sind nicht im Zimmer«, verteidigt sich Grace. »Der Schutzraum ist im Garten. Das ist nicht im Haus.«
Argent seufzt und schüttelt den Kopf. Er schaut Connor mit übertriebener Leidensmiene an. »Verstehst du, was ich meine?«
»Ja, klar«, antwortet Connor. Er registriert einen weiteren Informationsschnipsel: Dieser Keller ist nicht im Haus, sondern im Garten. Wenn es Connor also gelingt, aus dem Keller zu fliehen, ist er der Freiheit vielleicht gleich ein Dutzend Meter näher. »Wird es nicht schwierig, geheim zu halten, dass ich hier unten bin«, fragt Connor, »wenn alle anderen nach Hause kommen?«
»Kommt aber niemand«, sagt Argent. Genau das wollte Connor wissen. Aber er ist ein bisschen zwiegespalten, wie er es bewerten soll. Wenn es in diesem Haushalt noch andere Leute gäbe, wäre vielleicht jemand so vernünftig und würde diese Sache stoppen. Andererseits würde ein vernünftiger Mensch Connor wahrscheinlich an die Behörden ausliefern.
»Na ja, ich dachte mir, ihr habt ein Haus, also müsst ihr eine Familie haben. Eltern vielleicht.«
»Tot«, sagt Grace. »Tot, tot, tot.«
Argent wirft ihr einen strengen, warnenden Blick zu, bevor er sich wieder an Connor wendet. »Unsere Mutter ist sehr jung gestorben. Und unser Vater ist letztes Jahr abgekratzt.«
»Und das ist gut so«, fügt Grace grinsend hinzu. »Er wollte Argents kümmerlichen Arsch umwandeln lassen – wegen dem Geld.«
Mit einer geschmeidigen Bewegung greift Argent eine Wasserflasche und wirft sie nach Grace. Sie duckt sich, aber nicht schnell genug, und die Flasche prallt mit der Geschwindigkeit eines Baseballs seitlich gegen ihren Kopf, so dass sie vor Schmerz aufschreit.
»ER HAT DAS NUR SO GESAGT!«, schreit Argent. »ICH WAR ZU ALT, UM UMGEWANDELT ZU WERDEN.«
Grace hält sich den Kopf, bleibt aber aufmüpfig. »Für Teilepiraten warst du nicht zu alt. Ihnen ist es egal, wie alt du bist!«
»HAB ICH DIR NICHT GESAGT, DU SOLLST DIE KLAPPE HALTEN?« Argent braucht einen Augenblick, bis sein Zorn verraucht ist, dann sucht er in Connor einen Verbündeten. »Grace ist wie ein Hund. Manchmal musst du ihr den Stock zeigen.«
Connor kann seinen eigenen Zorn kaum zügeln. »Das war mehr als zeigen.« Er schaut zu Grace hinüber, die sich immer noch den Kopf hält, aber Connor ist sicher, dass vor allem ihre Seele verletzt ist.
»Ja, schon, aber über das Umwandeln macht man keine Scherze«, sagt Argent. »Das weißt du besser als jeder andere. Ehrlich gesagt, hätte unser Vater uns beide umwandeln lassen, wenn er gekonnt hätte. Damit er unsere Mäuler nicht mehr stopfen muss. Aber Grace war nie zugelassen. Schwachsinnige dürfen per Gesetz nicht umgewandelt werden. Nicht mal Teilepiraten tun es. Und mich konnte er nicht umwandeln lassen, weil er mich gebraucht hat. Damit ich für Grace sorge. Kapierst du das?«
»Ja, verstehe.«
»Minderbegabt«, raunzt Grace. »Nicht schwachsinnig. Ich bin minderbegabt. Ist nicht so beleidigend.«
In Connors Ohren klingt minderbegabt allerdings durchaus beleidigend. Er dreht seine Hände und testet, wie fest die Knoten sitzen. Argent kennt sich offenbar mit Knoten aus, denn die Fesseln geben überhaupt nicht nach. Seine beiden Hände sind jeweils einzeln verschnürt, so dass er aus beiden Fesseln herausschlüpfen muss, um freizukommen. Die Situation erinnert Connor daran, wie er Lev an einen Baum fesselte, nachdem er ihn zum ersten Mal befreit hatte. Er hatte ihn gegen seinen Willen festgehalten, um sein Leben zu retten. Nun ja, denkt Connor, früher oder später rächt sich alles. Jetzt ist er jemandem ausgeliefert, der denkt, er halte ihn zu seinem eigenen Besten fest.
»Hast du zufällig die Sandwiches noch, die ich gekauft habe?«, fragt Connor. »Ich sterbe nämlich vor Hunger.«
»Nö. Die sind wahrscheinlich immer noch auf dem Parkplatz.«
»Also, wenn ich dein Gast bin – findest du es dann nicht unhöflich, mir nichts zu essen zu geben?«
Argent denkt darüber nach. »Ja, das ist unhöflich. Ich mach dir was.« Er befiehlt Grace, Connor eine Flasche Wasser aus ihren Überlebensvorräten zu geben. »Mach keinen Blödsinn, solange ich weg bin.«
Connor ist sich nicht sicher, ob er mit ihm redet oder mit Grace, aber eigentlich ist das auch egal.
Als Argent weg ist und Grace nicht mehr unter dem Einfluss ihres Bruders steht, wirkt sie sichtlich entspannter. Sie hält Connor die Wasserflasche hin, merkt aber dann, dass er sie nicht nehmen kann. Also dreht sie den Verschluss ab und kippt Connor das Wasser in den Mund. Er bekommt einen guten Schluck ab, aber das meiste spritzt auf seine Hose.
»Entschuldigung!« Grace wirkt fast panisch. Connor weiß, warum.
»Keine Sorge. Ich sag Argent, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Kein Grund, wütend auf dich zu werden.«
Grace lacht. »Er wird schon einen Grund finden.«
Connor schaut ihr in die Augen. Es liegt eine Treuherzigkeit darin, die nun langsam verschwindet. »Er behandelt dich nicht besonders gut, was?«
»Wer, Argie? Nö, der ist schon okay. Er ist einfach wütend auf die Welt, aber die Welt ist nicht da. Nur ich.«
Connor muss lächeln. »Du bist schlauer, als Argent denkt.«
»Vielleicht.« Grace ist nicht allzu überzeugt. Sie dreht sich zur geschlossenen Kellertür um und dann wieder zu Connor. »Dein Tattoo gefällt mir«, sagt sie. »Der weiße Hai?«
»Tigerhai«, erklärt Connor. »Ist allerdings nicht mein eigener. Er hat einem Typen gehört, der mich mit genau diesem Arm erwürgen wollte. Hat’s aber nicht geschafft. Hat in letzter Sekunde gekniffen. Egal, er wurde umgewandelt, und ich habe seinen Arm bekommen.«
Grace verarbeitet die Informationen. Sie schüttelt den Kopf und läuft dabei ein bisschen rot an. »Das hast du dir ausgedacht. Meinst du, ich bin so dumm? Dass ich glaube, der Flüchtling aus Akron nimmt den Arm von einem Wandler?«
»Ich hatte keine Wahl. Sie haben mir dieses Ding aufgebrummt, als ich im Koma lag.«
»Du lügst.«
»Binde mich los, und ich zeige dir die Narbe, wo der Arm transplantiert wurde.«
»Netter Versuch.«
»Ja, hätte besser funktioniert, wenn ich mein Hemd anhätte und du die Narbe nicht sowieso sehen würdest.«
Grace kommt näher, geht auf die Knie und untersucht Connors Schulter. »Ich werd verrückt. Ist ja wirklich transplantiert!«
»Ja, und er tut höllisch weh. Man darf einen transplantierten Arm nicht so nach hinten binden.«
Grace schaut ihn an. Vielleicht sucht sie in Connors Augen dasselbe, was er in ihren sucht.
»Du hast auch neue Augen?«, fragt Grace.
»Nur eines.«
»Welches?«
»Das rechte. Das linke ist mein eigenes.«
»Gut«, sagt Grace. »Ich hab nämlich schon entschieden, dass es das ehrliche ist.« Sie greift hinter Connor nach dem Seil. »Ich binde dich nicht los. So blöd bin ich nicht. Aber ich mach das Seil an diesem Arm ein bisschen lockerer. Dann zieht es nicht so an deiner Schulter.«
»Danke, Grace.« Connor spürt, wie sich das Seil löst. Er hat nicht gelogen. Seine überdehnte Schulter brennt. Als das Seil nachgibt, zieht Connor seine – Rolands – Hand zurück. Sie gleitet durch die Schlaufe und ist frei. Reflexartig ballt sie sich zur Faust und ist bereit zuzuschlagen. Auch Connors Instinkt rät ihm dazu, aber Risas Stimme, die wie ein Transplantat immer in seinem Kopf gegenwärtig ist, hält ihn zurück. Denk nach, würde Risa sagen. Handle nicht überstürzt.
Tatsache ist, dass er nur eine Hand benutzen kann. Ist er in der Lage, Grace mit einem Schlag niederzustrecken, dann seine andere Hand zu befreien und zu fliehen, bevor Argent zurückkehrt? Kann er in seinem derzeitigen Zustand vor den beiden weglaufen? Und was würde passieren, wenn es ihm nicht gelänge? All das schießt Connor im Bruchteil einer Sekunde durch den Kopf. Grace starrt immer noch total geschockt auf Connors befreite Hand und weiß nicht, was sie tun soll. Connor trifft eine Entscheidung. Er holt tief Luft, öffnet die Faust und schüttelt die Hand aus. »Danke. Das fühlt sich schon viel besser an«, sagt er. »Aber jetzt schnell. Fessle meine Hand wieder, bevor Argent zurückkommt – nur nicht wieder ganz so fest.«
Erleichtert fesselt Grace Connor wieder, und Connor lässt sie ohne Widerstand gewähren. »Aber du sagst ihm nicht, was ich gemacht habe, ja?«, bittet Grace.
Connor lächelte sie an. Es ist leichter, ein Lächeln für Grace zustande zu bringen als für Argent. »Das bleibt unser Geheimnis.«
Wenige Augenblicke später kehrt Argent mit einem Schinkensandwich mit mehr Mayo als Schinken zurück. Er füttert Connor damit, merkt aber nicht, dass sich die Dynamik im Raum ein winziges bisschen verändert hat. Grace traut Connor jetzt mehr als ihrem Bruder.
2.Klatscher
Der Klatscher hat Bedenken, aber er hat den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt.
Vor vielen Monaten hatte er auf der Straße eine schlimme Zeit durchgemacht. Um zu überleben, musste er schreckliche, demoralisierende Dinge tun. Sie waren so menschenverachtend, dass nicht mehr viel von ihm übrig war, das sich auch nur entfernt menschlich anfühlte. Er hatte sich der Schande ergeben und sich mit einer Randexistenz auf den schäbigsten abgelegenen Straßen von Sin City abgefunden.
Er war nach Las Vegas gegangen, weil er dachte, ein flüchtiger Wandler könnte dort leicht untertauchen. Aber Las Vegas behandelt keinen gut, der dort strandet. Nur wer die Freiheit hat, die Stadt auch wieder zu verlassen, erhält VIP-Status. Und obwohl die meisten mit leeren Taschen gehen, bleiben sie wenigstens nicht als leere Hülse zurück.
Als der Klatscher angeworben wurde, hatte er seine Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden, bereits eingebüßt. Sie war ihm in jeder Hinsicht ausgetrieben worden. Er war absolut reif für eine Anwerbung gewesen.
»Komm mit mir«, hatte der Anwerber gesagt. »Ich bring dir bei, wie du sie büßen lässt.«
Mit »sie« meinte er all die anderen, das allgemeine »Nicht-Ich«, das sein Leben zerstört hatte. Alle hatten Schuld. Alle mussten büßen. Der Anwerber verstand das, und so war der Handel perfekt.
Jetzt, zwei Monate später, betritt er vorsichtig zusammen mit dem Mädchen seiner Träume ein Fitnessstudio in Portland, Oregon. Das ist weit weg von Las Vegas, weit weg von dem, was einmal sein Leben gewesen war. Je weiter, desto besser. Sein neues Leben, so kurz es auch sein mag, wird leuchtend hell sein. Und laut. Man wird ihn zur Kenntnis nehmen müssen. Dieses zufällige Ziel wurde von jemandem weiter oben in der Klatscher-Hierarchie für sie ausgewählt. Komisch, aber er hätte nie gedacht, dass Klatscher so organisiert sind. Hinter dem Chaos gibt es definitiv eine Struktur. Er schöpft Trost aus dem Gedanken, dass hinter dem Wahnsinn eine Methode steckt.
Er gehört zu einer Zweier-Zelle. Er und das Mädchen wurden von einem kampflustigen Trainer vorbereitet und scharfgemacht, der in seinem vorherigen Leben bestimmt Motivationsredner gewesen war.
»Die Beliebigkeit wird die Welt verändern«, hatte man ihnen eingebläut. »Noch in etlichen Jahren wird man eure Tat loben, und bis dahin wird eure Rache süß sein.«
Dem Klatscher liegt weniger daran, die Welt zu verändern, und mehr daran, Rache zu nehmen. Er wäre erbärmlich auf der Straße gestorben, aber jetzt hat sein bitteres Ende wenigstens eine Bedeutung. Er hat die Kontrolle allein durch das, was passiert, wenn er in die Hände klatscht. Oder macht er sich etwas vor?
»Bist du bereit?«, fragt das Mädchen, als sie auf das Fitnessstudio zugehen.
Er möchte ihr seine Zweifel nicht anvertrauen. Für sie möchte er stark sein. Entschlossen. Mutig. »Maximales Blutbad«, sagt er. »Los!«
Sie betreten das Studio. Er hält ihr die Tür auf, und sie lächelt ihn an. Ein Lächeln, ein Augenblick der Zärtlichkeit – weiter wird ihre Beziehung niemals gehen. Sie wollten mehr, aber es sollte nicht sein. Ein innigeres Verhältnis hatte ihr explosives Blut nicht erlaubt.
»Was kann ich für euch tun?«, fragt der Typ an der Rezeption.
»Wir kommen wegen einer Mitgliedschaft.«
»Super! Ich hol euch jemanden.«
Schaudernd atmet das Mädchen tief ein. Der Junge nimmt ihre Hand. Behutsam. Sehr behutsam, denn man braucht nicht immer einen Zünder, um loszugehen. Mit den Zündern geht es schnell und sauber, aber Unfälle passieren.
»Ich möchte bei dir sein, wenn wir … unseren Auftrag erfüllen«, sagt sie.
»Ich auch, aber es geht nicht. Du weißt das. Ich verspreche dir, dass ich an dich denke.« Sie haben Befehl, mindestens zehn Meter voneinander entfernt zu sein. Je weiter die Entfernung desto größer ist die Wirkung.
Ein muskulöser Typ kommt breit lächelnd auf sie zu. »Hallo, ich heiße Jeff. Ich bin für die neuen Mitglieder zuständig. Und wer seid ihr?«
»Sid und Nancy«, sagt der Klatscher. Das Mädchen kichert nervös. Er hätte auch Tom und Jerry sagen können. Es spielt keine Rolle. Sogar ihre richtigen Namen hätte er nennen können, aber die Pseudonyme machen den Betrug irgendwie glaubwürdiger.
»Kommt. Ich mach mit euch beiden die Grand Tour.« Jeffs Zahnpastalächeln ist allein schon Grund genug, den ganzen Laden in die Luft zu jagen.
Er führt sie am Büro des Managers vorbei. Der Manager telefoniert, schaut aber kurz zu den Klatschern auf und hat einen Moment lang Augenkontakt. Der Klatscher wendet den Blick ab, weil er sich durchschaut fühlt. Jeder Fremde, der ihn anschaut, scheint seine Absichten zu erkennen, als ob er die Hände schon ausgebreitet hätte. Aber der Manager wirkt wirklich argwöhnisch. Rasch verlässt der Klatscher sein Gesichtsfeld.
»Dort drüben haben wir die Hanteln. Die Krafttrainingsgeräte mit Gewichten sind hier auf der rechten Seite. Alles natürlich hochmodern mit holographischen Konsolen.« Die beiden hören nicht zu, aber Jeff bemerkt es nicht. »Unsere Aerobic-Halle ist oben.« Jeff gibt ihnen durch ein Zeichen zu verstehen, dass sie ihm die Treppe hinauffolgen sollen.
»Geh du mit ihm, Nancy«, sagt der Klatscher. »Ich schaue mir mal die Hanteln genauer an.« Sie nicken sich kurz zu. Hier gehen sie auf Abstand. Hier nehmen sie Abschied.
Er entfernt sich von der Treppe und betritt den Hantelbereich. Es ist 17 Uhr und sehr voll. Hat er ein schlechtes Gewissen, weil er zu dieser Tageszeit kommt? Nur wenn er den Leuten ins Gesicht schaut, also vermeidet er es. Sie sind keine Menschen aus Fleisch und Blut, sondern reine Phantasiebilder, nur eine Erweiterung des Feindes. Außerdem hat er sich die Tageszeit nicht ausgesucht. Sie hatten Befehl, genau jetzt zu kommen, genau an diesem Tag. Und wenn es um eine so große Sache geht, kann man sich leicht dahinter verstecken, dass man »nur Befehle ausführt«.
Er tritt hinter eine Säule, zieht die runden, pflasterartigen Zünder aus seiner Tasche und befestigt sie an seinen Handflächen. Es passiert wirklich. O mein Gott. O mein Gott …
Und wie ein Echo zu seinen Gedanken hört er: »O Gott.«
Als er aufschaut, steht der Manager vor ihm. Er erwischt ihn mit den centgroßen Zündern, die wie Wundmale in den Handflächen des Klatschers glänzen. Es ist unverkennbar, was er vorhat.
Der Manager packt ihn an den Handgelenken und hält seine Hände auseinander.
»Lassen Sie mich los!«
»Da gibt es etwas, das du wissen solltest, bevor du das tust!«, zischt der Manager. »Du denkst, dass du zufällig hier bist, aber das stimmt nicht. Du wirst benutzt!«
»Lassen Sie mich los, sonst …!«
»Sonst … was? Jagst du mich in die Luft? Genau das wollen sie doch. Ich arbeite für die Anti-Umwandlungs-Front. Wer immer dich schickt, hat es auf uns abgesehen! Hier geht es nicht um Chaos. Hier geht es darum, uns zu beseitigen! Du arbeitest für die falsche Seite!«
»Es gibt keine Seiten!«
Er reißt sich los und will seine Hände zusammenführen … Aber auf einmal ist er sich nicht mehr so sicher. »Sie sind von der AUF?«
»Ich kann dir helfen!«
»Dafür ist es zu spät!« Er spürt das Adrenalin in seinem Körper aufsteigen. Er spürt seinen Herzschlag in den Ohren und fragt sich, ob ein schlagendes Herz ihn in die Luft sprengen kann.
»Wir reinigen dein Blut! Wir retten dich!«
»Sie lügen!« Doch er weiß, dass es möglich ist. Sie haben auch Lev Calder ›entwaffnet‹, oder? Aber dann spürten die Klatscher ihn auf und wollten ihn töten, weil er nicht geklatscht hatte.
Schließlich bemerkt einer der vielen geistesabwesenden Gewichtheber, worüber sie reden: »Klatscher?« Er weicht ein paar Schritte zurück. »KLATSCHER!«, schreit er und rennt schnurstracks zur Tür. Andere erkennen rasch die Situation, und es bricht Panik aus, aber der Manager wendet den Blick nicht von dem Klatscher ab.
»Lass dir helfen!«
Auf einmal wird das Fitnessstudio von einer Explosion erschüttert, und der Boden des Kardiobereichs stürzt herab. Sie hat es getan! Sie hat es getan! Sie ist tot, und er steht immer noch hier.
Blutende Menschen stolpern hustend und schreiend an ihm vorbei. Der Manager packt ihn noch einmal, fast so hart, dass er explodiert. »Du musst ihr nicht folgen! Entscheide selbst. Kämpfe für die richtige Seite!«
Und auch wenn er glauben möchte, dass es tatsächlich eine richtige Seite gibt, dass dieser Hoffnungsschimmer echt ist und keine Täuschung, fliegt in seinem Kopf alles durcheinander wie die brennenden Trümmer, die immer noch auf ihn herabfallen. Darf er sie verraten? Darf er die Tür schließen, die sie geöffnet hat, und sich weigern zu vollenden, was sie begonnen hat?
»Ich bringe dich an einen sicheren Ort. Niemand muss wissen, dass du nicht explodiert bist!«
»Okay.« Er trifft seine Entscheidung. »Okay.«
Der Manager stößt einen Seufzer der Erleichterung aus und lässt ihn los. Im selben Augenblick breitet der Klatscher die Hände aus und schwingt sie gegeneinander.
»Neiiiiiiiiiiin!«
Er ist tot – wie der AUF-Mann, wie alle anderen in dem Fitnessstudio und wie jeder Funke Hoffnung.
3.Cam
Der erste Designermensch der Welt trägt Abendgarderobe.
Sein maßgeschneiderter Smoking ist von höchster Qualität. Er sieht gut aus. Beeindruckend. Imposant. Er sieht älter aus, aber da Alter für Camus Comprix ein sehr vager Begriff ist, kann er nicht genau sagen, wie alt er eigentlich aussehen sollte.
»Gib mir einen Geburtstag«, bittet er Roberta, die an seiner Fliege nestelt. Offenbar konnte kein einziger der Jugendlichen, deren Teile er in seinem Kopf hat, eine Fliege binden. »Weis mir ein Alter zu.«
Roberta ist der einzige Mensch, der jemals annähernd so etwas wie eine Mutter für Cam sein kann. Jedenfalls ist sie vernarrt in ihn wie eine Mutter. »Such dir eines aus«, sagt sie, während sie an seiner Fliege zieht, zupft und zerrt. »Du kennst den Tag, an dem du zusammengefügt wurdest.«
»Falsch«, sagt Cam. »Jeder Teil von mir existierte, bevor ich zusammengefügt wurde. Das ist also nicht der Tag zum Feiern.«
»Jeder Teil eines jeden existiert, bevor er als Individuum der Welt präsentiert wird.«
»Geboren wird, meinst du.«
»Geboren wird«, räumt Roberta ein. »Aber Geburtstage sind reiner Zufall. Babys kommen früh, Babys kommen spät. Das Leben mit dem Tag zu definieren, an dem jemand von der Nabelschnur abgeschnitten wurde, entbehrt jeder Begründung.«
»Aber sie wurden geboren«, betont Cam. »Das heißt, dass ich auch geboren wurde. Nur eben nicht an einem Tag und von verschiedenen Müttern.«
»Wohl wahr.« Roberta tritt einen Schritt zurück und schaut ihn bewundernd an. »Deine Logik ist so untadelig wie dein Aussehen.«
Cam dreht sich um und betrachtet sich im Spiegel. Seine Haare mit den vielen symmetrischen Farbschattierungen sind geschnitten und perfekt frisiert worden. Die verschiedenen Hauttöne, die von einem Punkt in der Mitte seiner Stirn ausgehen, lassen ihn noch phantastischer aussehen. Seine Nähte sind nur noch haarfeine Linien. Eher exotisch als abschreckend. Seine Haut, seine Haare, sein ganzer Körper ist schön.
Warum sollte Risa mich also verlassen?
»Lockdown«, sagt er reflexartig. Dann räuspert er sich und tut so, als ob er gar nichts gesagt hätte. Lockdown ist das Wort, das neuerdings aus ihm herausbricht, wenn er einen Gedanken aus seinem Kopf verbannen möchte. Er kann es einfach nicht verhindern. Das Wort ruft ein Bild von eisernen Türen hervor, die ins Schloss fallen und die Gedanken einschließen, so dass nirgendwo in seinem Kopf ein Austausch stattfinden kann. »Lockdown« ist für Cam eine Lebensweise geworden.
Leider weiß Roberta genau, was das Wort bedeutet.
»10. Oktober«, sagt Cam rasch, bevor Roberta die Gesprächsführung übernehmen kann. »Mein Geburtstag wird am 10. Oktober sein, das ist in diesem Jahr der Kolumbustag.« Was wäre passender als ein Tag, der an die Entdeckung eines Landes und eines Volkes erinnert, die schon da waren und gar nicht entdeckt werden mussten? »Ich werde am 10. Oktober achtzehn.«
»Phantastisch«, sagt Roberta. »Wir geben eine Party für dich. Aber jetzt müssen wir uns auf eine andere Party konzentrieren.« Sie fasst ihn vorsichtig an den Schultern und zwingt ihn, sie anzusehen. Dann korrigiert sie den Sitz seiner Fliege, als würde sie ein Bild an der Wand geraderücken. »Ich bin sicher, dass ich nicht noch einmal betonen muss, wie wichtig diese Gala heute Abend ist.«
»Ja, aber du wirst es trotzdem tun.«
Roberta seufzt. »Es geht nicht mehr um Schadensbegrenzung, Cam«, sagt sie. »Risa Wards Verrat war ein Rückschlag, aber du hast ihn mit Bravour überwunden. Und mehr sage ich nicht zu diesem Thema.« Offenbar aber doch, denn sie fügt hinzu: »Die kritische Beobachtung durch die Öffentlichkeit ist eine Sache, aber jetzt stehst du unter kritischer Beobachtung derer, die in dieser Welt tatsächlich etwas bewegen. Du machst in diesem Smoking eine tolle Figur. Jetzt zeig ihnen, dass du im Innern ebenso prachtvoll bist wie außen.«
»Pracht ist subjektiv.«
»Gut. Dann überzeuge jeden Einzelnen.«
Cam schaut aus dem Fenster. Ihr Wagen ist vorgefahren. Roberta nimmt ihre Handtasche, und Cam, immer Gentleman, hält ihr die Tür auf, als sie den noblen Washingtoner Stadtsitz des Proaktiven Bürgerforums verlassen und in den schwülen Juliabend hinaustreten. Cam vermutet, dass die mächtige Organisation in jeder größeren Stadt des Landes, vielleicht sogar der Welt, eine Residenz besitzt.
Warum hat das Proaktive Bürgerforum so viel Geld und Einfluss für mich geltend gemacht?, fragt sich Cam oft. Je mehr sie ihm geben, desto mehr ärgert er sich darüber, denn es macht seine Gefangenschaft immer deutlicher. Sie haben ihn auf ein Podest gestellt, aber Cam hat inzwischen verstanden, dass ein Podest nichts anderes ist als ein eleganter Käfig. Keine Wände, keine Schlösser, aber wenn man keine Flügel hat, um wegzufliegen, sitzt man in der Falle. Ein Podest ist das heimtückischste Gefängnis, das jemals erdacht wurde.
»Einen Penny für deine Gedanken«, sagt Roberta neckisch, als sie auf den Autobahnring auffahren.
Cam grinst, aber er schaut sie nicht an. »Ich glaube, das Proaktive Bürgerforum kann sich mehr als einen Penny leisten.« Doch er vertraut ihr keinen einzigen Gedanken an, egal, wie viel sie zahlt.
Es dämmert schon, als die Limousine am Potomac entlangfährt. Auf der anderen Seite des Flusses werden die Denkmäler von Washington bereits hell angestrahlt. Das Washington Monument ist fast ganz von einem Gerüst eingehüllt, denn das Pionierkorps bemüht sich, die ausgeprägte Schieflage zu korrigieren, in die das Monument in den vergangenen Jahrzehnten geraten ist. Erosion im felsigen Untergrund und Verschiebungen durch Erdbeben haben der Stadt ihren eigenen schiefen Turm geschenkt. »Von Lincolns Sessel aus gesehen, neigt er sich nach rechts«, haben Politikexperten bekanntlich gesagt, »aber von den Stufen des Kapitols aus gesehen, neigt er sich nach links.«
Cam ist zum ersten Mal in Washington, D.C., aber er hat dennoch Erinnerungen an einen Besuch in dieser Stadt. Zum Beispiel, wie er zusammen mit einer Schwester, die eindeutig umbra war, mit dem Fahrrad die Nationalpromenade entlangfährt. Oder wie er mit Eltern japanischer Herkunft Urlaub macht, die wütend sind, dass sie den Jähzorn ihres kleinen Jungen nicht in den Griff bekommen. Er hat eine farbenblinde Erinnerung an ein riesiges Vermeer-Bild im Smithsonian und eine parallele Erinnerung an dasselbe Kunstwerk, aber in voller Farbenpracht.
Inzwischen macht es Cam fast Spaß, diese verschiedenen Erinnerungen zu vergleichen und gegenüberzustellen. Erinnerungen an dieselben Orte oder Dinge sollten identisch sein, aber sie sind es nie, denn die verschiedenen Wandler, die in seinem Gehirn gegenwärtig sind, sahen die Welt um sich herum auf sehr unterschiedliche Weise. Zuerst fand Cam das verwirrend und beunruhigend, es hatte Angst und Panik in ihm ausgelöst, aber jetzt erscheint es ihm auf kuriose Weise aufschlussreich. Die Vielschichtigkeit seiner Erinnerungen ermöglicht ihm ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt, eine Art Tiefenwahrnehmung jenseits des begrenzten Gesichtsfelds eines einzelnen Menschen. Er hält sich das immer wieder vor Augen, aber dennoch brodelt unter jeder Schicht ein sehr ursprünglicher Zorn. Wenn verschiedene Erinnerungen sich widersprechen, breitet sich der Misston bis zum innersten Kern seines Wesens aus und erinnert ihn daran, dass nicht einmal seine Erinnerungen ihm selbst gehören.
Die Limousine biegt in die geschwungene Einfahrt eines im Plantagenstil erbauten Anwesens ein, das entweder sehr alt ist oder sehr neu, aber auf alt getrimmt wurde, wie so viele Dinge. Stadtautos und Limousinen parken entlang der Auffahrt. Diener drängeln sich, um die Wagen der Gäste zu parken, die ohne Chauffeur gekommen sind.
»Du weißt, dass du in der höchsten Schicht der Gesellschaft angekommen bist«, bemerkt Roberta, »wenn es dir peinlich ist, dass du den Valet-Parkservice nutzen musst.«
Ihre Limousine hält an, und die Tür wird für sie geöffnet.
»Leuchte, Cam«, sagt Roberta zu ihm. »Leuchte wie der Stern, der du bist.«
Sie küsst ihn zärtlich auf die Wange. Erst als sie aussteigen und Robertas Aufmerksamkeit sich auf den Weg vor ihnen richtet, wischt er die Überreste des Kusses mit dem Handrücken ab.
WERBUNG
Wie oft haben Sie schon ein Wort gesucht, das Ihnen auf der Zunge lag, und dann ist es Ihnen doch entwischt? Wie oft wollten Sie sich eine Telefonnummer merken, und dann haben Sie sie einen Moment später doch wieder vergessen? Mit zunehmendem Alter wird es einfach schwieriger, Informationen im Langzeitgedächtnis zu speichern, auf die wir im täglichen Leben angewiesen sind.
Sie können es mit NeuroWeave versuchen, aber das ist teuer und enthält zunächst eigene Informationen, nicht Ihre.