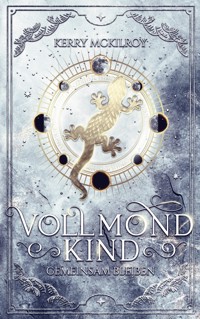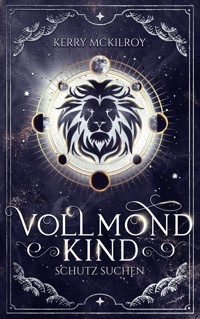Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Vollmondkind
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißender Fantasy-Roman über Vertrauen, Magie und das Geheimnis des Vollmonds Lucys Leben verändert sich in der Nacht ihres 16. Geburtstags für immer. Seit ihrer Kindheit fühlt sie sich in den Nächten des Vollmonds seltsam anders, als würde eine unbekannte Kraft in ihr erwachen. Schlaflose Nächte, lebhafte Träume und allgegenwärtige Gefahr begleiten sie ihr ganzes Leben. Erst jetzt versteht sie, dass darin eine uralte Kraft verborgen liegt. Als eine tiefe, uralte Stimme zu ihr spricht und sie auf die Suche nach dem Hüter der Eule schickt, ahnt sie nicht, dass sie längst Teil der geheimnisvollen Gemeinschaft der Mondkinder ist. Doch wem kann sie vertrauen? Dunkle Mächte verfolgen sie, ihre Gefühle bringen sie völlig durcheinander und jeder scheint Geheimnisse vor ihr zu haben. Wird sie den Mut finden, sich ihrer Bestimmung zu stellen? Kann sie die Magie in sich kontrollieren, bevor es zu spät ist? Für alle Fans von magischen Geschichten voller Geheimnisse, Spannung und ein klein wenig Romantik. Wenn du Bücher wie Tintenherz, Alea Aquarius oder die Chroniken von Narnia liebst, wird dich auch "Vollmondkind - Vertrauen finden" in seinen Bann ziehen. Ein mystischer Fantasy Roman voller Spannung und Emotionen Perfekt für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene, die Urban Fantasy mögen Eine Reise voller Gefahren, Liebe und der Suche nach Wahrheit. Vollmondkind - Vertrauen finden ist der gelungene Debütroman der Schriftstellerin Kerry McKilroy und der Beginn einer magischen Gemeinschaft im Licht des Vollmonds. Sichere dir noch heute dein persönliches Exemplar oder überrasche deine Freunde oder Familie mit einem außergewöhnlichen Geschenk. Der Original-Klappentext - kurz & knapp: Vertraue dem Licht, meide die Schatten. Als an Lucys 16. Geburtstag der Mond zu ihr spricht, lernt sie die geheime Welt der mächtigen Vollmondkinder kennen. Lucy hat kaum Zeit, sich an die neuen Bekanntschaften, ihre Fähigkeiten und die Bestimmung zu gewöhnen. Während sie in einem Strudel aus Freundschaft, Liebe und Verrat gefangen ist, setzt die Finsternis alles daran, sie auf ihre Seite zu ziehen. Viel zu schnell muss Lucy sich entscheiden: Wem kann sie vertrauen? Auftakt der Vollmondkind Saga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
WIDMUNG
Für meine Familie. Ihr seid die Besten. Ohne euch wäre das alles nicht möglich.
INHALTSWARNUNG
Liebe*r Leser*in,
vielen Dank, dass du dich für mein Buch entschieden hast. Damit du die Geschichte von Lucy bestmöglich genießen kannst, gibt es hier eine Themenübersicht, was dich in meinem Roman erwartet. Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Triggerwarnung liest, da sie auch ein Spoiler für den Roman ist.
„Vollmondkind – Vertrauen finden“ enthält Passagen zu Panikattacken, Stalking und Verfolgung, Wutausbrüche nahestehender Personen, Verlust geliebter Menschen, Liebeskummer, Platzangst und Erwähnung von Depressionen.
Bitte gehe zu jeder Zeit achtsam mit dir um.
Falls es dir nicht gut geht, finde jemanden, dem du vertrauen kannst, suche Schutz und hole dir Hilfe.
Ich wünsche dir nun viel Spaß mit meiner Geschichte.
Alles Liebe
Deine Kerry
PS: Danke Katrin und Marie, dass ihr mich auf diesen wichtigen Hinweis aufmerksam gemacht habt.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
EPILOG
PROLOG
10. Januar 2020
Ich sitze hellwach an unserem Dachfenster und schaue in den Himmel. Mit meinen Augen versuche ich die Nacht zu durchdringen, mein Gegenüber fest im Blick, und hoffe auf eine Reaktion. Doch wie immer in letzter Zeit bekomme ich keine Antwort. Hinter mir rascheln die Decken und wenig später umfangen mich starke warme Arme.
„Immer noch Schweigen?“, fragt mein Mann und küsst mir vorsichtig den Nacken.
„Ja“, sage ich und seufze. Ich drehe mich zu ihm um.
„Mach dir keine Gedanken, wer weiß …“, versucht er zu erklären. Aber wie schon zu oft davor gibt es keine helfenden Worte für mein Dilemma.
„Ich mache mir keine Gedanken, ich mache mir Sorgen. Unendliche, unfassbare Unmengen an Sorgen.“
„Ich weiß.“ Er seufzt ebenfalls und umarmt mich fester.
„Bald wird Mel 16. Du weißt, was das bedeutet.“
Statt einer Antwort nickt er und sieht genauso besorgt aus, wie ich mich fühle.
„Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, um all das zu erklären. Um sie zu schützen und auf alles vorzubereiten, was auch immer kommen mag.“
„Ich habe eine Idee“, beginnt er vorsichtig. „Ich wollte es dir schon lange vorschlagen, aber ich wusste nicht, was du davon halten würdest. Aber nun denke ich, vielleicht ist es ein Anfang.“
„Sag schon. Deine Ideen sind immer die besten.“
„Schreib ein Buch.“
„Was?“
„Na, schreib ein Buch. Das wolltest du doch schon immer. Schreib unsere Geschichte auf, warum wir sind, was wir sind, und wie es dazu kam. Nur so kann sie verstehen, was das alles bedeutet.“
Er hat recht. Mal wieder weiß er die Lösung schon, bevor ich das Problem überhaupt erkannt habe. Ein Glück, dass wir seit langer Zeit ein so gutes Team sind. „Weißt du was? Das mache ich, und ich fange direkt damit an. Aber dich lass ich schlafen, du musst morgen wieder fit sein.“
„Und du nicht?“
„Ich kann eh nicht mehr schlafen. Und bevor ich mich sinnlos durch die Nacht grübele, setze ich mich direkt dran. Dann ist die Energie dieser Vollmondnacht zumindest nicht verschwendet.“
Ich gebe ihm noch einen Kuss und könnte schwören, dass er schon wieder eingeschlafen ist, noch ehe ich unser Schlafzimmer verlassen habe. Ich nehme mir meinen Laptop, Block und Stift und mache es mir an unserem großen Esstisch gemütlich. Kein Laut unterbricht die nächtliche Ruhe. Alle außer mir schlafen friedlich, beide Kinderzimmer habe ich eben noch einmal kontrolliert. Nur die Uhr über der Küchentür unterbricht die Stille mit ihrem gleichmäßigen Ticken. Ich nehme einen tiefen Schluck von meinem Kaffee, den ich mir so leise wie möglich gemacht habe, und schreibe:
Es ist wieder Vollmond.
Diese Feststellung meiner Mutter begleitet mich schon mein ganzes Leben. Mal als hilfloser Seufzer, mal mit einem Augenzwinkern und leider viel zu oft als verzweifelter Erklärungsversuch der wechselhaften, unausstehlichen Launen meines Vaters. Vollmond – das heißt Kopf einziehen, im Zimmer verstecken und möglichst unauffällig auf das reibungslose Verstreichen der kritischen Tage hoffen, in denen der Erdtrabant als runde Scheibe am Himmel steht und auf der Erde sein Unwesen treibt.
Der Vollmond war in meinem Leben so präsent, dass ich mich gar nicht erinnern kann, wann ich zum ersten Mal den Verdacht hegte, dass auch an mir diese Nächte nicht spurlos vorübergehen. Schon als Kind habe ich in Vollmondnächten entweder kaum oder nur sehr schlecht geschlafen oder „die wildesten Sachen geträumt“, wie meine Mutter immer zu sagen pflegte. Die Tage durchlief ich meist wie ferngesteuert, stets in Erwartung eines lautstarken Ausbruchs meines Vaters. Gegen Abend wich dies oft dem Gefühl, wieder einen Tag überstanden zu haben, nur um einer weiteren unruhigen Nacht ausgeliefert zu sein.
Wenn ich daran zurückdenke und versuche, den Beginn all dieser unglaublichen Ereignisse auszumachen, die bis heute mein Leben bestimmen, fallen mir nur zwei Gegebenheiten ein. Einerseits mein wiederkehrender Kindheitstraum, kurz bevor ich richtig schlimm krank wurde, und mein 16. Geburtstag – oder vielmehr die Vollmondnächte kurz davor, im Frühjahr 1999 …
KAPITEL 1
30. März 1999
Ich schrecke schweißgebadet in meinem Bett auf, mein Herz rast. Es klopft so wild in meiner Brust, dass man es bestimmt sehen könnte, wäre es nicht stockfinster in meinem Zimmer. In Vollmondnächten muss ich den Rollladen komplett schließen, damit ich überhaupt eine Chance auf Schlaf habe. In der Dunkelheit hält mich der Nachhall meines Traums gnadenlos gefangen. Sequenzen wie Blitzlichtgewitter leuchten vor meinem inneren Auge auf:
Ein kleines Mädchen steht allein auf einem trostlosen Bahnsteig und schaut einem Zug entgegen, der sich am Horizont nähert. Unbeholfene Schritte, wackeliger Stand auf unebenem Gleisbett, die kleinen Füße wie eingefroren. Alle Instinkte verlangen nach Flucht, doch der Körper gehorcht nicht. Eine dampfende, zischende und vibrierende Wand aus Lokomotiven kommt unaufhaltsam näher. Das Kreischen der Bremsen mischt sich mit dem Schrei des Mädchens. Meinem Schrei.
Der Blick auf mein von Panik erfülltes, verzweifeltes Gesicht mit den unzähligen Zügen im Hintergrund ist immer der Moment, in dem ich hochschrecke und aufwache.
So auch heute. Doch nachdem ich meinen Traum zunächst nicht mit den darauffolgenden Krankheiten wie Windpocken oder Lungenentzündung in Verbindung gebracht oder mich später meinem Schicksal ergeben habe, regt sich zum ersten Mal Widerstand in mir. Übermorgen ist mein 16. Geburtstag, den ich unbedingt mit meinen Freundinnen feiern möchte. Schon seit Wochen freue ich mich darauf, dass wir einen lustigen Abend haben werden und ich endlich mal abends weggehen darf. Zwar nicht allzu lange, aber immerhin!
Ich schwinge leise vor mich hinmurmelnd die Füße aus dem Bett. Vielleicht kann ich mit etwas klarer, nächtlicher Frühlingsluft alle schlechten Vorzeichen vertreiben und stattdessen positiv denken. Also ziehe ich meinen Rollladen möglichst geräuschlos hoch. Draußen ist es taghell und an einem sternenklaren, dunkelblauen Nachthimmel steht ein silbern schimmernder Vollmond.
Mein erster Impuls ist, schnell wieder den Rollladen zu schließen und mir am besten noch die Decke über den Kopf zu ziehen, in der Hoffnung, dass ich so das Mondlicht fernhalten kann. Gleichzeitig kann ich mich der Schönheit nicht entziehen und verharre am offenen Fenster. Angenehm warme Frühlingsluft umspielt mich und ich nehme einige tiefe Atemzüge, um die ganze Energie dieser Nacht in mich aufzusaugen. Ich schließe die Augen, mein Herzschlag beruhigt sich und langsam spüre ich wieder neuen Optimismus. Plötzlich habe ich das Gefühl, der silberne Schein des Mondes erstreckt sich bis zu mir, hüllt mich ein und lässt mich in einem unwirklichen, überirdischen Glanz erstrahlen. Einen Moment lang kribbelt mein ganzer Körper wie elektrisiert. Während mich der Mondschein weiter in seiner magischen Umarmung hält, formuliere ich eine dringende Bitte und sende sie dem stummen Himmelskörper.
„Bitte, bitte lass mich diesmal nicht krank werden. Ich freue mich doch so auf meinen Geburtstag.“
Mit aller Energie und aus tiefstem Herzen denke ich fest an diesen einen Wunsch. Auf einmal versichert mir eine tiefe, vibrierende, uralte Stimme: „Alles wird gut.“
Instinktiv reiße ich die Augen auf und dieser unwirkliche, ja fast magische Moment, sofern es ihn überhaupt außerhalb meiner lebhaften Fantasie gab, ist vorüber. Mittlerweile ist es fast ein Uhr nachts, und wenn ich heute in der Schule halbwegs fit sein will, sollte ich versuchen, noch etwas zu schlafen.
Ich flüstere ein „Gute Nacht“ in Richtung Vollmond, als ich das Fenster schließe und mich wieder ins Bett lege. Den Rollladen lasse ich offen, teils weil ich nicht mehr mit viel Schlaf rechne, teils weil ich auf diese Weise eine Rückkehr des Alptraums verhindern möchte. Im Halbschlaf höre ich noch einmal diese unendlich beruhigende Stimme: „Ich bin bei dir.“
Dann bin ich eingeschlafen.
Sollte sich meine Mutter am Morgen über den offenen Rollladen gewundert haben, hat sie zumindest nichts gesagt. Die morgendliche Routine mit Frühstück, Schulzeug packen und Schulbus erreichen lässt der Erinnerung an die vergangene Nacht keinen Raum. Erst als wir in einer Doppelstunde Englisch bei Miss George, einem strengen, kleinen Energiebündel, zum tausendsten Mal die unregelmäßigen Verben durchgehen, schweifen meine Gedanken ab.
Was war das denn letzte Nacht? Ein Traum nach dem Traum?
Apropos Traum: Entgegen all meiner Befürchtungen habe ich tatsächlich die restliche Nacht tief und fest geschlafen. Bislang ist kein Anzeichen irgendeiner Krankheit zu spüren, kein Kratzen im Hals, keine Kopfschmerzen, kein Frieren oder Bauchweh. Trügerische Ruhe oder hält der Mond wirklich sein Versprechen und alles wird gut? Quatsch! Über so viel eigene Dummheit muss ich kopfschüttelnd leise vor mich hin lachen.
Das bringt mir prompt die Aufmerksamkeit von Miss George ein, und ich darf zur Strafe die nächste Runde Verben konjugieren. Problemlos erfülle ich die Aufgabe und mit einem kurzen Nicken entlässt mich Miss George wieder in meine übliche Unauffälligkeit. Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und vermeide jeden Augenkontakt mit denjenigen Mitschülern, die keine Gelegenheit ungenutzt lassen, um über mich herzuziehen. Was kann ich dafür, dass mir Schule so leichtfällt? Dass die meisten Lehrer mich mögen? Dass ich ohne viel Lernen gute Noten schreibe und es nur meiner mündlichen Mitarbeit zu verdanken ist, dass meine Zeugnisnoten lediglich leicht über dem Klassenschnitt liegen?
Zwar habe ich bislang noch nicht den übergroßen „Streber“-Stempel auf der Stirn, ein Außenseiter bin ich trotzdem. Mein Blick bleibt an Tristan hängen, der mir von der anderen Seite des Klassenzimmers schüchtern zulächelt. Er ist ebenfalls so etwas wie ein geduldeter Außenseiter, ein kreativer Kopf mit einem ganz eigenen Humor, den nicht jeder gleich versteht und auf den sich viele in unserer Klasse nicht einlassen können. Also bleibt auch Tristan lieber im Hintergrund. Er versucht, nicht ins Visier der verschiedenen Gruppen zu geraten und konzentriert sich auf vereinzelte Freundschaften innerhalb unseres Jahrgangs. Viel haben wir nicht miteinander zu tun, aber wir respektieren einander, und das ist in unserer Klasse selten genug.
„Lass dich bloß nicht mit dem ein, der ist total uncool“, flüstert meine beste Freundin Natascha von links in mein Ohr. Sie ist mein Lichtblick im grauen Schulalltag und Anschluss an den Rest der Klasse. Wie viele der anderen Mädchen mich nur in ihrer Nähe dulden, weil ich mit Natascha befreundet bin? Wie viele Jungs den Kontakt mit mir suchen, um indirekt an Natascha heranzukommen? Ich will es gar nicht wissen. Mit Natascha kann man eine Menge Spaß haben. Sie sieht das Leben viel entspannter als ich und hat eine ungebremst positive Einstellung, obwohl sich ihre Eltern getrennt haben und sie in der fünften Klasse die Schule wechseln musste, um das Schuljahr zu wiederholen. Seit ihrem ersten Tag in unserer Klasse sind wir unzertrennlich und wenn sie mich ihre „Seelenverwandte“ nennt, fühle ich mich gleich viel besser, akzeptiert und wertvoll. Natascha ist immer am Lächeln und strotzt vor Selbstbewusstsein; auch etwas, was mir fehlt. Dass sie knapp zwei Jahre älter ist als ich, stört uns nicht, und ich genieße jede Minute mit ihr.
Tristan senkt den Blick und auch ich schaue schnell weg.
Während die meisten in der Klasse weiter mit den unregelmäßigen Verben beschäftigt sind, erklärt mir Natascha noch einmal die Ziele für meinen Geburtstagsabend. Mit wem wir reden müssen und mit wem wir auf keinen Fall gesehen werden dürfen. Es folgen Anweisungen für Kleidung, Styling, Makeup. Ihr Vortrag erstreckt sich bis hin zu der angeblichen Symbolkraft meiner Getränkebestellung. Aber bevor ich mit der Frage nach der Bedeutung von Cola meine Unwissenheit erneut unter Beweis stellen kann, klingelt es und der Schultag hat ein Ende.
Zu Hause schwirrt mir noch immer der Kopf von Nataschas Monolog. Ich hatte keine Ahnung, dass es bei einem 16. Geburtstag so viel zu beachten gibt. Zum Glück sieht meine Mutter dem morgigen Ereignis gelassen entgegen und fragt beim Mittagessen nach meinem Schultag. Das hilft mir, wieder einen klaren Gedanken zu fassen, und schnell kehrt die Vorfreude zurück.
Den Nachmittag verbringe ich mit meinen Hausaufgaben. Alle Lehrer wollen uns kurz vor den Osterferien noch einmal alles abverlangen und überhäufen uns mit Aufgaben. Der ein oder andere hat außerdem angekündigt, dass es über die Ferien auch Referate geben wird. Da will ich nichts auf die lange Bank schieben, sondern erledige alle Hausaufgaben direkt.
Es dämmert bereits, als ich das letzte Heft zuklappe und im Rucksack verstaue. Mir raucht der Kopf vor lauter Theorie und ich brauche dringend frische Luft. Im Hintergrund spielt das Radio und ich summe leise vor mich hin, schalte die Schreibtischlampe aus und bin überrascht, wie dunkel es bereits in meinem Zimmer ist. Im Dämmerlicht öffne ich mein Fenster und nehme mit geschlossenen Augen einige tiefe Atemzüge. Sofort geht es mir besser, mein Kopf wird frei und alle Erschöpfung fällt von mir ab. Ich öffne die Augen und lasse den Blick über die Felder vor meinem Fenster schweifen. Vereinzelte Hundebesitzer sind unterwegs und auch die Vögel sind noch eifrig am Zwitschern, als wollten sie mit ihrem Gesang das letzte bisschen Tageslicht festhalten und den Frühling umso schneller herbeisingen.
Ich will mich gerade abwenden und zu meiner Mutter gehen, da fällt mein Blick auf einen „alten Bekannten“ – den Vollmond! Seine silbrige Scheibe erhebt sich über die Wipfel der Obstbäume, als wolle er mich begrüßen. Ich verharre und lasse mich davon verzaubern, wie der Mond das Feld, die Bäume und Wege in durchdringendes Licht hüllt. Auch ich werde von seinem Strahlen erfasst. Wie heute Nacht habe ich das Gefühl, nicht nur von Mondlicht, sondern auch von einer seltsamen Energie eingehüllt zu werden. Ein wohliges Kribbeln breitet sich in meinem ganzen Körper aus, sogar meine Kopfhaut prickelt und ich spüre, wie sich alle feinen Härchen in meinem Nacken aufstellen. Der silberne Schein zieht mich in seinen Bann und ich versinke in einem Strudel aus flirrender, elektrisierender Energie. Ich fühle mich unendlich leicht, durchflutet von einer unglaublichen Zuversicht und würde am liebsten meine Arme ausbreiten und zum Mond fliegen. Ich schließe erneut die Augen und versinke in diesem Moment.
„Geht es dir gut?“
Seine Frage dringt zu mir durch und holt mich aus meinen Gedanken. „Ja, und dir?“
Spontan gebe ich meine unbewusste Antwort, bevor ich die Absurdität meiner Gegenfrage bemerke.
„Danke, auch mir geht es gut, wenn es meinen Kindern gut geht.“
„Deinen Kindern?“
„So nenne ich euch gerne. Ich bin sentimental, entschuldige. Muss am Alter liegen.“
Täusche ich mich oder lacht der Mond gerade über sich selbst? Ich werde verrückt, glaube ich.
„Nein, Lucinda, du wirst nicht verrückt. Aber am Anfang ist alles sehr verwirrend, das gebe ich zu.“
Anfang? Kinder? Ich verstehe gar nichts mehr.
„Lucinda, bald wirst du deine Gabe erkennen. Aber du brauchst Rat und Hilfe. Wende dich an den Hüter der Eule, er wird dir helfen und den richtigen Weg weisen.“
„Welche Gabe? Welcher Hüter?“ Darauf bekomme ich keine Antwort mehr, denn hinter mir wird meine Zimmertür geöffnet.
„Was machst du denn da?“, fragt meine Mutter, als sie zu mir ans Fenster tritt. „Und warum stehst du am offenen Fenster und schaust ins Dunkle? Ist alles okay bei dir?“
„Ja, Mama, alles okay“, beruhige ich sie. „Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen nach all den Hausaufgaben.“
„Alles klar, kommst du runter? Es gibt Abendessen.“
„Mach ich.“
KAPITEL 2
1. April 1999
Dumpfe, stoische Schläge einer Basstrommel holen mich kurz nach Mitternacht aus dem Reich der Träume. Während ich versuche, den stetig ansteigenden Lärm zu ignorieren und wieder einzuschlafen, kommt zum tief dröhnenden Donnern ein weiterer, höherer Ton dazu. Ich weiß, das ist erst der Anfang, und muss trotzdem den Kopf schütteln, als das scheppernde Schlagzeug immer lauter, wilder und unkontrollierter wird.
Mein Vater weiß, wie spät es ist. Er weiß, dass ich direkt im Zimmer nebenan liege und schlafen sollte, damit ich morgen fit für die Schule bin. Er weiß, dass unsere Wände hellhörig sind und er mit seinem Krach auch den ein oder anderen Nachbarn aufweckt.
Mir ist klar, wie groß seine Wut sein muss, dass er all diese Punkte außer Acht lässt und keinen anderen Weg sieht, als sich den Zorn von der Seele zu trommeln. Ja, mein Vater, seiner eigenen Aussage nach der unmusikalischste Mensch unter der Sonne, hat sich vor einigen Jahren ein Schlagzeug zugelegt. Damit umfasst sein Repertoire, um mit seinen Wutattacken umzugehen, zwei Punkte: laufen und trommeln. Das klingt zugegebenermaßen harmlos und ist natürlich deutlich besser, als würde er es direkt an meiner Mutter oder mir auslassen. Aber beides bringt auch unangenehme Begleiterscheinungen mit sich. Wenn er das Haus mit seiner blindwütigen Trommelei zum Erzittern bringt, wünsche ich mir, er wäre stattdessen Laufen gegangen. Dann wäre sein Zorn nicht so gegenwärtig und vorherrschend. Geht er allerdings joggen, und dann noch mitten in der Nacht, kommt meine Mutter schier um vor Sorge, weil er oft stundenlang verschwunden ist.
Noch im Halbschlaf ziehe ich den Kopf ein und verkrieche mich unter meiner Decke. Irgendeine Kleinigkeit scheint ausgereicht zu haben, dass er explodiert und all seine über den Tag aufgestaute Wut an seinem Schlagzeug entlädt.
Ich liege im Bett und weiß nicht, auf wen ich in diesem Moment wütender bin. Auf ihn, der sich seine Stimmung durchdringend laut von der Seele trommelt und es damit indirekt an denjenigen auslässt, die meist am wenigsten dafürkönnen. Oder auf meine Mutter, die es über sich ergehen lässt, anstatt Grenzen zu ziehen und ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Wie so oft bin ich stumme, unsichtbare Zeugin eines unserer ganz speziellen Familiendramen, die erst beendet sind, wenn ihm die Energie zum Trommeln ausgeht.
Ich weiß, ich sollte froh sein, dass er uns nicht schlägt, das wäre noch viel schlimmer. Aber jeder seiner Ausbrüche ist ein Schlag auf die Seele. Ich glaube, dass die Seele meiner Mutter schon oft verletzt wurde. Denn sie weiß, dass sein Trommeln nicht Freude an der Musik ist, sondern der unkontrollierte Ausbruch ungezügelter Wut. Auch wenn ich es nicht ganz verstehe, aber sie leidet doppelt: unter dem Lärm und für ihn, dass es wieder eine Situation gab, die ihn über den Rand seiner Selbstbeherrschung getrieben hat.
Auch heute dauert die gefühlte Ewigkeit nur wenige Minuten und nebenan im Zimmer kehrt Ruhe ein. Stattdessen verlagern sich die Geräusche meines Vaters ins Wohnzimmer, wo nun der Fernseher lauter gestellt wird. Kurze Zeit später höre ich meine Mutter zu Bett gehen.
Bittersalzige Tränen kullern auf mein Kissen und ich balle die Fäuste, bis sich meine Fingernägel schmerzhaft in meine Hände bohren. Am liebsten würde ich aufspringen und ihm die Meinung sagen, aber ich traue mich nicht. Die wenigen Male, in denen ich bislang aufbegehrt habe, hat sein Schlagzeug unmittelbar ein Vielfaches seines Zorns abbekommen und statt es besser zu machen, habe ich es verschlimmert. Also lasse ich diese Episoden wie eine giftige Welle über mich hinwegspülen, halte die Luft an und kneife die Augen zusammen. So warte ich darauf, dass ich wieder frei atmen kann und das sprichwörtliche Unwetter vorüber ist. Das hat sich über die Jahre bei meiner Mutter bewährt und ich habe es unbewusst übernommen. Beide ertragen wir es in einer Art stummer Übereinkunft, immer in der Hoffnung auf ein schnelles Ende. Heute haben sich die Wogen schnell wieder geglättet, wobei ich nicht sagen kann, wie lange das Getrommel schon ging, bevor ich aufgewacht bin. Doch jetzt liege ich wach und kriege kein Auge zu.
Von unten dröhnt der Fernseher mit irgendeiner Sportsendung herauf. Aus dem Schlafzimmer meiner Eltern dringt kein Laut, obwohl meine Mutter mit Sicherheit noch wach ist. Und ich liege grübelnd im Dunkeln. Da suchen sich durch vereinzelte, kleine Ritzen meines Rollladens silbrige Mondstrahlen ihren Weg in mein Zimmer und in mein Bewusstsein. Leise stehe ich auf und lasse Millimeter für Millimeter tröstendes Licht zu mir ins Zimmer.
Wie schon in der Nacht zuvor öffne ich das Fenster und werde augenblicklich von Mondlicht umarmt. Das vertraute, elektrisierende Kribbeln breitet sich auf meiner Haut aus und ich höre ein klares: „Hör auf zu weinen, du kannst ihn nicht ändern.“
Komisch, das sagt meine Mutter auch immer. „Aber man muss doch irgendetwas machen können, das ist wirklich furchtbar so.“ Obwohl ich flüstere, ist es nicht zu überhören, wie aufgebracht und hilflos ich mich fühle.
„Ja, du kannst lernen, damit zu leben und es an dir abprallen zu lassen. Leider finden nicht alle meine Kinder mithilfe der Hüter zu ihrer Gabe. Bei manchen, so wie bei deinem Vater, entwickelt sich aus einer Gabe dann im Laufe der Zeit eine Bürde. Aber was viel wichtiger ist als das Getrommel deines Vaters ist die Tatsache, dass du heute Geburtstag hast. Herzlichen Glückwunsch, mein Kind.“
„Siehst du, vor lauter Wut habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Aber woher weißt du, dass ich Geburtstag habe?“
Ich freue mich über meinen ersten Gratulanten, auch wenn ich niemals einer Menschenseele davon werde erzählen können.
„Ich kenne meine Mondkinder, und glaube mir Lucy, deinen Geburtstag würde ich niemals vergessen. Ich habe sogar ein Geschenk für dich.“
Bevor ich verwundert nachfragen kann, teilt sich der Mondstrahl, der zu meinem Fenster scheint. Eine schmale Silberspur führt seitlich auf meine Fensterbank und erhellt einen etwa Handteller großen Fleck zwischen zwei Blumentöpfen und einem kleinen Porzellanfigürchen aus unserem letzten Urlaub. Ich traue meinen Augen kaum, denn urplötzlich liegt dort eine Art Münze, die seltsam silbrig schimmert und mit merkwürdigen Zeichen versehen ist. Ich nehme sie in die Hand. Das kalte Material wird augenblicklich warm. Mit den Fingerspitzen fahre ich die mir unbekannten Zeichen nach, die eingraviert sind. Details kann ich nicht erkennen, dafür reicht das Licht nicht aus, auch wenn es aussieht, als würde die Münze das Mondlicht nicht nur reflektieren, sondern einfangen.
„Der Hüter der Eule wird dir alles erklären. Folge der Eule und du wirst deine Antworten finden.“
Mein Zimmer ist erfüllt mit halblauter Musik und albernem Gelächter. Natascha ist seit einer Stunde bei mir und gemeinsam machen wir uns ausgehfertig. Für halb neun haben wir uns mit den anderen verabredet. Nun gilt es, uns so gut wie möglich herauszuputzen, ohne dass meine Eltern einen Schreikrampf kriegen und wir in letzter Sekunde doch nicht gehen dürfen. Während wir meinen Kleiderschrank durchforsten und verschiedene Outfits anprobieren, sprechen wir über jeden interessanten Jungen aus unserer Schule. Ich bin sehr gespannt, auf wen wir nachher treffen werden.
Nataschas Geschenk steht auf einem Ehrenplatz neben dem Geburtstagsblümchen meiner Mutter. Es ist eine kleine Steinfigur, die wir bei einem Ausflug entdeckt haben. Ich hatte mich auf den ersten Blick in die Skulptur verliebt und bin gerührt, dass sich Natascha daran erinnert hat und sie mir schenkt.
Nach einer kurzen Fahrt setzt uns mein Vater in der Stadtmitte ab, wir machen einen Treffpunkt mit Uhrzeit für später aus, und dann kann der Abend endlich beginnen. Wir werden bereits erwartet.
Ella und Sue sind auch in meiner Klasse, während Anne nur mit uns Französisch hat und eher zufällig mit dabei ist. Unsere Freundschaft ist zwar nicht so innig wie zwischen Natascha und mir, aber wir anderen sind in den letzten Jahren eng zusammengewachsen. Dabei könnten wir rein äußerlich nicht unterschiedlicher sein. Seit Sue vor drei Jahren in unsere Klasse kam, bin ich endlich nicht mehr das größte Mädchen. Sie hat lange, dunkelbraune Locken, die sie zu den kunstvollsten Frisuren flechten kann. Anne ist kleiner, sportlich und hat immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Mit ihren Piercings und der monatlich wechselnden Haarfarbe ist sie die Flippige in unserer heutigen Gruppe. Natascha und Ella sind ähnlich groß und gehen mir etwa bis zur Schulter. Natascha ist eher zierlich, trägt einen adrett frisierten hellbraunen Pagenkopf und achtet sehr auf ihr Styling. Ella dagegen kann ihre schwarzen Locken kaum bändigen, läuft am liebsten in bequemen Sportklamotten rum und hat von uns allen die weiblichste Figur.
Ich bin die Einzige mit kurzen, blonden Haaren, die im Sommer sehr hell werden und im Winter gerne einen leicht rötlichen Stich bekommen. Die unzähligen Sommersprossen habe ich meiner Mutter zu verdanken, genau wie die strahlend blauen Augen. Mein Vater ist vom Aussehen her eher der südländische Typ, auch wenn meine Großeltern gebürtige Niedersachsen sind.
So unterschiedlich wir von außen betrachtet wirken, wir sind meistens auf einer Wellenlänge und teilen den gleichen Humor.
Jetzt reihen wir uns gut gelaunt in den Strom der Jugendlichen ein, die sich an den Wochenenden in den zahlreichen Innenhöfen entlang der Hauptstraße treffen, die Bars und Cafés bevölkern oder sich einfach ein Plätzchen suchen und in Gruppen zusammensitzen. Unsere erste Anlaufstelle ist eine kleine Bar in einem ausladenden Hinterhof, in der die Mädels fast jedes Wochenende sind. Ich lasse mich treiben, genieße den Abend und fühle mich mit meinen frischen 16 Jahren großartig. Wir ergattern eine gemütliche Nische, von der aus man die komplette Bar im Blick hat und jeden beobachten oder kommentieren kann. Schnell sind wir versunken in lustigen Gesprächen, jeder Neuankömmling wird gemustert und eingeordnet. Wir sind voll in unserem Element, ausgelassen am Lachen und Reden und vergessen dabei fast die Zeit.
Doch Geburtstag hin oder her, mein Vater hat als prinzipientreuer Mensch eine nicht verhandelbare Uhrzeit festgelegt, und so kommt das Ende meiner Feier für mich schneller als gewünscht. Für die anderen ist der Abend noch nicht zu Ende, sie sind alle schon älter oder haben entspanntere Eltern als ich. Mit einem tiefen Seufzer und einer großen Portion Selbstmitleid trinke ich den letzten Schluck meiner Cola aus und wende mich zum Gehen. Natascha und Ella bringen mich zum Treffpunkt mit meinem Vater, während die anderen beiden bleiben, um den Tisch zu blockieren. Sie bestellen sich gerade neue Getränke, als ich mich von ihnen verabschieden muss. Ich drehe mich langsam um und drängle mich durch die mittlerweile zum Bersten volle Bar in Richtung Tür, als meine Aufmerksamkeit von einem Paar atemberaubend schöner, schokoladenbrauner Augen gefangen genommen wird. Unsere Blicke verhaken sich ineinander und für den Moment scheint die Zeit stillzustehen.
Natascha läuft ungebremst auf mich auf. Sie ist noch mit Ella in ein Gespräch vertieft und hat nicht gemerkt, dass ich wie angewurzelt stehen geblieben bin, versunken in diesen unendlich warmen und jetzt sehr amüsiert dreinschauenden Augen.
„Hoppla, Lucy!“, ertönt es nur Sekundenbruchteile bevor mich ein Ellenbogen trifft und grob zwei Schritte nach vorn befördert. Im Stolpern sehe ich aus den Augenwinkeln, wie sich der Besitzer dieser Zartbitterschokoladen-Augen belustigt abwendet. Die Erkenntnis, dass der Rest dieses Typen genauso ansehnlich ist wie die Augen und dass ich mich mit meiner Tollpatschigkeit mal wieder komplett zum Affen gemacht habe, trifft zeitgleich in meinem Kopf ein. Ich seufze.
„Was war denn los eben?“, fragt mich Natascha, kaum dass wir draußen stehen und noch auf Ella warten, die im Gedränge feststeckt.
„Da drin steht ein Typ an der Bar mit den tollsten Augen, die ich je gesehen habe“, schwärme ich.
„Wo? Wer denn?“
„Na, da hinten in der Ecke an den Spielautomaten, der sich gerade mit dem einen Blonden da unterhält.“
„Stimmt, der ist wirklich nicht zu verachten“, sagt Ella, die mittlerweile den Weg nach draußen geschafft hat.
„Wenn du willst, versuchen wir mal ein bisschen was über den Kerl herauszufinden“, bietet Natascha an, kurz bevor wir am Auto meines Vaters ankommen.
„Auf jeden Fall!“ Ich lächle. „Viel Spaß euch noch und danke für den schönen Geburtstag“, verabschiede ich mich beim Einsteigen.
Die Heimfahrt verbringe ich in Gedanken an ein Paar Zartbitterschokolade-Augen, die mich mitten ins Herz getroffen haben.
KAPITEL 3
5. April 1999
Da das Aprilwetter seinem Namen alle Ehre macht, habe ich mich mit einem Buch in meinem Zimmer verkrochen und die Stunden mit Lesen verbracht. Doch nun schleicht sich Langeweile ein und auch wenn es nur noch ein paar Tage sind, bis die Schule wieder losgeht, zieht sich der heutige wie Kaugummi.
Gerade sitze ich im Wohnzimmer und blättere wahllos durch einen Haufen abgelegter Zeitungen. Plötzlich fällt mein Blick auf einen Artikel aus dem Lokalteil der Zeitung vor einigen Tagen: „Neue Bücherei eröffnet.“
Darunter befinden sich ein Bild und die Öffnungszeiten. In diesem Moment kommt meine Mutter und sagt mit einem Blick auf den Artikel: „Geh doch mal hin, schließlich hast du ja deine neuen Bücher schon wieder verschlungen.“
Da ich zudem bei meinem Geschichtsreferat zum Thema Hexenverfolgung in unserer Stadt feststecke und mehr Informationen benötige, mache ich mich wenig später auf den Weg. Die neue Bücherei befindet sich im alten Rathaus unseres kleinen Dorfes, einem liebevoll restaurierten Fachwerkhaus direkt im historischen Ortskern. Ich bin gespannt, ob ich neben hilfreichen Materialien zur Hexenverfolgung auch etwas Unterhaltsames für mich finden werde.
Als ich durch die schwere Eichenholztür in das Innere der Bücherei trete, fühle ich mich sofort wohl. Das wunderschön aufbereitete Fachwerk ist durch einzelne Leuchten in warmes Licht getaucht. Der hohe Raum ist an den Wänden und an der Decke mit allerlei historischen Werkzeugen ausgestattet, von denen einige zu weiteren Lampen umfunktioniert wurden. In der Mitte stehen Regale, antike Kommoden und Schränke voller Bücher. Allerdings ist die Anordnung der Möbel so gelöst, dass sich kleine Nischen ergeben, in denen gemütliche Ohrensessel aus Omas Zeiten stehen und zum Schmökern einladen.
Ich bleibe stehen und lasse diese wohligheimelige Atmosphäre auf mich wirken, atme den markanten Geruch alten Gemäuers und zahlreicher Bücher ein und fühle mich angekommen. Außer mir befindet sich keine Menschenseele in diesem Raum. Aber ich kann Stimmen und Geräusche von oben hören, sodass ich meinen Blick schweifen lasse. Eine schmale, steile Holztreppe führt in ein weiteres Geschoss mit niedriger, rustikaler Decke und vielen kleinen Fensterchen. Hier sind die Bücher ausschließlich in halbhohen Regalen und Schränken gelagert. Von der Treppe aus kann man den kompletten Bereich überschauen. An den Wänden geht eine lange, polierte Holzbank einmal komplett rundherum, die durch unzählige bunte Kissen und kleine Leselämpchen ebenfalls zu gemütlichen Leseplätzen umfunktioniert wurde. Am liebsten würde ich mir sofort eines der Bücher schnappen, mich in eine Ecke kuscheln und einfach nur lesen.
„Hallo, wer bist du denn?“
Ich drehe mich um und entdecke zwei Männer, die mich interessiert aus einer Nische neben dem Treppenaufgang mustern. Neben ihnen ist gerade genug Platz für einen antiken Sekretär, der sich so perfekt in die Ecke einfügt, als habe er schon immer dort gestanden. Eine Leuchte erhellt die dunkelbraune Arbeitsplatte, auf der einige Broschüren, Stifte, Formulare und Stempel liegen. Der jüngere der beiden Männer trägt einen Anzug und sein Gesicht kommt mir vage bekannt vor. Er schenkt mir ein knappes Nicken, bevor er sich wieder seinem Gesprächspartner zuwendet.
Dieser beachtet ihn jedoch gar nicht, sondern lässt weiter seinen Blick auf mir ruhen. Er ist groß, hat eine runde Brille, ein freundliches Gesicht, rotblonde Haare mit leicht grauen Geheimratsecken und eine angehende Halbglatze. Seine kräftige Statur wird von einem ordentlichen Bauch unterstützt, der von einer grauen Strickjacke kaum verdeckt wird. Er ist zu groß für die niedrige Zimmerdecke, weshalb er leicht gebückt an seinen Sekretär gelehnt steht und mich freundlich lächelnd, abwartend anschaut.
„Ich … äh … Ich bin Lucy“, stottere ich.
„Hallo, Lucy. Willkommen in der neuen Bücherei. Mein Name ist Alexander. Wenn du magst, kannst du dich gerne umsehen, ich bin gleich bei dir.“ Mit diesen Worten nimmt er das Gespräch mit dem anderen Mann wieder auf und ich gehe langsam an den mittig stehenden Regalen vorbei. Es gibt eine umfangreiche Auswahl der verschiedensten Themengebiete und Autoren.
„Na, bist du schon fündig geworden?“, fragt Herr Alexander nach einer Weile und tritt neben mich. Ich verneine schüchtern, worauf er erklärt: „Im unteren Raum befinden sich die Bücher für Erwachsene und Sachliteratur. Hier oben sind Kinder und Jugendbücher, Fantasy und ein wenig Informatives für die Schule.“ Dabei zwinkert er mir freundlich zu, während er weiter aufzählt: „Alles nach Themengebieten sortiert und hoffentlich gut beschriftet.“
Ich bin überfordert von der Fülle an Informationen und sehe mich verlegen um. „Also eigentlich brauche ich Infos zum Thema Hexenverfolgung hier in der Stadt für ein Referat“, sage ich und nage unsicher auf meiner Unterlippe.
„Aber viel lieber würdest du dich dort drüben bei den wirklich interessanten Sachen umsehen, stimmt’s?“, fragt er lächelnd. Mein Gesicht flammt prompt auf, was man hoffentlich im Dämmerlicht nicht sofort sieht.
„Lieber spannende Krimis oder romantische Liebesgeschichten?“
„Je nach Tagesform“, antworte ich. Aus dem Nichts schießt mir das Bild von einem unwiderstehlichen, dunklen Augenpaar durch den Kopf. Ich bin völlig verdattert und meine heißen Wangen glühen noch ein wenig mehr, nur von dieser kurzen Erinnerung.
Herr Alexander schaut mich kurz fragend an, dann dreht er sich um und geht geschäftig in Richtung der Wissensecke. „Was hältst du davon, wenn wir dir erst mal ein bisschen Informationen zusammenstellen und danach, als Schmankerl sozusagen, noch ein unterhaltsames Buch raussuchen?“
Ich nicke erfreut und überlasse ihm die Auswahl. Mit gezielten Griffen hat er innerhalb kurzer Zeit einiges zu meinem Referatsthema aus den Regalen gezogen und schlendert weiter zu den Jugendbüchern. Dabei murmelt er vor sich hin und schielt immer wieder zu mir herüber.
„Wie findest du das?“, fragt er und wendet sich mir zu. Mein Blick fällt auf einen übergroßen Vollmond, in dessen rechter Seite ein blutiges Messer steckt. Ein Rinnsal frisches Blut läuft an der Stichwunde herunter und fließt in gruselig verzerrte Buchstaben. „Vollmondwahn“ ist das Letzte, was ich sehe, bevor ich mich von diesem Buch losreiße. Kreidebleich und mit weit aufgerissenen Augen starre ich Herrn Alexander an, der mir urplötzlich alles andere als freundlich vorkommt. Er mustert mich mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck.
„Nicht?“, fragt er schulterzuckend, dreht sich um und stellt das Buch wieder zurück an seinen Platz.
„Ich muss los“, stammele ich und will nur noch hier raus. Die Bücher für das Referat halte ich wie ein Schutzschild an mich gepresst.
„Warte!“ Herr Alexander eilt an mir vorbei in Richtung des antiken Sekretärs. „Du brauchst noch einen Büchereiausweis, sonst darf ich dir die Bücher nicht mitgeben.“
Am liebsten würde ich ihm den ganzen Stapel in die Hand drücken und die Flucht ergreifen, aber stattdessen stottere ich meinen Namen, Adresse und Telefonnummer, was er alles zügig, aber dennoch sehr kunstvoll mit einem Füller auf einem Kärtchen einträgt. Zuletzt drückt er noch schwungvoll einem kleinen Stempel in die rechte untere Ecke und reicht es mir lächelnd. Mit zitternden Fingern nehme ich den Ausweis entgegen, klemme ihn zwischen die Bücher, drehe mich auf dem Absatz um und renne die steile Treppe nach unten. Mich interessiert weder der gerufene Abschiedsgruß von Herrn Alexander noch ob ich beim Verlassen der Bücherei die Tür richtig schließe. Ich will einfach nur weg, stürme blindlings aus dem alten Rathaus und niete jemanden um.
„Aahh! Autsch! Spinnst du?“
Um die Ecke ist eine Horde Skateboarder herangerauscht. Gerade rappelt sich der Typ fluchend wieder auf. Ich stehe wie versteinert in einem Chaos aus seinem abgewetzten Skateboard, meinen Büchern und der Kappe des Jungen. Er setzt sie sich mit einem weiteren bösen Blick in meine Richtung wieder betont schräg auf den Kopf.
„Bist du bescheuert, oder was? Kannst du nicht aufpassen? Echt!“
Langsam erwache ich aus meiner Schockstarre und hebe mit hochrotem Kopf die gerade ausgeliehenen Bücher auf. Währenddessen ruft der Typ seinen Kumpels hinterher, sodass diese nun umkehren und zu uns zurückkommen. Endlich habe ich meinen Bücherstapel wieder zusammen und erhebe mich noch immer mit heißen Wangen. Dabei mustere ich die restliche Gruppe der Skateboarder, und dieser Moment wird zu einem der schlimmsten meines Lebens. Denn inmitten seiner Freunde kommt ausgerechnet kein Geringerer als „mein“ toller Typ aus der Bar auf mich zu. Ich starre ihn an. Er erkennt mich. Sein Freund dreht nun in Anwesenheit seiner Clique noch einmal richtig auf und setzt zu einer neuen Schimpftirade an. Ruckartig wende ich mich ab und suche mit schnellen Schritten das Weite, wobei mir Wortfetzen wie „Blindschleiche“, „Streberkuh“ oder „voll verpeilt, die Alte“ hinterherschallen.
Die letzten Tage habe ich das Regenwetter genutzt, um an meinem Referat zu arbeiten. Mittlerweile habe ich genug Material zusammen, um einige spannende Begebenheiten der Hexenverfolgung in unserer Stadt zu berichten. Die Zweifel, ob ich alle Fakten so vortragen kann, dass sich meine Klassenkameraden nicht langweilen, verschiebe ich erst einmal auf nächste Woche, wenn die Schule wieder losgeht. Denn aktuell habe ich ein viel größeres Problem: Ich muss die ausgeliehenen Bücher zurückbringen. Wie ein sprichwörtlicher Scheiterhaufen brennt sich der Stapel in mein Gewissen und doch kann ich mich nicht aufraffen, zur Bücherei zu gehen. Liegt es an dem Zusammenstoß mit dem Skater? An diesem furchtbaren Buch, das mir Herr Alexander geben wollte? An seinem seltsamen Blick, wie ich wohl reagieren würde? Oder an der Tatsache, dass ich meinem Traumtypen zukünftig besser nie mehr begegnen sollte, nach zwei absolut peinlichen Situationen?
Aber es hilft nichts, die Bücher müssen zurück. Und so siegt mein Pflichtbewusstsein. Mit einem resignierten Seufzer packe ich alles in eine Leinentasche, stecke den Büchereiausweis dazu und mache mich auf den Weg. Immerhin scheint nach tagelangem Regen wieder die Sonne und es duftet nach Frühling. Für den Moment kann ich alle düsteren Gedanken verdrängen und bin guter Dinge, als ich an der Bücherei ankomme. Die Holztür quietscht leise, als ich sie öffne, und ich betrete das Dämmerlicht des alten Rathauses. Wieder ist das Erdgeschoss leer. Ich hole tief Luft und erklimme langsam die steile Treppe, obwohl ich am liebsten die Bücher auf einen der kleinen Beistelltische ablegen und flüchten würde. Oben angekommen begrüßt mich das strahlende Lächeln des bestens gelaunten Herrn Alexander.
„Hallo, Lucy. Schön, dich zu sehen!“
„Äh … hallo“, krächze ich und traue mich kaum, ihn anzusehen. „Ich bringe die Bücher zurück.“
„Prima. Ich hoffe, du hast alles für dein Referat zusammen?“
Ich nicke und hole die Bücher einzeln aus dem Beutel, um sie Herrn Alexander zu geben. Zum Glück haben alle den Fall auf das Kopfsteinpflaster unbeschadet überstanden.
„Schau mal, ich habe dir noch mal einen neuen Ausweis gemacht, der andere ist mir nicht richtig gelungen“, sagt Herr Alexander und reicht mir ein laminiertes Kärtchen, auf dem in kunstvoller Schrift meine Daten stehen. Nun kann man auch erkennen, dass der Stempel unten in der Ecke ein Eulenkopf sein soll.
„Danke“, murmele ich verlegen, denn es war mein überhasteter Aufbruch, weshalb keine Zeit für die Formalitäten blieb. Ich stecke den Ausweis in mein Portemonnaie und freue mich über diese kleine, nette Geste.
„Magst du dich noch ein bisschen umsehen?“
Während er die Bücher über Hexenverfolgung wieder in die Regale räumt, stöbere ich in den Jugendbüchern. Immer mit gebührendem Abstand zu diesem gruseligen „Vollmondwahn“. Letztendlich habe ich ein Buch gefunden, mit dem ich mich in eine der Ecken auf der polierten Holzbank setze und darin versinke.
Ein paar Minuten später kommt jemand in das Obergeschoss, spricht kurz mit Herrn Alexander und macht es sich dann ebenfalls mit einem Buch auf der Bank gemütlich. So vergeht die Zeit wie im Fluge und erst das dämmrige Licht von draußen erinnert mich daran, dass ich nach Hause muss.
„Willst du das Buch ausleihen oder soll ich es hier für dich reservieren?“, fragt mich Herr Alexander zum Abschied.
Ich entscheide mich für das Reservieren und freue mich schon darauf, morgen wiederzukommen.
Auf der Straße weht derweil ein kühler Wind und von Frühling ist nichts mehr zu spüren. Während ich noch meine Jacke zumache, tritt auf einmal jemand neben mich. „Hallo!“
Überrascht schaue ich hoch. Vor mir steht mein Traumtyp! Ich bin sprachlos, meine Handflächen kribbeln und in meinem Magen flattern mindestens ein Dutzend Schmetterlinge. Es kostet mich unglaubliche Energie, mein laut klopfendes Herz mit einem heiseren „Hallo“ zu übertönen.
„Die neue Bücherei ist schön, oder?“, fragt er mich, und sein Lächeln wärmt mir nicht nur das Herz, sondern auch noch den kleinsten Winkel meiner Seele. Endlich habe ich die Gelegenheit, ihn bei Tageslicht und aus der Nähe ungestört zu betrachten. Er ist ein wenig größer als ich, schlank und hat dunkelbraune Haare, die ihm wuschelig in die Stirn hängen. Wenn er lächelt, bilden sich kleine Grübchen in den Mundwinkeln und aus seinen wunderschönen Augen blitzt der Schalk.
„Ja, stimmt. Und man muss nicht extra bis in die Stadt fahren.“
„Manche kommen sogar von dort extra her.“
Grinsend zeigt er auf sein Fahrrad, das an einer Laterne angeschlossen ist. Ich muss lachen und will mich gerade verabschieden, als er fragt: „Darf ich dich noch ein Stück begleiten?“
Zuerst glaube ich, mich verhört zu haben. Unwillkürlich sehe ich mich um, in der Angst, dass gleich seine Kumpel hinter der nächsten Ecke hervorspringen und sich entweder über mich lustig machen oder mich beschimpfen. Als nichts Schlimmes passiert und er mich noch immer abwartend anschaut, denke ich, dass er es ernst meint, und nicke automatisch.
„Ich bin übrigens Noel.“
„Lucy“, erwidere ich und nehme seine dargebotene Hand. Unser Händedruck ist komisch, schließlich begrüßen sich so nur Erwachsene, dennoch fühlt es sich richtig an. Seine Hand ist warm, ganz im Gegensatz zu meiner. Viel zu schnell lässt er meine Finger auch schon wieder los, um sein Fahrradschloss zu öffnen und in seinem Rucksack zu verstauen.
Während wir nebeneinanderher schlendern, erzählt mir Noel, dass er mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder erst vor ein paar Wochen hergezogen ist, weil sein Vater beruflich nach Frankfurt versetzt wurde. Er ist 17 Jahre alt und geht in die Jahrgangsstufe über mir. Kurz wundere ich mich, dass ich ihn bislang noch nicht auf dem Schulgelände gesehen habe, als mir einfällt, dass die anderen Skateboarder gewöhnlich in den Pausen und Freistunden außerhalb des Schulgeländes abhängen. Das ist natürlich verboten, trägt aber dazu bei, dass die Mehrzahl der Mädchen aus meinem Jahrgang diese Typen cool finden und anhimmeln.
Obwohl sich mein Heimweg sonst wie Kaugummi zieht, vor allem wenn es schon dämmert und ein eisiger Wind weht, vergeht heute die Zeit wie im Flug. Viel zu schnell stehen wir vor der Einfahrt zu meiner Häuserreihe. Ich beschreibe Noel noch kurz, wie er von hier aus am einfachsten nach Hause kommt, dann verabschieden wir uns voneinander und er schwingt sich auf sein Fahrrad. Mit einem Winken radelt er davon. Mir will mein Lächeln den restlichen Abend nicht mehr vom Gesicht weichen.
KAPITEL 4
10. April 1999
„O Mist, heute ist Samstag“, ist mein erster Gedanke, als ich morgens aufwache und noch im Halbschlaf versuche, Traum und Wirklichkeit zu trennen. Noels schokobraune Augen haben mich im Schlaf begleitet und ich lächele. Doch dieses Lächeln erstirbt, als mir klar wird, dass heute wirklich Samstag ist. Das bedeutet zuallererst, mein Vater ist zu Hause. Da seine Laune seit meinem Geburtstag nicht besser geworden ist, heißt das „Alarmstufe Dunkelrot“. Leider habe ich alle Bücher gelesen, die Ferienhausaufgaben sind erledigt und mir fällt beim besten Willen nicht ein, was ich das komplette Wochenende in meinem Zimmer zu tun hätte.
Außerdem hat am Wochenende die Bücherei geschlossen, die so etwas wie mein zweites Zuhause geworden ist. Ich fühle mich dort geborgen und könnte ewig bleiben. Natürlich umso lieber, wenn mir Noel Gesellschaft leistet. Die letzten Tage haben wir uns immer getroffen, obwohl wir nichts fest ausgemacht hatten. Mittlerweile haben wir uns zwei Leseecken nebeneinander ausgesucht, in denen wir es uns gemütlich machen. Von Zeit zu Zeit reden wir leise miteinander, lesen uns gegenseitig lustige Stellen aus den Büchern vor oder hören Herrn Alexander bei einer seiner Geschichten zu. Wenn nichts zu tun ist, setzt er sich zu uns und zieht uns mit seinen Erzählungen in den Bann. Noel begleitet mich jeden Tag noch ein ganzes Stück, bevor wir uns voneinander verabschieden. Nur gestern hat keiner von uns daran gedacht, dass wir uns erst in zwei Tagen in der Schule wiedersehen.
Warum müssen Ferien immer so schnell enden? Die Wochen in der Schule ziehen sich und kaum haben die Ferien angefangen, sind sie auch schon wieder vorbei. Immerhin gibt es dieses Mal jemanden, auf den ich mich freuen kann. Vor dieser Freude liegt aber noch ein Wochenende zu Hause, ohne Programm und ohne Fluchtmöglichkeit.
„Hilft ja alles nix“, sage ich und seufze. Dann verlasse ich völlig unmotiviert mein Bett. Dabei entdecke ich ein kleines Büchlein, das mir Herr Alexander vorgestern in die Hand gedrückt hat. Auf meinen fragenden Blick hat er lediglich geantwortet: „Nimm das mal mit, ich denke, das könnte dich interessieren.“
Da mir der Buchtitel nichts sagte und ich bereits mit Noel im Aufbruch war, hatte ich es einfach eingesteckt, abends auf meinen Schreibtisch gelegt und bis jetzt vergessen. Mit einem Anflug schlechten Gewissens nehme ich das Büchlein und will es in meine Tasche mit den anderen Ausleihen packen, als ich den Text auf der Rückseite bemerke: „Vollmondrituale der Kelten und anderer Naturvölker“.
Augenblicklich überläuft mich ein kalter Schauder. Wie kommt Herr Alexander auf die Idee, mir dieses Buch mitzugeben? Da sehe ich eine Zeichnung, die genauso aussieht wie mein Medaillon, das ich zum Geburtstag bekommen habe. Ich lasse das Büchlein fallen, als hätte ich mich daran verbrannt. In diesem Moment kommt meine Mutter ins Zimmer.
„Na, habe ich doch richtig gehört, dass sich bei dir was rührt. Guten Morgen! Was willst du frühstücken?“
„Äh … Müsli und einen Kakao“, bringe ich gerade so hervor und gehe schnell ins Bad, bevor meiner Mutter auffällt, dass meine Hände zittern.
Nachdem ich mich beim Frühstück kaum konzentrieren oder unterhalten konnte, sitze ich wieder in meinem Zimmer und bin auf der Suche nach einer Beschäftigung, die mich den Tag über aus der Schusslinie halten wird. Es muss etwas sein, das ich bei geringer Lautstärke machen kann, damit ich keinen Anlass gebe, negativ aufzufallen. Mein suchender Blick fällt auf das Büchlein und mehr aus Langeweile als aus wirklichem Interesse lese ich die ersten Seiten. Anders als der Titel vermuten lässt, ist es kein wissenschaftlich trockener Lesestoff über irgendwelche altertümlichen Völker, sondern die Mond- und Sonnenfeste der Kelten werden anschaulich und lebendig geschildert. Ich lese von den Ritualen und Bräuchen, der wichtigen Rolle des Mondes und vor allem den mythischen Kräften, die zu den wichtigen Mondfesten, Beltaine und Samhain, wirkten. Das letzte Kapitel widmet sich einer besonderen Gruppierung. Ich muss bei der Überschrift zweimal hinschauen, weil ich es nicht glauben kann: „Kinder des Mondes“ steht dort. Hatte nicht der Vollmond von „seinen Kindern“ gesprochen?
Natürlich ruft mich genau jetzt meine Mutter nach unten. Mein Vater möchte das schöne Wetter nutzen und einen Spaziergang machen. Innerlich rolle ich mit den Augen, sehe jedoch den flehentlichen Blick meiner Mutter. „Bitte komm mit“, heißt das im Klartext. Ich würde jetzt gerade noch tausendmal lieber zu Hause bleiben als sonst, schließlich muss ich unbedingt herausfinden, was es mit den Kindern des Mondes auf sich hat. Aber ich weiß, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sich mein Vater den Frust seiner Woche von der Seele laufen kann und am Wochenende zumindest ein wenig entspannter ist, sollten wir diese Chance nutzen.
Er fährt mit uns in den Taunus und die nächsten zwei Stunden stapfen wir über matschige Feld- und Waldwege. Mein Vater läuft vorneweg, während meine Mutter und ich versuchen, ihn nicht komplett aus den Augen zu verlieren und uns dabei zu unterhalten. Da ich die letzten Tage in der Bücherei war, haben wir uns kaum gesehen. So fragt mich meine Mutter nun nach meinem neuen Lieblingsort aus. Ich erzähle ihr von Herrn Alexander, von den Büchern, die ich bislang gelesen habe, und auch ein wenig von Noel. Mein unwillkürlich auftauchendes Lächeln nimmt meine Mutter schweigend, aber mit einem wissenden Blick zur Kenntnis und fragt nicht weiter. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es eh nicht viel zu berichten.
Irgendwann haben wir den Parkplatz, unser Auto und meinen Vater erreicht. Gerade rechtzeitig, es dämmert und der Sonnenschein des Mittags war zwar schön, aber viel zu schwach, um zu wärmen. Immerhin scheint sich mein Vater erholt und entspannt zu haben, denn auf der Heimfahrt ist er in Plauderlaune. Nun kann meine Mutter durchatmen und auch ich finde es gar nicht mehr so schlimm, dass uns noch der Sonntag bevorsteht.
Nach einem harmonischen Abend, an dem ich lange im Wohnzimmer saß und einen Film mit angeschaut hatte, habe ich noch länger geschlafen als an den restlichen Ferientagen. Morgen heißt es früh aufstehen und zur ersten Stunde in die Schule fahren. Da genieße ich es noch einmal, faul im Bett zu liegen und mich genüsslich zu recken und strecken. Dabei fällt mein Blick auf das kleine Büchlein von Herrn Alexander, das ich nach unserem Spaziergang vergessen hatte. Doch nun erinnere ich mich an das letzte Kapitel, das mir noch fehlt: „Die Kinder des Mondes“.
Gespannt lese ich diesen Abschnitt und bin sofort gefesselt von Geschichten rund um eine besondere Gruppe innerhalb der verschiedenen Kelten-Clans. Wenn ich die Unmenge an Informationen richtig verstehe, gab es in allen Sippen und Stämmen immer Personen, die auf besondere Weise mit dem Mond in Verbindung standen. Bei Erwachen ihrer Mondkräfte schickte man sie zu einem Zirkel der Weisen, wo sie ihre Fähigkeiten schulen konnten und in alte Überlieferungen eingeweiht wurden. Nach ihrer Rückkehr standen die „Kinder des Mondes“ in der Rangfolge auf gleicher Höhe mit dem Ältestenrat des Dorfes. Jedes Mondkind bekam zum Zeichen der erwachenden Kräfte ein silbern-schimmerndes Medaillon mit dem keltischen Jahreskreis darauf, das man auch als Kette tragen konnte. Zum Schutz vor Verfolgung in kriegerischen Zeiten und während der Christianisierung nutzte der Kreis der mächtigsten Anführer später eine weitere Symbolik und nannte sich „Hüter der Eule“.
Unwillkürlich muss ich ein bisschen grinsen. Dass sich heidnische Gelehrte als Vogelschützer getarnt haben, finde ich nicht nur schlau, sondern schon fast lustig. Ich greife nach meinem Medaillon, das ich in den letzten Tagen kaum beachtet habe. Wie in der Nacht von meinem Geburtstag wird es sofort angenehm warm in meiner Hand, was man von seinem metallenen Aussehen gar nicht erwarten würde. Langsam folge ich mit den Fingerspitzen den eingravierten Zeichen und Symbolen. Mit geschlossenen Augen versuche ich, auch die kleinste Unebenheit wahrzunehmen. Doch die Gedanken überschlagen sich in ähnlich wilden Kreisen wie ich das Medaillon zwischen meinen Fingern drehe. Ich versuche, mir einen Reim darauf zu machen, wie es in dieser Nacht auf meine Fensterbank kam. Mein Kopf sagt mir, dass es schon vorher dort gelegen haben muss, aber dann bleibt die Frage, wer es dorthin gelegt hat. Und warum es mir vorher nicht aufgefallen ist. So absurd es klingt, aber ich habe keine Zweifel, dass der Vollmond mir das Medaillon „persönlich“ übergeben hat. Nur warum? Und wie?
Noch während ich die Gravur im Material näher betrachte, kommen mir einige Symbole bekannt vor und ich nehme mir wieder das Büchlein zur Hand. Tatsächlich findet sich dort in der Mitte eine Doppelseite mit keltischen Zeichen und den Erklärungen dazu. Die nächsten Minuten vergleiche ich Buch und Medaillon und bekomme unwillkürlich eine Gänsehaut, als einige der Symbole übereinstimmen. „Verrückt“, flüstere ich heiser und kann es kaum erwarten, das Rätsel der geheimnisvollen Inschrift zu lösen.
Auf einen Block male ich zunächst die einzelnen Symbole ab und ergänze die jeweilige Bedeutung. Nicht alle Zeichen finden sich, aber nach einer guten Stunde, die ich konzentriert gezeichnet und zugeordnet habe, sehe ich mein Medaillon mit ganz anderen Augen. Behutsam nehme ich es wieder in die Hand, spüre die beruhigende Wärme und betrachte die wunderschön gestalteten Symbole. Auf der einen Seite befindet sich eine stilisierte Sonne mit flammenähnlichen Strahlen und einem angedeuteten Gesicht, um die in einem äußeren Kreis der keltische Jahreskalender mit den Zeichen für die vier Sonnenfeste verläuft. Auf der anderen Seite sind um stilisierte Strahlen die vier Mondfeste Imbolc, Beltaine, Lughnasadh und Samhain eingraviert. Die Mitte beider Seiten nimmt jedoch ein Symbol ein, für das ich in meinem Buch keine Übersetzung finde.
Leise seufzend behalte ich das Medaillon noch ein paar Minuten in meiner Hand und schließe die Augen. Zwar habe ich einen Teil des Rätsels gelöst, aber mit jedem kleinen Schritt in Richtung Klarheit stellen sich neue Fragen. Was bedeutet das einzelne große Symbol? Was hat Herr Alexander mit all dem zu tun? Wieso hat er mir ausgerechnet dieses Buch gegeben? Hat ihn meine entsetzte Reaktion am ersten Tag in der Bücherei stutzig gemacht? Wenn ja, welche Schlüsse hat er daraus gezogen? Und am allerwichtigsten: Was soll ich jetzt machen?
Am Abend liege ich noch lange wach und finde keine Ruhe. Von meinem Vater weiß ich, dass auch er in der letzten Nacht seines Urlaubes schlecht schläft und in seinen Gedanken bereits wieder auf der Arbeit ist. Ähnlich geht es mir gerade und ich frage mich, wie der erste Schultag laufen wird. Werde ich mit meinen Klassenkameraden einen guten Start haben? In den Tagen vor den Ferien lief es harmonisch, sodass ich mir vielleicht keine Sorgen machen muss.
Ich freue mich, meine Freundinnen wiederzusehen, die ich seit meiner Geburtstagsfeier weder getroffen noch gesprochen habe. Erfahrungsgemäß gelingt es uns nicht, in den Ferien in Kontakt zu bleiben, weil wir aus unterschiedlichen Orten kommen und jeder ein gut ausgefülltes Freizeitprogramm hat. Auch während der Schulzeit sehen wir uns selten privat am Nachmittag. Für mich ist das okay, wir haben genug Gelegenheit, um alles Wichtige zu besprechen. Nichtsdestotrotz braucht es nach den Ferien immer ein paar Tage, bis alles wieder seinen normalen Gang geht. Ich bin gespannt, was meine Freundinnen erlebt haben.
Mit dem Wissen, dass ich morgen Noel wiedersehen werde, zum ersten Mal bewusst in der Schule, kann ich es kaum noch erwarten, dass der nächste Tag anbricht. Doch im letzten Moment, bevor mir die Augen friedlich zufallen wollen, kommt mir ein beunruhigender Gedanke: Was, wenn Noel vor seinen Freunden nichts mit mir zu tun haben will und vorgibt, mich nicht zu kennen? Was, wenn es ihm peinlich ist, mit mir gesehen zu werden?
KAPITEL 5
12. April 1999
Mit einem kleinen Lächeln im Gesicht und wild klopfendem Herz gehe ich an diesem Morgen inmitten der üblichen Schülerherde in Richtung Schulgebäude. Das muntere Schwatzen und fröhliche Gelächter um mich herum sorgt dafür, dass sich mein Knoten im Bauch langsam in kleine Schmetterlinge verwandelt und ich mich beinahe auf den Schultag freue. Plötzlich fällt mein Blick auf die Reihen der Fahrradständer und mein Herz macht einen kleinen Freudensprung. Dort steht Noel lässig grinsend an seinem Fahrrad und schaut mir entgegen. Hat er auf mich gewartet? Vorsichtig hebe ich die Hand und winke schüchtern zu ihm rüber, während aus meinem Lächeln ein Strahlen wird.
Gerade kommt er auf mich zu, als hinter mir ein Ruf ertönt: „Lucy! Warte doch mal, ich hetz’ jetzt schon seit der Bushaltestelle hinter dir her! Wo bist du denn nur mit deinen Gedanken?“
Ich fahre herum. Sue kommt mit rotem Kopf und etwas außer Atem auf mich zu. „H-hey, Sue …“, stottere ich. Bei einem kurzen Blick hinter mich sehe ich gerade noch, wie Noel sich mit einem seiner Kumpel abklatscht und in Richtung Schule verschwindet. Natürlich schaut er nicht zurück. Habe ich mir nur eingebildet, dass er dort an den Fahrradständern auf mich gewartet hat?
„Sag mal, war das nicht der Typ aus der Bar?“, fragt Sue genau in dem Moment, als ich mich wieder zu ihr umdrehe und ein unverbindliches Lächeln aufsetze.
„Welcher Typ?“ Ich versuche, weitere Fragen zu umgehen, hake mich bei ihr unter und lasse mir von ihren Ferien erzählen, während ich mit meinen Gedanken noch bei Noel bin. Viel Zeit bleibt mir allerdings nicht zum Grübeln, denn wir haben unseren Klassenraum erreicht. Kurz darauf erscheint unser Lehrer und der Schulalltag hat uns wieder.
Abends liege ich im Bett und lasse diesen Tag noch einmal in Gedanken Revue passieren. Es war ein guter Schultag, kein Ärger mit meinen Klassenkameraden und meine Freundinnen waren entspannt wie eh und je. Ich habe keine vergessenen Ferienhausaufgaben und mein Referat für Geschichte ist auch so gut wie fertig. Leider habe ich Noel den ganzen Tag nicht mehr gesehen, sodass ich enttäuschter bin, als ich mir eingestehen möchte. Fast verfluche ich das plötzliche Auftauchen von Sue am Morgen, aber andererseits, wie wäre wohl ein Gespräch mit Noel verlaufen? Und wie lange hätten wir dort ungestört stehen können, ohne dass es eine meiner Freundinnen oder einer seiner Freunde gesehen und komische Fragen gestellt hätte? Vielleicht sollte sich meine Freundschaft mit Noel auf die Zeit in der Bücherei beschränken, da sind wir ungestört und müssen keine bohrenden Fragen beantworten.
Heute hatte ich keine Gelegenheit, in die Bücherei zu gehen, da mit dem Schulanfang auch meine Freizeitaktivitäten wieder begonnen haben. In meinem Fall heißt das zweimal die Woche Tennistraining und an den Wochenenden bis zu den Sommerferien meistens irgendein Punktspiel. Zusammen mit einem Tag mit Nachmittagsunterricht bleiben mir nur Mittwoch und Freitag, an denen ich zukünftig in die Bücherei gehen kann. Bei meinem Glück werden das genau die Nachmittage sein, an denen Noel keine Zeit haben wird. Ich seufze tief. Wie dumm, dass ich letzten Freitag nicht daran gedacht habe, das mit Noel zu besprechen. Was, wenn er heute in der Bücherei war und auf mich gewartet hat? Wird er denken, ich hätte ihn versetzt und sauer auf mich sein? Aber wir hatten gar kein Treffen abgemacht.
Dennoch ist Noel ein Typ, der sich bestimmt vor interessierten Mädchen nicht retten kann. Und wenn er denkt, ich würde nicht mehr in die Bücherei kommen, warum sollte er dann noch einen Gedanken an mich verschwenden? Ärgerlicherweise habe ich morgen lange Schule, also muss ich versuchen, Noel Bescheid zu geben, sonst wartet er eventuell wieder umsonst auf mich.
Nach zwei langen Schultagen und einer Flut an Hausaufgaben bin ich endlich auf dem Weg in die Bücherei. Im Gepäck habe ich das Buch von Herrn Alexander, viele Fragen dazu und die große Hoffnung, dass ich Noel wieder treffe. Leider ist Noels Fahrrad vor der Bücherei nicht zu sehen. Andererseits habe ich so Gelegenheit, meine brennenden Fragen zu den Kindern des Mondes beantwortet zu bekommen. Am Fuß der Treppe höre ich allerdings Stimmen aus der oberen Etage. Während ich Stufe um Stufe erklimme, muss ich die Enttäuschung unterdrücken, dass Herr Alexander nicht allein ist und wohl keine Zeit für mich haben wird.
Als ich den Raum betrete, steht er an seinem antiken Sekretär, wo er mir am ersten Tag meinen Ausweis ausgestellt hat. Ein hochgewachsener, hagerer Mann mit Hakennase und militärisch kurzen, flachsblonden Haaren hat sich vor Herrn Alexander aufgebaut und versucht, ihn in die Ecke hinter dem Sekretär zu drängen. Obwohl ich beide nur im Profil sehen kann, jagt mir der starre, eiskalte Blick des Fremden eine grausige Gänsehaut über den Rücken Die beiden scheinen sich zu streiten und nehmen mich zunächst gar nicht wahr. Vorsichtig verharre ich auf der obersten Stufe, unschlüssig, wie ich mich verhalten sollte.
Plötzlich fällt Herr Alexanders Blick auf mich und ich habe den Eindruck, er ist erschrocken, mich zu sehen. Dann hat er sich wieder gefangen, räuspert sich und sagt mit einer kühlen Stimme: „Wir haben heute geschlossen. Du musst wieder gehen.“
Ich will ihn gerade fragen, ob es ihm gut geht, da strafft er sich und fährt fort: „Ich habe wohl vergessen, die Tür abzuschließen. Tut mir leid, dass du umsonst gekommen bist. Unten hängt ein Schild mit den Öffnungszeiten. Morgen bin ich wieder für dich da.“