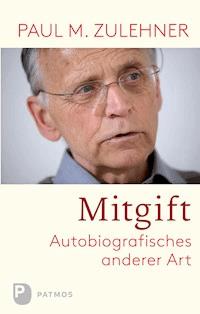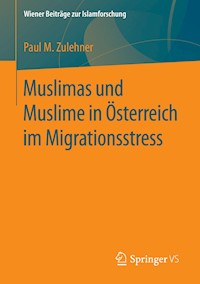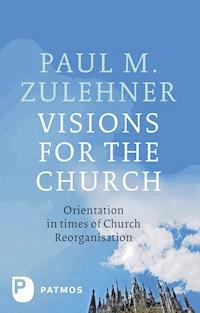Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Dokument "Amoris laetitia" wurde in der Rezeption erheblich unterbewertet. Dabei handelt es sich um ein Dokument, das weit über die Ehe- und Familienpastoral hinausweist. Der erfahrene Pastoraltheologe Paul M. Zulehner zeigt hier seine zukunftsweisende Bedeutung auf. Der Papst wirbt für eine Seelsorge, welche vor allem verwundete Menschen auf dem Heilungsweg begleitet, um sie wieder ins volle, auch sakramentale Leben der Kirche zu integrieren. Was die Weltkirche lernen kann, ist Seelsorge mit Fingerspitzengefühl, Respekt vor dem Gewissen der Menschen. Dazu braucht es in neuer Weise "erfahrene Seelsorgende", die nicht das Gesetz auf Menschen anwenden, sondern einmalige Menschen mit dem Evangelium begleiten. So vollzieht sich der Perspektivenwechsel: vom Gesetz zum Gesicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Leseempfehlung
Paul M. Zulehner
Vom Gesetz zum Gesicht
Ein neuer Ton in der Kirche:
Papst Franziskus zu Ehe und Familie
AMORIS LAETITIA
Patmos Verlag
Inhalt
Vorwort
Zu früh dran
Ein neuer Ton
Eine pastorale Wende
Widersprüchliche Stimmen
Quellentexte
Tuchfühlung mit der Realität
Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
Leben als Kleinstunternehmen in privater Hand
Wandel der Autorität der Kirchen
Kulturelle Vielfalt
Synodalität
Moderne Verbuntung von „Ehen und Familien“
Vom Vertrag zum Vertragen
Ein leidsensibles Dokument
Innerfamiliäres Leid
Ehen und Familien auf Wegen und Umwegen
Was also macht der Beichtvater?
Logiken
Ars pastorandi: erfahrene Seelsorge
Ostkirchliche Pastoralkultur weiterentwickelt
Eine neue Pastoralkultur – ihre Grundmelodie: Barmherzigkeit
Vom Ideologen zum Hirten
Vom Gerichtssaal ins Feldlazarett
Von der Hartherzigkeit zur Barmherzigkeit
(Halb)offene Themen
Genderfalle
Homosexualität
Alleinlebende
Familialismus
Quellentexte
Text 1: Zärtliche Mütter – männliche Väter
Text 2: Gott führt Ehepaare zusammen
Text 3: Was Paare hindert zu heiraten
Text 4: Vorteile der Institution Ehe
Text 5: Vorgeschichte des Ringens um eine neue Pastoral im Umkreis von Scheidung und Wiederheirat
Text 6: Johannes Paul II. – Familiaris consortio 83
Text 7: Johannes Paul II. – Familiaris consortio 84
Text 8: Situationen unterscheiden
Text 9: Logik der Integration
Text 10: Aus- und Weiterbildung
Text 11: Kriterien
Text 12: Hauskirche
Vorwort
Zu früh dran
Als Karl Rahner, einer meiner großen Lehrer in Innsbruck, wieder einmal für seine kühnen theologischen und pastoralen Überlegungen von „Rom“ ein Rede- und Schreibverbot erhalten hatte, wurde er gefragt, wie er denn damit umgehe. Brummig meinte er, er habe da nur zwei Möglichkeiten: Entweder habe er sich geirrt, dann müsse er wieder zurück auf den festen Boden des Bewährten; oder er sei zu früh dran gewesen.
Dieser weise Ausspruch eines der größten Theologen Europas im letzten Jahrhundert wird manchen heute in den Sinn kommen. Papst Franziskus hat nämlich in seiner Apostolischen Exhortatio im Bereich der Ehe- und Familienpastoral Positionen bezogen, für die Bischöfe und Theologen vor seiner Zeit verurteilt worden waren. Zu diesen zählen die inzwischen zu Kardinälen kreierten Bischöfe Walter Kasper von Rottenburg-Stuttgart und Karl Lehmann von Mainz, die 1994 für ihr Schreiben als oberrheinische Bischöfe vom damaligen Chef der Glaubenskongregation Kardinal Joseph Ratzinger harsche Kritik ernteten. Der dritte im oberrheinischen Verbund war der inzwischen verstorbene Freiburger Erzbischof Oskar Saier. Ihnen war von Rom strengstens verboten worden, ihre Position öffentlich weiter zu vertreten.
Den erleichternden Gedanken, zu früh dran gewesen zu sein, wird auch der Wiener Weihbischof Helmut Krätzl haben. Er hatte mit dem Wiener Priesterrat im Jahre 1979 ein Dokument zur Pastoral rund um Scheidung und Wiederheirat verfasst. Kardinal König hatte als Wiener Erzbischof die Bemühungen des Priesterrats wohlwollend unterstützt. Kurz danach war Weihbischof Krätzl mit Kardinal Franz König zur Familiensynode 1979 nach Rom gefahren, zu der Johannes Paul II. eingeladen hatte. Schon während des Konzils hatte der Wiener Kardinal 1963 die katholische Kirche aufgefordert, in die Schule der Orthodoxie zu gehen und von ihr in Fragen der Geschiedenenpastoral zu lernen. Als sich dann bei der Bischofssynode in Rom 1979 abzeichnete, dass der Moraltheologe Papst Johannes Paul II. in dieser Frage keine Entwicklung zulassen werde, fuhren die beiden heim und versammelten die österreichische Bischofskonferenz. Diese gab 1980, noch bevor sich der Papst geäußert hatte, eine Erklärung heraus, die nicht nur von den Beratungen auf der Familiensynode berichtete, sondern mit besorgtem Blick auf die konkrete pastorale Praxis faktisch den Vorschlag des Wiener Priesterrates aufgriff. Wörtlich erklärten sie:
„Ein besonderes Problem, das die Bischofssynode sehr beschäftigt hat, betrifft die Pastoral an Geschiedenen, die wieder geheiratet haben. Die Kirche hat auch solchen Christen gegenüber zu bezeugen, dass die Ehe nach dem Gebot des Herrn als unauflösliche Gemeinschaft zu verstehen ist. Deshalb kann sie derartige Zweitehen nicht als sakramentale Gemeinschaften anerkennen. Auch die Kirche steht unter dem Wort des Herrn.
Andererseits ist es aber nach der Überzeugung der Bischofssynode Aufgabe der Kirche, auch gegenüber solchen, bloß standesamtlich geschlossenen Ehen Verständnis zu zeigen. Solche Eheleute sind nicht von der Kirche getrennt. Sie sollen am gottesdienstlichen Leben teilnehmen. Nach der traditionellen Praxis der Kirche können sie aber nicht am vollen sakramentalen Leben teilnehmen, es sei denn, es liegen besondere Verhältnisse vor, die jeweils im Gespräch mit einem erfahrenen Priester der näheren Klärung bedürfen.“1
Hier tauchen schon all jene Elemente auf, welche das Schreiben von Papst Franziskus bestimmen: Die orthodoxe Unterscheidung zwischen „Akribie“ (wir müssen ungeschmälert das Gebot des Herrn bezeugen) und „Oikonomie“ in der Form von Verständnis und Einzelfalllösung und im Einzelfall Begleitung durch erfahrene Seelsorger mit dem Ziel der vollen Integration in das kirchliche, also auch sakramentale Leben.
Die österreichischen Bischöfe hatten sich in der Einschätzung von Papst Johannes Paul II. nicht getäuscht. In seinem nachsynodalen Schreiben „Familiaris consortio“ (Die familiäre Schicksalsgemeinschaft, 1980) bestätigte dieser die traditionelle Praxis. Zwar schrieb er dagegen an, dass die betroffenen wiederverheiratet Geschiedenen „exkommuniziert“ seien (FC 83). Er betonte zudem, dass die Fälle oftmals sehr verschieden gelagert seien und pastorale Aufmerksamkeit erforderten – eine Passage, welche die Familiensynode und mit ihr Papst Franziskus bereitwillig aufgegriffen hat. Zugleich aber betonte er, dass der Zugang zu Beichte und Eucharistie solange verwehrt werden müsse, als die betroffenen Personen in der zweiten Verbindung verblieben. Denn in diesem Fall bestehe ein objektiver Widerspruch zwischen dem Sakrament der Einheit der Eucharistie und der in der Zweitehe gelebten Untreue. Solange das erste Eheband bestehe und nicht annulliert werden könne, sei daher ein Zugang zu den Sakramenten nicht möglich. Muss dann ein Paar wegen neuer Verbindlichkeiten aus sittlichen Gründen dennoch zusammenbleiben – der Papst nannte konkret die Sorge um gemeinsame Kinder – und es möchte dennoch zur Kommunion hinzutreten, dann müsste es bereit sein, sich jener Akte zu enthalten, die Eheleuten vorbehalten sind (FC 84). Dieses „wie Bruder und Schwester zu leben“ würde die zweite Verbindung von ihrer „sündhaften Eheförmigkeit“ befreien, auch wenn sie dann doch eine „familiale Schicksalsgemeinschaft“ bliebe. Der Weg zu den Sakramenten führe also allein über eine sogenannte „Josephsehe“.
Noch in meiner Passauer Zeit am Lehrstuhl für Pastoraltheologie hatte ich 1982 ein Buch geschrieben mit dem damals bedrängenden Titel: „Scheidung – was dann …? Fragment einer katholischen Geschiedenenpastoral“. In diesem Buch hatte ich die pastorale Bedeutung der Erklärung der österreichischen Bischöfe aus dem Jahre 1980 als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gewürdigt. Es gebe für sie viele gute Argumente prominenter Theologen wie Rahner, Ratzinger, Lehmann und Kasper. Kurz nach dem Erscheinen des Buches übermittelte mir der damalige Bischof von Passau, Antonius Hofmann, – er tat dies gar nicht gern – wegen dieses Buches ein Monitum der Glaubenskongregation. So kann auch ich mich in die gar nicht kleine Zahl jener Bischöfe, Theologinnen und Theologen einreihen, die nach Karl Rahner in der Ehe- und Familienpastoral offensichtlich „zu früh dran waren“.
Ein neuer Ton
In dem vorliegenden pastoraltheologischen Essay werde ich die Apostolische Exhortatio „Amoris Laetitia“ (Die Freude der Liebe, 2016) von Franziskus, Bischof von Rom, kritisch würdigen. Dabei mögen die interessierte Leserin, der interessierte Leser keinen typischen Fachkommentar zu dem vielseitigen „päpstlichen Handbuch für die katholische Ehelehre, Eheberatung und Ehespiritualität und in all dem Ehe- und Familienpastoral“ erwarten. Das ist auch allein deshalb nicht vordringlich, weil das Dokument dank einer eingängigen und realitätsnahen Sprache keiner eigenen Erschließung bedarf: Es versteht sich von selbst und legt sich selbst aus.
Vielmehr greife ich einige wenige zentrale Aspekte heraus, um diese zu präsentieren und fachlich einzuordnen. Sie sollen die grundlegende pastorale Tragweite dieses engagierten päpstlichen Dokuments herausschälen. Denn das Dokument berührt nicht nur die Pastoral rund um Scheidung und Wiederheirat und ist auch nicht nur einfach eine Ehe- und Familienpastoral. Vielmehr werden Grundzüge einer überaus innovativen feinfühligen „Pastoralkultur“ erkennbar, die versucht, das Evangelium in die Lebenskultur heutiger Menschen behutsam einzuweben. Ein „neuer Ton“ wird hörbar, der dank Franziskus weitere Bereiche der Pastoral durchdringen wird.
Papst Franziskus ist kirchenpolitisch nicht leicht einzuordnen. Progressive möchten ihn ungeduldig vereinnahmen, Konservative bekämpfen ihn geharnischt. Aber der Papst ist weder konservativ noch progressiv. Wenn man ihn schon mit einem einzigen Wort charakterisieren will, dann am ehesten mit „radikal“. Des Papstes Pastoral hat jesuanische Wurzeln (radix). Sie lebt vom Vertrauen, dass Gott als der wahre Oberhirte der Herzen in jedem Menschen ein Leben lang als der „unbeirrbar treue Gott“ (Dtn 32,4) mit einem Erbarmen, das seine Gerechtigkeit krönt, am Werk ist. Und die Kirche steht, randvoll mit dem Evangelium, gewissenhaften Menschen bei der letztlich eigenverantwortlichen Meisterung ihres Lebens wegweisend und leidsensibel-heilend zur Seite und kümmert sich darum, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sie dabei mehr fördern als behindern.
Eine pastorale Wende
Dies sind einzelne Facetten dieser noch weithin ungewohnten feinfühligen Pastoralkultur, die in diesem Essay in juwelartigen Kapiteln bedacht werden sollen:
Tuchfühlung mit der Realität
Typisch ist des Papstes hoher Realitätssinn. Er geht nicht davon aus, wie er die Menschen haben möchte, sondern wie sie faktisch sind: mit all ihren Freuden und Leiden, Erfolgen und Niederlagen, aber immer in ihrer einmaligen Geschichte, die sie inmitten eines unentrinnbaren gesellschaftlichen Klimas schreiben. Dabei verzichtet der Papst nicht darauf, den Menschen auf ihrem Lebens- und Liebesweg das Evangelium als Ermutigung zu einer Entwicklung ihrer Lage zuzusingen. Er ermutigt zur Freude der Liebe, übersieht aber auch nicht die Schattenseiten.
Leidsensibles Dokument
Sein Dokument ist leidsensibel. Während bisher viele in der Kirche mehr auf das Gelingen von Ehe und Familie im Sinn der kirchlichen Weisungen geschaut haben, geht sein Blick auf die Menschen, die nicht heiraten können, weil sie keine Arbeit finden, die Gewalt erleben, unfreiwillig ihre Heimat verlassen müssen. Die praktische Frage, welche viele in der Kirche im Kontext des Reichtums und solider Familienpolitik am meisten berührt – nämlich der Zugang von Menschen, deren Ehe nicht hält und die aus vielfältigen Gründen in einer neuen Beziehung leben, zu den Sakramenten der Versöhnung und damit zur Eucharistie –, wird konkret lediglich in einer Fußnote (351) bedacht. Es werden also klare Prioritäten gesetzt: Die communio in vita ist dem Papst wichtiger als die communio in sacris, auch wenn diese beiden Facetten der communio nicht voneinander getrennt werden. Der verstorbene Passauer Bischof Franz Xaver Eder war, als er diese Rangordnung im Passauer Pastoralplan 2000 vertrat, von römischen Dikasterien gerügt worden.
Ehen und Familien auf Wegen und Umwegen
Dennoch gibt das Dokument auch zur zweitwichtigsten Frage – nämlich Scheidung und Wiederheirat – klare Weisungen, die auf tiefschürfenden theologischen Überlegungen beruhen.
Was macht also der Beichtvater?
Ziel pastoraler Sorge ist für den Papst nicht gesetzesgeleitetes Ausschließen, sondern fürsorgliches Integrieren. Den Anspruch auf volle Integration haben aber nicht die Perfekten – keiner lebt bereits das volle Ideal –, sondern die gläubigen Pilger, die auf je eigenen Wegen und Umwegen der Liebe sich dem Ideal der ehelichen Liebe nähern. Der Einzelfall zählt und dass jemand willens ist, auf dem Weg in Richtung jenes göttlichen Traums zu sein, den Jesus angesichts der Herzenshärte im Volk Israel wieder freigelegt hat.
Logiken
Um den jeweiligen Einzelfällen gerecht zu werden, braucht es eine Pastoral der Unterscheidung und der Integration. Diese ist nicht mehr primär an Defiziten und Sünden interessiert, sondern würdigt Fragmente des schon gelebten Ideals, die unterstützt durch die Fürsorglichkeit von erfahrenen Hirten entfaltet werden sollen. Dabei kann es manchmal schon ein Erfolg sein, wenn ein kleiner Schritt zu mehr Liebe gelingt oder wenn es keine weiteren Rückschritte gibt, wenn Wunden heilen und nicht neue geschlagen werden.
Ars pastorandi – erfahrene Seelsorgende
Von jenen Personen, welche seelsorglich an der Seite der Menschen sind – allen voran den Bischöfen –, erwartet der Papst eine hochwertige „ars pastorandi“. Eine solche moralisiert nicht, sondern heilt. Sie bevormundet nicht, sondern begleitet kompetent und einfühlsam. Die letzte Entscheidung liegt beim gewissenhaften Menschen und kann diesem nicht abgenommen werden. Diese sensible Balance zwischen dem bischöflichen Hirtenamt und dem Gewissen der Gläubigen gehört zu den „Lehrelementen“ mit höchster Tragweite für die gesamte Pastoral.
Ostkirchliche Pastoral weiterentwickelt
Beim Entwurf dieser neuen Pastoralkultur stützt sich Papst Franziskus sowohl auf unverbrauchte biblische Weisheiten als auch auf alte und in der Gesetzeslastigkeit vergessene Traditionen. Er geht mutig in die pastorale Schule der Ostkirchen. Deren eher paternalistisch gehandhabte Prinzipien der „Akribie“ und der „Oikonomie“ personalisiert er aber, indem die letzte Entscheidung nicht mehr beim Bischof (allein) liegt, sondern der Bischof einen von der Gnade Gottes getragenen Heilungsprozess durch erfahrene Seelsorge im „forum internum“ verantwortlich begleiten lässt und nach einer angemessenen Heilungszeit die volle Integration ins volle (auch sakramentale) Leben bescheinigt.
Eine neue Pastoralkultur
Zusammenfassend zeigt sich, dass die von Franziskus im Dokument faktisch geübte Pastoralkultur einen weitreichenden Perspektivenwechsel darstellt. Das Dokument des Papstes ist somit pastoraltheologisch besehen revolutionärer und mutet allen an der Ehe- und Familienpastoral in irgendeiner Weise Beteiligten weit mehr zu als erste oberflächliche Kommentare erkennen lassen. Es steht für eine weitreichende pastorale Wende, welche im Schlussdokument der Familiensynode bereits angekündigt worden ist. Es bringt einen neuen Ton in die Pastoral. Wende und Ton finden sich komprimiert in dem einem Wort: Barmherzigkeit.
(Halb)offene Themen
Gleichsam in einer Art Anhang geht es um ein paar Themen, die im Dokument des Papstes zwar aufgegriffen, aber teils unbefriedigend behandelt wurden und einer Fortführung bedürfen. In Frage gestellt wird ein Hang zu einem pastoralen „Familialismus“ – also eine derartige Hochbewertung der Familie, dass zumal die Alleinlebenden aus dem Blick geraten. Es leben aber in vielen Gemeinden Personen, die nicht heiraten wollten oder auch niemanden gefunden haben, mit dem sie sich verbünden hätten können. Die Kirche als „Familie von Familien“ zu definieren, ist theologisch fragwürdig. Ein wunder Punkt ist sodann die einseitige Kritik an Gender, die verkürzt unter dem Begriff „Gender-Ideologie“ läuft. Ausführungen dazu werden den berechtigten Anliegen der wissenschaftlich gut entfalteten Gender-Theorie nicht gerecht.
Widersprüchliche Stimmen
Natürlich gab es nach dem Erscheinen der Apostolischen Exhortatio Stimmen, welche die Bedeutung des Schreibens erahnten und deshalb herunterspielen wollten. Manche Bischöfe und Kardinäle hatten schon während des synodalen Prozesses vor einer häretischen Entwicklung gewarnt: „Wenn die Kirche den Empfang der Sakramente (auch nur in einem Fall) einer Person erlauben würde, die sich in einer irregulären Situation befindet, würde das bedeuten, dass die Ehe entweder nicht unauflöslich2 ist und damit diese Person nicht im Stand des Ehebruchs lebt, oder dass die heilige Kommunion nicht Gemeinschaft im Leib und Blut Christi ist, die hingegen die rechte Disposition der Person erfordert, nämlich die schwere Sünde zu bereuen und die feste Absicht, nicht mehr zu sündigen.“3 Der Historiker Roberto de Mattei kam „unumwunden zum Urteil, dass Amoris Laetitia ein ‚katastrophales Dokument‘ sei“.4
Ganz anders der Papstvertraute Antonio Spadaro (SJ). Er „schrieb nach der Bischofssynode 2015, die Synode habe ‚die Grundlage‘ für die Zulassung der wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion geschaffen, indem sie ‚eine Tür geöffnet hat‘, die bei der vorigen Synode noch verschlossen geblieben sei. Nun schrieb er zu Amoris Laetitia, dass sich seine Vorhersage damit bestätigt habe.“5 Bemerkenswert ist die Aussage, das Dokument sei revolutionär nicht in dem, was es lehre, sondern was es nicht mehr lehre.
Jedenfalls wünscht sich der Papst eine Kirche, in der fortan niemand mehr sagen kann: „Man hat immer anerkannt, dass Gott vergeben kann, auch wenn die Möglichkeit der Kirche, Sünder wieder in die Gemeinschaft einzugliedern, beschränkt war.“6 Oder ein wenig einfacher ausgedrückt: Mag ja sein, dass dir Gott (privat) vergibt, aber die Kirche kann dir nicht vergeben.
Der Papst hegt einen gewaltigen Anspruch an die katholische Kirche: Sie soll selbst „wie der Vater werden“7, randvoll von göttlichem Erbarmen (Lk 15,11–32).
Die revolutionären pastoraltheologischen Aspekte, die sich in dem sprachlich über weite Passagen poetisch-spirituellen Dokument von Papst Franziskus verbergen, gilt es in den folgenden Ausführungen herauszuschälen. Ob sie im Leben der Kirche Frucht tragen werden, hängt sowohl von der Courage der Betroffenen als auch vom Mut der für die Pastoral Verantwortlichen ab. Nicht zuletzt sind die Bischöfe und die Bischofskonferenzen gefordert. Eine nachhaltige pastorale Dezentralisierung der bislang uniformierten, künftig aber kulturell verbunteten und dennoch im Evangelium geeinten universellen, also wahrhaft katholischen Weltkirche hat begonnen.
Quellentexte
Zuletzt einleitend noch ein kurzer praktischer Hinweis. Das Buch ist lesefreundlich gestaltet. Es ist nicht nötig, bei der Lektüre die den Ausführungen zugrundeliegenden Dokumente bei der Hand zu haben. Die Zitate werden im Text möglichst kurz gehalten. Mittellange werden in eine Fußnote gesetzt. Längere Zitate finden Sie im Anhang unter „Quellentexte“. In einer Fußnote wird auf die Position im Anhang verwiesen. Zur besseren Unterscheidung sind alle Zitate aus Amoris Laetitia – und nur diese – kursiv gesetzt.
In den Zitaten aus Amoris Laetitia (AL) kommen häufig „Subzitate“ vor, in denen sich der Papst auf andere Quellen stützt. Diese Fußnoten aus AL werden in diesem Buch nicht dokumentiert. Sie können jederzeit leicht im Apostolischen Schreiben nachgesehen werden.
Tuchfühlung mit der Realität
Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
Gesellschaft und Kultur sind Meisterleistungen der Menschheit. Die großen Aufgaben des Lebens werden gemeinsam gestaltet. Beantwortet werden wichtige Fragen des Lebens und Überlebens: Wie wird angesichts der Sterblichkeit des Menschen das Leben weitergegeben, wie wird Sexualität kultiviert und wie konstituiert sich der optimale Gedeihraum für die nachwachsende Generation? Wie werden jene Güter erwirtschaftet, welche die Menschen zu einem gesicherten Leben und Überleben brauchen? Wie kann Macht politisch domestiziert und kann ein Gemeinwohl in Gerechtigkeit und Freiheit gesichert werden? Wie werden jene bewährten Modelle des Lebens und Überlebens als Kulturgut durch Bildung verbindlich an die kommenden Generationen tradiert, sodass es einen wahren Fortschritt der Kultur geben kann, weil jede kommende Generation auf den Schultern der vorigen aufruht? Wie kann dem Chaos des Lebens Sinn abgewonnen werden? Welchen Sinn hat das Ganze?
Das Dokument des Papstes, der sich als verantwortlicher Leiter der katholischen Weltkirche versteht, beteiligt sich im vorgelegten Schreiben an der Gestaltung der erstgenannten Überlebensaufgabe. Diese wird traditionellerweise unter der Überschrift „Ehe und Familie“ diskutiert. In den meisten Kulturen wird ihr die Gestaltung menschlicher Sexualität zugeordnet. Ganz im Sinn des Konzilsdokuments „Kirche in der Welt von heute“ (Gaudium et spes, 1965) bindet der Papst das Tun der Kirche in die Entwicklung der Gegenwartskultur ein.
Leben als Kleinstunternehmen in privater Hand
Jede Kultur und Gesellschaft hat zu diesen Herausforderungen „Institutionen“ geschaffen. Der Vorgang der Ausbildung von Institutionen kann so rekonstruiert werden: Handlungsmuster werden erprobt und wiederholt; bewährte Handlungsmuster werden verbindlich gemacht und den nächsten Generationen weitergegeben.8 Jede Gesellschaft kennt als eine ihrer Kerninstitutionen die Institution Ehe und Familie.
Sinn der Institutionen ist es, das gemeinsame Leben verbindlich zu gestalten und damit auch von der Anstrengung der „Dauerkonstruktion“ zu entlasten. Sie schützen angesammeltes „Lebenswissen“ vor dem Vergessen, schränken aber dank ihrer Verbindlichkeit zugleich den Handlungsspielraum der einzelnen Menschen ein. Institutionen haben immer zugleich einen „entlastenden“ sowie einen „repressiven“ Charakter.9
Wie Institutionen wirken und welche Formkraft sie besitzen, hat sich in den letzten Jahrzehnten im Zuge der „Modernisierung der Kultur“ tiefgreifend verändert. In vormodernen, wenig freiheitlichen Gesellschaften nötigte die Gesellschaft die Menschen, sich in die institutionellen Vorgaben einzufügen. Individuelle Abweichungen waren marginal und wurden unterbunden. Moderne Gesellschaften hingegen haben die Bedeutung von Institutionen verändert. Der repressive Charakter wurde seit der Achtundsechziger Revolution abgemildert. Manche halten diesen Vorgang für eine Entinstitutionalisierung, andere sehen eine Transformation der Bedeutung von Institutionen. Ähnliches widerfuhr Normen und Autoritäten.10
Das Ziel dieser Modernisierung der Gesellschaft war die Ausweitung des Freiheitsspielraums der Menschen. Die errungenen neuen Freiheiten brachten den Menschen individuellen, persönlichen Gestaltungsspielraum. Das machte das Leben weder einfacher noch glücklicher, sondern riskanter11 sowie bunter und vielfältiger. War Leben bislang gleichsam ein „Großunternehmen in öffentlicher Hand“, wandelte es sich in ein „Kleinstunternehmen in privater Hand“ (Thomas Luckmann).12
Wandel der Autorität der Kirchen
Diese temporeich verlaufende kulturelle Entwicklung schwächte den Einfluss auch der religiösen Institution „Kirche“ und erweiterte den Handlungsspielraum der Mitglieder ihr gegenüber enorm. Innerkirchliche Sanktionen, welche noch in der nachreformatorischen Zeit den Ausschluss aus der Gesellschaft oder gar den Tod mit sich brachten, wurden zunehmend sozial folgenlos. Eine wachsende Zahl begann, unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen mit den Weisungen der Kirche „wählerisch“ umzugehen.
Manche forderten deshalb eine strenge und sanktionierende Kirche für die Abweichler von Lehre und Gesetz der Kirche. Ein Teil der Kirchenleitung erfüllte diese Forderung. Am Beispiel der kirchlichen Institution Ehe und Familie: Kirchenmitglieder, die nach einer staatlich vollzogenen Scheidung eine neue Beziehung aufnahmen, wurden von kirchlichen Ämtern und von den sakramentalen Feiern ausgeschlossen.
Andere hingegen, vor allem Betroffene, die sich in ihrer konkreten Lebensgeschichte keineswegs vom Evangelium verabschiedeten, wünschten sich eine Neubewertung ihrer individuellen Lage oder zumindest Verständnis für ihren Balanceakt zwischen den ererbten Weisungen der Kirche und den Spielregeln der modernen Kultur.
Der Grund dieses Wunsches liegt nahe: Die „kognitive Dissonanz“ zwischen den Erwartungen der Kirche und den Lebensmöglichkeiten in der Kultur war für die Kirchenmitglieder enorm gewachsen.13 Dabei verweigerten sich nicht wenige engagierte Kirchenmitglieder der Ansicht, sie seien schon allein dadurch schlechtere Christen geworden, dass sie ihr Leben im Rahmen der vorherrschenden Kultur selbstverantwortlich gestalteten. Dieser Ansicht neigten hingegen jene zu, die meinten, die moderne Entwicklung laufe dem Evangelium zuwider.
Das Zweite Vatikanische Konzil hatte Sympathie mit der ersten Position. Die Aufteilung in „hier die gute Kirche“ und dort „die böse, säkularisierte, gottlose Welt“ erweise sich als zu einfach. Sie sei auch theologisch unhaltbar. Das Wirken Gottes ereigne sich auch in den modernen Kulturen. Diese schafften in manchen Bereichen menschlichen Fortschritt. So sei es durchaus ein enormer Gewinn moderner Kulturen, wenn die Person, das Individuum aufgewertet und die Rechte von Frauen durchgesetzt werden. Individualität und Individualismus seien nicht dasselbe. Der rasante Wandel im modernen Verständnis von Ehe und Familie müsse daher als ein „Zeichen der Zeit“ gesehen werden und in einer behutsamen „Theologie der Welt“ auf gute wie weniger gute Aspekte hin evaluiert werden. Im modernen Eheverständnis finde sich keinesfalls nur Dunkles, sondern auch Licht, es sei kein blanker Verrat am Evangelium, sondern eine Entwicklung, die letztlich – wenn auch nicht nur – aus dem Geist des Evangeliums gespeist sei.
Papst Franziskus ist der erste Papst, der nicht Konzilsteilnehmer war. Aber er ist einer, der die Theologie von „Gaudium et spes“ (Kirche in der Welt von heute) überaus schätzt und in den dynamischen Entwurf seines pastoralen Handelns einfließen lässt.14
Das also ist ein erstes Hauptmerkmal des Dokuments Amoris Laetitia: Es stellt sich den kulturellen Entwicklungen hinsichtlich Ehe und Familie und unterscheidet typisch ignatianisch die Geister. Evangeliumskonforme Anteile der Entwicklung erhalten Unterstützung, dunklen Entwicklungen wird ohne moralische Anklage, vielmehr aus Sorge um das Gelingen der Liebe, prophetisch der kritische Spiegel des Evangeliums vorgehalten.
Kulturelle Vielfalt
Diese Wertschätzung der kulturellen Entwicklungen als Orte des Wirkens Gottes in der Welt hat allein schon enorme Konsequenzen. Denn Kultur gibt es konkret nur im Plural der „vielen Kulturen“. Eine wahrhaft katholische Weltkirche schätzt nicht nur den Reichtum der verschiedenen Kulturen. Ihr ist daran gelegen, dass in die Entwicklung der Kulturen – also auch der Kultur des Verhältnisses der Geschlechter und der Sexualität – das Evangelium wegweisend, also humanisierend und heilend eingewoben wird.
Im Zuge solcher „Kulturation“ aus der Kraft des Evangeliums werden bislang verborgene Möglichkeiten des Evangeliums entdeckt. Die Kirche lernt durch die „Zeichen der Zeit“ das Evangelium tiefer zu verstehen. Das geht nicht immer konfliktfrei, weil oftmals die kulturelle Entwicklung gegen eine von der Kirche verteidigte Gestalt der Kultur erkämpft werden musste und immer noch muss. Das reibt nicht zuletzt jene Kirchenmitglieder bisweilen auf, die sich sowohl in der Gemeinschaft des Evangeliums wie in der modernen lernenden Kultur daheim fühlen.
Ein solches Verständnis der Evangelisierung als Einweben des Evangeliums in den Reichtum unterschiedlicher Kulturen führt zwangsläufig zu einem Ende der in den letzten Jahrzehnten angstvoll uniformierten und zentralisierten katholischen Weltkirche. Aus uniform wird universell. Sie wird durch die Fülle der Kulturen „verbuntet“, reicher, vielfältiger. Das Band der Einheit ist das eine Evangelium: „Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist“ (Eph 4,4–6).