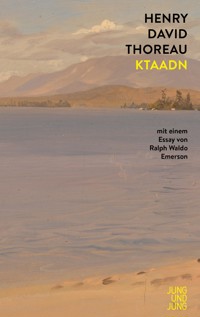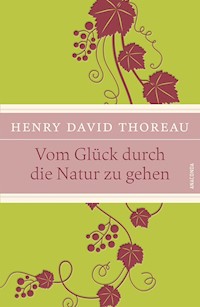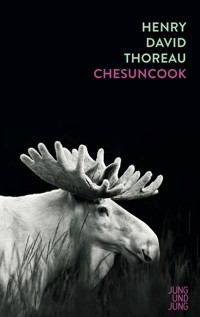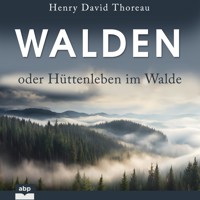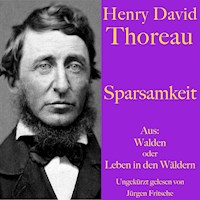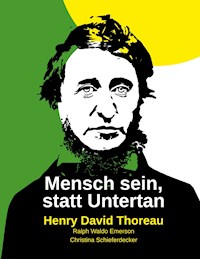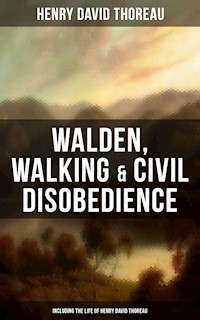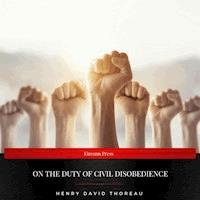6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
»Alles Gute ist wild und frei!« Thoreaus berühmter Essay gilt in seiner zivilisationskritischen Haltung als eine der Gründungsurkunden des Naturschutzes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
[Was bedeutet das alles?]
Henry David Thoreau
Vom Wandern
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Ulrich Bossier
Reclam
2013 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2019
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960264-6
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-19074-6
www.reclam.de
Inhalt
Vom Wandern
Zu dieser Ausgabe
Zum Autor
Zu dieser E-Book-Ausgabe
Vom Wandern
Ich will meine Stimme erheben für die Natur, für absolute Freiheit und Wildheit, im Gegensatz zur zivilisatorisch eingehegten Freiheit und Kultur; dabei betrachte ich den Menschen als Bewohner, ja als festen Bestandteil der Natur, nicht als Glied der Gesellschaft. Ich will eine extreme Position vertreten, und dies, mit Verlaub, durchaus energisch; denn Verfechter der Zivilisation gibt es ja genug; der Pfarrer, das Schulkomitee und jeder einzelne von Ihnen werden sich ihrer schon annehmen.
Ich habe in meinem Leben nur ein, zwei Menschen kennengelernt, die sich auf die Kunst des Spazierens verstanden oder, anders ausgedrückt, eine Begabung zum Schlendern besaßen. Spazierengehen heißt, gemächlich zu gehen, eben zu schlendern, to saunter, wie wir im Englischen sagen; eine reizvolle Etymologie* zu diesem Wort vermeint, es leite sich her von »müßigen Gesellen, die im Mittelalter durch die Gegend streiften und unter dem Vorwand, sie wollten à la Sainte Terre, ›ins Heilige Land‹, Almosen erbettelten«; irgendwann hätten dann die Kinder gerufen: »Da kommt ein Sainte-Terrer« – ein ›Heiligländer‹, und daraus wurde Saunterer. Heute bezeichnet to saunter schlicht ein gemächliches Gehen; die Volkssprache verwendet sogar ›pilgern‹ in dieser Bedeutung. Jene aber, deren ›Pilgermärsche‹, entgegen ihrer Vorgabe, nicht ins Heilige Land führen, sind wahrhaftig nur müßige Streuner und Stromer; doch jene, die ihre Schritte tatsächlich dorthin lenken, sind Saunterer im guten Sinne, sind echte Pilger, und die meine ich. Manche behaupten freilich, das Wort komme von sans terre ›ohne Land‹, ›ohne Heimstatt‹, was ins Positive gewendet hieße, keine eigene Heimstatt zu haben, sondern überall gleichermaßen daheim zu sein. Dies nämlich ist das Geheimnis des erfolgreichen Wanderns und Pilgerns. Wer immer still zu Hause hockt, kann trotzdem der größte Streuner sein; der Pilger im guten Sinne jedoch vagabundiert ebenso wenig wie ein kurvenreicher, mäandernder Fluss, der ständig und unermüdlich den kürzesten Weg zum Meer sucht. Ich bevorzuge allerdings die erste Herleitung, die übrigens auch die wahrscheinlichere ist. Denn bei jedem Fußmarsch handelt es sich um eine Art Kreuzzug; irgendein Peter der Einsiedler* ruft uns dann auf, hinauszugehen und ein bestimmtes Heiliges Land von den Ungläubigen zu befreien.
Nun sind wir freilich recht kleinmütige Kreuzfahrer, und auch die Wanderer unternehmen heute keine Reisen, die Beharrlichkeit erfordern und deren Schluss nicht absehbar ist. Unsere Expeditionen sind eher kleine Touren, und abends finden wir uns an jenem vertrauten Herde wieder ein, von dem wir morgens losgezogen waren. Auf solchen Partien verbringen wir die Hälfte der Zeit damit, unsere Schritte zurückzuverfolgen. Vielleicht aber sollten wir selbst den kürzesten Gang in einer besonderen Geisteshaltung vollführen: Stellen wir uns vor, er wäre ein Abenteuer, das kein Ende kennt, bei dem wir damit rechnen müssten, dass wir nie heimkehrten und nur unsere einbalsamierten Herzen als Reliquien in unsere verlassenen Königreiche gelangten.* Wer bereit ist, sich von Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Weib, Kind und Freunden zu trennen und sie nie wiederzusehen, wer seine Schulden bezahlt, sein Testament gemacht und alle Angelegenheiten geregelt hat – der mag wandern.
Um auf meine eigenen Erfahrungen zu sprechen zu kommen: Mein Begleiter und ich – ja, gelegentlich habe ich einen Begleiter – gefallen uns in der Phantasie, wir wären Mitglieder eines neuen oder vielmehr eines recht bejahrten Ordens: freilich nicht Equites oder Chevaliers, nicht Ritter oder Reiter, sondern Fußläufer – eine, denke ich, noch ältere und noch ehrbarere Klasse. Der ritterliche, heroische Geist, der einst die Herren zu Pferde beseelte, wohnt jetzt offenbar den Fußläufern inne oder setzt sich allmählich in ihnen fest: Was früher der Irrende Ritter war, ist heute der Irrende Wanderer. Er gehört zu einer Art viertem Stand, außerhalb von Kirche, Staat und Volk.
Wir haben den Eindruck, dass wir hierorts fast die einzigen sind, die diese edle Kunst praktizieren. Seltsam, denn die meisten in meiner Stadt würden eigentlich – sofern man ihren Beteuerungen glauben darf – auch gern hin und wieder wandern wie ich; aber sie können es nicht. Kein Reichtum kann die erforderliche Muße, Freiheit und Unabhängigkeit kaufen, die in diesem Metier das Kapital darstellen. Diese Dinge schenkt allein die Gnade Gottes. Hier bedarf es einer himmlischen Fügung. In die Familie der Wanderer muss man hineingeboren werden: Ambulator nascitur, non fit.* Einige meiner Mitbürger erzählten mir, sie seien doch schon einmal gewandert, vor zehn Jahren, so erinnern sie sich. Dabei hatten sie Glück und verirrten sich für eine halbe Stunde im Forst. Aber seitdem, das weiß ich genau, haben sie sich stets brav auf der Landstraße gehalten; deshalb können sie noch so sehr Anspruch darauf erheben, auch zu jener ausgewählten Klasse zu gehören, er wird davon nicht legitimer. Zweifellos fühlten sie sich damals einen Augenblick lang innerlich erhoben, wohl deshalb, weil sie sich einer früheren Stufe ihrer Existenz entsannen, als sogar sie noch als Wäldler und Gesetzlose lebten.
When he came to grene wode,
In a mery mornynge,
There he herde the notes small
Of byrdes mery syngynge.
It is ferre gone, sayd Robyn,
That I was last here;
Me lyste a lytell for to shote
At the donne dere.
[Als er in den grünen Wald kam / eines schönen Morgens, / hörte er die zarten Töne / von Vögeln, die fröhlich sangen. // »Es ist lange her«, sprach Robin, / »dass ich zuletzt hier war. / Ich hätte Lust, ein wenig zu jagen / den graubraunen Hirsch«.]*
Ich glaube, dass ich meine körperliche und geistige Gesundheit nur bewahren kann, wenn ich regelmäßig schlendere, täglich mindestens vier Stunden, meist sogar mehr, durch den Wald und über Hügel und Felder, gänzlich frei von allen weltlichen Belangen. Jetzt werden Sie bestimmt sagen: »Ich möchte doch allzu gerne wissen, was er dabei so denkt, während er läuft«. Nun, zum Beispiel an Handwerker und Ladenbesitzer. Vergegenwärtige ich mir, dass diese nicht nur den Vormittag, sondern auch den Nachmittag drinnen verbringen, in ihren Werkstätten und Läden sitzend, oft sogar auch noch mit gekreuzten Beinen – als wären Beine gemacht zum Daraufsitzen anstatt zum Daraufstehen und -gehen –, so finde ich, diesen Leuten gebühre durchaus ein wenig Anerkennung dafür, dass sie sich nicht alle längst umgebracht haben.
Bleibe ich nur einen ganzen Tag in meinem Zimmer, setze ich Rost an; und wenn ich manchmal meinen Spaziergang verstohlen erst um die elfte Stunde beginne, d. h. also um vier Uhr nachmittags – zu spät, denn dann kann ich die Helligkeit kaum noch nutzen, weil sich bereits die Schatten der Nacht mit den Lichtern des Tages vermischen –, fühle ich mich, als hätte ich mir eine Sünde zuschulden kommen lassen, für die ich noch büßen werde. Ich gestehe, ich bin erstaunt über das Durchhaltevermögen und mehr noch über die moralische Gefühllosigkeit meiner Nachbarn, die sich Wochen und Monate, ja fast ganze Jahre auf ihre Läden, Werkstätten und Büros beschränken. Ich weiß nicht, aus welchem Stoff die gemacht sind – sitzen um drei Uhr nachmittags da, als wäre es drei Uhr morgens. Bonaparte* sprach einst, der wahre Mut sei der um drei Uhr früh*; aber das ist nichts gegen die Tapferkeit dessen, der um drei Uhr nachmittags fröhlich die Person belagert, mit welcher er schon den ganzen Vormittag zusammen war, nämlich die eigene, mit der ihn doch eigentlich eine starke Freundschaft verbinden sollte. Ich frage mich, weshalb um diese Zeit – sagen wir: zwischen vier und fünf Uhr nachmittags, wenn es für die Morgenzeitung zu spät und für die Abendzeitung zu früh ist – keine gewaltige Explosion erfolgt, straßauf straßab, welche die Scharen antiquierter und hausbackener Marotten und fixen Ideen in alle vier Winde zerstreut, dann würde einmal ordentlich durchgelüftet – und das Übel sich selbst beheben.
Wie die Frauen das durchstehen, die ja noch stärker ans Haus gebunden sind als die Männer, weiß ich nicht; aber ich habe Grund für den Verdacht, dass sie es eben gar nicht durchstehen. Passieren wir sommers am frühen Nachmittag eilig die Häuser mit den stilecht dorischen oder gotischen Fassaden, Gebäude, die eine Atmosphäre stillster Ruhe verströmen, so flüstert mir, bevor wir den Staub des Städtchens vom Saum unserer Kleider schütteln und aufbrechen, mein Begleiter zu, dass um diese Zeit vermutlich alle Bewohner dieser Häuser im Bett lägen. Da lobe ich mir doch die Schönheit und Herrlichkeit der Architektur, die sich nie nach drinnen zurückzieht und schlafen legt, sondern immerdar draußen aufrecht steht und über die Schlummernden wacht.