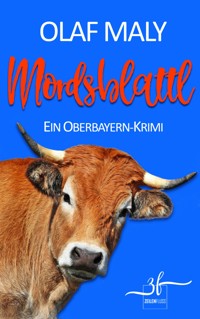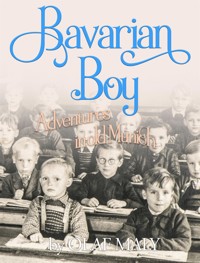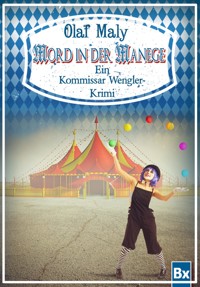4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer möchte nicht gerne die Liebe seines Lebens finden?
Man sollte nie aufgeben, denn sie kann unerwartet auf einen treffen, auch dann, wenn man es am wenigsten vermutet, wie man in diesem Buch erfahren kann. Dann gibt es auch die Enttäuschung, wenn einen diese Liebe unvermittelt verlässt, ohne dass man etwas geahnt hat. Auch kann es sein, dass man jemanden trifft und nicht weiß, ob es wirklich die wahre Liebe ist. Oder vielleicht etwas ganz anderes.
Viele Optionen, wenige Lösungen. Von Menschen ist in diesem Buch die Rede, die nach etwas suchen, was es vielleicht gar nicht gibt. Sie suchen dennoch.
Ein Pilot will immer weiter nach oben, bis er droht, in der Sonne zu verglühen. Es ist ihm egal.
Ein anderer träumt von seinem Glück auf Erden, bis er einsehen muss, dass ihm das Schicksal nichts Gutes will, egal was er auch versucht.
Und letzten Endes erlebt jemand immer wieder sich selbst. Wieder und immer wieder.
Sind es Träume oder ist es sein Leben? Wo ist der Unterschied? Das Leben der Menschen ist unergründlich. Und so sind die Geschichten, die sie erleben. Kein Leben gleicht dem anderen. Und doch geht es scheinbar immer nur um eines. Um das Glück, das hoffentlich, irgendwo und irgendwann, auf einen wartet, auch wenn es manchmal an uns vorbeirauscht, ohne uns zu sehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Von der Liebe und anderen Tragödien
Ich möchte mich an dieser Stelle bei einigen Personen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre. Zuallererst sei meine langjährige Partnerin Marita Stepe genannt, die es stets auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen und mit konstruktiver Kritik auf den Inhalt Einfluss nimmt. Des Weiteren möchte ich Vivian Tan danken, die seit Jahren alle meine Covers erstellt und sich dieses mal wieder einmal übertroffen hat. Dann bedanke ich mich bei Alice Scharrer, die das Buch korrigiert und mit ihren Vorschlägen wesentlichen Einfluss auf die vorliegende Fassung hatte. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDie Kreuzfahrt
Es war ein Sonderangebot. Kreuzfahrt pur. Sieben Tage Erholung, nur feinstes Essen, ausruhen und auf dem Schiff herumwandern. Hauptsächlich schlafen und es sich gut gehen lassen. Das war es, was wir wollten. Endlich raus aus dem Stress und rein ins Vergnügen. Es waren keine Häfen geplant, an denen wir anlegen würden. Das hätte, wie der Prospekt es ausdrückte, nur der Harmonie der totalen Entspannung Abbruch getan. Irgendwie kam uns das seltsam vor, aber da wir noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hatten, wussten wir auch nicht, was man so macht und was nicht, wenn man auf dem Wasser ist. Der Kahn würde langsam vor sich hinschwimmen, sich den Wellen ergeben und wir es mit uns geschehen lassen. Das war das Besondere, das andere, das diese Fahrt von allen anderen unterscheiden sollte. „Häfen sind gestern“, hieß es noch im Prospekt, „Seefahrt ist heute.“ Da wir noch ein paar Tage Resturlaub hatten, dachten wir, es sei genau das, was wir brauchten. Also packten wir die Koffer. Ein guter Anzug musste rein, hieß es, ein kleines Schwarzes für die Weiblichkeit. Es würde einen speziellen Abend geben. Immerhin war es so etwas wie eine Jungfernfahrt. Wie wir gelesen hatten, sollte es auch ein Abendessen mit dem Kapitän geben.
Wir kamen im Terminal an, der, wie zu erwarten, am Wasser lag. Man hörte die Wellen leicht gegen Pier schlagen. Nur ganz leise, fast untergehend im Geräusch der Welt um uns herum. Man musste genau zuhören, um es nicht zu verpassen, dieses für uns so ungewöhnliche Geplätscher. Und man roch das salzige Wasser, das in der Luft war und uns in kleinen Wassertropfen ins Gesicht blies. Ich musste die Augen ein wenig schließen.
Es war ein großes, hohes Gebäude. Irgendwie sah es aus wie eine große Lagerhalle, aber nicht unsympathisch. Weiße Wände, unterbrochen mit blaufarbenem Glas in drei Reihen übereinander. Elegant sah es aus. Fast ein wenig beeindruckend. Wir sahen kein Schiff, was uns im ersten Moment ein bisschen seltsam vorkam, aber da wir, wie gesagt, keine Ahnung hatten, wie so etwas aussah, dachten wir, dass das wohl so sein musste. Vielleicht war es ja auch hinter der Halle. Ja, das musste es sein. Das Schiff war hinter der Halle, darauf einigten wir uns.
Als wir durch die verspiegelte Glastür gingen, die keinen Blick ins Innere zuließ, eröffnete sich vor uns ein gewaltiger, fantastischer Raum. Alles war in einem gedämpften Weiß gehalten, die Wände, die Möbel, einfach alles. Griechische Säulen hielten eine wunderschöne, bunt bemalte Decke in der Höhe. Kleine Engel in hellblauen Mäntelchen schwebten unter blauem Himmel mit weißen Wölkchen. Nymphen sah man am See, der im Hintergrund lag, umrandet von grünem Gras. Jemand saß auf einem Felsen, eine Laute neben sich. Überall hingen goldene Kronleuchter und gaben dem ganzen einen Eindruck von Größe, Reichtum und vielleicht auch ein bisschen Verschwendung. Oder sogar Dekadenz. Wir waren jedenfalls sofort beeindruckt. So etwas sah man nicht alle Tage. Und wir mussten es uns ansehen, es in uns einsaugen wie Wasser sich in einen Schwamm saugte. Wir wollten den Eindruck mit uns nehmen und für immer behalten.
Es gab Sessel, immer in einer Gruppe von drei, mit kleinen Tischen davor, auf goldfarbenen Gestellen. Auf einem Sessel in jeder Gruppe saß eine junge Frau in blauer Uniform und weißem Käppchen und wartete auf die Gäste. Es waren einige dieser Sesselgruppen im Raum verteilt. Wir wurden von einer netten älteren Dame zur nächsten freien Sitzgruppe verwiesen und dort herzlichst begrüßt. Gläser für Sekt standen bereit. Ein livrierter Diener mit einer Flasche kam und fragte, ob wir etwas haben möchten und goss, nachdem wir kurz mit dem Kopf als Zustimmung genickt hatten, ein. Leicht golden aussehendes Wasser mit winzigen Perlen sprudelte in den Sektkelchen. Der Diener lächelte, band ein Handtuch um die Flasche, stellte diese in einen silbernen Kübel und verabschiedete sich mit einem leichten Kopfnicken.
Leise Musik kam aus Lautsprechern, die man nicht sehen konnte. Der ganze Raum war voll von Klängen, leise, fast still, aber doch hörbar. Mehr Klangteppich im Hintergrund, unaufdringlich und sanft.
Unsere Papiere, die wir der Dame am Tisch gaben, wurden von ihr überprüft und in eine blaue Tasche aus feinstem Leder gesteckt. Dann bekamen wir eine goldene Karte für unsere Kabine, auf dem unser Bild zu sehen war. Dreidimensional. Wir hatten ein Foto geschickt, als wir uns angemeldet hatten. Sie meinten, es sei besser als eines, das man dort machen könne. Schließlich sollte es ein schönes Bild sein.
Auf ein kleines Klingelzeichen hin, das die Dame, die uns registriert hatte, mit einer winzigen Glocke dezent ertönen ließ, erschien eine weitere junge Frau, die uns unter ihre Fittiche nahm. Auf ihrem Namensschild stand Monika in goldener kursiver Schrift auf blauem Hintergrund. Wir gingen durch eine Glastür, die sich mit einem leisen Summen vor uns öffnete, und folgten ihr in einen Gang, der abwechselnd in allen erdenklichen Farben erleuchtet wurde. Auf dem weichen Teppich lief man wie auf Wolken. Ineinander gehend war alles in Blau, dann in sanftem Rot, dann Rosa, Weiß, Gelb. Die Farben wechselten sich ab, gingen ineinander über, verflossen und begannen wieder zu leuchten. Und wieder kam leise Musik aus dem Nirgendwo. Das Licht wurde gedämpfter, je weiter wir gingen, bis die nächste Tür aufging und wir auf das Deck eines Schiffes kamen.
Bevor wir durch die Tür gingen, gab uns Monika noch eine Brille, die wir aufsetzen sollten. Sie sagte, es sei besser wegen der Sonne. Wir sollten sie nicht absetzen, sagte sie. Es war eine Brille mit sehr dünnen Gläsern, die die Augen komplett bedeckte, aber scheinbar die Sicht nicht beeinträchtigte. Nach kurzer Zeit hatten wir uns daran gewöhnt und sie als Teil von uns betrachtet.
Alles war getaucht in strahlend blauem Himmel, die Sonne stand hoch oben am Horizont. Uns wunderte das ein wenig, da es stark bewölkt war, als wir den Terminal betraten. Auf unsere Frage hin, wie das sein konnte, antwortete die junge Frau, dass sie leider keinen Einfluss auf das Wetter habe. Wir sollten uns ganz einfach freuen, dass es aufgeklart hätte.
Ein leichter Wind säuselte uns um die Ohren, nur ganz sanft, fast nicht bemerkbar. Man sah einen Wald aus Palmen im Hintergrund, davor eine Straße und das Dock, an dem das Schiff angelegt hatte. Ich dachte mir, das dass gar nicht sein konnte. Dort, wo wir wohnten, und wo der Terminal war, gab es sicher keine Palmen. Eher ein paar Schlote von den Hochöfen, die man vor langer Zeit außer Betrieb genommen hatte. Das war sehr seltsam. Wir sahen uns beide an und zuckten leicht mit den Schultern. Wird sich schon herausstellen, dachten wir uns. Dass wir eine Brille aufhatten, war uns schon nicht mehr bewusst.
Vom Deck aus betraten wir das Innere des Schiffes. War der Eindruck, den Terminal zu betreten schon gewaltig, stellte dies jedoch alles davor Gesehene in den Schatten. Wieder war es meistens weiß oder beige, manchmal ein leichtes helles braun. Große Kronleuchter mit Tausenden von kleinen Kristallen hingen von der Decke. Es gab eine Treppe, die in die oberen Stockwerke führte. Die Stufen waren aus hellem Marmor, die Geländer und Handläufe wie aus Gold. Der Boden war mit einem roten, weichen Teppich belegt, über den man sanft und leise schwebte. Viele Leute waren bereits anwesend, gruppierten sich, redeten miteinander. Aufzüge, die wie runde Glaszylinder aussahen, rauschten geräuschlos hinauf und hinunter. Die Türen öffneten sich an den verschiedenen Etagen. Menschen stiegen ein und aus. Blumen standen überall und gaben dem Ganzen ein Ambiente von Luxus und absoluter Schönheit. Es roch nach Rosen und salziger Meeresluft. Wieder sah man diese livrierten Diener, die auf Verlangen alles zu bringen schienen, was man wollte.
Von einem jungen Mann wurden wir in unsere Kabine gebracht. Als die Tür aufging, tat sich ein großer Raum auf, der sich nach allen Seiten hin erweiterte und noch mehr Räume freigab. Es war eine Suite mit drei Zimmern, einem Schrankzimmer und zwei Bädern. Elegante Möbel standen überall herum, die teuersten elektronischen Geräte hingen an den Wänden oder waren auf kunstvollen Konsolen befestigt. Auf der ganzen Breite des Zimmers war eine Tür, die auf einen Balkon führte.
Leichtes Schaukeln begann. Ein untrügliches Zeichen, dachten wir, dass die Fahrt losgehen sollte. Das wussten sogar wir. Wir setzten uns erst einmal auf unsere Terrasse und sahen in die Unendlichkeit. Nichts als Wasser und Horizont. Nur eine leichte Brise war wieder zu spüren. Es war sehr schnell gegangen, das mit dem Ablegen. Irgendwie hatten wir wahrscheinlich das Gefühl für Zeit verloren, dachten wir uns. Alles war so einmalig, da konnte man schon ein bisschen wegtreten.
So ging eine ganze Weile dahin, bis jemand, angekündigt mit einem leisen Gong, durch die Lautsprecheranlage zum Dinner aufrief. Wir sollten uns entsprechend anziehen. Die Koffer waren schon längst gekommen, und alles war in den Schränken verstaut, ohne dass wir einen Finger rühren mussten.
Einige Zeit später stand ein Butler vor der Tür, der uns in den Speisesaal zu bringen gedachte. Alles schien perfekt organisiert. Wir gingen zum Aufzug und bemerkten, dass es wieder dieselben Leute waren, die dort standen und miteinander redeten, so als hätten sie sich die letzte Stunde nicht von der Stelle gerührt. Seltsam, dachten wir, und sahen uns fragend an.
Im Restaurant angekommen, waren wir scheinbar die ersten Gäste. Nur Ober standen herum und warteten auf ihren Einsatz. Wir wurden an einen Fensterplatz geführt, von dem aus wir nichts anderes sahen als Wasser. Sonne und Wasser, tiefblauer Himmel, untermalt von leiser, fast melancholischer Musik. Das Restaurant war, wie die Eingangshalle, in Weiß und Beige gefasst, mit viel Gold und Glas. Wir setzten uns. Dann passierte erst einmal nichts. Kein weiterer Gast kam, die anwesenden Leute verließen den Raum. Es wurde uns irgendwie seltsam zumute, fast unheimlich. Wir fragten uns, was nun passieren würde. Es war alles leer. Nur wir und die Tische in einem fast unendlich großen Saal. Keine Menschenseele war mehr zu sehen. Die Musik hörte plötzlich auf zu spielen. Es war gespenstig ruhig.
Dann, auf einmal, flackerte der Himmel, den wir aus dem Fenster sahen. Rote Streifen blitzten von links nach rechts. Der vorher so sanfte Ton der Musik kam als kräftiges Rauschen und Knacken zurück. Für einen Moment wurde, was wir hinter dem Fenster sahen, grün, um dann in eine Berglandschaft umzuschalten. Wir fuhren mit dem Schiff durch die Berge. Ein gespenstiger Eindruck machte sich breit. Wo waren wir hier gelandet? Berge rauschten nun auf einmal in atemberaubender Geschwindigkeit an uns vorbei, Blumen, Almhütten, Kühe, Menschen, die uns zuwinkten. Manchmal dachten wir, an so einen Berg zu krachen, nur um im letzten Moment noch die Kurve zu bekommen. Wir hielten uns an dem Tisch fest, der in diesem großen Raum stand. Es war der einzige Tisch, den wir sahen. Alles andere war auf einmal verschwunden, einfach weg, als wäre es blitzschnell aufgeräumt worden. Wir standen nur da und warteten, was kommen sollte.
Dies ging so für ein paar Minuten, bis das Licht komplett ausfiel und große Neonlampen mit rauschendem Summen angingen. Alles was wir vor noch wenigen Minuten gesehen hatten, war endgültig weg. Wir nahmen die Brillen ab, um zu sehen, was los war. Es krachte überall, als würde etwas auseinanderbrechen. Wir sahen nach oben. Teile fielen herunter, kleine Platten aus Metall und Gips. Es staubte, als sie am Boden zerbrachen. Ein Teil der Decke fiel uns fast auf den Kopf. Wir mussten uns schnell zur Seite ducken, um nicht getroffen zu werden. Die prächtige Einrichtung war weg, der Kronleuchter existierte nicht mehr, die Säulen waren wie weggezaubert. Wir saßen an einem Tisch in einer großen Lagerhalle und sahen nur grüne Wände um uns herum. Kein Mensch war zu sehen. Projektoren flimmerten, warfen buntes Licht auf fahle Wände. Es wurde immer wärmer um uns herum, dann richtig heiß. Das konnte nichts Gutes bedeuten.
Wir bewegten uns in Richtung einer Tür, die uns, wie wir dachten und hofften, irgendwie nach draußen, oder zumindest weg von diesem Geschehen, bringen würde. Wo immer draußen sein würde. Jedenfalls heraus aus dem Ort, wo wir waren. Sie ließ sich nur schwer öffnen, wir schafften es aber. Wir standen wieder in der Eingangshalle, in dem die paar Menschen, die wir vorher getroffen hatten, bedrückt beieinander standen und miteinander redeten. Als sie uns sahen, löste sich die Menge auf und verstreute sich in verschiedene Richtungen.
Andere Leute kamen aus verschiedenen Türen, die wir vorher nicht gesehen hatten. Sie kamen zu uns, wollten wissen, was passiert war. Wir wussten es so wenig wie sie.
Als wir endlich den Weg nach draußen gefunden hatten, sah es genauso aus wie zu Beginn unserer Reise. Nur regnete es jetzt noch mehr als vorher. Irgendwelche Leute standen herum und diskutierten, sahen uns aber nicht. Wir gingen auf sie zu, sie waren wie durchsichtig, bewegten sich nicht. Wir konnten durch sie durchgehen, als wären sie nur durchsichtige Bilder. Dann wurde alles dunkel. Die Welt schien das Licht ausgeschaltet zu haben.
Als ich wieder aufwachte, dachte ich, es war nur ein Traum. Ich lag in einem Bett, bis oben hin mit Decken zugelegt. Ich wusste nicht, was los war, konnte mich nicht bewegen. Durch einen kleinen Schlitz vor meinen Augen sah ich eine Neonlampe in einer weißen Decke, die unablässig flackerte und summte. Wo war ich? Angestrengt versuchte ich, meine Arme zu heben, es ging nicht. Ich fluchte innerlich. Ich hasste es, mich nicht unter Kontrolle zu haben.
Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, aber auf einmal stand jemand neben mir. Ich sah es nicht, da mein Blickfeld auf den Schlitz vor meinen Augen sehr begrenzt war und ich damit nur die Decke und das verdammte Neonlicht sehen konnte. Es war eine Frau. Sie hatte eine sanfte Stimme. Sie sprach leise, und erklärte mir, dass ich in einen Brand geraten war. Man hatte einen Versuch unternommen und ein virtuelles Schiff gebaut, mit dem man, ohne das Gelände zu verlassen, um die Welt fahren konnte. Alles war computergesteuert und mit einem großen Knall vorbei. Ich selbst hatte überlebt, sonst niemand. Da ich durch das Feuer gelaufen war, wurde mein Körper zum größten Teil verbrannt. Ich wurde nur mit Medikamenten am Leben gehalten. Es würde Jahre dauern, bis ich wieder einigermaßen normal sein konnte. Viele Jahre.
Dann ging sie. Ich dachte nach, dachte an die Worte, die sie mir in einem sanften, regelmäßigen Ton gesagt hatte. Ohne Aufregung, ohne theatralisch zu sein. Einfach so, als würde sie mir erzählen, was sie heute zum Essen gemacht hatte. Dann fing ich an zu weinen.
Das ist sehr lange her. Wie ich das schreibe und mich an diesen Tag erinnere, sitze ich in meinem kleinen Haus, draußen auf dem Land, eine Stunde von der Stadt entfernt. Es ist einsam hier draußen, aber das ist es gerade, was ich am meisten liebe. Die Einsamkeit, die absolute Ruhe. Das Nachdenken. Manchmal sitze ich für Stunden am Fenster, sehe nichts als Bäume, Wiesen und den großartigen Himmel, der alles überspannt. Die Gerüche der Natur dringen in mein Zimmer. Das feuchte Gras, die wenigen Blumen, die ihren Duft in die Welt ausbreiten, um damit die Bienen anzulocken. Es geht nicht um uns in diesem Fall, kommt mir in den Sinn. Es geht darum, sich zu verbreiten, den Bienen zu zeigen, wo sie sind. Wir sind nicht wichtig, nur Beigabe. Wenn ich so auf meinem Sessel sitze, kann ich in mich gehen, mich an Zeiten erinnern, in denen es schön war, nicht so wie heute. Zeiten, in denen ich glücklich war, wir glücklich waren. Die Bilder verblassen über die Jahre, die Erinnerung wird immer durchsichtiger, bis man gar nichts mehr sieht, nur noch einen nebeligen Eindruck, der etwas vortäuscht, was es nie gegeben hat. Meine Augen sind müde geworden, sehr müde. Ich möchte nichts mehr sehen, versuche, sie immer geschlossen zu halten. Am wenigsten möchte ich mich selbst sehen. Ich habe auch alle Spiegel aus dem Haus entfernt, damit ich mich nicht in Versuchung führen kann. Und ich habe Mathilde verboten, mir zu sagen, wie ich aussehe. Ich will es nicht wissen. Ich lebe mit der Vorstellung, wie es einmal war. Mit dem Bild, das ich von mir habe, und das ist mir genug. Manchmal denke ich, wie einfach es wäre, wenn man sich nie selbst im Spiegel sähe. Man wäre immer jung.
Besucher empfange ich nicht. Ich habe allen, die ich kenne, verboten, mich zu besuchen. Die wenigsten kennen meine Adresse. Ich brauche kein Mitleid, keinen Trost. Ich brauche es nicht, ständig an den Tag erinnert zu werden, der meinem Leben ein Ende gesetzt hatte. Ich brauche das nicht.
Manchmal, nachts, wenn es dunkel ist, gehe ich aus dem Haus, setze mich auf die Bank neben dem Eingang und genieße die Luft, die mich umgibt. Es ist ein großer Unterschied, ob man draußen oder drinnen ist. Die Luft draußen ist rein, jungfräulich, frisch, unverbraucht, sanft und endlos frisch. Das genieße ich. Auch die Kühle, die dann vom Wind in mein Gesicht getragen wird und mich umfängt. Es ist, als würde mich eine sanfte Hand berühren und mich streicheln. Ich habe es geliebt, gestreichelt zu werden. Der Wind kommt und fragt nicht, wo er auftrifft. Es ist ohnehin nur für eine kurze Zeit, für einen winzigen Augenblick. Er streicht an einem vorbei, um sich einen neuen Weg zu suchen, ein anderes Objekt. Wir können ihn nicht aufhalten, nur den Moment genießen.
Das Haus konnte ich mir von der Versicherungssumme kaufen, die ich ausbezahlt bekommen hatte. Ich hätte gerne auf das Geld verzichtet, aber auf der anderen Seite war es ein Geschenk, das ich annehmen musste. Wie die monatliche Rente, die es mir ermöglicht, hier meine Tage zu verbringen. Ich musste irgendwo leben, und da kam mir dieses einsame Haus gerade recht.
Mathilde, die Krankenschwester, kommt jeden Morgen und hilft mir, mich zu waschen und mich anzuziehen. Ohne sie würde es Stunden dauern. Wahrscheinlich würde ich nur im Bett liegen und nichts tun, wenn sie nicht wäre. Meine Haut spannt sich um meinen Körper, als wäre sie um mindestens zwei Nummern zu klein. Es schmerzt den ganzen Tag. Ich dachte immer, es würde sich geben, aber es tat sich nichts. Es spannt, den ganzen, langen Tag.
Mathilde ist eine Frau mittleren Alters, die, wie sie mir erzählt hat, ihre Eltern pflegen musste, bis diese gestorben waren. Nun kümmert sie sich um mich. Sie hat ihr Leben verpasst, meinte sie einmal, und lachte ein wenig dabei. Nicht weil es lustig war, mehr aus Selbstmitleid, dachte ich damals. Vielleicht war es auch die Erinnerung an bessere Tage, die sie lächeln ließ. Ich weiß es nicht. Sie hat es mir nie gesagt. Und ich habe nicht gefragt.
Sie muss einmal hübsch gewesen sein. Nun ist sie ein wenig füllig, ihre Haare sind vergilbt, ihre Haut ist trocken und übersät mit kleinen roten Flecken. Nur ihre Fingernägel sind immer gepflegt. Das ist mir schon am ersten Tag aufgefallen. Immer hat sie dasselbe Kleid an. Dunkelblau mit kleinen roten Punkten und einem Saum aus rotem Band. Vielleicht hat sie ja auch mehrere davon. Ich weiß es nicht. Für mich sieht es immer gleich aus. Wir haben nie darüber geredet. Vielleicht sollte ich sie einmal darauf ansprechen. Nur fällt mir das Reden sehr schwer, da auch im Gesicht die Haut überspannt ist und es am wenigsten weh tut, wenn ich ganz einfach meinen Mund nicht bewege. Im Winter zieht sie eine graue Jacke über ihr Kleid, die ihr viel zu groß ist. Sie sei selbst gestrickt, sagte sie einmal, als ich sie in bestimmter Weise ansah, die sie sofort verstand. Und dass sie das Stricken danach hat sein lassen. Ich würde ja sehen, warum.
Sie sei auf die Welt gekommen, um Menschen zu pflegen, meinte sie eines Tages zu mir, als ich sie fragte, warum sie das alles tun würde. Es würde ihr nichts ausmachen, sagte sie. Manche Leute kommen, um Großes zu schaffen, wie Künstler, Musiker, Schriftsteller, Politiker. Manche kommen, um Kinder zu bekommen, eine Familie zu haben. Und manche eben, um andere zu pflegen. Es ist vorbestimmt, wozu man geboren wird. Das war ihr Credo. Sie ist zufrieden. Das ist ihr Platz auf dieser Welt. Sie hat es akzeptiert. Ich frage sie, ob sie denn nie einen Mann gehabt hatte. Aber ja, meinte sie. Verliebt war sie, als sie noch nicht zwanzig war. Unheimlich verliebt. Sie redeten von Hochzeit, wie schön es werden würde und wie viele Kinder sie haben würden. Nur seine Eltern waren dagegen, da sie eine bessere Partie für ihren Sohn hatten haben wollen. Der Vater war der Zahnarzt des Ortes, sie das Arbeiterkind. Dann, eines Tages, war der Geliebte nicht mehr da. Einfach so zog er weg. Sie hatte noch lange nach ihm gesucht. Ihre Eltern meinten, sie solle es sein lassen. Lass ihn gehen, sagten sie. Er hat ein neues, besseres Leben angefangen, in dem er dich nicht wollte. Es dauerte lange, bis sie darüber hinwegkam, meinte sie. Sie hat ihn nie wieder gesehen.
Es ist wieder Winter geworden. Winter sind für mich immer die schwerste Zeit. Die Kälte vertrage ich nicht. Kein Teil meines geschundenen Körpers verträgt die Kälte. Ich versuche, ihr nicht zu begegnen. Ich sitze im warmen Zimmer, auf meinem Sessel, und sehe, wie es draußen schneit. Schwere Flocken schweben ganz langsam und gemächlich vom Himmel und sammeln sich auf dem Rasen vor dem Haus. Morgen wird alles weiß sein, denke ich mir. Es ist schön anzusehen, die weiße Pracht, auch wenn ich sie nur von einem warmen Platz aus bewundern kann.
Irgendwie war mir heute den ganzen Tag nicht sehr wohl. Ich wusste nicht warum, aber nachdem Mathilde gegangen war, setzte ich mich hin und schrieb diese Zeilen auf. Sie gingen mir die ganze Zeit im Kopf herum, wie lästige Fliegen, die man nicht verscheuchen kann. Man verjagt sie mit der Hand, aber sie kommen immer wieder. Nur das Aufschreiben hat ein wenig geholfen, mich zu beruhigen, mir ein Gefühl des Ganzen zu geben, das ich gesucht hatte. Als hätte etwas gefehlt an diesem Tag, was zusammengefügt werden musste. Vielleicht habe ich es geschafft. Und nun fallen mir die Augen zu und ich muss aufhören.
Mathilde kam am nächsten Tag ins Haus und fand mehrere, mit Handschrift vollgeschriebene Blätter auf dem kleinen Tisch neben dem Sessel. Herr Schrader saß im Sessel, den Kopf nach vorne auf der Brust aufliegend. Sie wusste sofort, was los war. Sie hatte es bei ihren Eltern gesehen. Es tat ihr nicht leid. Im Gegenteil. Sie meinte nur, dass er jetzt endlich seine Ruhe gefunden hätte. Er lächelte. Sie hatte ihn nie lächeln sehen. Es war auch möglich, dass sich einfach seine Mundmuskulatur entspannt hatte. Dann rief sie den Notarzt.
Alleinflug
Wir hatten die Maschine gefunden. Zwei Tage waren wir herumgeflogen und haben nach einem Stück Metall gesucht. In einer Wildnis, die so groß ist, dass wir noch nicht einmal einen kleinen Bruchteil erkundet hatten. Es gab auch nicht viel zu erkunden. Nur die endlose Weite, voll mit Bäumen und Gras. Im Sommer ist es das Reich der Mücken, die so groß waren wie kleine Vögel. Es gibt kein Entrinnen, wenn sie auf einen trafen. Die Einheimischen schmierten sich mit einer stinkenden Masse ein, von der man nicht wusste, woher sie kam. Und wir wollten es auch nicht wissen.
Die Suche musste mehrmals unterbrochen werden, wegen des schlechten Wetters. Es ist eigentlich nie gutes Wetter hier oben in Alaska. Es gab nur manchmal eine kleine Erholung. Manche sagten, wenn die Sonne schien, man solle nicht auf die Toilette gehen, sonst würde man es verpassen. Das schöne Wetter. Wir hatten ein wenig Glück. Nachdem es am späten Vormittag ein bisschen aufgeklart hatte, flogen wir den Weg nach, den Armin hatte nehmen wollen. Laut Flugplan, den er in der Hütte am Flugplatz hinterlassen hatte. Das war Routine. Jeder musste das. Man wollte wissen, wohin jemand flog, falls man ihn suchen musste. Nur konnte man diesen Plan nicht immer einhalten, so gut man es auch versuchte. Es gab Umstände, davon abzuweichen. Also suchten wir. Ich saß am Steuer, Frank hatte das Fernglas in der Hand und schaute damit auf den Boden.
Dann sahen wir sie. Das heißt, Frank bemerkte sie zuerst und deutete auf die Stelle, die er im Blick hatte. Dort war sie, die Havilland DH 2 Beaver. Das perfekte Flugzeug für die Einsätze hier im Norden. Sie lag verwundet, mit nur einer Tragfläche, dort am Hang. Einer der Wasserschwimmer war abgebrochen und lag unterhalb, dort, wo die Neigung des Berges in ein kleines Tal überging. Der muss als erstes abgebrochen sein, dachte ich mir. Er lag vielleicht hundert Meter vor und in der Richtung der Absturzstelle. Es war eine grüne Weide, die sich sanft in einem schwachen Winkel am Berg nach unten verlängerte. Man konnte sich gut vorstellen, dass Kühe darauf weideten. Es fehlte nur noch eine kleine Hütte, dort oben, zwischen den Krüppelkiefern, die verstreut ein bisschen Panorama abzugeben versuchten. Es wäre ein perfektes Bild der Ruhe und Natur gewesen. Nur gab es keine Kühe hier oben in Alaska. Elche gab es, und Wölfe, aber keine Kühe.
Wir landeten in einem kleinen Tal, vielleicht zwei Kilometer weg von der Unfallstelle. Der Hang, an dem die Havilland lag, war ein bisschen zu steil und zu kurz, um dort zu landen. Wir sicherten die Maschine, nahmen unsere Rucksäcke, Seile, Spaten und Wasser und stiegen auf. Es war ein leichter Aufstieg. Nicht nur war die Steigung gering, aber wir wollten auch sehen, was mit Armin war. Das trieb uns voran. Wir spürten nicht, wie schwer wir atmeten wegen der dünnen Luft. Als wir ankamen, sahen wir ihn. Er saß in seinem Sitz, hatte die Hände am Steuerhorn und lächelte. Blut lief aus einer Wunde an seinem Kopf, der auf seine Brust gefallen war, seitlich über dem rechten Ohr. Sonst war nichts Besonderes zu sehen, keine großen Verletzungen.
Es war schlechtes Wetter vorausgesagt worden an diesem Tag, als Armin zum See der Karibus hatte fliegen wollen. Die Indianer nannten ihn so. Vielleicht erst, seitdem die Weißen, die vor nicht einmal hundert Jahren dort angekommen waren, sie gefragt hatten, wie der See denn hieße. Wie sich später herausstellte, hatten die Seen in dieser Gegend keine Namen. Nur die Weißen wollten alles mit Namen versehen, ihnen Bedeutung geben. Die Einheimischen wussten nicht warum. Also erfanden sie Namen. Für die Indianer war es ein Stück Wasser, in den ein Bach mündete, der den See dann wieder Richtung Ozean verließ.
Es gab Lachse in diesem See, die im Herbst vom Meer nach oben schwammen, um dort zu sterben, nachdem sie ihre Eier dort abgelegt hatten und dafür sorgten, dass eine neue Generation den Fortbestand sicherte. Sie wussten sicher nicht, warum sie dorthin zurückkamen, vielleicht nicht einmal, dass sie von dort stammten. Sie kamen trotzdem. Es war ihr Leben und ihre Bestimmung dorthin zu schwimmen.
Wegen der Lachse stand am Ufer auch eine Hütte, dort am See der Karibus. Und dort hatte Armin hingewollt. Nachschub bringen für die wenigen Abenteurer, die es in diese Einöde verschlagen hatte. Er hatte sie vor zwei Wochen dorthin gebracht. Vier Männer aus New York, die einfach einmal allein sein wollten. Nichts als fischen und essen und trinken. Ohne die Frauen, wie sie immer betonten, als er sie dort abgesetzt hatte. Gelacht hatten sie dabei, als wäre es der Witz des Tages. Dann riefen sie über Funk an, dass ihnen der Whiskey ausgegangen war. Und noch ein paar andere Sachen. Es war nur eine Stunde Flug, also erklärte sich Armin bereit, ihnen Nachschub zu liefern. Da das Wetter nicht sehr vielversprechend war, wollte er über Nacht bleiben und dann am Morgen zurückkommen. Das war der Plan. Dann, am Abend riefen die Bewohner der Hütte an und fragten, wo denn ihr Whiskey bliebe. Sie säßen total auf dem Trockenen und das sei nicht so gut. Dabei lachten sie alle grölend. Sie hatten seltsame Späße, diese Männer aus New York.
Langsam machten sie Armin von seinen Gurten frei und nahmen ihn behutsam aus seinem Sitz. Er war schwer geworden. Als er vor vielen Jahren ankam, war er zwar schon mittleren Alters, aber immer noch sehr rüstig und schlank. Er stand auf einmal in der Tür des kleinen Flughafengebäudes, einem Platz mit einer Startbahn und ein paar Holzschuppen, in denen man die Maschinen bei schlechtem Wetter unterstellen konnte. Dazu gab es noch so etwas wie einen Aufenthaltsraum in einer Blechhütte, aus der ein altes Ofenrohr stakste, das unablässig Rauch in den meist grauen Himmel quellen ließ. Jemand hatte auf ein Holzbrett „Lounge – First Class“ gemalt und es über die Tür genagelt. Alles, was es dort gab, war eine alte durchgesessene Couch und zwei Sessel, mit einem Tisch davor, auf dem uralte Illustrierte lagen, die irgendwann mal jemand dort vergessen hatte. In der Ecke stand ein Schreibtisch, darauf das Mikrofon und eine Sendeanlage, um mit den Piloten, die unterwegs waren, in Kontakt bleiben zu können. Es war eine einfache Anlage, aber sie tat seit vielen Jahren treu ihre Dienste.
Der Flugplatz hatte eigentlich keinen Namen. Man nannte ihn einfach den Flugplatz, da es in weiterer Umgebung keinen anderen gab. Namen braucht man nur, wenn es dasselbe zweimal gab, sagte man denen, die sich darüber wunderten. Natürlich hatte der Platz ein offizielles Kennzeichen, dass auf allen einschlägigen Karten verzeichnet war, aber nur, weil es Vorschrift war.
Es gab einen Ort in der Nähe, in dem eine Tankstelle, ein Motel und ein Gemischtwarenladen waren. Im Sommer wohnten vielleicht dreißig, vierzig Leute dort. Im Winter nur noch weniger als zehn. Früher, vor vielen Jahren, war es einmal eine Ansiedlung, von dem aus die Goldsucher nach Norden aufbrachen, wenn sie, von Victoria kommend, die Route zum Klondike nahmen. In Victoria war das Büro, in dem man die Claims zugewiesen bekam, zu denen man dann sich dann mühevoll hinschleppte. Viele hatten ihr Ziel nie erreicht, und von denen, die es geschafft hatten, kamen nur sehr wenige zurück. Der Ort hieß Bishopstown, nach dem ersten Mann, der dort ein Haus gebaut hatte, um die sehnsüchtigen Träumer vom großen Geld mit all dem zu versorgen, was sie vergessen hatten. Es gab kein Schild mehr, das den Namen zeigte, auch keine Adressen. Die, die dorthin wollten, wussten, wo es war. Die, die es nicht wussten, mussten dort nicht hin. Manche blieben damals hängen, als sie die Berichte gehört hatten, wie anstrengend es war, den Weg durch die Eiswüste zu nehmen. Und manche wurden reich von denen, die durchzogen. So wuchs dieser Platz und hatte in seiner besten Zeit mehrere hundert Einwohner. Aber das war lange vorbei. Wenn man sich die Mühe machte, konnte man noch die alten, halbverfallenen Häuser sehen, die wild in der Landschaft standen. Die Straßen und Wege, die es einmal gab, waren alle wieder zugewachsen. Die Natur hatte sie sich zurückgeholt. Nur der Friedhof sah noch so aus, als würde ihn jemand pflegen. Das war der einzige Platz, an dem die Geschichte dieses Ortes noch lebte.
„Ich möchte hier fliegen“, meinte Armin, als man ihn fragte, ob man etwas für ihn tun könne. Er stand dort in der Tür, ließ seine alte lederne Reisetasche auf den Boden fallen und wartete. Da stand er, angezogen mit einer alten Jeans, einer braunen Lederjacke über einem karierten Holzfällerhemd und Stiefeln, die ihm fast bis zum Knie reichten. Seine Haare hatte er seit Wochen nicht geschnitten, ebenso wenig wie den Bart. Außerdem hatte er einen alten, braunen Filzhut auf, den er abnahm, als er das Büro betrat. Sein Haar war leicht grau, nicht ganz, aber man merkte, dass es angefangen hatte, das Alter zu zeigen.
Kalter Wind blies in die Lounge. Nur Georg und Josef, die zwei Piloten, die gerade nicht flogen, waren da und beschäftigten sich mit dem Wetter, das über Funk hereinkam. Sie hatten einen Plan vor sich auf dem Tisch und malten darin herum. Dann war da noch ein Ehepaar, das scheinbar ungeduldig auf seinen Abflug wartete. Es waren Eingeborene, die nach Hause wollten. Sie hatten mehrere Plastiktüten neben sich. Sichtlich hatten sie eingekauft.
Georg bat ihn, die Tür zu schließen und sich zu setzen. Dann fragte er ihn, wie er denn das anstellen wolle und wie er sich das alles vorstellte. Er meinte, dass er sich von seiner Frau getrennt habe und ein neues Leben anfangen wolle. Mehr möchte er darüber nicht reden. Jedenfalls nicht jetzt. Vielleicht später einmal. Er suchte einen Job als Pilot. Erfahrung hätte er nicht viel, aber das würde schon werden, sagte er voller Zuversicht. Die erforderlichen Lizenzen hätte er, also gab es keinen Grund, es nicht wenigstens einmal zu versuchen. Sie sollten ihm doch bitte eine Chance geben. Und warum nicht? Das jedenfalls meinte Georg, dem der Platz gehörte, und der immer auf der Suche nach Piloten war, die in dieser Gegend fliegen wollten. Es gab nicht viele, die dieses Leben wollten. Und viele von denen, die es taten, waren eines Tages in der endlosen Weite der Prärie verschollen.
Der Lohn war mickrig, die Aussichten auf ein angenehmes, abenteuerliches Leben in Saus und Braus gering. Es roch mehr nach Arbeit, die sich nicht lohnte, aber es ging Armin nicht um Geld oder ein gutes Leben. Es ging ihm darum, zu fliegen, seiner Leidenschaft jeden Tag, wenn möglich, nachzugehen. Das war alles. Er wollte nach oben, über die Wolken. Dort, wo die Freiheit keine Grenzen hat.
Die ersten Jahre flog er einfach mit. Saß neben den Piloten, die froh waren, nicht allein in die Wildnis gelassen zu werden. Meist führte der Weg einsam durch die Berge, nur die Bäume, die Felsen und die unendliche Weite unter sich. Und die Verbindung über Funk. Da war man froh, manchmal jemanden neben sich zu haben.
Eines Tages war es dann soweit. Man gab ihm die Havilland, eine alte Maschine, die ein Pilot namens Gregor geflogen hatte. Gregor ging nach San Francisco. Hatte genug von Kälte, Wind und Eis. Das war Armins Chance.
Es war viele Jahre her, mehr als zwanzig, seit er das erste Mal in einer Maschine gesessen hatte. Trotzdem war es für Armin immer so, als wäre es der erste Flug in seinem Leben. Das erste Mal, mit dem Gerät abzuheben. Man sah ihm die Begeisterung an, als er dort saß, das Steuerhorn anfasste und nach draußen blickte. Wie ein kleiner Junge, der ein neues Spielzeug bekommen hatte und nicht erwarten konnte, es auszuprobieren. Selbst Georg musste zugeben, dass er wenige Piloten kannte, die so mit Leib und Seele dabei waren.