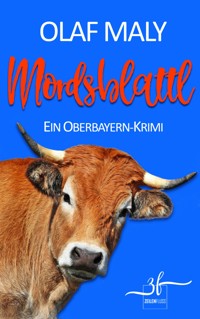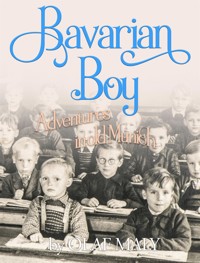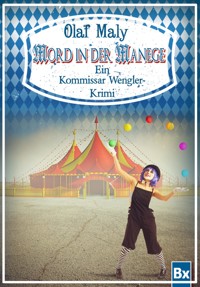6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leopold Weber kommt als junger Mann rein zufällig auf den Oberhof. Eigentlich nur, um ein wenig Geld zu verdienen. Dass sich dort sein Leben für immer verändern könnte, damit rechnet er nicht. Schon gar nicht damit, dass er sich hoffnungslos verliebt.
Eine Liebe, die ihm nicht vergönnt sein wird, weil sie nur für kurze Zeit Teil seines Selbst wird. Denn ausleben und erleben darf er sie nicht. Dennoch werden diese wenigen Jahre, die er dort, an jenem Ort, erlebt, sein ganzes Leben beeinflussen wie nie etwas anderes, das er zuvor oder danach jemals erlebt hat.
Viele Jahre gehen ins Land – Jahre, in denen er versucht, diese eine bedeutungsvolle Begegnung, die ihn so sehr geprägt hat, zu vergessen. Oder zumindest zu verarbeiten, zu verstehen. Jahre, in denen er versucht, mit den Erinnerungen zu leben. Doch es gelingt ihm schlichtweg nicht.
In den letzten Wochen seines Lebens versucht er nun, all das, was ihn so lange und intensiv beschäftigt hat, erneut aufzuarbeiten. Die Erinnerungen an eine bessere Zeit, Erlebnisse, die seinen Weg bestimmt haben, sind einfach zu tief in sein Gedächtnis eingebrannt. Die Liebe, die er nie hat leben dürfen, kann er nicht mehr zurückholen. Und doch hat sie ihn stets begleitet. Er will sie noch einmal erfahren, diese Gefühle – indem er sich an sie erinnert, dort, wo alles begonnen hat. Alles ist vergänglich, aber träumen, das kann er. Und eines wird ihm ganz bewusst: Man kann sich den Tod nicht aussuchen. Das Leben … allerdings auch nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Weiße Tannen am Oberhof
Eine Liebesgeschichte
Ich möchte mich an dieser Stelle bei zwei Personen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre. Da wäre zuallererst meine langjährige Partnerin Marita Stepe, die es stets auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen, und mit konstruktiver Kritik auf die Handlung Einfluss nimmt. Und dann noch bei meiner Lektorin, Alice Scharrer, die mit Engelsgeduld meine Fehler ausmerzt. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort
Die Kugelmenschen
In der griechischen Mythologie erscheinen die Kugelmenschen in einem fiktiven Dialog, den Platon von dem Komödiendichter Aristophanes erzählen lässt:
Dem Mythos zufolge war die menschliche Natur einmal sehr viel anders gestaltet, als wir sie heute kennen. Die Menschen hatten kugelförmige Rümpfe sowie vier Hände und Beine und zwei Gesichter mit je zwei Ohren auf einem Kopf, den ein kreisrunder Hals trug.
Es gab nicht nur zwei Geschlechter, sondern deren drei. Manche waren rein männlich, manche rein weiblich, und manche waren beides, männlich und weiblich. Die rein männlichen stammten von der Sonne ab, die rein weiblichen von der Erde, und die zweigeschlechtlichen vom Mond.
Nun wurden diese Kugelmenschen eines Tages so übermütig, dass sie sich erdreisteten, die Götter angreifen zu wollen. Also beratschlagten die Götter, was zu tun sei, um die Macht der Kugelmenschen zu brechen. Zeus wollte die Kugelmenschen nicht töten, da auch die Götter nicht auf die Menschen verzichten wollten. Jemand musste sie ja verehren, sie anbeten und ihnen Opfer bringen.
Zeus befahl also, diese Kugelmenschen in zwei Teile zu spalten, um sie damit zu schwächen. Und daraus entstand der heutige Mensch, mit zwei Beinen, zwei Armen und einem Gesicht mit zwei Ohren.
Der Gott Apollon erhielt den Auftrag, die Gesichter in Richtung Schnittfläche zu drehen und die Schnittfläche zu verschließen. Den Verschluss, den Nabel, kann man bis heute noch sehen.
Nun aber litten die Menschen sehr unter der Teilung, und sie weigerten sich, weiter so leben zu wollen. Um das Aussterben der Gattung zu verhindern, schließlich brauchte man ja die Menschen, verlegte Zeus die Geschlechtsorgane, die bis dahin hinten angebracht waren nach vorne, damit die Menschen sich wenigstens vorübergehend befriedigen konnten und damit zeitweise glücklich waren. Das hatte auch den positiven Effekt, dass die Menschheit nicht aussterben konnte.
Diese Sehnsucht nach Vereinigung, der Ganzheit, zeigt sich bis heute in dem Verlangen, seine zweite Hälfte zu finden, um mit ihr glücklich zu werden.
Jeder sucht verzweifelt seine zweite Hälfte. Manchmal sein ganzes Leben lang. Die, die ihre Hälfte finden, sind als glücklich einzuschätzen, wenn sie es auch manchmal nicht wissen.
Oberhof
Oberhof
„ Es ist spät geworden“, sagte Maria. Sie stand langsam auf, streckte sich ein wenig, nahm ihre Brille vom Tisch und versuchte, sich einen Weg vorbei an den Beinen und Füßen der anderen zu bahnen, die wenig Lust hatten, ihr Platz zu machen. Es ging ihr nicht gut an diesem Abend. Irgendwie war sie müde geworden. Keiner sagte etwas zu ihr, alle schauten sie nur an, als sie versuchte, sich durch den Dschungel von Beinen zu schlängeln. Keiner unterbrach, was er gerade tat. Auch nicht, um jemandem Platz zu machen. Man lachte, redete, trank, stieß die Gläser zusammen und freute sich des Lebens.
Es war dunkel geworden. Der Mond hatte sich hinter den Wolken versteckt, die nur noch erahnen ließen, dass er am Himmel stand. Das fahle gelbliche Licht, gefiltert durch dünne Wolkenfetzen, zauberte seltsame Schatten von den hohen Tannen, die neben dem Haus standen.
Das meiste Licht, das die Terrasse vor dem Haus etwas erhellte, kam, wenn auch schwach gedämpft, aus dem Fenster dahinter. Dort war die Bibliothek, wie man den Raum nannte, auch wenn es dort nur wenige Bücher gab. Und schon überhaupt gar kein Regal, in dem diese stehen konnten. Meistens waren es Illustrierte, die verstreut auf einem kleinen Tisch lagen. Alte, zerfledderte Hefte, die schon hundertmal gelesen waren. Die meisten Seiten fehlten. Fing man an, eine Geschichte zu lesen, hörte sie irgendwo auf einmal auf. Die nächsten Seiten waren herausgerissen. Den Rest musste man sich also denken. Vielleicht war das der Reiz. Jeder dachte sich den Fortgang anders aus. Dann erzählte man davon, und hatte jemand den Anfang auch schon gelesen, ergaben sich erhitzte Diskussionen, was denn nun das Ende hätte sein können.
Der gemeinsame Fernsehapparat stand dort, einige Sessel, ein alter Plattenspieler mit zwei großen Lautsprechern. Der Fernseher war ein sehr altes Modell, groß, klobig, mit kleinem Bildschirm. Wenn man wirklich etwas sehen wollte, musste man sehr nahe heranrücken. Als man ihn kaufte, war es das größte Modell, das es gab. Das war allerdings schon sehr lange her. Nussbaum furniert. Mit goldenem Rand und einem Lautsprecher auf der Seite, der mit einem goldfarbenen Netz abgedeckt war. Es war an der Seite eingerissen. Wenn der Ton an war, schwang das Netz dort, wo es gerissen war, mit. Man konnte meinen, es ließ den Ton herausblasen. Die Leute, die im Haus wohnten, sahen kein fern, sie wussten nicht einmal, warum sie so etwas wie diese „Kiste“, wie man es allgemein nannte, hatten. Es war mehr ein Relikt der Vergangenheit. Man sträubte sich, es wegzuwerfen. Man schmiss alte Sachen nicht weg, nur weil sie alt waren. Man selbst war alt.
Eine kleine Lampe, die über dem Eingang montiert war, trug seitlich am Haus noch etwas zur Helligkeit bei. Es hellte den Bereich nicht unbedingt gewaltig auf, nur konnte man mehr sehen als ohne diese fahlgelbe Strahlung. Man hatte auch noch eine Stehlampe, die neben der Couch stand, eingeschaltet. Der große dunkelbraune Lampenschirm, der tief nach unten reichte, nahm das meiste Licht auf, ohne es wieder abzugeben.
Das Fenster zur Bibliothek war leicht geöffnet. Der durchsichtige Vorhang schwebte wie schwerelos davor auf und ab. Er züngelte sich nach innen, in den Raum, wie eine weiße Flamme aus Stoff. Er zeigte sich dann wieder durch das offene Fenster, wenn der Wind es einen Spalt weiter geöffnet hatte. Ein paar Kerzen, die auf dem alten Tisch standen, flackerten sanft.
Kurt Edermann hatte auf dem Plattenspieler Mahler aufgelegt. Die erste Symphonie. Sehr zum Unbehagen einiger Anwesenden, die sich aber seufzend irgendwann damit abfanden und es ganz einfach ignorierten. Sie konnten ohnehin nichts dagegen tun. Die Musik passte sehr gut zur Stimmung, zur Natur, zum lauen Abend, wie Kurt Edermann meinte. Er saß mit dem Rücken zum offenen Fenster, hatte also den besten Platz.
Sie waren an diesem Abend alle noch zusammen auf der Couch und den Sesseln gesessen, auf der Veranda, die seitlich und teilweise auch vorne, mit einem Geländer begrenzt war. Die senkrechten Stützen des Geländers waren alle einzeln gedreht und sahen aus wie kleine Säulen. Die, die man über die Jahre auswechseln musste, waren alle ein wenig anders. Dicker, schwerfälliger. Andere waren auch schlanker. Nie schien man die richtigen Proportionen wiedergefunden zu haben. Sie hatten sicherlich nicht die Eleganz der ersten Generation, erfüllten aber ihre Bestimmung. Auch die Farbe war oft unterschiedlich.
Alle zwei Meter waren diese Säulen mit kräftigeren Exemplaren nach oben verlängert, um den Balkon zu halten, der über der Terrasse hing. Niemand betrat mehr diesen Balkon, da man berechtigte Angst hatte, er würde einen nicht mehr tragen. Schief hing er irgendwie in der Wand. Nur Blumenkästen gab es dort im Sommer, die Maria in ihrem unerschütterlichen Optimismus das 'der wird schon noch halten' jedes Jahr dort pflanzte. Sie war dann auch die einzige, die es wagte, dort hinauszugehen.
Man musste, um nach oben auf die Veranda zu kommen, ein paar Stufen hochgehen, die mittig angebracht waren. Es war der Haupteingang, als es noch der Hof war und die Gutsherren das Haus bewohnten. Der Betrieb selbst lag abgeschirmt hinter einer Mauer. Das war sehr lange her, aber man konnte sehr wohl noch die Grandiosität erahnen, wenn man vor dem Eingang stand.
Vor der erhöhten Terrasse gab es einen kleinen Kreis, in der Mitte stand eine Tanne. Sie war sehr klein, diese Tanne, als Maria sie mit ihrem Vater gepflanzt hatte. Sie hatten sie aus dem Wald geholt, vorsichtig ausgegraben und dann dort wieder eingepflanzt. Heute war sie viele Meter hoch und versperrte den Blick auf die kleinen Hügel, die im Osten lagen. Der Kreis war auch die Zufahrt zum Eingang, die, dort von der Hauptstraße kommend, endete. Der Dienstboteneingang lag seitlich, ebenerdig, an der Südseite. Dort waren auch die Parkplätze der Autos. Man hatte nur zwei, und die nahmen fast die ganze Länge des Hauses ein.
Die Gruppe, die den Oberhof ihr Zuhause nannten und ihn zu dem machten, was er war, saß an diesem Abend noch gemütlich zusammen. Ein großes Abenteuer war es, dachte man. Ein Lebensabenteuer, das zu Ende ging. Unweigerlich. Unaufhaltsam. Also musste man die Stunden, die man noch hatte, genießen. Man erzählte, lachte und trank. Das alte Sofa und die verschlissenen Sessel waren alle eingenommen. Vor ihnen stand ein abgenutzter kleiner Holztisch, der an sich schon lange in den Müll sollte. Aber niemand hatte es bisher übers Herz gebracht, das endlich einmal zu tun. Solange man etwas darauf abstellen oder ablegen konnte, war er noch zu etwas nutze. Warum also wegwerfen.
Er hatte wahrscheinlich viel gesehen in seinem Leben, dieser Tisch, was man sehr wohl an all den Ringen ablesen konnte, die Gläser im Laufe der Zeit auf dem verworfenen Furnier hinterlassen hatten. Teilweise war es an den Rändern sogar abgeblättert und gab die Spanplatte frei, auf die man es geklebt hatte. Als hätte man ihm die Haut abgezogen und sein Inneres bloßgelegt. Es wäre sicher sehr interessant gewesen, all die Geschichten zu hören, die um ihn herum stattgefunden haben. Geschichten, die die Zeit ausmachten, in der er Mittelpunkt war. Nur die meisten dieser Geschichten waren schon viel zu lange eben genau das. Geschichten, die sich aufgelöst hatten und die keiner mehr hören wollte. Man hatte ohnehin keine Geduld mehr, mit all den Gefühlen, Erlebnissen und verlorenen Ereignissen umzugehen, die irgendwo im Nichts verschwunden waren. Man wollte auch nicht der Traurigkeit nachhängen, die sich ergab, wenn man nostalgisch an etwas dachte, das in Wirklichkeit gar nicht so war. Was zählte, war die Zukunft, die doch so viel mehr zu bieten hatte. Man vergaß dabei immer, dass man nur in der Gegenwart leben konnte. Ein Zustand, den es eigentlich gar nicht gab, wenn man so darüber nachdachte. Die Zukunft ist nichts als ein Traum, der noch nicht einmal angefangen hatte. Man ahnte, wie es weitergehen konnte, das war alles. Die Vergangenheit ist längst gewesen und nur noch Erinnerung. Dazwischen war nur das absolute Nichts. Und dort hielten wir uns auf.
Eine kleine, blaue Tischdecke, die all die Jahre und die Feste , die hier stattgefunden hatten, auch nicht richtig darunter verbergen konnte, war gut genug, ihm das Recht zu geben, dort zu stehen. Auch wenn sie ihn nicht ganz bedeckte, sie gab ihm ein gewisses Attribut der Schönheit. Marias Mutter hatte die Tischdecke einmal selbst genäht, aus einem alten Hemd, das zerrissen war, und Maria hatte sie später geerbt. Das war im Winter, wenn das Wetter kalt war und der Schnee schwer unter den Schuhen klebte und einem der Atem in der Nase fror. Dann hatte man Zeit dazu, solche Sachen zu erledigen. Man saß am Kamin, freute sich, dass man es warm hatte, sang leise ein Lied vor sich hin und beschäftigte sich.
Marias Mutter war besonders begabt in dieser Richtung , wenn es um solche Dinge ging. Singen und Musizieren waren ihre Leidenschaft und wann immer sich die Möglichkeit ergab, holte sie ihr Hackbrett heraus und stimmte ein bisschen Stubenmusik an. Der Knecht Heronimus zupfte leise auf der Gitarre. Dann ermunterte sie ihre Kinder, dazu zu singen. Er hieß wirklich Heronimus, jedenfalls sagte er das, als er um Arbeit fragte und eingestellt wurde, weil gerade jemand gebraucht wurde. Keiner interessierte sich dafür, wie er hieß und ob es stimmte oder nicht. Und er wusste die Gitarre zu spielen. Es waren schöne Erinnerungen, die man sich auf die Reise des Lebens mitnehmen konnte.
Es war ein warmer, samtiger Abend, als alle sich zusammenfanden. Einer von denen, die man zählen konnte hier in Oberbayern, wo es gerade einmal zwei Monate so angenehm warm war, dass man ohne Jacke herumlaufen konnte. Den Rest des Jahres regnete es entweder oder der Schnee, die Kälte, und der Wind ließen einen nicht aus dem Haus. Dann waren es immer nur die Krähen, die man den ganzen Tag hörte und die ihr Lied von der Traurigkeit in die Welt sangen. Man sang keine fröhlichen Lieder bei diesem Wetter. Auch Vögel nicht. Und Krähen schon überhaupt nicht.
Und wenn man dann doch aus dem Haus musste, dann zog man sich alles an, was man hatte, nur um nicht zu erfrieren. Es war ein harsches Klima, das die Menschen prägte, sie zu dem werden ließ, was sie sind. Zurückgezogen in sich selbst, leben sie meistens stumm vor sich hin, dem Schicksal ergeben. Sie redeten wenig, dort auf den Höfen, die vereinzelt in die karge Landschaft gestellt wurden. Nur das Nötigste. Als würde es zu viel Kraft kosten, etwas zu sagen. Und was sollte man auch schon sagen. Nichts passierte, was es wert gewesen wäre, darüber zu reden. Außer jemand starb oder ein Kind wurde geboren. Jeder hatte dasselbe Los zu tragen und seine Erfahrungen zu machen. Das war kein Grund, sich gegenseitig die Zeit zu stehlen.
Man sah es auch in den Gesichtern, die eine dunkle, lederartige Haut umspannte. Die Augen waren tief in den Höhlen, die Nasen immer rot und von vielen kleinen Adern durchzogen. Auch die Backen hatten diese Färbung, vom endlosen Wind, der immer von den Bergen herunterblies und einem manchmal die Luft nahm, wenn man sich ihm entgegenstellte. Dann stand man auf dem Feld, zog den Kopf tief in die Schultern, den Hut nach vorne übers Gesicht und verfluchte den Tag, der so gut angefangen und sich mit all den vielen schwarzen Wolken wieder verabschiedet hatte. Wenn man nass bis auf die Knochen war, klebte der Lehm in schweren Brocken an den Schuhen, die dem Gewicht nicht standhielten. Die Sohle gab nach, aufgeweicht und schlapp fiel sie vom Schuh. Wieder mehr Arbeit, die man nicht brauchen konnte.
Aber diese Zeiten waren lange vorbei. Das waren die Mühen der Vorfahren, nicht die der jetzigen Generation.
Die Menschen, die sich an diesem Abend auf der Terrasse zusammengefunden hatten, mussten nicht mehr aus dem Haus, wenn sie nicht wollten. Sie konnten sich aussuchen, wo sie sich aufhalten wollten. Sie waren, sozusagen, angekommen. Man hatte kein anderes Ziel mehr. Man war selbst das Ziel geworden.
An diesem Abend war die Luft wie Seide und sie schwang im Rhythmus der Schöpfung. Ein leises Säuseln war alles, was man wahrnehmen konnte. Die Blätter in den Bäumen ergaben sich dem leichten Wind und raschelten wie ein leiser Besen auf einem Schlagzeugbecken zu zärtlicher Jazzmusik.
Die Frösche quakten um die Wette, weit entfernt, dort unten am Teich, der mehr als zweihundert Meter weg war. Man nahm sie wahr, leise zwar, aber dennoch. Sie bildeten den Hintergrund der Geräusche der Nacht. Es waren meistens Erdkröten. Die warzigen, braunen, schlammigen Genossen, die es dort in Mengen gab. Der Teich war vom Haus aus nicht zu sehen, aber jeder wusste, dass er dort lag. Man nahm nicht diese Richtung, wenn man spazieren ging, da dort der Weg endete und nur undurchdringlicher Wald anfing. Der Weg zum nächsten Dorf führte mehrere Meter westlich daran vorbei.
Er war dunkel, geheimnisvoll und tief. Man konnte ihn hören, diesen Weiher, wenn man seine Ohren aufmachte und sich die Zeit dazu nahm. Jede Nacht gab er seine Existenz preis durch Plätschern und ein leises Rauschen. Ein kleiner Bach, der über große, blank gewaschene Steine floss, endete dort, nur um im Erdreich zu versickern. Es knackten Äste, die über die Zeit herunterfielen und sich am Boden häuften. Dann raschelte das Laub, wenn sich etwas dort auf den Weg machte. Man sah es nicht, wusste aber, dass dort Leben war.
Dieser modrige Teich lag in einer kleinen Mulde, umgeben von großen, alten, gewichtigen Eichen, Buchen und Tannen, die dort schon lange standen, bevor sich jemand in ihrer Nähe niedergelassen hatte. Sie waren in dieser Gegend die Zeichen der Ewigkeit und der Unvergänglichkeit. Dann gab es diese Sumpfpflanzen, die besonders im Sommer immer alles zu wucherten. Man erzählte in der Gegend, dass der Teich sehr tief sei und schon einige versucht hatten, nach unten zu tauchen. Keiner wäre bisher wieder aufgetaucht. Das waren wahrscheinlich mehr Märchen, die man hauptsächlich erzählte, damit Kinder dort nicht hineinsprangen. Aber sicher konnte man sich nicht sein.
Auch sollte es dort einen Karpfen geben, der mehr als zwei Meter lang sei. Gesehen hatte ihn noch niemand, aber wenn man die Leute fragte, die in der Gegend wohnten, sprachen sie mit Ehrfurcht von diesem Monster.
Man hatte vor Jahren alte Feuersteine dort am Ufer gefunden, die darauf hindeuteten, dass es an diesem Platz schon Menschen gab, die nichts anderes hatten als sich selbst und ein Dach aus Ästen und Laub, wenn sie eines brauchten. Es muss also schon damals, vor vielen Tausenden von Jahren, diese Wasserstelle gegeben haben. Sicher der Grund, warum sich diese Menschen dort trafen.
Wenn man am Steg stand, den einmal jemand völlig grundlos und wahrscheinlich nur aus reiner Lust gebaut hatte, damit man sich dort niederlassen konnte, war immer dieses leise Platschen zu hören. Es waren die Fische, die in diesem Brackwasser lebten und wahrscheinlich vor lauter Lebensfreude Sprünge machten. Man sah sie nicht, und wenn, dann nur sehr kurzzeitig. Ein goldfarbener, fast spiegelnder, kleiner Bauch kam für eine Sekunde aus dem Wasser, nur um sofort wieder in der Dunkelheit zu versinken. Viel mussten sie nicht befürchten, konnten sich sehr wohl sehen lassen, wenn sie sprangen. Man ließ sie leben.
Glühwürmchen flogen vor dem Haus in unregelmäßigen und launenhaften Bewegungen ihre leuchtenden, nervös irritierenden Bahnen. Motten umkreisten das trübe Licht in einem unerfindlichen Drang nach Wärme und Sonne, die sie doch nie zu sehen bekamen. Was sie erwartete, war der Tod, nicht das Leben, wenn sie ihr Ziel ansteuerten und es endlich erreicht hatten. Sie sehnten sich danach, zu sterben, so schien es.
Es roch nach frisch geschnittenem, nassem Gras, das noch auf der Wiese vor dem Haus lag und darauf wartete, eingebracht zu werden. Je später der Abend wurde, so feuchter und intensiver war der Geruch, den alle so liebten und der vielleicht auch einer der vielen Gründe war, hier zu wohnen. Ob man sich nun dessen bewusst war oder nicht.
Der Wein und das Bier flossen noch kräftig, man hatte sich eingedeckt und gedachte so schnell nicht ins Bett zu gehen. Es gab viel zu erzählen. Man lachte, stieß mit den Gläsern an. Man freute sich, hier zu sein. Das Leben, das man hinter sich hatte, war es wert von anderen erfahren zu werden. Man erzählte sich gegenseitig die Geschichten, die alle schon so oft gehört hatten, und die dennoch immer wieder anders waren. Immer wieder neu und interessant und umso aufregender, je öfter man sie sich erzählte. Mahlers Erste lief schon zum dritten Mal. Der Plattenspieler fing automatisch immer wieder an der ersten Rille an, wenn sich der Tonarm abhob und an den Anfang zurückschwang. So hörte man nur den ersten Satz.
„Stellt euch das einmal vor“, meinte Günter Berger.
„Wie viele Geschichten es gibt, die man in seinem Leben erleben kann. Geschichten, die eigentlich keine Bedeutung haben, und die immer so oder auch anders hätten ausgehen können, ohne dass wir etwas dazu können. Sind sie aber nicht. Sie sind in dieser Richtung verlaufen, in der sie irgendwie geplant waren, sich selbst zu entwickeln. Hätte nur eine Winzigkeit nicht gepasst, in dieser Abfolge von Ereignissen, alles wäre anders gekommen.“
„Ja“, meinte Kurt Edermann, „man hätte andere Menschen getroffen. Unterschiedliche Wege hätten sich gekreuzt, ob man nun wollte oder nicht. Niemand hat irgendwie darauf Einfluss. Die anderen Wege sah man nicht, hat sie vielleicht nicht wahrgenommen. Oder sie waren nicht von Bedeutung. Man nahm sie vielleicht wahr, diese Ereignisse, die doch im letzten Moment verhindert wurden, oder man sah sie auch nicht. Man läuft doch an den meisten Menschen vorbei, als wären sie nicht einmal anwesend. Und dann, in einer Minute der Ruhe, sieht man sie wieder vor Augen, diese Menschen, und man denkt sich: Mit dem hätte ich gerne gesprochen. Was wäre gewesen, wenn wir uns unterhalten hätten? Was hätte dieser Mensch mir geben können, und was ich ihm? Nur ist es zu spät. Der Augenblick ist vergangen, die Chance verpasst.“
„Ja“, antwortete Günter Berger, „dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen mit der großen Liebe, die man sich doch so ersehnt hat und die dann wieder zerbrochen ist wie ein Glas, das auf den Boden gefallen ist. Sobald man sich besser kannte und feststellte, dass die Fassade bröckelte, waren die Illusionen nur noch das. Träume vom großen Glück. Was dann kam, war nur grau und leer, nur ein Gespenst dessen, was man sich einmal vorstellte. Und dann dachte man, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie es nicht gegeben hätte, die große Liebe. Der Schmerz, das Leid, die Zerrissenheit. Alles hätte man sich ersparen können. Die Traurigkeit ändert sich nicht, nur weil man das Leben gesehen hat. Sie bleibt bei einem wie die Haut, die einen umspannt.“
Er sagte das in einem sehr nachdenklichen, fast betrübten Ton.
Nun saßen sie alle da, auf der Terrasse, und sahen sich an. Sie hatten sich gefunden, auch wenn sie sich nicht unbedingt gesucht hatten. Etwas, was man Schicksal nannte, hatte sie zusammengeführt. Sie waren irgendwie angekommen. Auf dem Oberhof angekommen.
Elise Blum kam aus der Tür, stellte sich vor die Gruppe und wartete, dass alle aufhörten zu reden. Alle sahen sie auf einmal entgeistert an. Alles war stumm. Nichts regte sich mehr.
Kurt Edermann, der Musiker, war der erste, der etwas sagte:
„Ist irgendwas, Elise? Du siehst so betroffen aus.“
Frau Blum stand nur dort und sah alle nach der Reihe an. Sie zitterte ein wenig. Es konnte nicht die Kälte sein. Es war immer noch samtig warm.
„Sie ist umgefallen“, meinte sie leise, als wollte sie es eigentlich nicht sagen. Es fiel ihr sichtlich schwer, diese Worte herauszubringen.
„Sie liegt im Gang. Wir sehen besser nach, was mit ihr ist.“
Nun sahen alle beklommen aus, auch wenn keiner genau wusste, was passiert war. Die Fröhlichkeit, die es den Abend über gegeben hatte, war wie weggeblasen. Wie auf ein Kommando standen alle auf und drängten sich durch die Tür, die offen stand. Dort, auf den blauen Fliesen, lag Maria Bauer und rührte sich nicht mehr. Eine kleine Blutlache war neben ihrem Kopf zu sehen. Sie war scheinbar umgefallen und auf die Fliesen im Gang zu liegen gekommen.
„Ruft bitte jemand den Notarzt?“, sagte Herr Edermann, der scheinbar als einziger Herr der Lage war. Mahlers Erste lief immer noch, als wäre nichts geschehen.
Die Erbschaft
Die Erbschaft
Es war ein nasser, nebliger Oktobertag. So wie viele Tage in diesem Monat nass und undurchsichtig waren. Man sah manchmal keine zehn Meter, was im Prinzip nicht so schlimm war, da man auch ohne den Nebel nicht viel Faszinierendes gesehen hätte. Das Grau der Häuser mischte sich mit dem Grau des Tages, bis nichts mehr zu erkennen war. Außer eben die graue Realität, die von allen Häusern, Bäumen und Straßenlampen tropfte, die den ganzen Tag nicht mehr erloschen. Es kamen noch viele solcher Monate. Sie hießen November, Dezember, Januar, Februar und März. Nur der April versprach manchmal Besserung, wenn auch immer nur für kurze Zeit. Wechselhaft. Mal so, mal so. Auch im Mai soll es schon geschneit haben. Alle diese langen Monate waren meist nass und kalt und verschwommen, milchig verglast und undurchdringlich nass. Also ein ganz gewöhnlicher Tag um diese Jahreszeit, auf den man sich nicht gerade gefreut hatte, an dem man aber auch nichts ändern konnte, ihn also ertrug so gut es ging.
Und an diesem Tag war dieser verwaschene rote Zettel, im verbeulten Postkasten gelegen, neben den zerfetzten Reklamesendungen und den Gutscheinen für eine Pizza. Wenn man zwei kauft. Dieser rosa Zettel passte irgendwie nicht zu diesem Tag. Nicht zu diesem und auch nicht zu einem anderen. Zu keinem. Oder vielleicht gerade doch, da verwaschene rote Zettel im Briefkasten im Allgemeinen nichts Gutes bedeuteten.
Ein Einschreiben wäre an der Post abzuholen, stand darauf. Mein Name war dort in schwarzen, geraden Amtsbuchstaben zu lesen, obwohl ich mich, Leopold Weber, der Empfänger der Nachricht, nicht erinnern konnte, etwas ausgefressen zu haben. Und wenn, so musste es etwas gewesen sein, was mir nicht bewusst war. Das kam schon einmal vor. Aber, dachte ich mir, es ist so wie mit dem Wetter. Es war schlecht, aber ich konnte sicher nichts dafür.
Als ich nun dort stand und den Zettel in den Händen drehte und immer wieder ansah, fiel mir dabei ein, dass es immer kalt und unfreundlich war, wenn man schlechte Nachrichten bekam. Ich wusste zwar nicht, ob es eine schlechte Nachricht war, aber in meinem Leben gab es in letzter Zeit keine rosa Zettel mit guten Nachrichten. Ich wusste nicht, warum ich gerade in diesem Moment daran denken musste, aber irgendwie kam es mir in den Sinn. Wie auch auf Beerdigungen. Nie schien die Sonne, nie kam man ins Schwitzen, nie musste man seine Jacke ausziehen, damit man Luft bekam, wenn man jemanden eingrub . Nein, man steht immer da, mit einem Regenschirm in einer Hand und hält mit der freien Hand den Mantel am Hals geschlossen, in der Hoffnung, dass man dann ein bisschen weniger friert. Und vielleicht nicht der nächste ist, für den man deswegen die Grube gräbt. Jeder Versuch der Besserung ist vergebens. Auf Beerdigungen friert man immer.
Der alte Herr Morgentaler vom dritten Stock geht an mir vorbei. Gebückt schleppte er zwei Einkaufstaschen die Treppe hoch und sah mich dabei ein paarmal an. Wahrscheinlich wollte er, dass ich ihm helfe. Ich machte das einmal, aus lauter Gutmütigkeit, nur um mir dann am nächsten Tag sagen zu lassen, dass die Eier kaputt waren, als er diese auspackte. Vielleicht hatte ich die Tüten vor der Tür etwas zu kräftig auf den Boden aufgesetzt, aber das deswegen die Eier kaputtgingen, konnte nicht sein. Das Ergebnis war, das ich seitdem nicht mehr helfen durfte. Und deswegen sah mich Herr Morgentaler immer wieder kurz an, wie ich dort neben den Briefkästen stand und mich über den roten Zettel wunderte.
Wichtige Dinge wie unbezahlte Rechnungen, Mahnungen, Gerichtstermine, Straf- oder Steuerbescheide werden meist mit so einem rosa Zettel angekündigt, ging mir durch den Kopf. Warum das so ist, wird wahrscheinlich niemand mehr wissen. Vielleicht gab es einmal einen wichtigen Grund dafür. Man hatte ihn vergessen und das System ganz einfach beibehalten.
Rosa und rot, wenn auch verwaschen, sollten eigentlich die Farbe der Freude, der Liebe und der Erwartung sein. Nicht eine Farbe der Tragik, mehr der Hoffnung. Solche Briefe erwecken dann normalerweise immer oft ein schlechtes Gewissen, auch wenn man sich fast sicher ist, keinen Grund dafür gegeben zu haben. Einschreiben sind nie Liebesbriefe oder Lottogewinne, immer ungute Nachrichten. Jedenfalls denkt man so. Und so dachte auch ich, als ich den Zettel in der Hand hielt, mich gegen die Wand lehnte und ihn für einige Minuten betrachtete.
Eine junge Frau mittleren Alters, die ich zwar vom Sehen her kannte, aber mit der ich bisher nie gesprochen hatte, ging an mir vorbei zu ihrer Wohnung im Erdgeschoss. In jeder Hand hatte sie eine Plastiktüte eines Kaufhauses. Es waren alte Tüten. Die Schrift war verblasst, fast gegangen. Sie sah mich an, als hätte ich mich verlaufen und wüsste nicht wohin. Sie kannte mich auch, wusste, dass ich hier im Haus wohnte. Sie sagte nichts, sah mich nur an, schüttelte den Kopf und ging ihrer Wege. An der Tür zu ihrer Wohnung blieb sie stehen, schloss umständlich auf und verschwand. Man hörte die Riegel ins Schloss fallen. Ich sah ihr gedankenlos nach. Sie musste neu sein, da die Frau Kernbauer, die in dieser Wohnung ihr halbes Leben lebte, vor ein paar Wochen mit den Sanitätern auf einem Rollbett einfach wegfuhr. Und nicht mehr zurückkam.
Ich mochte die Frau Kernbauer. Sie wusste immer, wann ich nach Hause kam. Ihre Tür hatte eine kleine viereckige Glasscheibe im oberen Drittel. Neben dem Rahmen, außen, hatte sie einen Spiegel angebracht, damit sie immer wusste, wer zur Tür hereinkam. Dann, wenn man die paar Stufen hinaufging, machte sie ihre Tür einen Spalt auf und begrüßte einen. Manchmal, meistens montags, sagte sie zu mir:
„Herr Weber, jetz bleim’s amal stehn, weil ich hab was für Sie.“
Dann ging sie zurück in die Wohnung und kam mit einem kleinen Paket wieder heraus, in dem sie den übrig gebliebenen Kuchen vom Sonntag eingepackt hatte.
„Damit’s auch was Schön’s ham“, meinte sie dann und verschwand wieder hinter ihrer Wohnungstür.
So stand ich immer noch da, an die Wand gelehnt, und dachte an Frau Kernbauer und die Kuchen, die ich manchmal bekam. Mein ganzer Kopf war irgendwie leer. Ich nahm nichts mehr richtig wahr, stand da nur und gab wahrscheinlich ein ziemlich trauriges Bild ab.
Hassan rannte an mir vorbei. Er kam die Treppe heruntergeschossen, nahm immer zwei oder drei Stufen auf einmal, riss die Tür auf und war so schnell weg, wie er nur konnte. Der kalte Wind kam ins Treppenhaus, dann schlug die Tür mit einem lauten Knall wieder ins Schloss. Ich wusste nicht wie er hieß, da er nie mit mir sprach, mich eigentlich immer total ignorierte. Für mich sah er aus wie jemand aus dem nahen Osten. Dunkle Haut, schwarze Haare, die tief bis in die Stirn reichten, dunkle Augen. Also nannte ich ihn für mich ganz einfach Hassan. Seine Mutter kam immer mit einem Kopftuch aus der Wohnung, das nur einen kleinen Teil ihres runden Gesichts freigab. Ich wusste nicht einmal, welche Haarfarbe sie hatte. Alles an ihr war immer grau. Den Mann der Familie hatte ich noch nie gesehen. Sie wohnten erst seit ein paar Wochen dort oben. Die Familie Schaderz, die die Wohnung dort vorher hatte, war auf einmal ausgezogen. Warum, wusste ich nicht. Sie gingen einfach.
Ich steckte den rosa Zettel in meine Jackentasche, seufzte und machte mich auf den Weg nach oben. In meine Wohnung, wo mein Leben auf mich wartete.
Ich wohnte mit meiner Frau in einem dieser alten Häuser aus den Zwanzigerjahren, die im Krieg irgendwie verschont wurden und die man dann auch stehen gelassen hatte. Als wir einzogen, gab es die Toilette nur auf dem Gang, zwischen den Stockwerken. Irgendwann wurde eine Heizung eingebaut, ein Bad nutzbar gemacht und dann das Prachtstück für horrendes Geld vermietet. Man nannte das Altbau, und jeder war verrückt danach, in einem Altbau zu leben. Warum, war mir allerdings ein Rätsel. Das einzig Gute waren die hohen Decken, die ein Gefühl der Großräumigkeit schafften. Alles andere, das Treppenhaus mit den feuchten Wänden, den Eingang, an dem die Tür nicht mehr schloss, den trostlosen Hinterhof mit den Mülltonnen, hatte man gelassen. Ganz zu schweigen von dem Aufzug, den es nicht gab.
Unsere Wohnung lag im zweiten Stock. Das Wohnzimmer lag direkt zur Straße hin. Das bedeutete, dass man die Fenster nicht aufmachen konnte, da sonst der ganze unerträgliche Lärm und Gestank in die Wohnung kam. Die Straßenbahn hielt genau vor dem Haus, was einerseits angenehm war, jedoch nur ein oder zweimal am Tag. Wenn man sie eben brauchte. Die restlichen Stunden war es einfach eine Plage. Sie fuhr an unserem Haus aus einer Kurve, von der Seitenstraße kommend, vorbei, was jedes mal ein quietschendes Geräusch verursachte, und einem langfristig das Trommerfell zertrümmerte. Jedenfalls fast.
Ich hatte noch nicht richtig aufgeschlossen und mich gegen die Tür gelehnt, die immer ein bisschen klemmte, da hörte ich schon meine Frau, Constanze, wie sie mir aus der Küche zurief:
„Bist endlich daheim. Ich hab schon auf dich g’wartet. Des Essen wird schon wieder kalt. Du sollt’st doch schon seit a Stund daheim sein. Wo hast denn wieder rum’trödelt? Kommst jetz auch immer später heim.“
Langsam zog ich mir meinen Mantel aus, hängte ihn an die Garderobe, stellte die Aktentasche auf den Stuhl, der neben dem Schränkchen mit dem Telefon stand, und zog meine Schuhe aus. Ich hatte keine Eile, meiner Frau zu antworten. Wollte eigentlich auch nicht antworten. Und es war auch keine Frage, die sie beantwortet haben wollte. Sie wollte eben nur etwas sagen. Wie sie immer irgendwas Sinnloses zu sagen hatte. Sie hörte sich gerne reden.
„Deine Mutter hat ang’rufen. Mit mir red die ja nicht, weißt eh, also wenn’st wissen willst, was die will, musst es selber anrufen. Nur blöd daher g’redt hat’s wieder, von wegen ‚ihr Sohn, der arme Hund‘ und so’n Schmarrn. Und dass du früher ganz anders warst. Derselbe Scheiß halt, wie immer. Ich hab dann aufg’legt.“
Ich sah sie auf dem Küchenstuhl sitzen, ein Bein unter das andere geschoben. Während sie redete, blätterte sie in einer Illustrierten und rauchte eine Zigarette. Der Aschenbecher quoll über.
Gemächlich machte ich mich auf den Weg ins Wohnzimmer und setzte mich auf den großen Sessel, der in der hinteren Ecke stand, gleich neben der Lampe. Im Frühjahr konnte man dort sitzen und durch das Fenster, das schräg gegenüber war, die Bäume, die auf der anderen Straßenseite wuchsen, blühen sehen. Die Stadt hatte sie vor ein paar Jahren gepflanzt. Begrünungsaktion, nannte man das. Irgendjemand aus der Stadtverwaltung war damals sogar angereist und hatte eine Rede gehalten, von dem grünen Stadtviertel und so, und dann noch ein rotes Band durchschnitten. Ganze fünf Minuten war er da, bis er wieder in seiner Karosse zum nächsten Empfang raste. Wir sahen uns das vom Fenster aus an. Wie in einem Logenplatz im Theater. Nur, nach ein paar Jahren waren die nicht mehr sehr grün. Aber die Hunde hatten dort ihren Platz gefunden. Alles ist für irgendwas gut, dachte ich mir.
Da es bereits früher Abend war, schaltete ich mir die Lampe ein, nahm die Zeitung, die ich mir mitgebracht hatte, und machte es mir bequem. Ich fand sie im Kaffeehaus, in dem ich am Nachmittag war, um ein wenig zu arbeiten.
Meine Frau sah von der Küche aus, dass ich mich hingesetzt hatte, entwirrte umständlich ihre Beine, stand auf und kam ins Zimmer. An den Türrahmen gelehnt meinte sie:
„Ja sauber, magst jetz nix essen?“
„Nein, ich hab schon was g’habt. Kannst es ja aufheben.“
„Is irgendwas?“
„Was soll sein?“
„Was soll sein? Was soll sein? Kommst einfach rein und setzt dich auf den blöden Stuhl da. Sagst nicht amal grüß Gott. Als wär ich nicht einmal da. Und ich häng den halben Tag in der Küch’n rum und koch was, ich Depp.“
Ich sah sie an, wie sie dort stand, in ihrer grauen Trainingshose, einer alten, verwaschenen Bluse und der roten Strickjacke. Ihre Füße steckten in schwarzen Latschen, die mindestens zwei Nummern zu groß waren. Die einst blonden und jetzt vergilbten Haare hatte sie sich in einem Knoten auf dem Kopf festgebunden. Die meisten der Haare jedoch hielten nicht in diesem Knoten und verflogen zerzaust und ungeordnet auf ihrem Kopf. Ihre Haut war rot und durchsetzt mit kleinen Pickeln. Ich konnte es nicht begreifen, dass ich diese Frau einmal geliebt haben sollte. Irgendwie wäre es besser, sie nicht mehr zu sehen, dachte ich mir, als ich sie mir betrachtete.
Wir hatten uns auseinandergelebt, das war keine Frage. Und doch tat sie mir in Momenten wie diesen irgendwie leid. Vor sechs Jahren dachte ich, in einem für mich heute unbegreiflichen Moment, ich müsste sie heiraten.
Sie kam aus einem sehr einfachen Haus. Aus Haidhausen, einer Gegend in München, die man das Glasscherbenviertel nannte. Das allein wäre nicht schlimm gewesen. Es gab dort sicher auch Mädchen, die etwas mitbrachten, auch wenn sie nicht die Möglichkeiten hatten, etwas aus sich zu machen. Nur in ihrem Fall, war das eben nicht gegeben.
Schon die Hochzeit war sehr anstrengend gewesen, da sie alle ihre Freunde eingeladen hatte, mit denen ich so absolut nichts anfangen konnte. Sie tranken bis zur Besinnungslosigkeit, schmissen sich an mich und wollten mir alles Mögliche von meiner Frau erzählen, die ich gerade geehelicht hatte. Ob ich es nun hören wollte oder nicht. Meistens waren es Geschichten, auf die man als frischer Ehemann nicht gerade gespannt war, sie zu hören. Sie kannten sich alle, ich kannte niemanden. Auch die Kneipe, die Constanze ausgesucht hatte, war eben das. Eine Kneipe. Wir hatten den Nebenraum. Dunkle alte Tische, die jemand mit verwaschenen weißen Tischdecken belegt hatte. Erst dachte ich, die Löcher wären Stickereien, bis mir auffiel, dass sie sehr unregelmäßig waren. Dann stellte sich schnell heraus, dass es einfach Löcher waren. Nichts anderes. Unbequeme Stühle und uralte schwere Vorhänge, die penetrant nach Rauch rochen, hingen vor blinden Fenstern. Auf den Tischen lagen grüne Blätter aus Plastik, mit roten Blüten. Zu essen gab es Schnitzel, aus denen das Fett tropfte. Mit Kartoffelsalat aus der Großmarkthalle. Ein Akkordeonspieler, wohl ein Freund der Familie, spielte zu vorgerückter Stunde die alten deutschen Lieder, zu denen die ganze Gesellschaft singen musste.
Meine Mutter war auch dabei, zeitweise, jedenfalls. Mein Vater hatte abgesagt. Sie nahm mich immer auf die Seite und meinte, ihr einziger Sohn hätte etwas Besseres verdient als das. Als sie mir das zweimal gesagt hatte, rief ich ein Taxi und sagte ihr, sie solle doch bitte nach Hause fahren. Ich hätte genug von ihren Ratschlägen und bräuchte das nicht. Es sei mein Hochzeitstag, und da hätte sie nichts hineinzureden. Sie sprach für ganze zwei Wochen nicht mit mir, was ich allerdings als Erholung empfand.
Constanzes Mutter war eine einfache, ziemlich runde kleine Frau, die immer nur da saß und an einem Glas Wein nippte. Das braune Kostüm, das sie sich zur Hochzeit ihrer Tochter gekauft hatte, sah aus wie ein grober Sack, der zwei Nummern zu groß war. Ihre Haare waren auf ihrem Kopf wie ein festgeklebtes Bündel Stroh. Sie war wohl beim Friseur gewesen. Oder eher doch bei einer Freundin, die dachte, Friseurin zu sein. Dort saß sie auf ihrem Stuhl, sah mich nur immerzu an und lächelte. Ich habe nie herausgefunden, ob sie mich nun an- oder auslachte. Wir haben uns allerdings auch nur ein paarmal gesehen in all den Jahren. Es gab nicht viele Gelegenheiten einer tiefgründigen Konversation.
Die Hochzeitsreise fand nicht statt, obwohl ein Onkel aus Augsburg ihr versprochen hatte, uns in sein Haus auf Mallorca einzuladen. Nachdem ich mehrmals gefragt hatte, wann wir denn nun endlich unsere Koffer packen sollten, und es keine definitive Antwort gab, gab ich auf. Wahrscheinlich gab es so ein Haus gar nicht. Wie es vieles nicht gab, in dieser Welt, in die ich eingeheiratet hatte. Herausgefunden hatte ich das nie. Der Onkel war nach ein paar Wochen plötzlich gestorben.
Es wurde mir nach nur wenigen Jahren voll bewusst, dass diese Wahl meiner Frau nicht die richtige war. Weder meine Frau noch das dazugehörige Umfeld war, was ich mir im Leben als erstrebenswert vorstellte. Constanze wusste es auch. Warum man noch zusammen waren, war eigentlich für uns beide ein Rätsel. Vielleicht war es Gewohnheit. Oder die Angst, allein zu sein. Was immer es war, wir wussten, dass es früher oder später zu Ende sein musste. Wir mussten uns trennen , auch wenn es weh tat. Mir tat es mehr weh, es nicht zu tun.
Sie lehnte dort am Türrahmen und sah mich an, als mir das alles durch den Kopf ging. Ich versuchte, mich mittlerweile wieder in meine Zeitung zu vertiefen und sie so gut wie möglich zu ignorieren. Die Straßenbahn quietschte um die Kurve. Autos hupten. Man hörte das dunkle Brummen der Diesel, die langsam die Straße entlang hämmerten.
Dann, auf einmal, drehte sie sich um, ging zurück in die Küche, schmiss demonstrativ das Essen in den Mülleimer, stellte die Teller in die Spülmaschine und verzog sich ins Schlafzimmer. Ich hörte nur noch, wie die Tür laut ins Schloss fiel. Dann war Stille. Ich würde wieder auf dem Bett im Kinderzimmer schlafen, wie immer öfter in letzter Zeit. Wir würden uns bis zum nächsten Morgen nicht mehr sehen. Vielleicht sogar nicht einmal dann. Und das war auch gut so.
Der nächste Tag fing an, wie der vorherige aufgehört hatte. Ich war früh aus dem Haus gegangen, nachdem ich, wie seit mehreren Monaten nun, die Nacht im Kinderzimmer verbracht hatte. Es war noch dunkel, als ich auf die nasse Straße trat. Nur wenige Leute waren schon unterwegs. Hauptsächlich nur, um ihren Hund auszuführen. Dann standen sie an den Bäumen, mit der Zigarette in der Hand, und versuchten, ihren vierbeinigen Mitläufern klarzumachen, dass sie endlich ihr Geschäft zu machen hatten. Die jedoch hatten mehr damit zu tun, an den Bäumen herumzuschnüffeln. Fast jeder war besetzt.
Und dann waren da noch die, die dachten, mit Laufen ihr Leben verlängern zu müssen. Auf unbestimmte Jahre. Was sie dann mit den Jahren machen sollten, wussten sie wahrscheinlich auch nicht.
Ich hatte vor, noch heute das Geheimnis mit dem rosa Zettel zu lüften. Es hatte mich die ganze Nacht nicht richtig schlafen lassen. Die Post war noch nicht offen, also ging ich gegenüber in das kleine Stehcafé mit den alten Sesseln und der abgewetzten Couch, nahm die Zeitung, die dort auslag und setzte mich erst einmal hin. Nach und nach kamen Leute und holten sich für viel Geld den lausigen Kaffee in Pappbechern und rannten wieder hinaus. Nebenbei tippten sie unablässig auf ihre Tablets ein. Ich beobachtete die Menschen, wie sie von einem Platz zum anderen hetzten, und wunderte mich, ob sie überhaupt wussten, wie dämlich das aussah.
Als ich auf meiner Uhr sah, dass es kurz vor neun Uhr war, machte ich mich auf den Weg zur Post, die keine zwei Straßen von uns weg war. Als ich um die Ecke bog, sah ich, wie jemand die Tür aufschloss. Ich raffte mich auf, ging über die Straße und stellte mich erst einmal geduldig in die Schlange, die sich bereits geformt hatte. Endlich war es an mir, die rote Linie zum einzigen Schalter zu überschreiten, der Einschreiben herausgab. Der Beamte war sichtlich gelangweilt, als er den Zettel in die Hand nahm, mich um meinen Ausweis fragte , diesen mit meiner Adresse verglich und mir die Karte wieder zurückgab. Dann drehte er sich wortlos um und verschwand hinter einer großen Schiebetür.
Wusste der denn nicht, wie wichtig diese Briefe für viele Menschen sein konnten, fragte ich mich. Sollte er nicht wenigstens ein geringes Maß an Mitgefühl zeigen? Man muss ja nicht gleich in Tränen ausbrechen und jemanden umschlingen , aber ein freundliches Guten Morgen oder ein sanftes Lächeln würde die Situation sicher entspannen.
Als ich den Brief endlich aus der Hand des sichtlich gestressten Schalterbeamten entgegennahm, nachdem ich vorher genötigt war, mehrere Unterschriften zu leisten, und diesen in der Hand hielt, drehte ich ihn erst einmal mehrmals von vorne nach hinten. Er kam aus München. Notariat Mallinger.
„Sie, Herr, Sie können Ihren Brief auch woanders lesen als hier am Schalter. Lassen’s die Leut durch. Der nächste bitte!“ Das hörte ich den Beamten sagen. Mit einer winkenden Handbewegung gab er seiner Ansprache Nachdruck. Ich sah ihn an, verstand und nickte zustimmend. Sein Blick war eindeutig. Und er hatte recht, absolut.
Der Brief sah sehr offiziell und professionell aus. Ich versuchte, ihn so sorgfältig wie möglich zu öffnen, und zog ein Schreiben hervor, dass an mich persönlich gerichtet war. Leopold Weber. Es war eine Nachricht mit der Bitte darum, den Notar anzurufen. Unter der Unterschrift stand in kleinen Buchstaben, dass auch eine gedruckte Unterschrift ihre Gültigkeit hätte, was mich unheimlich beruhigte. Wahrscheinlich, dachte ich mir, hatte der Notar keine Zeit, all die Briefe selbst zu unterschreiben, die über seinen Tisch gingen. Und die sich die Leute dann vom Postamt abholen mussten. Hoffentlich wusste er wenigstens, was er verschickt hatte.
Anrufen, stand also dort unter einem sehr teuer aussehendem Briefkopf. Mit ins Papier geprägten Buchstaben seines Namens. Dr. Mallinger. So etwas hatte ich einmal in einer Ausstellung gesehen. 'Wichtige Dokumente aus vergangenen Jahrhunderten', hieß die.
So bald wie möglich, stand auf dem Brief. Da 'so bald wie möglich' in seinem Wortschatz wahrscheinlich 'sofort' bedeutete, nahm ich mein Handy und wählte die angegebene Nummer. Immer noch auf der Post. Ich hatte mich mittlerweile auf eine der kalten, unbequemen, gelben Blechbänke mit den vielen runden Löchern gesetzt, die dort standen.
„Notariat Dr. Franz Mallinger. Womit kann ich Ihnen helfen?“, fragte eine weibliche Stimme. Eine scheinbar sehr junge weibliche Stimme. Fast wie ein Kind. Wobei man sich in diesen Fällen wohl auch täuschen konnte.
Einmal hatte ich ein Telefongespräch mit einer Frau, die so eine ähnliche sehr junge Stimme hatte. In einer Buchhandlung. Als ich dann die Bücher abholte, dort im Laden, stellte sich heraus, dass meine telefonische Gesprächspartnerin mehr als sechzig Jahre alt war. Ihre Stimme hatte sich erhalten, alles andere war mit den Jahren mit dahingegangen. Seitdem war ich mit der Abschätzung von Alter über das Telefon etwas vorsichtiger geworden.
„Ich habe da einen Brief, der sagt, ich soll in der Kanzlei anrufen.“
„Und wie ist Ihr Name, bitte?“
„Ach ja, wie dumm von mir. Weber, Leopold Weber.“
Stille kehrte ein. Die junge Stimme schien etwas auf der Tastatur zu tippen. Man hörte ein ständiges Klicken. Türen fielen ins Schloss. Gemurmel aus der Ferne war zu hören. Irgendwo klingelte ein Telefon. Der Kopierer schien Tausende von Blättern pro Minute auszuspucken. Jemand im Hintergrund sagte, dass dieses Mistding schon wieder streiken würde. Die üblichen Geräusche eines Büros bei der täglichen Arbeit.
„Ja, hier haben wir Sie. Es geht um ein Erbe. Sie sollten einen Termin ausmachen, Herr Weber. Wann könnten Sie hier sein.“
„Erbe? Ich kenne niemanden, der mir etwas vererbt.“
„Mehr kann ich Ihnen dazu am Telefon leider nicht sagen. Ich kann ja nicht beurteilen, ob Sie der richtige Herr Weber sind, der mit mir jetzt redet. Also, wann können Sie kommen?“
„Jetzt?“
„Nein, heute leider nicht mehr. Der Herr Notar ist heute nicht im Haus. Wie wäre es “ ... „warten Sie“ ... „mit Donnerstag gegen halb drei?“
„Donnerstag, halb drei.“
Ich legte eine Pause ein und tat so, als würde es unheimlich schwierig sein, den Termin wahrzunehmen.
„Ja, ist gut. Ich werde es möglich machen und da sein.“
„Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Personalausweis mitzubringen, Herr Weber. Bis Donnerstag dann. Auf Wiederhören .“
„Werde ich nicht vergessen, versprochen.“
Ob sie nun diesen letzten Zusatz noch gehört hatte, wusste ich nicht. Wahrscheinlich hatte ich das in die unendlichen Sphären der Satellitenschüsseln gesagt, wo es klanglos verschollen war. War auch unbedeutend.
Für mich war eigentlich jeder Tag gut. Heute war Dienstag. Also musste ich noch zwei Tage warten, um zu erfahren, was ich denn geerbt hatte. Ich hatte nicht sehr viel zu tun in letzter Zeit, also war jeder Tag so gut wie der andere. Dennoch dachte ich, es würde gut aussehen, wenn ich so tue, als wäre mein Terminkalender voll, aber auf der anderen Seite war ich auch Realist. Ich wusste, wer hier den Termin für mich führte.
Da ich nun dort auf der Bank saß und mein Telefon in der Hand hielt, fiel mir ein, dass ich gestern meine Mutter anrufen sollte. Sie würde keine Ruhe geben, bis ich das nicht endlich getan hatte. Ich suchte ihre Nummer in dem Verzeichnis und drückte auf 'senden'. Es dauerte keine zwei Sekunden, und sie war in der Leitung. Sie musste neben dem Telefon gesessen haben.
„Hallo Mutter, ich bin’s. Was gibt’s?“
„Das is ja schön, dass du auch mal deine Mutter anrufst. Ich hab schon denkt du bist g’storben und keiner hat mir was g’sagt.“
„Was is los, Mutter? Wir haben erst vor einer Woche telefoniert und da war nix B’sonders. Also?“
„Was soll ich sagen, Poldi. Es ist dein Vater. Er sitzt immer nur da und wird jeden Tag träger. Gestern hat ihm der Arzt g’sagt, er wird sterben, wenn er sich nicht bewegt. Aber der Depp sitzt immer nur da und raucht wie ein Schlot. Sein Bein is schon so dick wie ein Telefonmast. Der Doktor hat g’sagt, dass es sein könnt, dass er des Bein abnehmen muss. Ich glaub, der weiß nicht, was des bedeutet, der Depp. Kannst nicht amal reden mit ihm? Auf mich hört der nicht. Hat der noch nie g’macht. Mein ganzes Leben hab ich mich immer nur um den Deppen kümmern müssen und jetz hab ich einfach genug, verstehst, g-e-n-u-g hab ich.“
Das letzte „genug“ streckte sie und kam verzweifelt aus der Leitung.
„Mutter, ich kann nicht mit ihm reden, und des weißt du. Wenn ich was sag, dann fängt der nur des Streiten an, und des brauch ich nicht. Ich hab schon selber genug Probleme.“
„Nein, des brauchst nicht, des weiß ich schon, weil deine Constanze ...“
„Mutter, des lass ma lieber. Wenn nix anderes is, leg ich jetz wieder auf.“
„Ja, weiß schon, ich darf ja schon gar nix mehr sagen. Nie darf ich was sagen. Du hörst schon immer auf andere, aber nicht auf mich. Und ich bin dei Mutter. Kommst wenigstens an Weihnachten? Ich mein, damit'st net so allein bist. Ich würd auch was Schön’s zum Essen machen. Die Haderer vom ersten Stock hat g’meint, sie könnt uns eine richtige Gans b’sorgen. Direkt von so einem Biohof, hat’s g’meint. Ihr Sohn, der sie mindestens jeden zweiten Tag anruft, hat’s g’meint, hätt da Beziehungen. Günstig wär’s auch, hat’s g’meint. A richtige Gans, Poldi. Des hamma schon seit Jahren nicht g’habt. Wie du noch ein kleiner Bub warst ...“
„Des wird nix, Mutter, des weißt doch. Des lass ma jetz lieber wieder, bevor das du den ganzen Schmarr’n wieder erzählst, den ich schon a paar Hundert mal g’hört hab. Und des mit Weihnachten hamma jetz schon so oft diskutiert. Des is für uns alle net gut. Und jetz hörn wir auf mit dem Zeug. Des bringt nix. Servus.“
Damit drückte ich den 'Auflegen'-Knopf und beendete das Gespräch. Ich wusste, wo es enden würde, und wollte das nicht wieder haben. Das Weinen und Jammern, dass jedes mal früher oder später anfangen würde. Die Geschichte von der verlassenen Mutter und dem undankbaren Sohn, der sie noch ins Grab bringen würde. Und sie hat doch so viel für mich getan, ihr ganzes Leben lang.
Die Gedanken, was und von wem ich etwas geerbt haben sollte, ließen mich die nächsten zwei Tage bis zu meinem Termin nicht mehr los. Wenn immer ich über meiner Arbeit saß, kamen mir die abwegigsten Gedanken, die mir alles Mögliche einredeten. Ich versuchte, diese Gedanken wegzuwischen, sagte mir, dass es idiotisch war, überhaupt eine Minute daran zu verschwenden. Und doch kamen diese Gedanken wieder. Immer wieder. Dann war noch das mit meiner Frau. Ich wollte nicht, dass sie es wusste. Noch nicht jedenfalls. Oder vielleicht sogar nie. Es würde sowieso nur in einer Katastrophe enden. Endloser Streit. Sinnlose Diskussionen. Und die Telefonate mit ihrer Verwandtschaft, die dann schon Schlange stehen würde, um ein Stück des Kuchens abzubekommen. Ohne zu wissen, wie groß der Kuchen überhaupt war. Dann war es immer besser, so viel wie möglich für sich zu behalten.
Es stellte sich heraus, dass die junge Stimme am Telefon wirklich einigermaßen dem Alter entsprach. Nicht nur das, sie nahm auch äußerlich alles in ihren Bann. Stimmen sagen viel aus über den Menschen. Ihren Charakter, Stimmung, Verfassung und Erlebnisse. Raue Stimmen zeugen von Nachlässigkeit. Man hatte in seinem Leben zu viel geraucht oder getrunken. Langsame Stimmen sind traurige Stimmen, die immer an etwas anderes dachten als das, was sie sagten. Sie mussten immer nachdenken, was sie sagten und hatten ständig Angst, sich zu verraten. Oder etwas Falsches zu sagen. Keine Spontanität. Zu schnelle Stimmen hatten keine Zeit, waren immer auf der Flucht, rannten davon. Vor was auch immer.
Nur die Stimme von Marianne Hofreiter war perfekt. Man sah das Schild auf dem Schreibtisch und verband den Namen Marianne mit der Person, die man sah. Der Name passte, wie auch die Stimme zu ihr passte. Besonders bewegte mich der Name auch deswegen, da ich einmal eine Marianne sehr gut kannte. Vor langer Zeit.
„Herr Weber?“
Ich hatte sie wohl ein wenig zu intensiv angesehen. Jedenfalls bekam ich nicht ganz mit, dass sie etwas zu mir gesagt hatte.
„Herr Weber?“, sagte sie noch einmal, etwas lauter und bestimmter.
„Ja, Entschuldigung. Was ham’s g’sagt?“
„Der Herr Notar hat jetzt Zeit für Sie.“
Damit stand sie auf. Ihr rotes Kleid, das jede Zone und Kurve ihrer Figur preisgab, rutschte ein wenig nach oben. Mit geschickten Griffen richtete sie es zurecht und ging Richtung der Glastür, die gegenüber des Schreibtisches war. Das Glas war milchig, man konnte nur Umrisse davon erkennen, was sich im Raum dahinter abspielte. Verschwommen sah man einen Tisch, zwei Stühle davor und Bewegungen eines Menschen, der an diesem Tisch saß.
'Wenn ich zehn Jahre jünger wäre', dachte ich mir, 'hätte sie keine Chance.' Aber ich war nicht zehn Jahre jünger. Also hatte ich keine Chance. Und wenn ich es so richtig bedachte, wollte ich eigentlich auch keine haben. In diesem Moment hatte ich nur Probleme mit Frauen und absolut keinen Bedarf, das auch noch zu multiplizieren.
Sie öffnete die Tür und bat mich, an ihr vorbei ins Büro zu gehen. Dabei kamen wir uns wohl so nahe, wie niemals wieder danach. Es war schade, aber wie so vieles im Leben glaubte man, wenn es nicht eintrat, es wäre ein Versäumnis, es wäre etwas, was man beklagen sollte. Nur wusste man das nicht. Vielleicht war es ja auch ein Segen, sich nicht zu nahe zu kommen.
Ich dachte in solchen Momenten dann immer daran, dass es Frauen gab, die ihre Männer umbrachten. Das sollen besonders hübsche und attraktive Frauen sein, was man so las. Es half, an so etwas zu denken, wenn man eine attraktive Frau sah und sich bestimmte Dinge vorstellte.
Das Büro war modern eingerichtet. Ein Glastisch als Schreibtisch, ein kleiner Laptop, ein Handy, das war alles, was man sehen konnte. Hinter dem Tisch ein kleines Regal, mehr eine Kommode, angereichert mit Figuren, Bildern, Blumen. Geschmackvoll. Gediegen. Ein modernes Bild hing über der Kommode. Bunt war es, und kubisch. Wenn man genau hinsah, konnte man sogar ein Gesicht ausmachen, wenn auch mit nur einem Auge und den Ohren dort, wo man mehr das Kinn vermutet hätte. Kunst war nie mein Metier, also beließ ich es dabei, meinen Kopf leicht zu schütteln.
Am anderen Ende des Raumes stand eine Sitzgruppe aus Leder, feinem, schwarzem Leder. Dazwischen das große Fenster, vom Boden bis zur Decke. Mit einem Gitter an der Außenseite des Hauses. Wahrscheinlich konnte man es öffnen, auch wenn der Raum klimatisiert zu sein schien. Man sah keine Heizung, und doch war es angenehm warm. Es war wieder einer der nebligen, grauen Tage, die Wärme so angenehm machte. Man sah, wie die Stadt lebte, aber man hörte nichts. Und man sah die gelben Lichter durch den nassen Schleier. Ansonsten war Totenstille.
Dr. Mallinger war ein gut aussehender Mann, etwa Ende vierzig, schlank, mit vollem, dunkelbraunem Haar, das elegant nach hinten gekämmt war. Er hatte eine Lesebrille auf. Eine, die man zusammenfalten konnte und die dann in ein kleines Röhrchen passte. Das Röhrchen aus Schlangenleder lag neben dem Laptop.
„Setzen Sie sich, Herr Weber. Meine Sekretärin hat ja schon Ihren Ausweis kontrolliert, also kommen wir sofort zur Sache. Frau Bauer hat, bevor sie leider von uns geschieden ist, noch ein Testament mit mir zusammen verfasst. Ich übergebe Ihnen hiermit die letzte Fassung dieses Testaments. Wenn Sie es bitte öffnen und lesen wollen. Sie müssen mir dann sagen, ob Sie das Testament annehmen oder nicht. Ich werde Ihre Entscheidung protokollieren und damit diesen Vorgang abschließen.“
Damit übergab Herr Dr. Franz Mallinger mir einen Umschlag, der versiegelt war. Erregt brach ich das Siegel, öffnete ihn und entnahm einen Bogen Papier:
Mein lieber Leopold, mein geliebter Poldi,
leider waren die Jahre, die uns altersmäßig getrennt haben, auch der Grund, warum ich nicht weiter mit dir zusammen sein konnte. Es ist nicht einfach für eine Frau, sich einzugestehen, das sie alt wird. Alt zu werden war für mich kein Privileg. Es war eine Strafe. Und mit jedem Tag mehr wurde diese Strafe härter und erbarmungsloser. Die einzige Erlösung wird der Tod sein. Jeden Tag habe ich verflucht, dass ich zu früh geboren wurde. Oder du zu spät. Du hättest mein Sohn sein können. Und ich hätte dich vielleicht auch so behandeln sollen. Nur konnte ich es nicht. Wie gerne hätte ich dich geliebt, mit dir mein Leben geteilt, meine Freuden, mein Leid, alles. Wie gerne hätte ich dich erhoben zur höchsten der gefühlten Welten. Wie ich das getan habe in meinen Träumen, in meinen einsamen Nächten, wenn ich da lag und nicht schlafen konnte, weil es mir mein Herz zerrissen hat. Wenn ich nur noch schreien wollte und es auch oft getan habe. Ja, ich weiß, du hast immer gesagt, dass das nicht stimmt, das mit dem Alter, aber ich wusste es besser. Immer hast du gesagt, dass macht dir nichts aus, aber mir hat es etwas ausgemacht. Es hat mich traurig gemacht, verzweifelt, einsam und ratlos. Wenn du das liest, ist es endlich vorbei. Ich muss nicht mehr auf die Erlösung warten, sie hat mich eingeholt. Ich danke dir für die Zeit, die wir zusammen sein durften. Aus Dank für diese so schönen Jahre vermache ich dir alles, was mir gehört.
Alle meine Verwandten, Geschwister, Tanten und Onkel sind schon lange vor mir gegangen. Nun ist der Oberhof deiner geworden. Mach etwas daraus, was immer du für richtig hältst. Ich vertraue dir, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, wenn sie auch in dem Fall unserer Beziehung nicht immer sehr gründlich durchdacht waren. Aber das rechne ich deiner Jugend und Unbedarftheit an. Das einzige, was ich dich bitte, ist, alle, die dort wohnen, auch dort wohnen zu lassen, bis sie entweder von selbst gehen oder den letzten Weg antreten, der ohne Wiederkehr ist. So wie ich diesen Weg nun angetreten habe. Herr Dr. Mallinger wird alles mit den dazu nötigen Papieren klären und die rechtlichen Schritte einleiten.
Lebe wohl, mein Lieber. Lebe wohl, Geliebter. Vielleicht sehen wir uns in einer anderen Welt, in der das Alter keine Rolle spielt. Wäre das nicht eine wunderschöne Vorstellung? Nur, irgendwie fehlt mir der Glaube, aber wer bin ich schon, mir über so etwas Gedanken zu machen.
Sei gewiss, dass ich dich, so lange ich noch gelebt habe, nachdem du in mein Leben gekommen bist, geliebt habe wie niemand anderen zuvor. Ich durfte erfahren, auch wenn es zu spät war, was die Liebe aus einem machen kann. Und war unendlich traurig, es nicht mit dir teilen zu dürfen.
Behalte mich in Erinnerung, wie du mich das letzte Mal gesehen hast. Und sei bitte nicht traurig. Lebe und freue dich auf den nächsten Tag.
Gezeichnet
Maria Bauer
Ich hielt den Brief in meinen Händen. Ich musste ihn auf den Schoss legen, um nicht den Verstand zu verlieren. Tränen begannen, mir über das Gesicht zu laufen, ohne dass ich das wollte. Ich konnte nicht weinen. Das hatte ich schon lange verlernt. Schon als Kind konnte ich nicht weinen. Wenn mein Vater mir wieder einmal eine reingehauen hatte, warum auch immer, und ich zu weinen anfing, gab es noch einmal eine dazu. Hart sollte ich sein. Im Nehmen und im Geben. „Nur so kommt man durch’s Leben“, meinte er immer, „und nur wenn man einstecken kann, kann man auch austeilen.“ „Weicheier werden zermatscht“, war einer seiner Lieblingssprüche. Wenn ich auch nicht sehr schlau war als Kind, das fand ich schnell genug heraus, dass Weinen nur mehr Schläge bedeuteten. Also gewöhnte ich mir das ab. Warum mir das in diesem Moment einfiel, wusste ich nicht. Ironie des Schicksals.
Nun, wie ich da saß, trat mir das Wasser ganz einfach aus meinen Augen, ohne das ich etwas dagegen tun konnte.
Der Notar reichte mir eine Schachtel mit Papiertüchern, die ich nur zu gerne annahm. So saßen wir eine ganze Weile, und ich wusste nicht, was wir tun sollten. Es hatte sich bewahrheitet. Es schien nie die Sonne, wenn man einen Menschen verlor. Es war immer grau, nass und kalt.
Es war nicht einfach, in wenigen Minuten ein Leben vor sich ablaufen zu lassen, dass Jahre gedauert hatte, sich zu entwickeln. Maria. Sie war einmal mein ganzes Leben. Bis vor fast zehn Jahren, als sie meinte, es hätte keinen Sinn und ich solle endlich anfangen, etwas aus mir zu machen. Irgend was anderes, als eben immer nur ihr hinterherzulaufen.