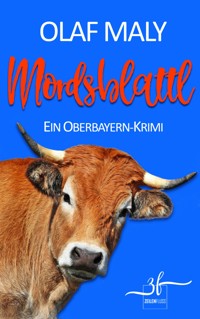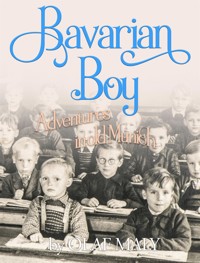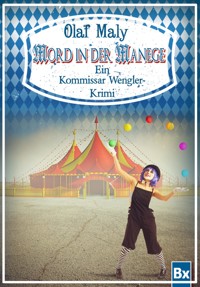3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Wengler
- Sprache: Deutsch
Es ist Faschingsdienstag in München. Kommissar Wengler will diesen Tag gemütlich mit ein paar Freunden bei einem Glas Bier ausklingen lassen. Aber zunächst macht er noch Halt auf dem Viktualienmarkt, um dort dem Faschingstreiben zuzusehen. Und es kommt wieder alles anders als geplant: Wengler wird von einem Mann in Frauenkleidern um Hilfe gebeten. Es ist Fasching, also erstaunt die Verkleidung nicht. Doch dann findet man in der Wohnung des Fremden einen Toten. Und auch die Aufmachung des Fremden war kein Zufall. Das bedeutet für Kommissar Wengler, in ein Milieu einzutauchen, von dem er sich nicht einmal hatte vorstellen können, es auf seine alten Tage noch kennenzulernen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Faschingsmord
Eine Kommissar Wengler Geschichte
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei einigen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre. Erst einmal, bei meiner langjährigen Partnerin, Marita Stepe, die es immer auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen, und mit konstruktiver Kritik auf die Handlung Einfluss nimmt. Und dann noch bei meiner Lektorin, Theresia Riesenhuber, die mit Engelsgeduld meine Fehler ausmerzt. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenFaschingsmord
Wenn Kommissar Wengler irgendetwas hasste, war es der Fasching in München. Nicht direkt der Fasching als solcher, mehr den Faschingsdienstag, den Tag bevor alles endlich vorbei war. Es war das Ende einer langen Durststrecke, einer Phase von mutwilligem Fröhlichsein, von Lachen ohne Grund, von freundlich gemeintem Schulterklopfen, das er so gar nicht liebte. Dann auch noch mit dem Zusatz, „Wo gehst denn heut hin, wie'st verkleidet bist?“, obwohl er überhaupt nicht verkleidet war. Manche fanden das lustig. Er nicht. Nicht einmal sein Gesicht, das seinen Unmut mehr als deutlich ausdrückte, hielt diese Spaßvögel davon ab, das immer und immer wieder zu wiederholen, und über ihren gar so einfallsreichen tollen Spaß auch noch herzlichst zu lachen.
Den Fasching an sich bekam man, im Gegensatz zu den Bereichen nördlich und besonders westlich der Landesgrenze, in München eigentlich gar nicht so richtig mit. Außer man ging auf einen dieser noblen, nächtlichen Bälle, auf denen man gesehen werden wollte und von denen man sich irgendwelche Kontakte erhoffte. Und für die man erst einmal Kontakte brauchte, um zugelassen zu werden. Dann wurden es meist mehr Abenteuer als Kontakte, oder wie man es sorglos nannte, Schmusgeschichten. Kurzzeiter. Eine Nacht und nie wieder. Abenteuer, mit mehr Betonung auf teuer, besonders am folgenden Tag. Und manchmal auch für die folgenden Jahre. Was immer das auch war oder sein sollte, man hatte um diese Zeit herum so etwas wie einen Freibrief für alle Missetaten, die man sich während des Rest des Jahres nicht herausnehmen durfte, wollte, konnte und sollte.
Es waren dann meist kurzzeitige Kontakte, die man besser vor seiner Frau geheim halten wollte, wenn es auch nicht immer gelang. Das heißt nicht, dass Frauen da in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd braver gewesen wären, nein. Aber wie es eben so ist, traut man es den Männern mehr zu. Warum, bliebe noch zu ergründen, dachte sich der Herr Kommissar immer, wenn er so darüber sinnierte.
Diese im wahrsten Sinne des Wortes nackten Tatsachen jedoch beschäftigten in den Wochen danach mehr die Scheidungsanwälte als den Herrn Kommissar Wengler. Außer der Ehemann oder die Ehefrau waren nach der Mittwochsaussprache nicht mehr am Leben, dann bekümmerte es ihn. Das kam vor, wenn auch nicht oft. Weihnachten war da viel ergiebiger, wahrscheinlich wegen der Pflicht, für diese Tage eng beieinander zu sein. Wegen der Einsamkeit, die man zu diesem Anlass suggeriert bekam. Und der man entfliehen sollte.
Kommissar Wengler war nicht verheiratet, war es nie gewesen. Und außerdem hatte er mit dem weiblichen Geschlecht schon vor Langem seinen Frieden geschlossen, mehr oder weniger. Das bedeutete, dass er absolut nicht mehr daran interessiert war, irgendetwas mit der Gegenseite zu tun zu haben. Oder, wie er es nannte, anzufangen. Jedenfalls nicht im Sinne von Beziehung, und inniger Beziehung schon überhaupt nicht. Nicht in seinem Alter und mit seiner daraus resultierenden Lebenserfahrung.
Seine Kollegen im Kommissariat, die etwa seine Generation waren, kamen fast jeden Tag frustrierter ins Büro. Und wenn man sie fragte, was denn wieder los sei, kam meist die Antwort: „Die Alte macht mich wieder wahnsinnig, bin ehrlich froh, dass ich hier bin. Hab ich endlich meine Ruh.“
Alleine die Tatsache, dass man lieber im Büro war als irgendwo anders, machte den Kommissar ein wenig stutzig. Und auch in gewisser Weise zufrieden, hatte er doch noch das Gefühl, auch außerhalb seines Büros noch eine einigermaßen heile Welt für sich zu haben. Er konnte sich in diesen Fällen ein kleines Schmunzeln nie ganz verkneifen, auch wenn er tunlichst vermied, es zu zeigen.
Er hatte sehr wohl seine Abwechslungen, seine Bekannten, auch weibliche, mit denen er ab und zu etwas unternahm, wie mal beim Italiener essen, mal zum Griechen gehen und Ouzo trinken, beim Chinesen wieder einmal mit den Stäbchen erfolglos seinen Reis in den Mund zu bekommen versuchen. Eben die Dinge, die man zu zweit etwas lieber macht als allein. »Es lacht sich besser zu zweit«, meinte er dann immer. An der Tür des Restaurants, wenn man voll von neuen Eindrücken, gutem Essen und viel Bier war, endete die gesellige Zusammenkunft dann häufig mit der Frage: »Kommst noch mit auf'n Kaffee?«, auf die er stets antwortete: »Nicht heute, weißt eh, hab an schweren Tag g'habt. Vielleicht das nächste Mal.« Wobei das Gegenüber eigentlich genau wusste, dass es dieses nächste Mal nicht geben würde.
Also verabschiedete man sich mit einem Küsschen auf die Wange, links und rechts, sagte einander, wie schön es gewesen war und dass man das doch bald wieder machen sollte, und jeder ging zufrieden seiner Wege.
Heute, an diesem Faschingsdienstag, saß der Kommissar also auf dieser Bank, am Viktualienmarkt, gleich neben der Liesl, die in Bronze gegossen auf ihn herab sah. Liesl Karlstadt, die Große, Kleine, neben Karl Valentin. Wie Falentin gesprochen, aber Valentin geschrieben. Wie er immer sagte, »Der Valentin, man sagt ja auch nicht Wogel, wenn man von einem Vogel spricht. Also sagt man Falentin, mit ‚f' eben, auch wenn man es Valentin schreibt.«
Sie stand da oben in Bronze auf dem Podest aus gehauenem Stein. Klein und doch so gewaltig, dass man zu ihr aufsehen musste, wollte man sie sehen und ihr Respekt und Achtung zollen. Und sie verdiente es, dass man zu ihr aufblickte. Vielleicht hatte der Künstler das im Sinn, als er sie dort oben über alle Leute stellte. Dass man ihr Respekt zollen sollte, jedes Mal, wenn man an ihr vorbei ging.
Er saß also da auf der Bank und beobachtete die Leute, die schon um die Mittagszeit genug Alkohol in sich hatten. Mehr als genug für den Rest des Tages, der gerade erst einmal halb vergangen war. Es war gegen Mittag, er hatte Hunger gehabt und sich deshalb vom Metzger gegenüber seinen Leberkäse und zwei Brezeln geholt, sich beim Löwenbräu eine halbe Maß Bier gekauft und sich auf die Bank gesetzt. Das Bier stand auf dem Boden, zugedeckt mit einem Bierfilz, worauf man es eigentlich normalerweise stellte. Aber in diesem Fall musste man es vor den Vögeln schützen. Die Münchner Vögel schienen sogar Bier zu mögen.
Die Tische vom Biergarten am Markt waren noch nicht aufgestellt, waren noch alle aufeinander und nebeneinander geschichtet. Mit schweren Eisenketten waren sie miteinander und den Bäumen verbunden, damit keiner der Tische auf die Idee käme, das Weite zu suchen. Man brauchte sie. Früher oder später brauchte man sie wieder, wenn die Sonne stark genug war, um Durst zu machen.
Es war ein außergewöhnlich schöner Tag für Mitte Februar. Sonne, blauer Himmel, kleine Wolken, die sich im wilden Spiel von Entstehen und Vergehen ein Rennen gaben, wild über den Himmel zogen und irgendwie sagen wollten, dass der Winter auch irgendwann einmal wieder vorbei gehen würde. »Freue dich auf den Sommer, einsamer Wanderer«, sagten sie, »freue dich, wenn es auch noch ein wenig dauern wird. Die ersten Anzeichen sind da, aber mach dir keine Hoffnung, es wird noch nicht so schnell passieren, wie du dir das erhoffst, aber ich gebe dir einen kleinen Vorgeschmack. Nur eine kleine Kostprobe, wenn es auch noch ein bisschen kalt bleibt. Stell deine Stiefel noch nicht in den Schrank und häng den Mantel noch nicht in den Keller.«
Kommissar Wengler hatte seinen leichten, grünen Lodenmantel offen und hatte sich zur Feier des Tages seine lederne Kniebundhose angezogen und das weiße Hemd, mit den eingestickten Hirschen und Fasanen auf der Knopfleiste. Dazu hatte er wollene, weiße Kniestrümpfe und schwere Halbschuhe an. Man nannte sie Haferlschuhe – schwere, doppelt besohlte Schuhe, die wie geschaffen waren für die schwere Arbeit auf dem Land. Er arbeitete zwar nicht auf dem Land, aber das war Nebensache, sie gehörten einfach dazu. Manchmal liebte er es, diese Tracht zu tragen, mit der er aufgewachsen war und die ihm stets diese Erinnerungen zurückbrachte. Erinnerungen an eine Zeit, als es noch üblich war, Trachten zu tragen und niemand einen deswegen seltsam anschaute.
„Haste amal 'nen Euro?“, kam eine Stimme von hinten auf Kommissar Wengler zu und schwang sich dann um die Bank herum, um ihm ins Gesicht zu sehen.
„Ach, Sie sind's, Herr Kommissar. Hab Sie nicht erkannt von hinten. Sehen gut aus heut!“
„Brunner, keine Schleimereien hier, wir kennen uns lang genug, um zu wissen, was wir voneinander halten. Hier“, und dabei kramte der Kommissar einige Euro aus seiner Manteltasche, „sind ein paar Euro. Geh und kauf dir ein Bier.“
„Vergelt's Gott, Herr Kommissar, vergelt's Gott.“
„Keine Ursache.“
„Werd Ihnen auch wieder helfen, wenn's soweit ist. Wie beim Kramer Fall, damals, wissen's noch?“
„Was hast uns denn da geholfen, Brunner?“
„Ich hab Ihnen g'sagt, wer's war, erinnern's sich?“
„Brunner, den hätten wir auch ohne dich entdeckt, war er doch noch da g'standen, mit'm Messer in der Hand und voller Blut. Neben dem Kramer.“
„Na ja, aber g'sagt hab ich Ihnen, dass er da steht, oder?“
„Ja, Brunner, und jetzt geh dir ein Bier kaufen und lass mich in Ruh. Es war so schön ruhig hier, bevor du 'kommen bist.“
„Geh schon, Herr Kommissar, geh eh schon. Bis ein anders Mal halt dann.“
Damit machte sich Brunner auf den Weg, sich ein Bier zu kaufen.
Georg Brunner war ein Stadtstreicher, wie man sie nannte, die unbesungenen Helden der Straße, denen Wetter und Hitze und Kälte scheinbar nichts ausmachten. Sie lebten auf und von der Straße und taten normalerweise niemandem etwas zuleide. Das wusste auch der Kommissar und hatte deshalb ein relativ gutes Verhältnis zu ihnen. Manchmal waren sie gute Beobachter. Sie wussten gelegentlich, was in der Stadt passiert war, ehe es die Polizei oder die Zeitung wusste. Und das konnte etwas ausmachen, in der Aufklärung bestimmter Sachverhalte.
Clowns mit roten Nasen, Weihnachtsmänner, Hexen und Teufel, Matrosen und unbestimmt Verkleidete zogen an Kommissar Wengler vorüber. Er sah sich alle an, die lachend und oft Arm in Arm und schwankend an ihm vorbei defilierten, versuchte, zu ergründen, warum Leute das machten, warum sie sich in etwas verkleideten, was im besten Fall gerade mal lustig aussah. In den meisten Fällen war es eher peinlich. »Vielleicht wollten sie einmal das werden, was sie jetzt darstellten«, dachte er sich. »Aber wer will schon eine Hexe werden? Clown vielleicht. Aber Hexe?«
Es wurde langsam ein bisschen kälter. Die Sonne verzog sich immer mehr hinter den nun doch mehr gewordenen Wolken. Und wenn die Sonne nicht mehr schien, übernahm der Frost wieder das Regiment. Es war ihm unangenehm geworden, dort zu sitzen, auch nachdem er seinen Mantel bis fast oben hin zugeknöpft hatte. Die Stände am Markt schlossen so langsam ihre Rollladen, machten dem Faschingstreiben auf dem Viktualienmarkt ein Ende. „Bis zum nächsten Jahr!“, sagte man sich mit roten, laufenden Nasen und noch röteren Wangen. Was aufgemalt oder echt war, konnte man nicht immer feststellen, aber das war auch nicht von Bedeutung. Man hatte seinen Spaß gehabt und ging nach Hause. »In ein paar Stunden wird niemand mehr hier sein«, dachte sich der Kommissar. »Es wird leer sein um Liesl Karlstadt und den verlassenen Biergarten.«
Die letzten Papierschlangen, die man sich in eitler Freude gegenseitig an den Kopf geworfen hatte, würden im Wind tanzen und sich in den Ästen der blattlosen Bäume verfangen. Sie machten sie bunt, diese Bäume, die um diese Jahreszeit nicht sehr viel zu bieten hatten. Die Stadtreinigung würde anrücken, mit ihren Reisigbesen und den kleinen Walzenwagen, die fein säuberlich Wasser auf das Kopfsteinpflaster sprühten und alles in ihren Schlund hinein kehrten. Als bräuchten sie das zum Leben, wie wir die Luft zum Atmen.
Die einzigen, die es nicht aufgaben, sich in Szene zu setzen, waren die Tauben, die gierig auf ein paar Brösel der Brezel warteten, die eventuell herunterfallen würden. Der Kommissar belohnte sie mit mehr als sie erhofft hatten. Er hatte ein gutes Herz für die wahren Herrscher der Stadt, die immer und überall zu sehen waren und ihre Spuren hinterließen.
Langsam stand der Kommissar auf, streckte sich ein wenig, knöpfte seinen Mantel bis oben hin zu, und wandte sich zum Gehen. Er würde noch bei seinem Freund in der Glockenbachstraße vorbeischauen, dachte er sich. Vielleicht geht etwas zusammen mit Schach oder so. Oder sie fanden einen Dritten für eine Runde Schafkopf, obwohl er dabei immer verlor. Oder einfach nur reden. Er hatte nichts Besonderes vor, war unabhängig, wollte den Tag jedoch noch nicht enden lassen.
Wind kam auf, ganz plötzlich und unerwartet. Die Wolken trieben noch schneller als zuvor und kündigten von nichts Gutem. Wenn dann der eiskalte Wind durch Häuserschluchten trieb und die letzten Blätter vom vergangenem Herbst noch vor sich her jagte, wenn es die Ohren frieren ließ, dass man meinte, sie fielen einem ab wie Eiszapfen, wenn man keine Luft mehr bekam, da es in der Brust stach, wenn man einatmete, weil es so kalt war, dann empfand man die Einsamkeit wie ein Messer, das sich immer tiefer in einen hineinbohrte, ohne dass man etwas dagegen tun konnte. »Verdammt«, dachte sich der Kommissar, »hätte das jetzt nicht noch ein paar Stunden aushalten können, dieses Wetter?«
„Herr Kommissar?“
Eine Stimme, die er nicht erkannte, kam von hinten auf ihn zu. Er drehte sich um und sah, dass ein Mann – oder besser gesagt, offensichtlich ein Mann, als Frau verkleidet – sich ihm näherte.
„Herr Kommissar, gehen Sie bitte noch nicht weg! Ich würde gerne mit Ihnen sprechen.“
Der Kommissar blickte den jungen Mann ein wenig erstaunt an, der sich eine langhaarige Perücke aufgesetzt, sein Gesicht geschminkt und sich in ein enges, rotes Kleid gezwängt hatte. Die roten, hochhackigen Schuhe und die feinen, schwarzen Netzstrümpfe machten die Ausstattung komplett. Über dem roten Kleid trug er noch einen leichten roten Mantel mit Pelzbesatz am Kragen und den Ärmeln. Man sah ihm an, dass das zwar nicht das war, was er täglich anhatte. Seinen Bewegungen und Gebärden nach zu schließen, war es ihm jedoch auch nicht fremd.
„Seien Sie bitte nicht verwundert, Herr Kommissar, aber mir wurde gesagt, dass ich Sie hier eventuell finden könnte und auch, wie Sie aussehen.“
Bei diesem Satz hätte der Kommissar nur zu gerne gewusst, was die Person, die ihn beschrieben hatte, wohl genau gesagt hatte.
„Von wem, tut hier nichts zur Sache, aber wenn Sie ein paar Minuten Zeit hätten, würde ich mich gerne mit Ihnen unterhalten. Wir könnten ins Löwenbräu gehen, dort an der Ecke. Da ist es warm und man kann ganz gemütlich sitzen.“
Also gingen sie zusammen ins Löwenbräu, die Wirtschaft an der Ecke, wo es immer die in Teig ausgebackenen Apfelscheiben gab, mit Zimt und Zucker, die der Kommissar so liebte. Und sein Lieblingsbier. Und viele andere Sachen, für die es sich lohnte, sich dort hinzusetzen.
2
Armin Staller war im Büro, Bereitschaftsdienst. Freiwillig. Er hatte keine Familie, kam aus dem Norden der Republik und war also am Münchner Faschingstreiben nicht sonderlich interessiert. Er fand es aufgesetzt, wie er immer sagte. Als würde man etwas machen, wovon man nichts versteht und deshalb auch nicht gut konnte. »Besser wäre es«, meinte er immer, »um diese Zeit in Köln zu sein. Aber es lohnt sich nicht, für die paar Tage dorthin zu fahren.«
Alles war überfüllt in den Hochburgen des Karnevals, wie sie es nannten, die Züge und Autobahnen, um dorthin zu kommen, die Kneipen, wenn man endlich dort war, die Straßen und die Hotels, einfach alles. Also meldete er sich freiwillig zum Dienst.
Es war ruhig an diesem Tag. Auch die bösen Menschen schienen an diesem, wohl größten Ereignis des jungen Jahres teilzunehmen und den Tag zu genießen. Es sah aus, als hätten die Bösen alles auf morgen verschoben. Er hatte Zeit, seine Zeitschriften zu lesen, wozu er sonst nie kam. Den Polizeidienst Anzeiger zum Beispiel, oder die Münchener Behörden Nachrichten, eben alle diese internen Illustrierten, die auf billigem Papier, mit schlechtem Druck und noch schlechteren Artikeln – von Amateuren verfasst – den Eindruck der großen weiten Welt im Amt vermitteln sollten.
‚Meine Reise nach Ägypten' von Polizeihauptwachtmeister Egon Biermoser war eine dieser berühmten Reiseerzählungen, die an Langeweile und dekadentem Schreibstil kaum zu überbieten waren. Ein Bild vom Egon vor den Pyramiden rundete den Gesamteindruck dann auch noch nachhaltig ab. Man musste Egon auf der Aufnahme nicht suchen, ein Pfeil deutete auf eine Person in weiter Entfernung, mit dem Hinweis ‚Egon Biermoser'. Ohne diesen Vermerk allerdings – und die runde Gestalt – wäre es schwer gewesen, ihn auszumachen.
Noch spannender war der Artikel über die Verwendung und Entwicklung von Schießpulver, von den Anfängen in China bis ins einundzwanzigste Jahrhundert. Geschrieben von einem Oberstaatsanwalt im höheren Dienst. Bereits im Ruhestand, hatte er endlich Zeit, sich seinem Hobby Geschichte voll und ganz zu widmen und nun sein Wissen endlich auch seinen ehemaligen Kollegen weitergeben zu können. Er hinterließ sogar seine E-Mail-Adresse, falls jemand Fragen hätte. Zur Entwicklung des Schießpulvers oder anderen quälenden und ungelösten Geheimnissen der vergangenen Jahrhunderte. Und derer gab es viele. Laut Oberstaatsanwalt Dr. jur. Antonius Balthasar Rottner.
»Ich hoffe, er hat einen großen Computer für all die Mails, die er bekommt,« dachte sich Armin, als er eines dieser Hefte durchblätterte. Nicht, dass ihn das alles sonderlich interessierte. Aber manchmal, nicht oft, aber manchmal, kam der Hauptabteilungsleiter und fragte die ganze Mannschaft, so ganz nebenbei, ob man nun dies oder jenes gelesen habe. Und wenn man dann mit dem Kopf nicken konnte, wurde man wohlgefällig angesehen. Und das schadete nicht. Insbesondere, wenn der Artikel auch noch von ihm verfasst war.
Das Telefon klingelte und ließ Armin von seinem Traum, auch einmal in Ägypten vor den großen Pyramiden zu stehen, aufwachen.
„Armin, komm ins Löwenbräu am Viktualienmarkt. Komm mit dem Auto, wir müssen ein bisschen aus der Stadt raus fahren.“
„Was ist, Herr Kommissar? Wo müssen wir hinfahren?“
„Frag nicht, komm einfach.“
Damit war das Gespräch beendet. Wenn der Kommissar nicht darüber reden wollte, dann wollte er eben nicht. Er hatte aufgelegt.
Ein paar Minuten später saß Armin Staller im Auto Richtung Viktualienmarkt. Es fing bereits an, dunkel zu werden. Die Sonne versank hinter den Häusern, das Rathaus warf tiefe Schatten Richtung Marienhof und in die Theatinerstraße. Ansonsten bevölkert von den Feinen und Reichen der Gesellschaft, war die Straße jetzt wie ausgestorben. Im Franziskaner gegenüber der Oper gingen langsam die Lichter an und verteilten ihren schwachen, gelblichen Schein spärlich auf die Straße, die vom Besprühen der Reinigungsfahrzeuge goldsilbrig glänzte. Man machte München sauber für die Nacht.
Die Straßenbahn kratzte wie jeden Tag mit metallischem, quietschendem Geräusch um die Kurven an der Oper und Theatinerstraße und ließ die wenigen Menschen, die noch unterwegs waren, in ihren Bewegungen erstarren. Man wollte nicht im Weg stehen. Schon gar nicht im Weg einer Münchener Straßenbahn.
Es war nicht weit zum Löwenbräu, nur die Ettstraße hinunter, dann links zum Marienplatz und über den Markt und schon war Armin angekommen. Der Kommissar wartete bereits auf der Straße, stieg vorne auf den Beifahrersitz ein und überließ dem zweiten Passagier den hinteren Sitz.
„Armin, das ist Anton Wimmer, oder auch Antonia Wimmer, je nachdem, wie man es sieht. Du wirst das jetzt nicht verstehen, Armin, aber ich werde es dir auf der Fahrt erzählen. Herr Wimmer, das ist Armin Staller, mein Assistent und Mitarbeiter. Wir werden diese Sache, die Sie mir erzählt haben, zusammen angehen, und wenn etwas dran ist, auch zusammen lösen.“
Damit zeigte der Kommissar mit der Hand auf Armin, drehte sich wieder nach vorne und fing an zu erzählen.
„Armin, wir fahren nach Solln, in die Herterichstraße. Welche Nummer war das noch, Herr Wimmer?“
„Nummer 68, Herr Kommissar, Nummer 68. Ich sage Ihnen, wo Sie stehenbleiben müssen.“
Sie fuhren los, Richtung Süden, hinaus aus der Stadt. Es war früher Nachmittag, also Berufsverkehr, wenn auch bei Weitem nicht so schlimm wie sonst, hatten doch viele Firmen und Ämter an diesem Tag geschlossen. Über die Lindwurmstraße kam man auf die Straße nach Wolfratshausen, und damit auf einen der ältesten Verkehrswege in Bayern, der noch von den Römern angelegt worden war, als sie ihrem Drang von Süden nach Norden folgten.
Auf dieser Straße ging es schon seit Hunderten von Jahren nach Garmisch, über den Achenpass und dann weiter in Richtung Italien. Besonders im Salzhandel machten dort manche Bauern reiche Ernte, da sie das Salz mit ihren Ochsen über die Pässe zogen und dafür eine entsprechende Gebühr verlangten.
„Also, Armin, die Geschichte ist folgende: Herr Wimmer und sein Freund besitzen eine Bar in der Schwanthalerstraße, gleich hinterm Bahnhof.“
„Das Anjou, Herr....“
„Staller, Armin Staller.“
„Ach ja, entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen durcheinander.“
Armin Staller sah sich kurz um zu Herrn Wimmer, der etwas verloren auf der Rückbank saß, und musste sich ein wenig wundern. Da er aber noch nicht wusste, was passiert war, konnte er sich auch noch keinen Reim darauf machen, was los war. Immerhin kam ihm seltsam vor, dass jemand, der so hübsch aussah und angezogen war, so eine tiefe Männerstimme hatte. Allerdings war Fasching, also war es doch nicht ganz so merkwürdig.
„Also, wie ich schon sagte, haben Herr Wimmer und sein Freund…“
„Carsten, Carsten Rotermann.“
„Ja, Carsten Rotermann. Haben eben dieses Etablissement in der Schwanthalerstraße. Herr Wimmer war heute etwas länger geblieben, da er noch die Abrechnungen gemacht hatte. Sein Freund ist sofort, nachdem sie die Bar geschlossen hatten, nach Hause gefahren.“
Eine kleine Pause entstand.
„Erklären Sie doch bitte, was dann passiert ist, Herr Wimmer.“
„Was passiert ist, ist Folgendes: Wir haben alles in unserer Wohnung elektronisch gesteuert, Herr Staller, einfach alles. Ich kann von meinem Handy aus die Wohnung kontrollieren, das Licht einschalten, die Heizung rauf- oder runterdrehen, die Tür aufmachen – eben einfach alles, was ich will. Wenn ich manchmal noch länger in der Bar bleibe und Carsten fährt schon vor, schaue ich dann auf meinem Pad nach, ob alles in Ordnung ist. Normalerweise schaltet er, wenn er ins Bett geht, dann alle Lichter aus, lässt die Rollläden hinunter und legt sich hin. Wenn ich dann nachsehe und alles in Ordnung ist, mache ich in der Regel die Abrechnung fertig, schließe den Laden irgendwann zu und fahre dann auch nach Hause. Heute jedoch war nichts in Ordnung. Die Rollläden sind immer noch oben und im Haus brennt Licht, die Eingangstür ist offen und das Radio läuft.“
„Ja, das und noch viel mehr, laut Angaben von Herrn Wimmer“, übernahm der Kommissar das Wort.
„Und deswegen fahren wir jetzt dahin?“, fragte Armin Staller, „nur um nachzusehen, ob die Tür zu ist?“
„Armin“, sagte der Kommissar, „Herr Wimmer ist sehr besorgt aufgrund der Tatsache, dass sich sein Freund nicht am Telefon meldet. Sie haben ausgemacht, wenn einem von den beiden irgendetwas passiert, einen Alarmknopf zu drücken, der einen leisen Alarm auf dem Handy des anderen auslöst. Man kann den Alarm von der Schalttafel im Flur oder auch vom Handy aus auslösen, je nachdem, was einfacher ist und wozu man am schnellsten Zugang hat.“
„Ich verstehe immer noch nicht, warum wir dorthin fahren. Wenn Herr Wimmer denkt, dass etwas passiert sei, kann er doch die Streife rufen, die dann nachsieht.“
„Und genau das hat er auch getan, Armin. Er hat die Funkstreife angerufen, das heißt, nicht direkt die Streife, aber unseren Freund Polizeiwachtmeister Andreas Potschenrieder. Der Andreas und der Herr Wimmer kennen sich schon seit Jahren und der Andreas hat dem Herrn Wimmer gesagt, er solle sich mit mir in Verbindung setzen, da er glaubt, dass wir ihm helfen können. Es ist eine heikle Sache und nicht jeder habe das Gespür für solche Sachen, hat der Andreas gemeint.“
„Und was genau ist diese ‚Sache', Herr Kommissar?“
„Das werden wir jetzt herausfinden, Armin.“
3
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts baute man durch Solln eine Eisenbahnlinie, von München Richtung Süden, weiter nach Wolfratshausen, bis nach Bad Tölz. Der Bahnhof dort änderte dann alles. Die Wohlhabenden der Stadt fuhren am Wochenende ‚hinaus auf's Land', wie man sagte. Erst nur für ein paar Stunden, nur auf ein Bier oder einen Spaziergang an der Isar. Später wurde es mehr und mehr zum Dauerwohnsitz. Ein kleines Dorf am Rande der Stadt wurde auf einmal eine Villensiedlung, in der hauptsächlich reiche Münchener ihr Refugium und die Ruhe auf dem Land suchten. Vor dieser Zeit hatte Solln noch dörflichen Charakter, mit einem richtigen Dorfkern, mit Kirche und Wirtschaft, Bauernhöfen, einem Maibaum und unbefestigten Straßen.
Das fand mit der Verkehrsanbindung an München jedoch sein endgültiges und trauriges Ende. Heute ist es eine Trabantenstadt, mit zum Teil gewöhnlichen Wohnblöcken, in aufregend modernem und schlicht gehaltenem Gelb und Grau, teils kleinen Häusern aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Und auch mehreren neuen Architektendenkmälern, die man, im Nachhinein gesehen, besser nicht gebaut hätte.
Es gibt auch noch die alten, großen Villen, die sich normale Menschen, mit einem normalen Beruf und Einkommen, nicht leisten können. Nicht wegen der Preise – das vielleicht auch – sondern mehr wegen der Auflagen der Stadt, diese Häuser als Denkmäler des Anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts zu betrachten und auch dementsprechend zu pflegen. Aus diesem Grund sind nur wenige der alten Herrschaftsvillen in ansehbarem Zustand. Die meisten sind sich selbst überlassen und dem Verfall preisgegeben. Denkmäler einer vergangenen Zeit, die man mit zeitgerechter Erhaltung zwanghaft, und nicht sehr erfolgreich, zurückholen möchte.