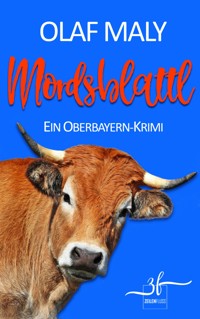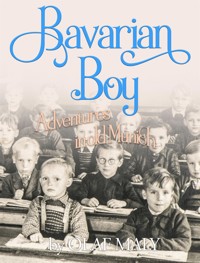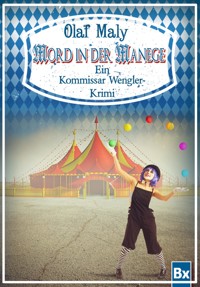0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernrieder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die Valentinshütte ist verflucht. So wird es zumindest von den wenigen Bewohnern gemunkelt, die das Verbrechen an einem jungen Mädchen vor vierzig Jahren noch miterlebt haben. Der Mörder wurde nie gefasst. Als nach all den Jahren ein Pilzsammler in der Hütte erneut eine Leiche findet, wird Kommissar Bernrieder mit den Geschehnissen von damals konfrontiert. Ein halbes Menschenleben liegt zwischen den beiden Morden. Doch wer sollte Interesse daran haben, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen? Akribisch muss Bernrieder die Puzzlestücke zusammenfügen. Denn der Täter hat dem Kommissar eine symbolische Nachricht hinterlassen, die es zu entschlüsseln gilt, bevor Bernrieder der Wahrheit näher kommen kann. "Hundskraut" ist der zweite Band der Serie "Bernrieder ermittelt". Dieser Roman ist in sich abgeschlossen. Alle Teile der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Hundskraut
Bernrieder ermittelt – Band 2
Olaf Maly
Für Marita.
Einfach nur so.
1
Es war Mittwoch. An sich kein besonderer Tag, für die meisten eher einer wie der andere, wenn man das bedenkt, außer aber für Franz Joseph Bernrieder. Bei ihm stand an diesen Tagen im Monat nach sechs Uhr abends nie etwas im Kalender. Nie etwas anderes als eben sein wöchentliches Treffen. Es war der Tag, an dem man sich zum Stammtisch traf, einer alten, ehrwürdigen, bayerischen Tradition, der gehuldigt werden musste. In seinem Fall, und natürlich dem seiner Freunde, war es in der Wirtschaft zum Egerwirt. Dort, auf der Straße nach Krün, nicht zu weit vom Hauptplatz. Ein wenig zurückgesetzt. Weg von der Straße. Also immer noch in Laufdistanz vom Ortskern, aber weit genug, um ungestört zu sein. Sie wollten sich nicht im Ort treffen, da sie ja alle eine Art verantwortungsvolle Position innehatten. Schließlich war er der Hauptkommissar von Bad Tölz und Region. Und auch der Einzige in dieser Position in diesem Ort. Da hat man schon eine gewisse Verantwortung. Auch die anderen hatten Stellen, die man respektierte. Und dabei wollte man es belassen.
Es gab Tage bei Franz Josef Bernrieder, an denen es sich nicht vermeiden ließ, diesen Termin ausfallen zu lassen, was ihm, verständlicherweise, überhaupt nicht gefiel, aber für gewöhnlich war es irgendwie immer möglich, etwas zu verschieben. Wenn zum Beispiel eine Freundin anrief, die er wochenlang nicht gesehen hatte, da diese nur im Sommer für ein paar Tage in Bad Tölz war, konnte man schon mal ein Auge zudrücken und gewisse Prioritäten setzen. Natürlich nur, wenn es nicht nach seinem Stammtischtreffen ging oder er irgendwie anderweitig fest gebunden war. Dann natürlich nicht. Die festen Bindungen waren bei ihm auch nicht gerade fest, wenn man so will. Im landläufigen Sinne, wie man das versteht. Mehr eben nur etwas fester als die anderen, die mehr locker waren.
Franz Joseph Bernrieder war nicht gerade ein Kind von Traurigkeit, wenn es um die Weiblichkeit ging. Mehr so ein Hallodri, wie man das in Bayern nennt. Seine letzte große Leidenschaft war eine junge, schlanke Brünette, die für ein paar Wochen in Bad Tölz zur Kur war. Sie sah absolut nicht irgendwie krank aus oder machte den Eindruck, dass sie unbedingt in ein Kurbad musste, um gesund zu werden. Er wollte auch nicht wissen, was sie wirklich nach Bayern gebracht hatte, als sie dort saß, im Café am Hauptplatz und langsam und genüsslich ihren doppelten Lattemachio in sich hineinschlürfte. Eigentlich mehr an der kleinen Tasse mit den zierlichen Röschen und dem Goldrand nippte. Den kleinen Finger nach außen gespreizt, balancierte sie die Tasse mit Daumen und Zeigefinger gekonnt zum Mund. Sie hatte ein rotes, kurzes Kleid an, das ihre ausgezeichnete Figur sehr gut zur Erscheinung brachte. Dazu rote, hohe Schuhe. Eine kleine, passend in Rot gehaltene Handtasche lag neben der Kaffeetasse. Die Sonnenbrille steckte nach oben in ihren welligen Haaren. Das Gesicht war leicht gebräunt, die Augenbrauen nachgezogen und das Rouge dezent auf den Wangen verteilt.
Es waren nur noch wenige Plätze frei im Lokal, da es Freitagnachmittag war und viele auf dem Weg nach Hause oder in ihr Kurhotel dort kurz Station machten, bevor sie ihre Anwendungen bekamen. Auch er war auf dem Weg in sein Heim und freute sich auf ein ruhiges Wochenende.
Er hatte seinen alten Käfer in der Nebenstraße abgestellt, dort wo sein Freund, der Herrgottsschnitzer Gustav Kernbauer, seinen Laden und die kleine Werkstatt hatte. Parken war schwierig geworden in der Innenstadt, und sein Freund hatte einige Plätze vor seinem Laden reserviert, die allerdings nie besetzt waren. Franz Josef wollte dort im Café nicht unbedingt Rast machen, aber als er daran vorbeischlenderte und sah, wie sie so allein und verlassen dasaß, vor sich hinblickend, in Gedanken versunken, dachte er sich, warum eigentlich nicht teilhaben an den Träumen, die sie scheinbar vor ihren Augen passieren ließ. Er hatte nichts Besonderes vor an diesem Wochenende, außer es eben zu genießen, also gab es für ihn keinen Grund, in besonderer Eile zu sein. Ohnehin hatte er sowieso nie Zeit für Eile. Es war ein Wort, das einfach nicht in seinem Vokabular auftauchte. Er war mehr der gemächliche Typ. Zu Hause wartete auch niemand auf ihn, nur ein leeres Haus. Es gab für ihn somit keinen Grund, es unversucht zu lassen.
Als er an ihrem Tisch vorbeischlenderte, fragte er ganz einfach in seinem besten Deutsch, ob der Stuhl neben ihr noch frei wäre. Sie sähe so verloren aus, so zerbrechlich und nachdenklich. Dazu lächelte er in seinem besten Lächeln. Sie sah ihn von unten an, strahlte auch ein bisschen und meinte: »Aber ja, gerne.«
Damit war das Eis bereits gebrochen. Sie unterhielten sich über belanglose Dinge. Das Wetter, wie schön es sei, den Ort, der doch so sein eigenes Flair hätte, den Brunnen auf dem Hauptplatz, der ihr besonders gefiel, und eben Sachen, die man sagt, ohne was zu sagen. Nach zwei weiteren Lattemachio und einem Stück Punschtorte erfuhr er, dass sie aus Dortmund kam, alleine lebte und hier versuchte, ihr seelisches Gleichgewicht wiederzufinden.
»Wo ham's denn des verloren. Ich mein des Gleichgewicht«, fragte er und lächelte dabei vielversprechend. »Vielleicht kann ich Ihnen ja dabei helfen, des zu finden, weil ich bin nämlich von der Polizei und besonders darauf spezialisiert, was zu finden, was verloren gangen is. Egal was. Auch Gleichgewichte, oder auch andere Gewichte.«
Das beeindruckte sie natürlich, was man ihr an ihrem erstaunten Gesichtsausdruck sofort ansah, und sie meinte, das wäre nur so dahergesagt. In Wirklichkeit könne man das natürlich nicht finden. Das verlorene Gleichgewicht, und so. Eigentlich bedeutete das mehr, sich selbst zu finden. Seine eigene Mitte, die irgendwo zu sein schien.
»Aber des weiß ich doch. Ich mein, wir könnten des doch wenigstens versuchen. Wenn man da anfängt zum suchen, wundert man sich manchmal, was man findet. Da kann man ja nur gewinnen. Wenn's dann nicht klappt, is auch nix passiert. Ich bin der Franz.«
Damit reichte er ihr seine Hand und zeigte seine makellosen Zähne unter dem kräftigen, schmalen, schwarzen Schnauzer.
»Und ich bin die Brigitte, wie schon erwähnt, aus Dortmund.«
»Dann, Brigitte, lass uns doch amal zu meinem Schloss fahr'n und des Weitere, wie immer man des nennt, dort suchen. Du glaubst gar nicht, was man da alles finden kann.«
Franz bezahlte, redete noch ein paar nette Worte mit seiner Freundin Fanny, die ihn verständnisvoll ansah, und beide verließen beschwingten Schrittes das Lokal. Als sie sein Auto erblickte, den alten Käfer, den er noch von seiner Großmutter geerbt hatte, wie auch den Bauernhof, auf dem er wohnte, starrte sie ihn ein wenig erschrocken an. Er dachte einen Funken Enttäuschung in ihrem Blick zu erkennen. Die Mundwinkel zeigten ganz leicht nach unten. Er wusste nicht, was sie erwartet hatte, aber sicher nicht ein Fahrzeug, das mit Klebebildern von Sonnenblumen bedeckt war, um die Löcher auf dem Blech zu verschließen.
»Des is alles nur Tarnung, Brigitte. Lass dich nicht daran stören. Wenn ich mit meinem richtigen Auto hier rumfahr, reden bloß immer alle blödes Zeug. Im Ort muss man da vorsichtig sein, speziell, wenn man so eine öffentliche Position hat wie ich. Ich steh ja quasi immer im Rampenlicht hier. Wie auf einem Präsentierteller. Ist nicht so einfach, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Jedes Haus hat hier Augen und Ohren.«
Das leuchtete sogar Brigitte ein, und sie meinte, dass sie daran erst gar nicht gedacht habe, aber wenn er ihr das so sagte, mache es voll Sinn. Gustav Kernbauer stand im Fenster seines Ladens und sah, was gerade vor sich ging. Er winkte seinem Freund aufmunternd zu und widmete sich dann wieder seiner Maria, an der er bereits seit ein paar Tagen arbeitete. Als beide endlich im Auto Platz gefunden hatten und sogar der Motor auf's erste Mal ansprang, fuhr man auf den Hof.
Die Führung dauerte nicht lange. Das hing erstens damit zusammen, dass es nicht viel zu sehen gab und zweitens das Haus kein Museum war, sondern sein Zuhause. Da das Wetter warm und der Himmel blau gewesen war an diesem Tag, setzten sie sich noch auf die Bank vor dem Eingang, dort wo sein Großvater immer gesessen und den Tag mit einem Zigarillo hatte ausklingen lassen. Langsam senkte sich die Sonne hinter den Bergen, malte die Felsen zuerst in ein tiefes Rot, um dann in ein Lila überzugehen, das immer dunkler wurde, bis das Grau der Berge sich mit dem des Himmels traf. Grillen fingen an zu zirpen, der Duft von frisch geschnittenem, feuchtem Gras schwebte ums Haus. Es war einfach schön, romantisch und vertraulich.
Nach ein paar Gläsern Bier auf der Bank kam man zur Sache und ging nach oben ins Schlafzimmer. Dem Suchen nach dem Gleichgewicht des Lebens musste nachgegeben werden. Es war schnell gefunden.
Am nächsten Morgen, es war ein wunderschöner Samstag wie aus dem bayerischen Bilderbuch, entdeckte er einen Zettel auf dem Küchentisch. Unten, dort wo die Eckbank stand und der Kachelofen. Im Sommer war das Bett immer oben im Schlafzimmer, nur im Winter wurde es mit Hilfe seiner Freunde nach unten getragen, da es oben keine richtige Heizung gab. Jedes Jahr versprach er sich, das zu ändern. Nur ging das Jahr stets so schnell und spurlos vorüber, dass es einfach immer zu spät und von Neuem kalt war, als er wieder daran dachte.
Bevor er aufstand, hatte er ein paarmal gerufen, dann im Bad nachgesehen und irgendwie gehofft, sie zu finden. Brigitte war nirgendwo mehr zu sehen. Nur der Platz neben ihm war zerwühlt und frei. Vielleicht war sie ja auch draußen und bestaunte die Kühe, die dort auf seiner Wiese gemächlich vor sich hinkauten. Er dachte sich, dass es in Dortmund nicht so viele Kühe vor dem Haus gab und sie vielleicht davon beeindruckt war. Immerhin hörte man sie bereits, als die Sonne aufging, und das war schon ein paar Stunden her.
›Such nicht nach mir‹, stand dort in Kursiv auf dem Zettel, auf dem er normalerweise immer seine Einkäufe notierte. ›Weder heiße ich Brigitte, noch wohne ich in Dortmund. Und mein Mann würde sich nicht freuen, wenn du plötzlich vor der Türe stündest. Meine vier Kinder schon gar nicht. Ich habe mein Gleichgewicht gefunden. Lassen wir es dabei.‹
Er stand da in seinen weißen Boxerhosen mit den kleinen, roten Herzchen darauf, sah sich den Zettel an, drehte ihn einige Male in seinen Fingern und warf ihn in den Abfalleimer, der neben dem Ofen stand. Dann atmete er kräftig ein und aus, blickte an sich herunter, bestätigte sich selbst, dass er noch ganz gut dastehe, haute sich mit seinen Fäusten auf seine Brust und ging nach oben, um dem Tag zu begegnen, der vor ihm lag. Es würde sich sicher etwas finden, um es an diesem schönen Wochenende zu unternehmen. Mit Brigitte, oder wie immer sie hieß, oder ohne sie.
Das war Vergangenheit. Eigentlich nur ein paar Tage, aber dennoch vorbei. Kein Grund, traurig zu sein. Nun aber war bereits Mittwoch und sein Stammtischtag. Gustav Kernbauer saß wie immer als Erster am Tisch, den Tölzer Anzeiger vor sich und das Glas Weizenbier in seiner Hand, als müsste er es festhalten, damit es ihm niemand wegnahm. Er blickte kurz hoch, als die Tür aufging.
»Setz dich her, Franz«, meinte er in seinem tiefen, melodischen Tonfall. Dank seiner Körperfülle hatte der Bass seiner Stimme volle Resonanz und harmonierte perfekt mit seiner Erscheinung. Mit seinen langen, braunen Haaren und dem kräftigen Bart sah er fast so aus wie eine der Jesusfiguren, die er schnitzte. Nur sein leicht gerötetes Gesicht passte irgendwie nicht zur göttlichen Erscheinung.
»Die blöden Preußen wollen jetz des Glockenläuten von die Kirchen verbieten. Kannst dir des vorstellen? Keine Glocken mehr am Sonntag. Die meinen, des würd grad am Sonntag immer so laut sein, wo die doch lang schlafen wollen, die Deppen. Ja soll'n die doch daheim schlafen, die …«
»Steht des in der Zeitung?«
»Ja, grad hier«, wobei er mit seinem Zeigefinger mehrmals auf die Stelle auf dem Papier klopfte.
»Des steht da jed's Jahr, Gustl. Und jed's Jahr drucken die dieselbe saublöde G'schicht, weil's um die Zeit nix zum berichten gibt. Des nennt man ein Sommerloch. Alois, eine Halbe vom Besten, wie immer.«
»Kommt«, meinte Alois, der Wirt, der hinter der Theke stand und unablässig Gläser putzte. Erst nahm er eines, hielt es hoch, blickte mit zugekniffenen Augen gegen das Licht und rieb mit einem Handtuch weg, was immer er gesehen hatte. Dieses Ritual wiederholte sich, bis er es zufrieden in die Rille hängte, die oben über dem Schanktisch angebracht war. Es waren nicht viele Leute in der Wirtschaft, aber, dachte er wahrscheinlich, man musste vorbereitet sein. Er hatte einen wirren, blonden Schopf auf dem runden, roten Kopf, den er nie irgendwie drapierte. Er meinte, das wäre ›in‹, und ›so würden des die Modernen in der Stadt tragen. Des Haar, eben.‹ So wild, wie es eben gerade wächst. Natürlich, von der Natur so gewollt. Und unheimlich bequem. Am Morgen aufstehen, mit den Fingern durchgehen und fertig. Er hätte das gesehen, als ihn die Brauerei einmal zur Zentrale in München eingeladen hatte. Er kam nicht oft nach München. Erstens wusste er nicht, was er dort sollte, und zweitens war er sieben Tage die Woche Wirt. Alle, die ihn kannten, meinten, er würde spinnen und doch nur zu faul sein, einmal mit einem Kamm die Borsten zu bändigen, aber das schlug er total in den Wind.
Seine schwarze, mit lila und gelben Blumen bestickte Trachtenweste spannte sich um seinen Bauch, dass man Angst haben musste, sie würde jeden Moment auseinanderreißen und sich explosionsartig in der Wirtschaft verteilen. Sie hatte einmal gut gepasst, als seine Frau noch gelebtt und ihn immer daran erinnert hatte, nicht zu viel zu essen. Das war lange her.
Franz Josef Bernrieder setzte sich an den Tisch. Das Bier kam wenig später. Er stieß mit seinem Freund Gustav an, und sie wünschten sich nur das Beste.
Es war noch früh. Der Apotheker Hans Günter Heiminger würde erst später kommen. Er hatte einen Laden, die Apotheke eben, die man nicht so einfach abschließen konnte. Als weitere Freunde waren da noch der Feuerwehrhauptmann Dieter Fröschl, der Johann Waginger, Direktor der örtlichen Sparkasse, der Ferdinand Grabner, der beste Versicherungsvertreter am Ort, wie er nicht lassen konnte, immer wieder zu betonen, und der Wachtmeister Korbinian Schuhnagel. Das waren alle, die sich regelmäßig trafen, um die Probleme der Welt zu lösen. Jedenfalls für sich.
2
Der Reiterhof liegt auf der Straße zwischen Greiling und Reichersbeuern, weg ab von der Bundesstraße 472, wenn man von Bad Tölz aus nach Osten, Richtung Tegernsee, fährt. Nicht weit, vielleicht fünfzehn Minuten mit dem Auto. Im Sommer jedenfalls. Fremde fahren dort nicht hin, weil es nichts zu sehen gibt. Außer viel Wald, Wiesen und Feldwege. Aber die gibt's überall in dieser Gegend. Dort, am Reiterhof, kann man sein Auto abstellen, da es keine Möglichkeit gibt, es weiter zu benutzen, will man zur Valentinshütte kommen, einem Platz, an dem viele gerne spazieren gehen. Besonders die Einheimischen. Der Reiterhof hat am Wochenende auch Kaffee und Kuchen, was auch einer der Gründe ist, sich dort in der Umgebung aufzuhalten. Die Zubringer Karin, die den Hof besitzt, macht ihn selbst. Allerdings nur wenige davon, sodass alles in ein paar Stunden weg ist. Wenn der Kuchen gegessen ist, schreibt sie ›zu spät‹ auf die Tafel neben dem Parkplatz und stellt die Stühle auf die Tische. Dann wissen alle Bescheid und versprechen sich, das nächste Mal früher zu kommen.
Von dort geht man weitere zehn Minuten zu Fuß, an der Großen Geißach entlang, einem kleinen Fluss, der über Umwege und andere sich anschließende Nebenflüsschen irgendwann der Isar sein Wasser abgibt und damit endgültig die romantische Landschaft nach Norden verlässt. Wenn man also an diesem vor sich hinplätschernden Wasserlauf entlang Richtung Süden geht, kommt man zwangsläufig an einer Hütte vorbei, die einmal, am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts von einem gewissen Valentin Schultheiß erbaut worden ist. Deswegen nennt man sie ›die Valentinshütte‹. Man weiß nicht mehr genau, warum er gerade in dieser Gegend, an diesem Platz, dieses Häuschen gebaut hat, nimmt aber an, dass es wegen des Holzes war, das dieser gefällt und in die naheliegende Sägerei verbracht hat. Das war sein Auskommen. Die Wälder um die Hütte herum gehörten ihm nicht, er hatte sie nur gepachtet, lebte also mehr schlecht als recht von dem wenigen Holz, das er fällen und dann zur Säge bringen konnte. Da das Wetter in dieser Gegend immer unberechenbar war und auch noch ist, wollte er wahrscheinlich eine Unterkunft haben, die ihm Schutz bot, sollte es nötig werden.
Wenn man etwas Phantasie hatte und sich vorstellte, wie diese Hütte einmal ausgesehen hatte, musste man zu dem Schluss kommen, dass sie vielleicht mehr war als nur eine Notunterkunft. Vielleicht war es der Fluchtpunkt für jemanden, der sonst nirgendwo hinkonnte. Zwar hatte er ein Zimmer auf einem Bauernhof, wo er auch aushalf, wenn Not am Mann war, aber wie die Leute sich erzählten, liebte er die Einsamkeit. Das war kein Wunder, da es wohl wenige Beschäftigungen gab, die einsamer waren, als in den Bergen Holz zu fällen. Da gab es nur ihn und seinen alten, treuen Kameraden Braun, den Ackergaul, der die Bäume zum Lagerplatz zerren musste.
Es gibt ein Bild im Heimatmuseum, auf dem ein kleines, nettes Häuschen zu sehen ist, mit Läden vor den Fenstern und einer winzigen, überdachten Terrasse. Darauf ein Stuhl und ein Tisch. Aber das ist lange her. Neben dem Haus sieht man einen mageren Mann in einer Arbeitshose, die ihm zwei Nummern zu groß ist, während er ein braunes Pferd am Zügel hält. Auf das Bild hat jemand in Sütterlin ›Valentin Schultheiß‹ geschrieben.
Nachdem dieser nun in den Sechzigerjahren gestorben war, kümmerte sich für viele Jahre niemand mehr um dieses kleine Anwesen. Das Gras wuchs meterhoch drum herum, Bäume und Büsche siedelten sich an, das Dach fiel teilweise ein. Die Natur holte sich ihr Eigentum zurück, wollte alles mit Vergangenheit zudecken.
In den Achtzigerjahren entdeckten und verwendeten es dann Jugendliche für wilde Partys, bei denen nicht nur Coca Cola getrunken und Zigaretten geraucht wurden. Wie das zustande gekommen war, wusste niemand. Sie waren einfach eines Tages da, wie eine Krankheit, von der man wusste, dass es sie gab, aber immer gehofft hatte, sie würde einen nicht befallen. Die Kultur, die sie mitbrachten, kam aus der Stadt, die weit weg war und mit dem Leben in dieser Region nichts gemeinsam hatte. Die Einheimischen wollten in Ruhe gelassen werden und empfanden es als Störung ihres Friedens. Nur scherten sich die jungen Leute aus der Stadt wenig darum, was die wollten, die dort lebten. Es war auch ihre Welt, und sie waren ein Teil davon. Sie konnten davon Gebrauch machen, ohne jemanden zu fragen.
Sie nagelten Bretter aufs Dach, reparierten die Fenster und bauten wieder eine Tür ein, machten es einigermaßen trocken und bewohnbar. Keiner hinderte sie daran, da niemand so recht wusste, wem diese Bude gehörte. Und wenn man es wusste, war es den meisten auch egal. Man wollte sich mit den Leuten aus der Stadt nicht anlegen, man hatte Besseres zu tun. Sie waren nur für Tage dort und weit weg von allem. Das ließ sich aushalten.
Es war ein berühmt-berüchtigter Platz in dieser Zeit und in der ganzen Gegend wohlbekannt. Abgelegen konnte man dort die Musik so laut aufdrehen, wie man wollte, niemand nahm Notiz. Nur die Tiere beklagten sich, ohne dass man allerdings davon wusste. Und es wahrscheinlich auch total ignorierte. Sie verzogen sich eben, und damit war das Thema für beide Parteien erledigt.
Meistens fanden diese Festivitäten an Wochenenden statt, oder in den Sommerferien, aber so genau wusste niemand, wann jemand dort war und wann nicht. Wenn sie angekommen waren, sah man von Weitem Rauch aufsteigen. Dann wusste das ganze Dorf, dass es wieder etwas vom Grill gab oder die Hütte geheizt werden musste.
Ein Ereignis in dieser so abgeschiedenen Hütte jedoch stach hervor, von dem die älteren Leute in der Gegend manchmal noch redeten, wenn sie auf der Bank vor dem Haus saßen und die Sonne hinter den Bergen versinken sahen. Es war Anfang neunzehnhundertachtzig, zur Faschingszeit. Da der Fasching immer so gegen Anfang Februar stattfindet, lag noch gewaltig Schnee auf dem Weg, der auch im Winter nicht geräumt wurde. Keiner musste da hin, und niemand wohnte dort. Also gab es keinen Grund, den Schnee zu beseitigen. Das hielt allerdings eine größere Gruppe Jugendlicher nicht davon ab, sich an diesem besagten Faschingssonntag auf den Weg dorthin zu machen. Mit Mopeds und Motorrädern, an denen sie kleine Anhänger mit Kufen angekuppelt hatten, zogen sie wie eine Prozession durch die Dörfer und dann über die Feld- und Forstwege zur Hütte. Diejenigen, die mit dem Auto kamen und auf der Zufahrtsstraße parken mussten, machten es sich auf den Anhängern bequem, und mit viel Gejohle, Bier und Schnaps ging es durch die ansonsten mehr ruhige Landschaft. Irgendwie hatten sie es geschafft, trotz der widrigen Verhältnisse sich einen Weg zu bahnen.
Noch am Sonntagnachmittag sah man wieder Rauch mitten im Wald aufsteigen. In den umliegenden Häusern wusste man, von wo diese dunkle Wolke sich spiralförmig in den Himmel erhob. Man scherte sich nicht besonders darum. Es waren Leute, mit denen man keine Verbindung hatte, weder direkt noch indirekt. Sie waren ihnen so fremd, wie sie selbst diesen wahrscheinlich fremd waren. Zwar war man auch nicht gerade mit anderen im Ort freundschaftlich verbunden, besonders mit denen, die erst zugezogen waren, aber das war noch intensiver. Die Abneigung war mehr substantiell, endgültig. Wie der Tod endgültig ist. Nichts mehr daran zu ändern, endgültig.
Wie man später feststellte, waren es hauptsächlich Leute aus der Stadt, heißt München, die irgendwie davon Wind bekommen hatten, dass es dort so etwas wie eine versteckte Behausung gab, in der man am Fasching endlos machen konnte, was man wollte. Ohne dass sich jemand darüber aufregen würde. Auch waren angeblich einige aus der näheren Umgebung dabei, aber die konnte man bestimmt an einer Hand abzählen. Das Umfeld dort bestand hauptsächlich immer noch aus Bauernhöfen, auf denen gewisse Regeln nach wie vor Gültigkeit hatten. Zum Beispiel nicht mit den Deppen was zu tun zu haben.
Die Tage bis Faschingsdienstag hörte und sah man nichts außerhalb des Umkreises der Hütte. Nur den Rauch, den sah man Tag und Nacht aufsteigen. Nachts auch schon einmal eine Rakete, die in den Himmel schoss und sich in einer roten, grünen oder weißen Funkenwolke entlud. Das war zwar verboten, aber die Polizei machte keine große Geschichte daraus. Die kurzfristigen Bewohner hätten ohnehin abgestritten, so etwas zu haben, und außerdem würden sie in ein paar Tagen sowieso weg sein. Der Aufwand lohnte sich nicht.
Am Aschermittwoch bewegte sich dann die Karawane, die sich am Sonntag dorthin begeben hatte, wieder aus dem Wald heraus. Es war kalt geworden an diesem Tag. Alle hatten sich eingepackt, mehrere Schichten von Kleidung angelegt, einen Schal bis über die Nase gebunden und sich langsam, aber stetig entweder zum Bahnhof oder dem Auto geschleppt. Oder sie fuhren auf ihren Mopeds knatternd über die eisglatten Wege. Es war vorüber, und man atmete in der Gegend auf. Schon am Nachmittag, als die Einheimischen das Revier wieder übernommen hatten, waren sie vergessen. Auch fiel wieder ein bisschen Schnee, der einen Mantel der Vergessenheit über diese Episode zu legen gedachte.
Am Freitag in dieser Woche, es war der erste Tag, an dem zwischenzeitlich die Sonne schien und allen vom Winter Erschöpften Hoffnung auf den Frühling machte, ging der Forstbeamte Martin Faber zur Hütte, wie er das ab und zu tat, um nach dem Rechten zu sehen. Er hatte keine innere Verbindung zu diesem Platz, sondern übernahm diese Aufgabe mehr aus Dankbarkeit, da er schon des Öfteren darauf angewiesen gewesen war, einmal dort zu übernachten. Entweder, weil das Gewitter, das einen in den Bergen besonders heftig und schnell überraschen konnte, ihn dort festgehalten hatte, oder der Schneesturm etwas früher gekommen war als geplant oder angesagt.
Als er sich dem Platz näherte, sah er, dass die Tür offen stand. Sie war nur leicht angelehnt. Der Schnee und der Wind der letzten Tage hatten sie weiter aufgedrückt, die Sonne schmolz das meiste jedoch bereits wieder weg. Wasser tropfte unablässig von den Eiszapfen, die vom Dach heruntergewachsen waren und sich nun auflösten. Er hatte nichts anderes als Unordnung erwartet, genauso wie die Reste, den Abfall, den die jungen Leute hinterlassen hatten und den er aufräumen würde, wenn der Schnee endgültig weg gewesen wäre. Alles war nass, klamm und ungemütlich, wenn auch das Wetter gut und der Himmel blau war. Der Schnee schmolz langsam, aber unablässig und machte alles in seinem Umkreis zu kleinen Wasserbächen, Rinnsalen und Pfützen.
Vorsichtig öffnete er die Tür, schob mit den Stiefeln den letzten nassen Schnee beiseite und sah sich das Innere an, nicht wissend, was ihn erwartete. Seine Augen mussten sich an die Dunkelheit gewöhnen. Und an den Geruch von Rauch und Alkohol, der von dem feuchten Holz wie von einem Schwamm eingesogen worden war. Nur die Sonne, später im Sommer, würde das wieder in Ordnung bringen.
Als es für ihn ein bisschen heller wurde und die Schwärze allmählich nachließ, sah er dort, auf dem Boden, inmitten der Hütte eine junge Frau liegen, die sich nicht mehr bewegte. Es gab ihm einen Stich ins Herz, der so plötzlich kam, dass er sich am Türrahmen festhalten musste, um nicht zu fallen. Es war nicht schön, so etwas zu sehen. Und das erste Mal für ihn, dass er es, wie es in diesem Moment schien, mit einem toten Menschen zu tun hatte. Für ein paar Minuten stand er nur da und blickte sich um. Fliegen kreisten um den Kopf, um den sich eine kleine Lache Blut angesammelt hatte. Dann ging er langsam zu dem leblosen Körper, fasste ihn vorsichtig an, nur um festzustellen, dass er so kalt war wie der Raum, in dem er lag. Ruckartig zog er seine Hand weg, stand wieder nur da, starrte minutenlang auf den Boden und blickte um sich, ob noch etwas anderes Ungewöhnliches zu sehen war.
»Ja so ein Scheiß. Eine Leich«, war das Einzige, was ihm in diesem Moment einfiel und er laut für sich selbst mehrmals sagte, wie er später auf dem Revier zu Protokoll gab.
Sein Herz klopfte, als wollte es ihm aus der Brust springen, Schweiß lief ihm übers Gesicht, er zitterte, obwohl es trotz der Sonne noch ziemlich kalt war. Das war er nicht gewohnt, so etwas zu sehen. Langsam drehte er sich um, ging aus der Hütte, verschloss die Tür, legte einen Riegel davor und lief, so schnell er konnte, zum nächsten Hof, um von dort aus die Polizei zu rufen.
Der zuständige Kriminalkommissar zu dieser Zeit, ein gewisser Georg Rauscher, war in weniger als einer halben Stunde am Tatort. Auch Männer mit Koffern, Fotoapparaten und allem möglichen Gerät waren angekommen und beschäftigten sich umgehend und mit akribischer Besessenheit in und um den Platz des Geschehens. Martin Faber musste seine Aussage machen und mehrmals wiederholen, was er gesehen und wie er die Tote gefunden hatte. Für einen Augenblick hatte er sogar das Gefühl, der Verdächtige zu sein, so viele Fragen schlugen auf ihn ein. Als der Amtsarzt allerdings feststellte, dass die Frau seit Mittwochfrüh dort gelegen hatte und um diese Zeit niemand anderer als eben die Leute aus der Stadt die Hütte in Anspruch genommen hatten, war dieser Gedanke schnell für alle erledigt. Der Kommissar hatte ohnehin nicht eine Minute daran geglaubt.
Was man später im gerichtsmedizinischen Institut in München auch herausfand, war, dass die Frau mindestens einmal vergewaltigt worden war. Besonders dieser Umstand gab dem Fall in dieser Gegend noch eine besondere Dimension. Man dachte immer, so etwas würde nur in der Stadt passieren, aber nicht auf dem Land, wo doch alles noch im Gleichgewicht war. Ja, die Jugendlichen waren, wenn sie kamen, irgendwie ein Störfaktor. Aber das waren Intermezzos, nicht die Normalität. Vergewaltigungen waren etwas, was man vielleicht in der Zeitung las oder auch in den Nachrichten hören konnte. Abgesehen davon gab es nur die Einsamkeit, die Natur und die eingeschworene Nachbarschaft.
Es war kein Problem gewesen, die Tote zu identifizieren. Zuerst hatte der Kommissar vermutet, jemanden aus der Stadt vor sich zu haben. Wie sich jedoch sehr schnell herausstellte, war es die Tochter des Almbauers Lorenz Wiesberger, eine gewisse Maria Wiesberger. Das ging deswegen so schnell, da die Eheleute Wiesberger noch am Dienstagabend in ebendieser Woche eine Vermisstenmeldung aufgegeben hatten, da die Tochter an diesem Tag nicht nach Hause gekommen war. Sie hatte gemeint, sie sei zu einer Faschingsparty eingeladen, aber am Abend wieder zu Hause. Der diensthabende Beamte wies die beiden, als sie verstört und ängstlich ihre Meldung machten, darauf hin, dass man achtundvierzig Stunden warten müsse, bevor die Polizei etwas unternehmen konnte, aber das interessierte die zwei nicht. Jeden Tag standen sie im Revier und fragten, ob man ihre Tochter gefunden hätte. So auch am Freitagnachmittag. Kommissar Rauscher zeigte ihnen ein Bild, das er mit einer Sofortbildkamera aufgenommen hatte. Frau Wiesberger brach daraufhin zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Herr Wiesberger übernahm die Identifizierung, bevor man den Körper nach München transportierte.
Die Wiesbergers waren eine Almbauerfamilie, was heißt, dass sie den ganzen Sommer auf der Alm, hoch in den Bergen verbrachten. Sie holten Kühe von den umliegenden Höfen, trieben sie im Frühjahr nach oben und im Herbst dann wieder hinunter. Dafür konnten sie den Gewinn der Produkte behalten, die sie über den Sommer produziert hatten. Es gab auch noch Wanderer, die an der Hütte dort oben haltmachten, was ein zusätzliches Einkommen versprach. Besonders an den Wochenenden war es immer voll, da Frau Wiesberger für ihre Blaubeer- und Himbeerkuchen in der weiteren Umgebung bekannt war. Im Winter kamen sie bei einem Bauern, dem Straubingerhof, unter, der ihnen für ein wenig Arbeit Essen und Unterkunft zur Verfügung stellte. Außer der Tochter Maria gab es noch einen Sohn, genannt Ruppert. Zur Zeit der Tat war dieser etwa zehn Jahre alt.
Kommissar Rauscher unternahm alle Anstrengungen, wenigstens ein paar der Leute ausfindig zu machen, die an diesem Faschingswochenende dort gewesen waren, allerdings mit mäßigem Erfolg. Es fanden sich zwei Männer, die von einem anonymen Anrufer namentlich genannt wurden. Wie sich herausstellte, stimmte es, dass sie an diesem Wochenende dort gewesen waren, das wurde von ihnen nicht verneint. Nur hatte keiner von ihnen eine Frau gesehen, die dort tot am Fußboden gelegen hatte. Es waren viele Frauen zu dieser Zeit dort gewesen, meinten sie, aber an diese eine konnte sich keiner der beiden erinnern. Als sie die Hütte verlassen hatten, sei alles in bester Ordnung gewesen. Und nein, weitere Personen kenne man nicht. Es sei ein lustiges und trinkfreudiges Wochenende gewesen, an das man sich nur nebelhaft erinnere. Sie wussten nicht einmal, wie sie am Mittwoch nach Hause gekommen waren, nur dass man am Donnerstag mit einem Kopf aufgewacht war, der so groß wie ein Kürbis zu sein schien. Es täte ihnen leid, nichts zu dem Fall beitragen zu können.
Da man niemandem etwas nachweisen und auch keine Spuren sichern konnte, die irgendeinen Hinweis ergaben, wurde der Fall nach zwei Jahren eingestellt, mit dem Vermerk, dass man ihn wieder aufnehmen würde, sollten sich neue Erkenntnisse ergeben. Die ergaben sich nie. Die Eheleute Wiesberger verstarben, ohne gewusst zu haben, wer ihre Tochter auf dem Gewissen hatte. Der Sohn war angeblich in die Stadt gezogen, aber Genaues wusste man damals nicht. Und musste es auch nicht wissen. Der Fall war erledigt, jedenfalls für die Polizei. Ab und zu redeten die Leute noch darüber, wenn jemand davon gehört hatte und wissen wollte, was da los war. Aber auch das ließ über die Jahre nach. Die, die es miterlebt hatten, verstarben einer nach dem anderen, die Jungen hatten kein Interesse daran. Das war früher und lange her.
Mehrere Jahre später ging Kommissar Rauscher in den verdienten Ruhestand. Bei seiner Abschiedsrede erwähnte er diesen Fall noch einmal kurz und bedauerte, dass er ihn in seiner Zeit nicht hatte klären können, hoffte aber, dass sein Nachfolger mehr Erfolg hätte, wohl wissend, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein würde.
Die Hütte wurde zugesperrt, ein Siegel wurde angebracht, das der Regen schon nach ein paar Wochen abgewaschen hatte. Es sprach sich herum, was dort passiert war, und von diesem Tag an war die Einrichtung für die Jungen aus der Stadt nicht mehr interessant. Langsam verkam sie, das Dach brach wieder ein, Bretter fielen heraus, das Fensterglas zersplitterte und ließ den Wald dort eintreten und sich verbreiten. Der Wind tat das Restliche. Heute sah man nur noch ein Gerippe und ein paar Dachbalken, die die Wände zaghaft, aber doch noch aufrecht hielten.
Die Alten stehen manchmal davor und sagen, dass die Hütte verflucht sei, seitdem man das Mädchen dort gefunden hat. Aber es gibt nur noch wenige, die sich daran erinnern. Der Mantel der Vergangenheit hat sich darübergelegt und alles zugedeckt. Keiner wollte diesen Mantel hochheben, um zu sehen, was vielleicht darunter verborgen lag. Tote soll man nicht aufwecken, lehrt ein Spruch, der sicher seine Berechtigung hat und von den Einheimischen ernst genommen wird.
3
Franz Bernrieder ging langsam über den Hauptplatz, als der Abend am Stammtisch sein Ende gefunden hatte. Gehen war vielleicht nicht der richtige Ausdruck, es war mehr schlendern und versuchen, einen Fuß nach dem anderen zu setzen, ohne dabei umzufallen. Die wenigen Menschen, die um diese Zeit noch unterwegs waren, sahen sich an und machten einen großen Bogen um ihn. Er lächelte ihnen nur zu und torkelte weiter.
Es war schön, wie es immer schön war, mit seinen Freunden ein paar Stunden zu verbringen. Er fand es einfach unkompliziert und entspannend, man musste sich nicht verstellen, nicht jemand sein, der man nicht sein wollte oder musste. Man konnte ganz der sein, der man war.
Oft dachte er, dass viele der Leute, mit denen er zu tun hatte, sich verstellten, um sich zu zeigen, wie sie gerne sein wollten, ohne zu begreifen, dass sie dieses Ziel sehr wohl erreichen könnten, wenn sie es nur wollten. Aber nein, sie liefen etwas nach, was andere in ihnen sehen wollten. Oder glaubten, sehen zu wollen. Jemand soll einmal gesagt haben, man solle ganz einfach so sein, wie man ist, alle anderen Versionen sind schon vergeben.
Solche schwerwiegenden Gedanken hatte er selten, und sie machten ihn nicht gerade glücklich. Schnell schob er sie beiseite, da er noch vorhatte, sich mit seiner alten Freundin Barbara Sponheimer im Fitnessstudio zu treffen. Nein, nicht um Gewichte zu heben oder auf dem Fahrrad imaginäre Berge hochzufahren, sondern sie zu bitten, ihn nach Hause zu bringen. Ihr gehörte das Studio.
Als er am besagten Haus vorbeikam, sah er im oberen Stockwerk Licht brennen, was bedeutete, dass seine Freundin noch arbeitete. Wahrscheinlich irgendwelche Steuersachen, dachte sich Franz Bernrieder. Leute, die ein Geschäft haben, machen immer irgendwelche Steuersachen. Das ganze Jahr. Sagen sie jedenfalls. Was sie wirklich dort um diese Zeit machten, war ihr wohlbehütetes Geheimnis.
»Wie auch immer«, meinte er zu sich selbst, »des werden wir jetz erforschen, wir zwei. Ich und mein Rausch.«
Die Tür war verschlossen, was man sich um diese Zeit auch hätte denken können. Er klingelte. Ein kleiner Bildschirm neben der Tür wurde eingeschaltet. Franz Bernrieder erkannte sich selbst darauf und lächelte sein bestes Lächeln. Zu sich selbst sprechen wollte er lieber nicht. Dann summte es, und die Tür ging langsam auf.
Oben war eine Glastür, die alle möglichen Figuren von starken Frauen und Männern eingefräst hatte und nur angelehnt war. Barbara saß an einem kleinen Schreibtisch, den Laptop vor sich und bearbeitete die Tasten wie ein Maschinengewehr. Die Finger flogen nur so über die Buchstaben.
»Setz dich irgendwo hin, Franz. Ich bin gleich fertig«, sagte sie, ohne aufzublicken.
Franz Josef Bernrieder hielt sich zurück. Er wollte sie in ihrer Euphorie nicht stören und setzte sich auf die grüne Couch, die an der Wand stand. Es war eine tiefe Couch, in die er sich fallen ließ. Wie er wieder von dort herauskommen sollte, bereitete ihm irgendwie Kopfzerbrechen. Es gab auch eine Flasche Wasser, die auf dem kleinen Beistelltisch stand. Sie war noch verschlossen.
»Nimm dir des Wasser, was da is, wenn'st an Durscht hast«, sagte Barbara, die ihm zwar den Rücken zukehrte, aber dennoch zu wissen schien, was er dachte und tat. Das faszinierte ihn immer wieder an Frauen. Nicht nur sie war so, sondern die meisten, die er kannte. Und er kannte einige. Irgendwie wussten die immer, was er dachte, auch wenn er es nicht dachte, aber wenn sie ihm gesagt hatten, was er gerade dachte, hatte er den Eindruck, dass sie recht hatten mit dem, was sie ihm sagten, was er dachte. Er hatte seine Freunde einmal danach gefragt, und sie hatten ihm bestätigt, dass es ihnen genauso erging. Es war einfach verwunderlich. Eine der Gaben der Weiblichkeit, die er nicht verstand und auch nicht versuchte zu verstehen. Wie viele andere.
Barbara klappte den Laptop zu, atmete tief ein und aus, stand auf und gesellte sich zu Franz, der gemütlich auf der Couch saß und die Flasche Gerolsteiner in der Hand hielt.
»Schön, dass'd da bist, Franz. Is was passiert?«
Franz Bernrieder sah sie enttäuscht an.
»Barbara, meine Liebste, ich komm doch nicht nur, wenn was passiert is. Ich wollt dich einfach amal wiederseh'n. Ganz spontan, so als Überraschung, verstehst?«
»Des is lieb von dir, Franzi. Und was genau kann ich für dich tun?«
Damit setzte sie sich auf einen Sessel, der gegenüber der Couch stand.
Der Raum war ihr Wohn- und Arbeitszimmer. Es waren nicht viele Möbel aufgestellt, eigentlich nur die Couch, zwei Sessel und der kleine Tisch dazwischen. An der Wand war der Schreibtisch, auf der anderen Seite ein großes Fenster, das vom Boden bis fast an die Decke reichte. Es war ein altes Haus, das man mühevoll und elegant umgebaut hatte. Die Fenster hatten einen Rundbogen am oberen Teil und Sprossen. So etwas nannte man französische Fenster, wie Franz einmal gelesen hatte, als er diese Art das erste Mal gesehen hatte.
»Du schaust müd aus.«
»Ja, wir ham an Stammtisch g'habt heut, und ich wollt dich fragen, ob du mich vielleicht heimfahr'n könntst. Ich mein, als Hauptkommissar sollt man nicht von den Kollegen erwischt werden, weil man ein bisserl was intus hat. Verstehst?«
»Versteh ich vollkommen. Des mach ich. Komm, wir geh'n.«
Damit stand Barbara Sponheimer spontan auf, eilte an eine kleine Kommode, die neben der Tür stand, und nahm einen Satz Schlüssel aus einem Korb.
»Ja, brauchst da nicht ein Zahnbürschtel und so? Ich mein, so allein heimfahr'n in der Nacht is ja nicht grad gut. Ich mein, du könntst da schon bei mir bleiben, bis die Sonn aufgeht, mein ich. Dann könnt ma zusammen frühstücken und so. Dann bist auch nicht allein, die Nacht.«
Barbara sah ihn eindringlich an, stützte ihre Arme in die Hüften und lächelte. Franz Bernrieder lächelte vielversprechend zurück.
»Franz, du weißt doch, dass ich jetz gebunden bin, also mach mir nicht solche Vorschläge, die ich ablehnen muss. Und jetz gemma.«
»Aber Barbara, des is doch kein Hinderungsgrund. Ich mein, wir sind doch alte Freund, des muss doch dein –«
»Franz, willst jetz heim oder nicht? Ich hab nicht die ganze Nacht. Ich muss morgen wieder arbeiten.«
»Ja, des is eben genau des Problem, Barbara. Dass du nicht die ganze Nacht hast. Ich hätt dich schon amal gern die ganze Nacht.«
Mit diesen Worten raffte er sich umständlich auf und ging, oder schwankte mehr, an Barbara vorbei ins Treppenhaus.
Der Hauptplatz war mittlerweile wie leergefegt. Nur die Kirchturmuhr schlug und verkündete die Zeit, die sie bedeutungslos in die finstere Nacht entließ. Kleine Kumuluswolken zogen langsam von West nach Ost und verdeckten teilweise immer wieder den Mond, der voll und hoch am schwarzen Himmel stand. Die Berge im Hintergrund waren dunkel und mächtig. Ein kleiner, hellblauer Streifen hatte sich um ihre Konturen etabliert, der sich vom nächtlichen Schwarz abhob. Er gab ihnen einen schwachen Lichtkranz, der alles wie ein Bild aus einem Reisemagazin aussehen ließ. Unwirklich, aber doch natürlich. Und unendlich schön.
Franz atmete tief durch, nahm die laue Luft, die ein bisschen feucht geworden war, in sich auf, als wäre es sein letzter Atemzug. Dazu machte er ein Geräusch, das sich wie Enttäuschung anhörte.
»Franz, du wirst es überleben.« Barbara schloss das Auto auf, setzte sich hinein, wartete, bis Franz eingestiegen war, und fuhr ihn nach Hause.
4
Andreas Mohn kam gerade aus München zurück. Nach ein paar Tagen, die er dort verbracht hatte, wollte er wieder einmal die Nacht zu Hause schlafen. Es bereitete ihm nicht gerade große Freude, aber da er verheiratet war und es auch noch für eine ganze Zeit bleiben wollte, dachte er sich, es wäre besser, sich einfach immer wieder sehen zu lassen. Er war nicht allein, wenn er nicht in seinem kleinen Haus in Bad Tölz weilte, sondern in der Wohnung in München, aber davon wusste seine Frau nichts. Frauen müssen nicht alles wissen, war seine Devise, und außerdem hätten Männer auch noch Bedürfnisse, wenn es bei den Frauen keine mehr gäbe. Es war ein einfaches, unkompliziertes Weltbild, das er sich da aufgebaut hatte, aber für ihn funktionierte es. Wenn es für andere nicht passen sollte, war das für ihn kein Problem.
Also fuhr er an diesem Mittwoch eben wieder einmal nach Hause. Natürlich hatte er vorher angerufen und seinen Aufenthalt angekündigt. Er war ein vielbeschäftigter Anwalt gewesen, der bereits in den Ruhestand gegangen war, wie seine Frau sehr wohl wusste, musste aber dennoch viel in der Kanzlei aushelfen und konnte daher nicht jeden Tag von München nach Bad Tölz fahren. Besonders, wenn er dann am nächsten Morgen einen frühen Termin hatte. Das müsse sie doch einsehen. Es täte ihm auch immer leid, aber irgendwo musste das Geld ja herkommen.
Sie hatten sich das kleine Reihenhaus dort am Ortsende erst vor zwei Jahren gekauft. Spontan, einfach so. Er meinte, man solle endlich einmal daran denken, was man nach dem Arbeitsleben machen wollte, und da böte sich doch ein Haus im Süden dieses wunderbaren Landes geradezu an. Dort könne man dann auf der Terrasse sitzen, in den weiß-blauen Himmel sehen, den Vögeln beim Singen zuhören und dabei genüsslich einen Kaffee trinken. Was wäre denn besser als das, fragte er seine Frau und hatte sie damit fast umgehend überzeugt. Dass man dann aus der Stadt heraus war, die sie so sehr liebte, sie ihre Freundinnen nicht mehr so oft sehen würde, das Einkaufen auch etwas schwieriger sein würde und sie niemanden dort kannten, das wären alles Dinge, die sich mit der Zeit bestimmt richten würden.
An diesem Tag also kam er erschöpft, wie er sich darstellte, aus der Stadt. Es war ein schöner, sonniger Tag gewesen, der ganz nach seinen Plänen verlaufen war, wenn auch nicht nach denen seiner Frau. Sie begrüßte ihn nur kurz, fragte, ob er denn etwas essen wolle, und da er meinte, er hätte schon was in der Stadt gehabt und es außerdem sowieso schon zu spät wäre, würde er passen. Und morgen früh müsste er wieder zeitig raus. Er würde erwartet werden. Man könne auf ihn eben leider nicht verzichten.