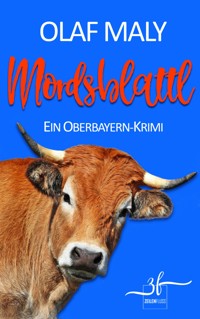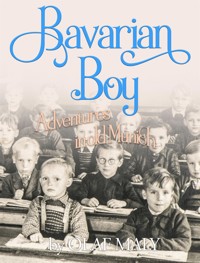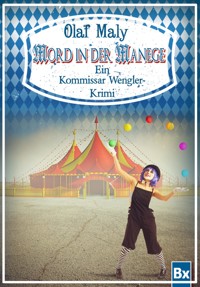4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Wenn in München Wiesn ist, was eigentlich Oktoberfest heißen soll, findet man Herbert Wengler bei seiner Cousine in Aschau. Und das schon seit vielen Jahren. Normalerweise ist es auch eine gemächliche Zeit für die Münchener Polizei. Außer den üblichen Auseinandersetzungen natürlich, die sich um diese Zeit ein wenig häufen, was mit dem Konsum von Alkohol verbunden ist. Aber die gehen meistens relativ glimpflich aus, und die Kontrahenten landen, wenn überhaupt, gerade einmal im Krankenhaus. Bis auf zwei auswärtige Bedienungen, die auf mysteriöse Weise in ihren jungen Jahren das Zeitliche segnen müssen. Das wiederum nötigt den Kommissar, seinen Aufenthalt in Aschau um einen Tag zu verkürzen, was er selbstverständlich nur unter Protest tut. Wie meistens, so stehen Herbert Wengler und Armin Staller wieder vor einem Rätsel, das sich langsam, aber sicher durch Akribie und Hartnäckigkeit des Kommissars wie von selbst löst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Wiesnblues
Eine Kommissar Wengler Geschichte
Ich möchte mich an dieser Stelle bei zwei Personen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre. Da wäre zuallererst meine langjährige Partnerin Marita Stepe, die es stets auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen, und mit konstruktiver Kritik auf die Handlung Einfluss nimmt. Und dann noch bei meiner Lektorin und Korrektorin, Alice Scharrer, die wie immer mit Engelsgeduld meine Fehler ausmerzt. Des Weiteren beim tz-Verlag, die mir freundlicherweise den Artikel vom 28.09.2020 kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Dankeschön. Sollte Ihnen das Buch gefallen haben, empfeh-len Sie es Ihren Freunden. Und vielen Dank, dass Sie es gelesen haben. BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenKapitel 1
Eines war so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn in München Wies‘n war, was eigentlich Oktoberfest heißen soll, war Herbert Wengler bei seiner Cousine in Aschau. Und das schon seit vielen Jahren. Es war eine ruhige Zeit, dort draußen auf dem Land, da die meisten eben in München zum Dauerbesäufnis waren. Es gab natürlich auch Leute, die von dort aus in die Stadt fuhren. Eine S-Bahn nahm sie morgens dorthin mit und brachte sie spät abends wieder nach Aschau. Die Bahn fuhr eigentlich jeden Tag, also nicht nur zur Wies‘n, aber um diese Zeit war sie immer ein bisschen voller als normal. Und sie fuhr später nach Hause. Auch war sie lauter, wegen denen, die immer noch die Lieder sangen, die sie gerade im Bierzelt gelernt hatten. Es waren einfache Lieder. Zwei Sätze. Die konnte man gut behalten. Fast zwei Stunden dauerte das Vergnügen, sich mit den Betrunkenen einen Platz zu teilen und durch das bayerische Oberland zu reisen. Die meisten sahen allerdings nichts von der Schönheit der Landschaft, wenn sie wieder Richtung Süden fuhren, da es erstens dunkel war und sie zweitens die Augen nicht mehr aufbekamen.
Das galt für die Leute, die in der Gegend wohnten oder sich ein Zimmer gebucht hatten, da Unterkünfte in München entweder nicht zu haben oder so teuer waren, dass man sich dafür eine Reise in die Seychellen hätte leisten können. Mit Sonne, weißem Sandstrand und einer leichten Brise vom Meer, die ein bisschen Kühlung brachte, wenn man im Liegestuhl seinen Cocktail schlürfte. Aber nein, diese Leute mussten in stinkende Bierzelte gehen, warmes Bier in sich hineinschütten, mit den anderen grölen, bis die Stimme versagte und fröhlich auf den Tischen tanzen. Sie wollten unbedingt ihr schwer verdientes Geld in Bier und verbrannten Schweinebraten umsetzen und dabei immer wieder Prosit singen, bis ihnen der Maßkrug aus der Hand fiel und sie selbst in sich zusammenbrachen. Dann fand man sie hinter dem Zelt, wo sie sich, mit einer Hand an der Zeltwand abstützend, auf den ehemals grünen Rasen durch die obere Lade entleerten. Nur um dann wieder von vorne anfangen zu können alles dort wieder hineinzuschütten.
Aber genau das machte Herbert Wengler eben nicht. Er blieb bei seiner Cousine. Sie freute sich, ihn zu sehen, und er hatte seine göttliche Ruhe. Nichts von dem Trubel drang in diese Gegend. Wüsste man nicht, was ein paar Kilometer nördlich vor sich ging, hätte man gedacht, dass das nur eine dumme Erzählung wäre, um die Leute neugierig zu machen. War es aber nicht. Das wussten er und alle anderen, die ihre Ruhe dort genossen.
Der Stress im Kommissariat war zwar während des Restes des Jahres auch nicht unbedingt unerträglich, da er ihn nicht an sich herankommen ließ, aber es ging doch nichts über die absolute Stille der Wiesen und Felder um die Pension seiner Cousine. Was gab es Schöneres, dachte er sich immer, als morgens mit einer Tasse Kaffee auf dem Balkon zu stehen und den Kühen beim Grasen zuzusehen.
Wo er konnte, half er aus. Es gab immer etwas zu reparieren. Auch wenn er nicht gerade meisterliche Fähigkeiten hatte, es reichte immerhin für den Großteil der Probleme.
Das Wetter war meistens beständig schön um diese Zeit. Die Sonne kam morgens über die Berge und verzauberte die Landschaft in ein goldenes Paradies. Die Blätter, die noch an den Bäumen waren, strahlten in allen erdenklichen Farben. So schön kann der Tod sein, dachte sich Herbert Wengler, wenn er es in sich aufnahm, den Geruch tief einsog und die leichte Kühle an seine Haut ließ. Es dauerte weit in den späten Vormittag, bis die Schatten sich zurückgezogen hatten und die Sonne das Regiment übernahm. So war das in den Bergen, besonders im Herbst und Winter.
Ende September waren die Felder geerntet, die Wiesen wurden noch ein letztes Mal geschnitten und das Heu in die Schober gefahren. Wenn er durch die Wiesen auf den Wegen am Bach spazieren ging, konnte er das getrocknete Gras riechen, was ihn immer wieder an seine Kindheit erinnerte. Damals wurde das Heu noch mit der großen Gabel auf Leiterwägen gehievt, die dann von zwei Ochsen in den Hof gezogen wurden. Die Kinder durften, wenn man wieder Richtung Tenne fuhr, dann obenauf sitzen und sich die Welt von dort aus ansehen. Den Geruch hatte er nie vergessen. Er war eingebrannt in sein Gedächtnis, wie so vieles aus seiner Kindheit.
Morgens also, wenn er aufstand, war sein erster Gang auf den kleinen Balkon, den er an seinem Zimmer hatte. Er öffnete die schmale Tür, stemmte sich gegen den Rahmen und atmete erst einmal ein. Dort stand er dann, holte tief Luft und genoss die kühle Feuchtigkeit, die er langsam und bedächtig durch seine Lungen sog. Um diese Zeit roch es nach feuchtem Gras, nach Dung und frischem Kaffee, der von unten durch das Treppenhaus nach oben zog.
Meist war um diese Jahreszeit niedriger Nebel auf den Wiesen, der die Beine der Kühe, die dort ruhig standen, mit ihrem Maul ständig malmend auf die Sonne warteten, unsichtbar werden ließ. Ein seltsames Bild, da man denken konnte, sie würden schweben. Manchmal muhten sie, was ihre Köpfe in die Höhe gehen und die kleinen Glocken klingen ließ, die man ihnen umgehängt hatte. Die Tiere gehörten nicht seiner Cousine. Das hatte sie schon lange aufgegeben. Es war zwar einmal ein Hof, aber die Scheune und das Wohnhaus hatte man vor vielen Jahren als Pension umgebaut. Die Wiesen waren verpachtet. Ihre Gäste liebten es, wenn sie nach draußen gingen, sich an den Zaun stellten und die Kühe auf sie zukamen. Dann fassten sie ihre Schnauzen an und konnten spüren, wie weich, warm, feucht und sanft sie waren. Etwas, was man nur erfahren kann, wenn man es einmal erlebt hatte. Auch Herbert Wengler liebte es, einer Kuh über das Maul zu streicheln. Allerdings immer nur mit einem Zaun dazwischen.
Nach seiner Atemübung jeden Morgen gab es dann Kaffee und ein ausgiebiges Frühstück. Wenn er dann noch die Zeitung gelesen hatte, ging er langsam am Bach entlang in den Ort hinein. Er kannte die Einheimischen, und sie kannten ihn. Die vielen Jahre, die er bereits dort verbracht hatte, machten ihn zum Teil der hiesigen Gesellschaft. Er liebte es, seine Lederhosen und das weiße Hemd mit den Blumen an der Knopfleiste anzuziehen, seine schwere, graue Filzjacke überzuwerfen und den Hut mit dem Gamsbart aufzusetzen. Niemand schaute ihn deswegen von der Seite an oder hatte irgendeine dumme Bemerkung. Im Gegenteil. Man betrachtete es mit Wohlwollen. Es war einfach so üblich. Jeder tat es. Zumindest jeder, der dort aufgewachsen war. Dann traf man sich im Ratskeller und diskutierte die Probleme der Welt. Man nannte ihn den Inspektor, und das mit gebührendem Respekt. Man wusste, was er in der Stadt tat, wenn Herbert Wengler auch selten darüber sprechen wollte. Außer man hatte in der Zeitung gelesen, dass ein gewisser Kommissar Herbert W. wieder einmal einen Fall aufgeklärt hatte. Dann musste man natürlich wissen, wer dieser ominöse Kommissar W. war. Nicht ohne Stolz bestätigte er, dass es wirklich er war. Allerdings war das nicht ohne finanzielle Auswirkungen. Er musste dann einen ausgeben. Eine Runde Bier für alle, obwohl er sich immer wieder beschwerte, dass es eigentlich umgekehrt sein sollte.
Der Hauptgrund allerdings in die Wirtschaft zu gehen, war natürlich das Kartenspielen. Schafkopf, nichts anderes. Man spielte nur Schafkopf. Es gab sogar einmal, vor vielen Jahren, eine bayerische Meisterschaft in Aschau. Die trug man in der Turnhalle der Realschule aus, da sich mehr als zweihundert Leute aus ganz Deutschland gemeldet hatten. Na ja, Deutschland wäre wohl etwas übertrieben, da der nördlichste Teilnehmer aus Ingolstadt kam, aber immerhin. Der Egerwirt aus dem Ort hatte extra einen großen Schanktisch aufgebaut und versorgte die Spieler mit genug Bier, um sie nicht verdursten zu lassen. Täglich wurden mehrere Fässer angefahren, die man mit viel Gebrüll dann in die Halle rollte. Bier war übrigens auch nötig, um in die richtige Stimmung zu kommen und dann das Spiel gewinnen zu können. Aber das zu erklären, würde den Rahmen dieser Geschichte sprengen. Es war einfach so und damit sollte man sich begnügen.
Der Hauptpreis war eine lebende Sau, die ständig grunzend neben der Halle auf ihr Schicksal wartete. Natürlich wusste sie nicht, warum man ihr dort einen kleinen Stall gebaut hatte und sie jeden Tag mit dem besten Futter verwöhnte, aber das war vielleicht auch gut so. Als entschieden war, wer denn gewonnen hatte, wurde für die Regionalzeitung und den bayerischen Schafkopfverband noch ein letztes Foto mit der Sau gemacht, die noch ein buntes Band mit einer Rosette um den Hals gebunden bekam. Dann ging es mit Gegröle zum Hinterhofer Hannes. Das war der Metzger des Ortes zu dieser Zeit. Eine Woche später war das Fleisch verpackt, geräuchert oder gepökelt und konnte abgeholt werden.
Herbert Wengler erinnerte sich oft an dieses Turnier, da er damals auch seine Freunde, den Schäfer Franz aus Giesing und den Hintermeier Georg aus der Glockenbachstraße eingeladen hatte, mit denen er allerdings fast auf einem der letzten Plätze gelandet war. Das wurde noch für Wochen, auch als sie schon lange wieder in München waren, heiß diskutiert. Sie meinten eben, dass die Leute da draußen auf dem Land zusammenhalten würden und man keine Chance gehabt hätte, auch nur einen Blumentopf zu gewinnen. Dass die vom Land ganz einfach mehr spielten und damit auch die besseren Spieler waren, kam den beiden natürlich nicht in den Sinn.
Aber das war lange her. Und Turniere hatten sowohl Herbert Wengler als auch seine Freunde nie mehr wieder gespielt. Jedenfalls nicht zusammen. Sie hatten sich darauf geeinigt, um die Freundschaft nicht zu gefährden.
Es war ein Samstag, an dem diese Geschichte anfing. Das letzte Wochenende, an dem sich Kommissar Wengler noch der Abgeschiedenheit und Schönheit des oberbayerischen Voralpenlandes hingeben konnte. Der Himmel meinte es gut mit ihm und seinen Mitbürgern. Leichte Föhnwolken kamen von Süden her über die Berge, die im Sonnenlicht leuchteten. Man hatte einen frühen Winter angesagt, aber der ließ Gott sei Dank noch auf sich warten. Der bayerische Wettergott hatte oft ein Einsehen und gab den Menschen, die in seinem Machtbereich lebten, noch ein paar Tage Sonne, Wärme und allen Grund, ein Bier im Garten zu trinken. Außer denen, die wegen des Föhns dachten, ihr Kopf würde jeden Moment zerspringen.
Kapitel 2
Es war schon weit nach Mitternacht an diesem Samstag, dem letzten des Oktoberfestes. Morgen gäbe es noch einen Tag, und dann würden die Fahrgeschäfte, die Wurst- und Hähnchenbuden, die Fischsemmelbuden, die Karusselle und die Bierzelte wieder schließen und abgebaut. Die Bierzelte würden verstaut werden und darauf warten, dass ein ganzes Jahr wieder vorbei geht. Die Karussells treten eine Reise an, die sie im Kreis durch alle Länder des Kontinents führten, um dann wieder am Ausgangspunkt anzukommen.
Für ein ganzes Jahr wird wieder totale Leere sein auf der Theresienwiese. Wie ein tristes, braches Feld würde sie daliegen, und wenn man nicht wüsste, wozu das Areal einmal im Jahr für zwei Wochen gebraucht wird, könnte man meinen, man hätte den Platz vergessen. Den Rest des Jahres war es sicher nicht schön, dieses Feld aus zerbrochenem Beton, kahlen Wiesenresten und grauen Teerstreifen. Kümmerliche, abgetretene Rasenstücke, unterbrochen von schmutzigen Wegen, aufgeteilt in gleich große Parzellen. Vereinzelt gingen um diese Zeit Leute mit ihren Hunden spazieren, Tauben versammelten sich und Radfahrer nutzten ihn als Abkürzung durch die Stadt. Wenn man morgens an einem Novembertag dort hingeht, sieht man nichts als Tristesse, schwachen Bodennebel und Pfützen, in denen sich der graue Himmel spiegelt. Sogar die im Sommer grünen Wiesenreste sind nur noch braun und schmutzig. Ein trauriger Anblick, der nur durch diese zwei Wochen etwas aufgehellt wird. Dann erwacht der Platz für ein paar Stunden am Tag zum Leben. Wenn es dann dunkel wird, ergießt sich ein Lichtermeer über den Platz, das fast die ganze Stadt erleuchtet. Kakophonie überdeckt jedes natürliche Geräusch. Es riecht nach gebrannten Mandeln, der Fischbraterei, dem Ochsen am Spieß und vor allem nach abgestandenem Bier.
Auch für Gregor Wader war es der letzte Tag, an dem er sich auslassen konnte, wie er wollte. Morgen, am Sonntag, würde er den ganzen Tag brauchen, um wieder einigermaßen in die Reihe zu kommen, damit er am Montag seinen Dienst versehen konnte. Er war Wachmann in der Firma Scheiter und Söhne, einem Betrieb in Freimann, der Kunststoffteile für die Automobilindustrie herstellte. Nicht dass das wichtig für die Geschichte wäre, aber es sollte dennoch erwähnt werden.
Gregor Wader war gerade einmal etwas über dreißig, ledig, und er hatte ein Problem. Das Bier. Eigentlich hatte er mehrere Probleme, wie Aggressivität, Spielleidenschaft und Unzuverlässigkeit, nur um die wichtigsten zu nennen. Diese lästigen Schwierigkeiten zusammengefasst, machte sein Leben nicht gerade einfacher. Er wusste das, wollte es auch immer wieder ändern, aber wie das Leben so spielte, hatte er nur wenig Macht über sich selbst. Das war wenigstens seine gängigste Ausrede, dass er eben nichts dafür und auch nichts dagegen unternehmen konnte. Wenn er Durst hatte, musste er sich diesen eben mit Bier löschen. Wasser oder ähnliche Ersatzmittel waren nicht in seinem Arsenal zu finden, was wiederum seine nicht so guten Merkmale zur Geltung kommen ließ. Oft landete er dann in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers seines Wohnsitzes.
An diesem Samstagabend, es war eigentlich schon fast Sonntagfrüh, ging er über eine verlassene Wiesn, auf der Hauptstraße, die sich von Nord nach Süd am Platz dahinzog, zur U-Bahn-Station Theresienwiese. Er war im Hofbräu-Festzelt, ging Richtung Norden am Löwenbräu und der Fischer-Vroni vorbei zum Ausgang. Nur wenige Menschen waren um diese Zeit noch unterwegs. Ein paar sichtlich verloren gegangene Paare, die ineinander hingen, damit sie überhaupt einigermaßen aufrecht blieben. Ständig mussten sie anhalten, um sich zu umarmen und abzuküssen. Oder einer von den beiden musste einmal kurz in die Büsche. Dann gab es noch die Polizisten, die langsam durch die Straße schlenderten und jedem sagten, dass jetzt Schluss sei und sie nach Hause gehen sollten. Als ob das nicht jeder selbst sehen würde. Man blickte sie nur müde lächelnd an und ging seiner Wege. Ein paar grölende Jugendliche, die sich kaum aufrecht halten konnten und ständig lachten, machten sich einen Spaß daraus, andere anzurempeln, nur um sich dann großartig mit ausladenden Verbeugungen zu entschuldigen. Das gehörte zum Spiel. Wenn dann einer etwas sagte, konnte es schon sein, dass man ihm eine ins Gesicht schlug. Auch das war oft Teil des Dramas. Alle wussten das, also ließ man sie in Ruhe.
Luftballone stiegen in den schwarzen Himmel, um dort in die Unendlichkeit zu verschwinden. Gregor Wader sah einem nach und dachte sich, wie schön es wäre, auch in die Höhen zu entfliehen. Einfach nach oben, bis man keine Luft mehr bekam. Als er in den dunklen Himmel sah, blinkten ein paar Sterne, die er im Meer der bunten Lampen um ihn herum gerade noch erkennen konnte. Vielleicht lag es daran, dass die Lichter immer weniger wurden. Ein Geschäft nach dem anderen schaltete die Musik und die Beleuchtung aus, hängte Planen um die Gestelle, zurrte Seile fest, damit sie nicht weggeblasen werden konnten. Noch ein Tag, dann musste man alles einpacken und in die weite Welt ziehen. Wo immer das war.
Einmal war er im bayerischen Wald, da er dort eine Großtante hatte, die plötzlich gestorben war, und er zum Begräbnis hinfuhr. Er kannte sie fast nicht, aber der Onkel, der Sohn der Großtante, war einmal geschäftlich in München und hatte ihn kontaktiert. Sie hatten zusammen eine Bierreise gemacht, die ein ganzes Wochenende gedauert hatte. Dabei sind sie sich näher gekommen, also hat er ihn zum Begräbnis eingeladen.
Es war ein feuchtes Unterfangen. Nach der üblichen Beisetzung und den überschwänglichen Reden von der Einzigartigkeit dieser Frau begab sich die Gesellschaft in die Dorfkneipe, in der schon ein Büfett aufgebaut war. Es gab belegte Brote mit selbst geräuchertem niederbayerischem Schinken, ölige verbrannte Hamburger und abgestandenen Kartoffelsalat. Und Bier. Viel Bier und selbst gebrannten Schnaps.
Er erinnerte sich nicht an viel, aber an den unheimlich dunklen schwarzen Himmel dort. Er stand mitten in der Nacht auf, um auf die Toilette zu gehen, und wankte danach auf den Balkon, der an seinem Zimmer angebaut war, das er in der Kneipe für die Nacht bekommen hatte. Er wusste damals nicht warum, aber als er dort stand und nach oben blickte, sah er nichts als Sterne. Millionen von Sternen. So viel hatte er noch nie gesehen, in seinem ganzen Leben. Er war in der Stadt aufgewachsen, also waren ihm viele Dinge, die es in der freien Natur gab, nicht geläufig. Er konnte es gar nicht glauben, wie viele es von diesen leuchtenden Punkten am Firmament gab. Eine ganze Weile stand er nur da und staunte. Als er das am nächsten Morgen am Frühstückstisch erzählte, sahen ihn alle entgeistert an und dachten, er sei noch betrunken. Also zuckte er nur mit den Schultern und beließ es dabei. Nur vergessen hatte er das nie.
Langsam wurden es immer weniger Leute, denen er auf seinem Weg zur U-Bahn ausweichen musste. Er begegnete den letzten der Betrunkenen, die eben nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden hatten, nach Hause zu gehen, die ihn nur kurz ansahen und dann an ihm vorbeigingen. Es wurde leer. Ein paar, die es nicht mehr schafften, hatten sich einfach am Rand der Bierzelte niedergelegt und wollten schlafen. Ein Sanitätswagen fuhr langsam auf und ab und sammelte diese Bierleichen, wie man sie nannte, ein. Dann brachte man sie in ein Zelt mit einem roten Kreuz darauf und legte sie auf eine Pritsche, damit sie ihren Rausch ausschlafen konnten. Die Sanitäter hatten sicher noch ein paar Stunden zu tun, wenn man sich so umblickte.
Kapitel 3
Armin Staller saß gerade am Schreibtisch und ordnete die Akten des letzten Falles. Es war ein einfacher Fall gewesen, den er zu klären hatte. Kommissar Wengler war selbstverständlich zu dieser Zeit nicht im Büro, da er, wie er Armin sagte, lieber kündigen würde als die Oktoberfestzeit in München zu verbringen. Alle wussten das, auch sein Vorgesetzter, der Oberkriminalrat Hubert Hauser. Wenn er allerdings etwas nicht wusste, oder einen Rat brauchte, konnte er ihn selbstverständlich anrufen. Dort in Aschau. Am Land. Wo die Welt noch in Ordnung war. Armin Staller wusste aus Erfahrung, dass er besser nicht anrufen sollte, also ließ er es und hoffte, dass niemand in den zwei Wochen zu Schaden kam. Nur war es besonders in dieser Zeit, in der Tausende von überall herkamen und einige davon die Stadt unsicher machten, ein großes Glück, wenn nichts Aufregendes passierte.
Er hatte Glück. Es gab nur einen kleinen Mord, in der Nähe des Marienplatzes. Nun, Morde waren eigentlich nie klein, aber in diesem Sinne war es offensichtlich, wer die Tat begangen hatte.
Es war der letzte Donnerstag, eigentlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Armin war gerade nach Hause gekommen, hatte sich noch ein paar Brote mit Mettwurst geschmiert, Essiggurken daraufgelegt und wollte sich ganz einfach hinsetzen und etwas fernsehen. Kaum hatte er gesessen, klingelte sein Handy. Die Bereitschaft war am Telefon und meinte, er solle doch bitte zum Marienhof kommen, da läge jemand, „der sich nicht mehr rühren tät“, wie der diensthabende Beamte in blumiger Sprache erklärte. Also setzte er sich in sein Auto und kam dort an, als schon alle anderen um den Schauplatz herumstanden.
Dr. Brunner von der Gerichtsmedizin war über den Toten gebeugt. Klaus Mergentheimer von der Spurensicherung stand am Rande und schaute sich um. Als sie ihn dort stehen sahen, sagte Dr. Mergentheimer:
„Guten Abend, Herr Staller. Wo ist Ihr Chef? Sollen wir noch warten, bis er kommt, oder dürfen wir schon aufräumen?“
„Wenn Sie mir sagen, was hier los ist, können Sie machen, was Sie wollen, da mein Chef, wie Sie sicher wissen, nicht in der Nähe ist. Außer Sie wollen hier noch fast eine Woche herumstehen und sich die Gegend ansehen.“
„Richtig, der is ja geflüchtet. Hätt ich ja fast vergessen. Nur seine Hoffnung, dass hier in seiner doch so lieben Stadt ja kein Mord begangen wird solang er nicht da ist, hat sich nicht erfüllt. Ja, Herr Staller, dann müssen’s des heut selber machen“, meinte Herr Mergentheimer.
Armin Staller stand zwischen den beiden und sah einen nach dem anderen an. Sie lächelten, also meinten sie es nicht so. Herbert Wengler war und ist eben eine Institution, an der man nicht vorbeikam, auch wenn er einmal nicht da war. Auch wenn man ihn nicht sah, war er doch irgendwie immer anwesend.
„Also, was haben wir?“
„Erst einmal haben wir einen Toten“, meinte Dr. Brunner gewichtig und überaus tragisch.
„Etwa Mitte dreißig, schlank, gut durchtrainiert, augenscheinlich gesund. Er hat nur leider ein Messer im Rücken, was ihm nicht besonders gutgetan hat. Todeszeitpunkt circa vor einer Stunde.“
„Und wer hat den Toten gemeldet?“
Dabei sah sich Armin in der Runde um, die hauptsächlich aus uniformierten Polizisten und Reportern bestand, die pausenlos Bilder machten. Das normale Volk stand in gewissem Abstand, schaute kurz, wer da lag, und ging wieder weiter. Er hörte aufgeregte Stimmen, die nicht in deutscher Sprache waren, kurze spitze Aufschreie von jungen Mädchen, die sich die Hand vor den Mund hielten. Ansonsten war es relativ ruhig. Wie eine Stadt eben um diese Zeit immer ruhiger zu werden schien, wenn langsam die Lichter ausgingen und die letzten U-Bahnen fuhren.
Einer der Polizisten, die um ihn herumstanden, es war Kurt Rösner, hob seine Hand und meinte, da könne er was zu sagen.
„Gut, Herr Wachtmeister, dann erzählen Sie doch einmal, was hier los ist.“
Kurt Rösner sah sich um, ging auf Armin zu und fing an zu erzählen.
„Also, als wir den Anruf bekommen ham, da von der Zentrale, sind wir sofort hierher, weil wir ja eh in der Näh war’n. Keine paar hundert Meter weg, da am Paulaner. Leut waren um den rum g’lungert, die wir erst amal ham wegscheuchen müssen. Nur einer is nicht ’gangen, der war da nur g’standen und hat g’schaut. Immer hat er auf den Toten g’schaut, als würd er den kennen. Dann bin ich hin zu dem und hab ihn g’fragt, ob er den kennt, der da liegt. Nein, hat er g’sagt, er hat nur noch nie an Toten g’sehn. Aber ganz rot war er im G’sicht, und leise hat er g’redt, dass ich ihn fast nicht verstanden hätt. Ja, Herr Kommissar, des hab ich nicht geglaubt, weil ich hab da schon a bisser’l Erfahrung, müssen’s wissen. Also hab ich g’sagt, Erwin, des is mein Kollege, schau dass der nicht die Fliege macht. Kaum hab ich des g’sagt, wollt der auch schon weglaufen. Grad hat er ihn noch am Ärmel erwischt und festg’halten.“
„Aha, und wo ist der Mann jetzt?“
„Ja, den hamma ins Auto g’setzt, weil wir auf Sie ham warten wollen.“
„Gut, dann schauen wir uns diesen Herrn doch einmal an.“
Kurt Rösner ging voraus, Armin Staller hinter ihm her. Am Auto angekommen, sah er den Mann, der auf der Rückbank zusammengekauert saß und auf den Boden starrte. Seine dunkle Jacke war verschmutzt, die braune Hose ebenso. Die Schuhe waren abgetreten und alt.
Armin stand nun neben der Tür, die von innen verriegelt war, und öffnete sie. Der Mann blickte ihn von unten an.
„Wie ist Ihr Name, bitte?“, fragte Armin ihn.
Der Mann lächelte ein wenig und starrte wieder auf den Boden.
„Haben Sie Papiere dabei?“
Wieder reagierte der Mann nicht auf die Frage.
„Gut, Herr Rösner, fahren Sie ihn auf die Wache. Ich werde mich mit ihm dort unterhalten.“
Damit ging Armin wieder zum Tatort und sah sich um. Inzwischen waren wieder die üblichen Zelte aufgestellt, Lampen installiert, die die Nacht zum Tage machten. Eine Truppe in weißen Overalls war damit beschäftigt, Bilder zu machen und alle möglichen Gegenstände in Plastiktüten zu verpacken. Die normale Prozedur in solchen Fällen. Die Menschenmenge hatte sich, bis auf wenige Unermüdliche, verlaufen. Auch die Presse war wieder ihrer Wege gegangen. Sie mussten den Fall in die Morgenausgabe bringen, auch wenn sie nicht wussten, worum es in diesem Fall ging. Wie meistens würden sie eben schreiben, was ihnen so einfiel. Wenn es nicht stimmte, konnte man es in der nächsten Ausgabe berichtigen.
Es war also wieder ruhig geworden. Gerade waren zwei Leute dabei, den Toten in einen Blechsarg zu legen. Sie würden ihn in die Gerichtsmedizin fahren. Dr. Brunner verabschiedete sich von Armin und meinte, morgen früh wisse er mehr. Da sonst nichts mehr für Armin Staller zu tun war, verabschiedete auch er sich und fuhr in die Ettstraße.
Im Präsidium angekommen, wartete der Mann, den man am Tatort festgenommen hatte, bereits vor seinem Büro. Kurt Rösner saß neben ihm und passte auf, dass er nicht wieder das Weite suchte. Armin ging an ihnen vorbei und bedeutete den beiden, dass sie ihm folgen sollten. Was sie taten. Dann setzte sich der Mann hin, Kurt Rösner stand in der Tür.
Armin schaltete den Computer ein und nahm sich Zeit, seine übliche Routine durchzugehen. Das hatte er von seinem Chef gelernt. Wenn Leute nicht reden wollten, dauerte es immer ein wenig, bis sie sich anders entscheiden würden. Früher oder später hatte noch jeder geredet. Es war nur eine Frage der Zeit. Man sollte seinem Gegenüber die Möglichkeit geben, sich zu entspannen und nachzudenken. Manche brauchten das, warum auch immer.
Als Armin in seinem Stuhl saß und ein bisschen am Computer herumgearbeitet hatte, lehnte er sich in seinem Stuhl zurück, und sah sich den Mann an. Sein Gegenüber fing an zu schwitzen. Kleine Rinnsale liefen ihm an den Wangen seitlich herunter und tropften auf seine Hose. Er wischte sich den Schweiß mit dem Handrücken ab so gut er konnte.
„Also, erzählen Sie mir, was passiert ist. Ich höre zu.“
Der Mann sah ihn an und lächelte wieder.
„Des war eine Sau, war des. Erst hat er g’sagt, dass ich mitgeh’n soll, und dann hat er g’sagt, dass des nur ein Witz war, weil er mit solche wie mir net mitgeh’n würd. Solche wie mir, hat er g’sagt. Was des heißen soll, hab ich ihn g’fragt. Dann hat er g’lacht, als wär des der Witz der Woche g’wesen. Z’erst hamma g’soffen auf der Wiesn, ich hab alles ’zahlt und dann wollte er noch bei sich was trinken. Am Marienplatz sind wir ausg’stiegen, und er is einfach von mir wegg’laufen. Ich ihm nach, aber er hat nur g’schrien, das ich ihn in Ruh lassen soll. Dann hab ich ihn eing’holt und festg’halten. Ich wollt ja nur, dass er mit mir redt. Dann hat er mich g’schlagen, ich hab mich nur g’wehrt. Des war Notwehr, Herr Kommissar. Nur Notwehr, des müssen’s mir glauben.“
„Und dann haben Sie ihm ein Messer in den Rücken gestoßen. Woher hatten Sie das Messer?“
Der Mann sah ihn wieder an und lächelte. Es war ein seltsames Lächeln. Eines, das irgendwie nicht von dieser Welt war. Armin hatte das Gefühl, dass der Mann irgendwie neben sich stand. Nicht wusste, was oder wo er war. Dann schaukelte er auf dem Stuhl von vorne nach hinten.
„Des hab ich immer dabei, wenn ich auf die Wiesn geh. Heut weiß man ja nicht mehr, wen das ma da trifft.“
„Ja, das glaube ich. Zum Beispiel solche Leute wie Sie.“
„Wie meinen's des?“
Armin ging nicht darauf ein. Er wusste, es machte keinen Sinn.
„Also, Sie haben ihm das Messer in den Rücken gestoßen. Und was war dann?“
„Ja, dann is die Polizei ’kommen. Des war alles.“
Armin sah den Wachtmeister an, der immer noch in der Tür stand.
„Herr ...“
„Rösner, Kurt Rösner, Herr Kommissar.“
„Ja, Herr Rösner, nehmen Sie bitte den Herrn mit. Nehmen Sie die Personalien auf, Erkennungsdienst und die üblichen Sachen, und dann bitte in die Zelle. Morgen früh möchte ich ihn dann noch einmal sehen. Fürs Protokoll.“
Der Mann war in sich zusammengesunken, starrte wieder nur auf den Boden, wie im Auto.
„Sagen Sie mir jetzt, wie Sie heißen?“, fragte ihn Armin.
Er blickte auf und antwortete er hieße Zorro, wobei er wieder lächelte. Dabei öffnete er den Mund, sodass Armin das erste Mal seine schwarzen Zähne genau sehen konnte. Oder das, was davon übriggeblieben war.
Armin nickte leicht mit dem Kopf, als er Kurt Rösner ansah, was bedeutete, dass es genug sei und er ihn mitnehmen konnte. So verließ Zorro mit dem Wachtmeister, der ihm mittlerweile die Handschellen angelegt hatte, das Büro. Armin schrieb noch auf, was der Mann gesagt hatte, schaltete seinen Computer aus und ging endlich nach Hause. Wenn die Sonne aufging, war es Freitag, und danach Samstag, mit dem folgenden Sonntag ein Tag der Ruhe. Morgen würde er sich dann weiter um den Fall kümmern, der sich mehr oder weniger von selbst gelöst hatte. Am Wochenende aber wollte er die warmen Spätherbsttage genießen, die kommen sollten. Der Wetterbericht hatte Föhn angesagt, der die grauen Wolken einfach nach Norden schicken und den Münchnern einen blauen Himmel schenken würde. Nicht an Tote oder Morde denken, nur in den Englischen Garten gehen und dort in Ruhe ein Bier trinken. Die meisten Leute wären ohnehin noch auf dem Oktoberfest, von dem er, wie sein Chef, auch überhaupt nichts hielt.
Kapitel 4
Armin saß gerade am Frühstückstisch und hatte sich eine Semmel mit Erdbeermarmelade gemacht, als das Telefon klingelte. Die Marmelade kam von seiner Mutter. Eine Art Care-Paket aus Köln. Sie machte sich Sorgen um ihren Sohn, der dort unten war, so weit weg. Besonders, da er noch nicht einmal eine Frau hatte, die sich um ihn kümmerte. Dass Frauen das heutzutage nicht mehr taten, kam ihr nicht in den Sinn. Wenn sie davon las, konnte sie es nicht verstehen, aber sie meinte zu sich selbst, dass ihre Mutter sie auch nicht verstanden hatte.
„Nein“, sagte er zu sich selbst, „bitte nicht wieder ein Mord. Heute ist Sonntag und die Sonne strahlt.“
Es half nichts. Er sah auf das Display und wusste, wer es war. Die Bereitschaft.
„Herr Staller?“
„Ja, am Apparat. Was gibt es an diesem so schönen Tag?“
„Ein anonymer Anruf. In einer Wohnung am Gärtnerplatz soll jemand tot in einer Wohnung liegen. Genaues wissen wir noch nicht, aber die Streife ist schon unterwegs.“
„Und warum rufen Sie dann mich an, wenn Sie noch nicht einmal wissen, was los ist? Es ist vielleicht jemand gestorben, wie Leute jeden Tag ganz einfach sterben. Und einer soll sogar einmal gesagt haben, dass das gar nicht so schlimm sein soll, da das ja schließlich alle machen.“
Das sollte ein kleiner Scherz sein, zur Auflockerung der Stimmung, da die Stimme des Anrufers nicht sehr fröhlich klang. Es hatte nicht den gewünschten Zweck erfüllt.
„Nein, Herr Staller, der Anrufer hat g’meint, dass da viel Blut wär, und der Täter, der scheinbar jemanden erstochen hat, noch daneben liegen würd. Des sieht also nicht aus wie ein natürlicher Tod. Und wenn wir uns beeilen würden, könnten wir den gleich mitnehmen, hat er noch g’sagt.“
Noch eine Messerstecherei, dachte sich Armin. Was war nur los in dieser Stadt? Zwei Messerstichfälle in einer Woche.
„Sind’s noch dran, Herr Staller?“, fragte der wachhabende Polizist am anderen Ende der Leitung, da Armin Staller nichts sagte.
„Ja, ja, ich bin noch da. Geben Sie mir die Adresse durch. Ich schau mir das an. Und rufen sie bitte die Kollegen an, dass die dann auch kommen.“
„Mach ich, Herr Kommissar.“
Damit legte sein Gegenüber auf. Wenige Minuten später kam die Textnachricht mit der Adresse. Armin ging zurück zu seiner Semmel und genoss erst einmal noch sein Frühstück. Tote konnten ein bisschen warten, die hatten es nicht mehr eilig.
Die Sonne stand schon halbhoch am Himmel. Um diese Jahreszeit hatte sie Mühe, sich nach oben zu arbeiten, und blieb immer nur in der Hälfte des Horizonts stehen. Die Schatten waren in diesen Monaten deswegen auch immer ein bisschen länger. Ein Vorzeichen des Winters, den man nicht herbeisehnte, der aber dennoch bestimmt und mit Kraft unaufhaltsam auf die Menschen und Natur zukam.
Von seinem Fenster sah er in einen Innenhof, in dem ein kleiner Baum in einem winzigen Stück brauner Erde stand. Darum herum gab es nur Tonnen in verschiedenen Farben. Rot, grün, blau, grau. Jede für etwas anderes, was man erst nach Hause geschleppt hatte und dann wieder entsorgen musste. Die Menschen machten immer mehr Müll, schien es. Früher gab es für jeden Hauseingang eine Tonne. Und das musste reichen.
Er öffnete das Fenster, um zu sehen, wie warm oder kalt es war und ob er eine Jacke brauchte. Es war Oktober, also war das eigentlich keine Frage, aber man konnte ja träumen. Immerhin schien die Sonne. Und nach dem Einsatz wollte er in den Englischen Garten. Ob Mord oder nicht.
Nachdem er alles aufgeräumt hatte, ging er zum Auto, das vor seinem Haus geparkt stand, gab die Adresse in sein Navi ein und fuhr langsam los. Es war nichts los auf den Straßen. Sonntag war ein ruhiger Tag in diesem Viertel, wo meist nur Menschen lebten, die jeden Morgen von Montag bis Freitag zur Arbeit mussten. Man sah nur ein paar Leute mit ihren Hunden spazieren gehen. Sie blickten sich immer ein wenig verschämt um, wenn das Tier stehen blieb, um sein Geschäft zu machen.
Der Wind trieb Blätter und alte Papiertaschentücher vor sich her, die sich in den wenigen Bäumchen, die man gepflanzt hatte, verfingen. Da man den mickrigen Stämmchen mit den dünnen Zweigen nicht sehr viel Erde gelassen hatte, um groß zu werden, sahen sie kümmerlich und krank aus. Vielleicht lag es daran, dass alle Blätter fehlten. Nur im Sommer gaben sie auch nicht viel mehr her. Es lag also vielleicht doch an der Lage.
An der Ecke war ein Café, in dem um diese Zeit bereits viel Betrieb herrschte. Auch er setzte sich dort oft hin. Es gab dort interessante Menschen zu beobachten. Meist junge Leute, die vergessen hatten, älter zu werden. Sie meinten, wenn sie sich die Haare seitlich abrasierten und die andere Seite in voller Pracht stehen ließen, dem Trend gerecht zu werden und damit dazuzugehören. Dabei vergaßen sie, dass man das Alter nicht wegrasieren konnte. Es blieb einem ins Gesicht geschrieben, da konnte man machen, was man wollte.
Frauen saßen oft dort, in ihre Laptops versunken, an irgendeinem Gemüse kauend. Meistens Karotten oder Sellerie. Sie hatten fast alle Tätowierungen an den Armen, am Hals, an den Beinen. Vielleicht auch noch an anderen Stellen, die man allerdings in diesem Umfeld nicht zu sehen bekam. Er wunderte sich immer, wo dieser Trend herkam. Früher gab es das nicht. Fast jede Frau in dieser Gegend kam nicht mehr ohne Bilder auf ihrer Haut aus. Er selbst war sicher irgendwie voreingenommen, aber wünschte sich, dass es noch welche ohne Malerei gab. Er stellte sich nur vor, wie seine Mutter darauf reagieren würde, sollte er jemals so eine Frau als Schwiegertochter vorstellen.
Das Café war wie eine Zufluchtsstätte für die Erfolglosen. So kam es ihm oft vor. Er passte nicht unbedingt dort hinein, es interessierte ihn aber, einfach dort zu sitzen und die Menschen zu beobachten. Sie schienen Spaß zu haben, unterhielten sich, lachten, umarmten und küssten sich und tranken einen Macchiato nach dem anderen.
An der Decke hing ein gelbes Flugzeug aus Blech, das eigentlich nur wie ein Flugzeug aussah, aber nicht fliegen konnte. Jemand hatte in seiner Fantasie ein Werk geschaffen, das nur etwas darstellte, ohne eine Funktion zu haben. Armin fragte einmal, was das sein sollte. Man erklärte ihm, dass das ein Flugzeug sei.
„Das sehe ich auch, aber Flugzeuge sollten doch fliegen können, oder?“
„Sagt wer?“, meinte die nette Bedienung, die rote und grüne Haare hatte sowie mehrere Ringe in Mund, Nase und den Ohren.
„Da haben Sie recht“, meinte Armin. Wer sagt schon, dass alles eine Funktion haben muss.
Er sah kurz zur Seite, als er daran vorbeifuhr, und lächelte ein wenig. Die Welt war eben manchmal nicht so einfach zu erklären.
Am Gärtnerplatz angekommen, parkte er auf dem Bürgersteig, da alle Plätze in der näheren Umgebung belegt waren. Die wenigen Parkplätze, die es gab, wurden von den Bewohnern genutzt, die sicher noch nicht weggefahren waren. Es war Sonntagvormittag. Vielleicht würden sie sich freuen, einmal den Platz für den ganzen Tag haben zu dürfen.
Armin klemmte das Blaulicht auf das Dach, damit die Polizei sehen würde, wer hier parkte. Außerdem stellte er noch ein Schild ins Fenster, das besagte, dass hier die Polizei im Einsatz war. Er konnte nur hoffen, dass es half und nicht jemand dachte, das wäre ein schlechter Scherz. Das Letzte, was er wollte, war, sein Auto auf dem Polizeiabstellplatz auszulösen.
Die Tür ins Haus stand offen. Es war ein alter Bau aus den Zwanzigerjahren, den man aufwendig renoviert hatte. Die alten Bewohner, die sicher Jahrzehnte dort gelebt hatten, waren wahrscheinlich ausquartiert worden. Die wenigsten konnten sich so eine Wohnung heute noch leisten, nachdem sie verschönert worden war. Sicher war das nicht, aber in den meisten Fällen ergab sich das so. Es war ein großes Thema in München, und nicht nur dort.
Es sah alles sehr neu aus, als er über zwei Stufen nach oben ging und vor dem Aufzug stand, den man in das freie Karree der Treppe eingebaut hatte, die sich an den Wänden nach oben schwang. Die Stiege war neu und dunkel eingelassen, die Wände in zartem Gelb gehalten. Oben an der Decke brachte man Stuck an, wie es wahrscheinlich früher schon einmal gewesen war. Er blickte hinauf, da er Stimmen hörte, und sah, dass sich vor einer Tür im dritten Stock eine größere Menge von Menschen angesammelt hatte. Es sah aus, als wären viele aus ihren Wohnungen gekommen, um zu sehen, was denn passiert war. Die zwei Polizisten hatten Mühe, die Menge zurückzuhalten.
Der Aufzug kam herunter, ohne dass er einen Knopf gedrückt hätte. Ein Polizist in Uniform stieg aus, sah ihn kurz an und ging wortlos an ihm vorbei. Er kannte ihn nicht, was sichtlich auf Gegenseitigkeit beruhte. Sein Gesicht strahlte so etwas wie Frustration aus, als wollte es sagen, dass er nun genug hatte von dem, was sich da oben abspielte.
Langsam und leise schwebte der Aufzug nach oben. Im dritten Stock angekommen, trat Armin der Menge entgegen, die sich aufgeregt unterhielt. Der Wachtmeister, der die Leute zurückdrängen wollte, stellte sich mit seinen fast eins achtzig und hundertfünfzig Kilo in die Tür und bewegte sich nicht.
„Kommissar Staller“, sagte Armin, als er in der Nähe der Tür, soweit man eben gehen konnte, angekommen war. Niemand beachtete ihn oder hörte, was er sagte.