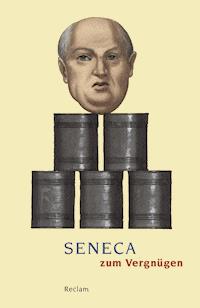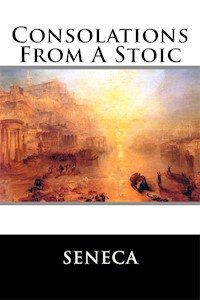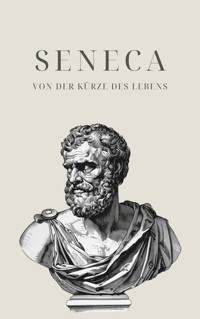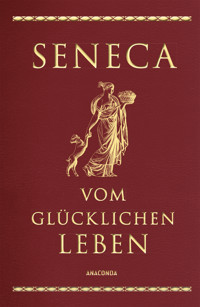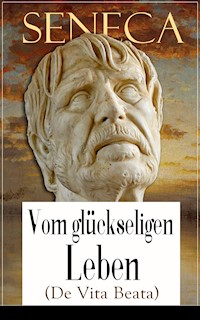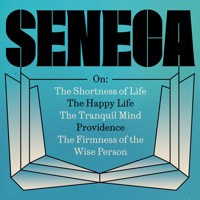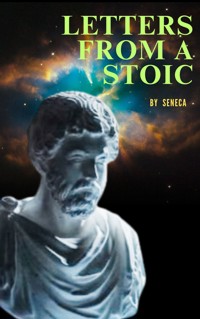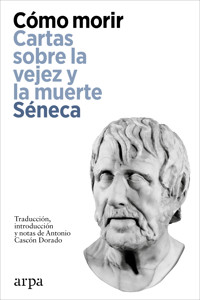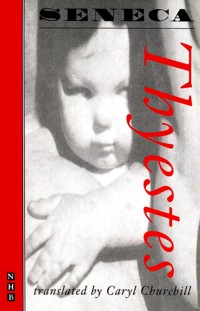Von der Seelenruhe, Vom glücklichen Leben, Von der Muße, Von der Kürze des Lebens. Illustriert E-Book
Seneca
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seneca, ein bedeutender römischer Philosoph der Antike, hinterließ eine reichhaltige Sammlung von Schriften, die sich mit verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens und der Philosophie befassen. In dieser illustrierten Ausgabe sind einige seiner wichtigsten Werke enthalten, darunter "Von der Seelenruhe", "Vom glücklichen Leben", "Von der Muße" und "Von der Kürze des Lebens". "Von der Seelenruhe" bietet philosophische Einsichten darüber, wie man in einer Welt voller Herausforderungen und Unruhe inneren Frieden finden kann. "Vom glücklichen Leben" erkundet die Natur des Glücks und des wahren Wohlbefindens. "Von der Muße" ermutigt dazu, Zeit für Kontemplation und Selbstreflexion zu finden, während "Von der Kürze des Lebens" uns daran erinnert, die kostbare Zeit, die uns gegeben ist, weise zu nutzen. Die Illustrationen in dieser Ausgabe tragen dazu bei, die zeitlosen Weisheiten und Lehren von Seneca visuell zu veranschaulichen und zu verstärken. Diese Sammlung ist nicht nur eine Einführung in die stoische Philosophie, sondern auch eine Quelle der Inspiration und Reflexion, die auch heute noch relevante Einsichten in das menschliche Streben nach Weisheit und Erfüllung bietet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seneca
Von der Seelenruhe, Vom glücklichen Leben, Von der Muße, Von der Kürze des Lebens
Illustriert
Seneca, ein bedeutender römischer Philosoph der Antike, hinterließ eine reichhaltige Sammlung von Schriften, die sich mit verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens und der Philosophie befassen. In dieser illustrierten Ausgabe sind einige seiner wichtigsten Werke enthalten, darunter "Von der Seelenruhe", "Vom glücklichen Leben", "Von der Muße" und "Von der Kürze des Lebens".
"Von der Seelenruhe" bietet philosophische Einsichten darüber, wie man in einer Welt voller Herausforderungen und Unruhe inneren Frieden finden kann. "Vom glücklichen Leben" erkundet die Natur des Glücks und des wahren Wohlbefindens. "Von der Muße" ermutigt dazu, Zeit für Kontemplation und Selbstreflexion zu finden, während "Von der Kürze des Lebens" uns daran erinnert, die kostbare Zeit, die uns gegeben ist, weise zu nutzen.
Die Illustrationen in dieser Ausgabe tragen dazu bei, die zeitlosen Weisheiten und Lehren von Seneca visuell zu veranschaulichen und zu verstärken. Diese Sammlung ist nicht nur eine Einführung in die stoische Philosophie, sondern auch eine Quelle der Inspiration und Reflexion, die auch heute noch relevante Einsichten in das menschliche Streben nach Weisheit und Erfüllung bietet.
Von der Seelenruhe
Von Serenus
[Brief des Serenus an Seneca]
I
[Serenus]: Bei innerer Selbstschau, mein Seneca, machten sich mir gewisse Gebrechen bemerkbar, teils sichtlich und offen daliegend, wie mit Händen zu greifen, teils verborgener und versteckter Art, und noch andere, nicht anhaltender Art, sondern stoßweise wiederkehrend, und diese, darf ich sagen, sind die allerlästigsten, gleich streifenden Feinden, die nur die Gunst des Augenblicks zu einem Anfall benutzen, so dass man weder gerüstet sein kann wie im Kriege, noch sorglos wie im Frieden. Und gerade dies ist der Zustand, auf dem ich mich überwiegend ertappe – denn warum sollte ich dir nicht als meinem Arzt die Wahrheit gestehen? – Weder unbedingt frei fühle ich mich von den Fehlern, die ich fürchtete und hasste, noch auch anderseits völlig in ihrer Gewalt. Ich befinde mich also, wenn auch nicht gerade in der schlimmsten, so doch in einer höchst kläglichen und verdrießlichen Lage: ich bin weder krank noch gesund. Und komme mir nicht mit dem Einwand, zu jeder Vortrefflichkeit bilde ein schwacher Ansatz den Anfang, erst die Zeit bringe dauernden und festen Halt. Ich verkenne nicht, dass auch, was auf die äußere Herrlichkeit hinarbeitet, wie z. B. auf Ehrenämter, auf den Ruhm der Beredsamkeit, sowie auf alles, was von der Zustimmung anderer abhängt, nur durch geduldiges Ausharren sich durchsetzt – nicht nur, was uns wahre Kraft schafft, sondern auch jene Künste, die, um Gefallen zu erwecken, einer gewissen Schminke bedürfen, erfordern manches Jahr, bis die Länge der Zeit der Farbe allmählich Festigkeit und Dauer verleiht, – allein ich fürchte, dass die Gewohnheit, diese Begründerin einer gewissen Beständigkeit im Verlauf der Dinge, diesen Fehler sich bei mir noch tiefer einwurzeln lässt: langer Umgang macht uns dem Bösen wie dem Guten befreundet. Das eigentliche Wesen dieser zwiespältigen, weder entschieden zum Rechten noch zum Verkehrten sich neigenden Gemütsschwäche kann ich dir nicht mit einem Schlagwort klarmachen, sondern nur durch eine Reihe von Einzelheiten; ich will dir meine Zustände schildern; du magst den Namen für die Krankheit finden.
Ich bin großer Freund der Sparsamkeit, ich gesteh’ es. Mein Lager soll nicht durch prunkhafte Ausstattung Neid erregen, ich mag nichts wissen von einem Gewand, das man aus einem schmucken Kasten hervorholt und dem man durch aufgelegte Gewichte und tausenderlei Druckmittel einen erzwungenen Glanz gegeben hat; nein ich lobe mir ein einfaches Hauskleid, das weder zum Aufbewahren noch zum Anlegen besondere Sorge erfordert. Meine Mahlzeit soll keiner Dienerschaft bedürfen, weder zur Zubereitung noch zum Aufwarten und Zuschauen; sie soll nicht schon viele Tage vorher bestellt und vieler geschäftiger Hände Werk sein, sondern wohlfeil und leicht beschaffbar, nicht ans fernen Bezugsquellen mit vielen Kosten bereitet, sondern überall erhältlich, weder dem Vermögen noch dem Körper schädlich, nicht von der Art, dass sie den Eingangsweg auch zum Ausgangsweg hat.
Zum Diener wünsche ich mir einen schlichten Naturburschen, zudem wuchtiges Silbergeschirr, wie es mein das Landleben liebender Vater hatte, ohne aufgeprägten Künstlernamen, einen Tisch, der nicht durch reiche Maserung die Augen auf sich zieht und durch häufigen Besitzwechsel unter Prachtliebhabern stadtbekannt ist, sondern dem schlichten Gebrauche dienend, ohne eines Gastes besonderes Wohlgefallen zu erwecken oder seinen Neid zu erregen.
Doch so sehr ich mich dadurch befriedigt fühle, so werde ich doch an mir selbst wieder irre, wenn ich den Blick werfe auf die stattlichen Einrichtungen mancher großen Herren zur Ausbildung von Sklavenknaben, auf die tadellose Kleidung der Dienerschaft mit den Goldstickereien, prächtiger als bei Prozessionen, und auf die Schar strahlender Sklaven, ferner auf ein Haus, dessen Fußboden schon eine Kostbarkeit ist, das in allen Winkeln von Reichtum strotzt, ja dessen Dach sogar durch seinen Glanz die Blicke auf sich lenkt; dazu der Volkshaufe, der das durch die verschwenderische Pracht dem Ruin geweihte Erbgut umlagert und sich zur Begleitung aufdrängt. Dazu die Bewässerungsanlagen, die mit ihrem spiegelklaren Wasser den Speisesaal umrahmen! Was bedarf es weiterer Worte darüber sowie über die Mahlzeiten selbst, die dem Glanz dieser Aufmachungen entsprechen? Wenn ich so aus einer vermoderten Häuslichkeit komme, dann hat der Glanz dieser Prachtentfaltung etwas Verführerisches für mich und umgaukelt mich von allen Seiten, dann flimmert’s mir vor den Augen, und eher noch kann ich mich innerlich fassen als den Blick erheben. So trete ich also den Rückzug an, nicht schlechter geworden, wohl aber betrübter, und bewege mich inmitten meiner armseligen Umgebung nicht mehr so selbstbewusst; ich fühle leise Gewissensbisse, und es beschleicht mich der Zweifel, ob jenes nicht vorzuziehen sei; nichts davon macht mich zu einem anderen Menschen, aber alles dies rüttelt doch an mir.
Ich entschließe mich, den Anweisungen meiner Lehrer zu folgen und mich mitten in den Strudel der Staatsgeschäfte zu stürzen. Dazu verleitet mich nicht etwa das Verlangen nach Ehrenstellen, nach dem Konsulat, nach Purpur oder Rutenbündeln, sondern der Wunsch, meinen Freunden, meinen Verwandten und allen meinen Mitbürgern, ja der ganzen Menschheit mich dienlicher und nützlicher zu machen. Festen Entschlusses und besonnen folge ich dem Zeno, dem Kleanthes, dem Chrysippus, von denen indes doch keiner selbst sich auf Staatsgeschäfte einließ, obschon jeder von ihnen dazu mahnte. Hat irgendetwas mein Gemüt, das keine starken Stöße verträgt, erschüttert, begegnet mir, wie das im Leben so häufig der Fall ist, irgend etwas, was mir wider den Mann geht, oder will eine Sache nicht recht von der Stelle rücken, oder fordern irgendwelche Lappalien einen unverhältnismäßigen Zeitaufwand, dann wende ich mich der Muße zu, und dabei geht es mir wie den Tieren, selbst wenn sie ermüdet sind: der Schritt nach der Heimstätte ist schneller; ich schließe mich behaglich in meine vier Wände ein: »Niemand soll mir fortab einen Tag rauben, denn er kann mir nichts geben, was an Wert dem entspräche: der Geist vertiefe sich ganz in sich selbst, widme sich ganz dem eigenen Dienste, treibe nichts, was sich nicht auf ihn bezieht, nichts, was vor den Richter gehört; alles Verlangen sei nur auf die Ruhe gerichtet, die von Sorgen für Staat oder einzelne Bürger nichts weiß.«
Aber wenn dann wieder eine kräftigere Lektüre den Mut aufgerichtet und leuchtende Beispiele anstachelnd gewirkt haben, dann regt sich wieder der Trieb nach dem Forum: dem einen möchte ich meine Stimme leihen, dem anderen meine Dienste, um, wenn es auch nichts nützt, doch wenigstens den Versuch zu machen, ihm zu nützen; auch den Übermut mancher im Glück sich Überhebenden möchte ich dort vor aller Öffentlichkeit demütigen.
Was die Studien anlangt, so meine ich, es sei wahrlich besser, die Dinge selbst scharf ins Auge zu fassen und um ihrer willen zu reden, die Worte aber aus der Sache hervorwachsen zu lassen, dergestalt, dass der frei gestaltete Vortrag den Anforderungen der Sache folgt. »Wozu bedarf es denn schriftlich ausgearbeiteter Reden? Was hat es denn auf sich mit deinem Streben, die Nachwelt nicht über dich schweigen zu lassen! Zum Sterben bist du geboren, ein stilles Leichenbegängnis erfordert weniger Umständlichkeiten. Daher bringe, um Zeit zu gewinnen, zum eigenen Nutzen, nicht zum tönenden Nachruhm, in einfacher Schreibart etwas zu Papier; wer für das Erfordernis des Tages schreibt, der erspart sich unnötige Mühe.«
Hat sich dann aber der Geist durch erhebende Gedanken wieder aufgerichtet, dann ist er ehrgeizig auf die Fassung der Worte bedacht, und seinem höheren Fluge entspricht auch das Verlangen nach eindrucksvollem Ausdruck und nach einer der Würde der Sache angemessenen Darstellung. Dann setze ich mich über Vorschrift und beschränkende Regel hinweg, überlasse mich einem höheren Schwung und rede gleichsam eine höhere Sprache.
Ich will nicht weiter ins Einzelne eingehen. Diese Unbeständigkeit einer an sich guten Sinnesweise werde ich in keiner Lebenslage los; ja ich fürchte, dass ich allmählich ganz vom Wege abkomme, oder, was noch Besorgnis erregender ist, dass ich einem Schwebenden gleiche, der herabfallen muss, oder dass es vielleicht noch schlimmer steht als es meinem Blicke erkennbar ist. Denn was uns selbst betrifft, das sehen wir immer mit parteiischem Auge an, und Voreingenommenheit schadet immer dem Urteil. Ich glaube, viele hätten zur Weisheit gelangen können, wenn sie nicht geglaubt hätten, sie hätten sie schon erreicht, und wenn sie sich nicht manche Fehler selbst verhehlt hätten, manche auch mit offenen Augen übersehen hätten. Denn man glaube ja nicht, es sei mehr fremde Schmeichelei als unsere eigene, die uns zugrunde richte. Wer wagt es, sich selbst die Wahrheit zu sagen? Wer hätte nicht mitten im umgebenden Gedränge von Lobhudlern und Schmeichlern sich selbst doch am meisten geschmeichelt? Ich bitte dich also: wenn du ein Mittel hast, diesen meinen schwankenden Zustand zum Stillstand zu bringen, so halte mich für wert, dir meine Ruhe verdanken zu dürfen. Ich weiß: diese meine Gemütsschwankungen sind nicht gefährlicher Art und arten nicht ins Stürmische aus. Soll ich durch ein der Sachlage wirklich entsprechendes Bild das, worüber ich klage, dir zum Ausdruck bringen: es ist nicht ein Sturm, der mich schüttelt, sondern die Seekrankheit. Wie es auch immer damit stehen mag, befreie mich von dem Übel und leiste mir Hilfe, der ich, das Land vor Augen, Not leide.
II
[Seneca]: Glaube mir, mein Serenus, lange schon suche ich selbst im stillen mir die Frage zu beantworten, womit ich einen Gemütszustand wie den deinigen etwa vergleichen könnte, und ich finde kein passenderes Seitenstück dazu, als den Zustand derer, die nach überstandener langer und schwerer Krankheit ab und zu von kleinen Störungen und leichten Anfällen heimgesucht werden und, selbst wenn sie auch die Rückstände der eigentlichen Krankheit bereits überwunden haben, sich doch noch von Argwohn beunruhigt fühlen und, schon genesen, sich doch noch von den Ärzten den Puls fühlen lassen und in jeder Steigerung ihrer Körperwärme Anlass zu allerhand Quengeleien finden. Bei ihnen, mein Serenus, steht es nicht etwa so, dass der Körper nicht völlig gesund wäre, nein! er hat sich nur noch nicht hinreichend an die Gesundheit gewöhnt: so zeigt auch das ruhige Meer noch eine gewisse zitternde Bewegung, wenn der Sturm sich gelegt hat. Es bedarf also bei dir nicht jener kräftigeren Mittel, über die wir bereits hinaus sind; du brauchst nicht dir selbst schroff entgegenzutreten, brauchst nicht in Zorn gegen dich auszubrechen, brauchst nicht die derbsten, die strengsten Seiten hervorzukehren, sondern musst, was allerdings erst zuletzt kommt, dir selbst vertrauen und glauben, dass du auf dem rechten Wege seist, unbeirrt durch die nach allen möglichen Seiten hinweisenden Spuren zahlreicher anderer, darunter auch solcher, die überhaupt wie blind umhertappen. Das, wonach du sehnlichstes Verlangen trägst, ist aber etwas Großes, Erhabenes, nahezu Göttliches, nämlich Unerschütterlichkeit. Diese Bestandesfestigkeit der Seele nennen die Griechen Euthymia (Wohlgemutheit), über die es eine vortreffliche Schrift des Demokrit gibt. Ich nenne sie Gemütsruhe, denn es ist nicht nötig, die Worte formgetreu nachzuahmen und zu übertragen; die Sache selbst, um die es sich handelt, muss mit einem passenden Ausdruck bezeichnet werden, der die griechische Benennung der Bedeutung nach wiedergibt, nicht der äußeren Form nach.
Unsere Frage geht also dahin, wie man der Seele zu einem gleichmäßigen und heilsamen Gange verhelfen kann, dergestalt, dass sie in bestem Einvernehmen mit sich stehe und ihre Freude an sich selbst habe und diese Freude nicht unterbreche, sondern immer im Zustand friedlicher Ruhe verharre, sich weder überhebend noch sich herabwürdigend: das wird das Wesen der Gemütsruhe ausmachen. Wie man dazu gelangen könne, will ich im allgemeinen untersuchen: Du wirst dir aus dieser allgemeinen Anweisung herausnehmen, was du für dich gut findest. Doch muss das Übel im ganzen ans Licht gezogen werden; jeder kann sich dann seinen Teil daraus entnehmen. Zugleich wirst du daraus ersehen, wie viel geringere Not du mit deiner Selbstquälerei hast als die, welche gefesselt durch den Glanz einer hohen Stellung und belästigt durch die Verpflichtungen eines hohen Titels, mehr durch ein gewisses schamhaftes Ehrgefühl als durch wirkliche Neigung in ihrer Gleisnerei festgehalten werden.
Alle sind sie in der nämlichen Lage, sowohl die vom Leichtsinn Besessenen wie die vom Überdruss und von beständiger Veränderungssucht Geplagten, denen immer das besser gefällt, was sie aufgegeben haben, nicht minder die Faulenzer und Tagediebe. Ihnen reihen sich noch die an, die, wie die schwer Einschlafenden, sich hin und her wälzen und sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite werfen, bis sie endlich vor Müdigkeit Ruhe finden; der beständige Wechsel ihrer Lebensweise führt dann dahin, dass sie endlich bei derjenigen stehen bleiben, bei der nicht etwa der Widerwille gegen Veränderung, sondern das Alter sie festhält, das nicht mehr die Regsamkeit zu Neuerungen hat; dazu gesellen sich noch die, deren geringe Beweglichkeit nicht etwa auf Charakterfestigkeit zurückzuführen ist, sondern auf Schlendrian: sie leben nicht eigentlich, wie sie wollen, sondern wie sie einmal angefangen haben. Daneben gibt es noch unzählige Spielarten; aber die Wirkung des Fehlers kommt auf dasselbe hinaus, auf das Missfallen an sich selbst. Dies Missvergnügen hat seinen Grund in der Ungebärdigkeit des Seelenzustandes und in den begehrlichen Trieben, die entweder nicht entschieden genug oder erfolglos sind: es fehlt entweder an dem der Höhe der Wünsche entsprechenden Wagemut oder an der Gunst des Schicksals zur Erreichung derselben; man stellt seine Rechnung immer ganz und gar auf die Zukunft – eine ewige Unrast, ein beständiges Schwanken, wie es unausbleiblich ist in solchen Schwebezuständen! Immer sind es nur die eigenen Wünsche, wodurch diese Leute sich bestimmen lassen; ja, das Unehrbare und schwer zu Erreichende wird für sie ein Gegenstand der Selbstbelehrung und des Zwanges; und erweist sich alle Mühe als erfolglos, so quält sie das Unwürdige ihrer vergeblichen Anstrengungen, und es schmerzt sie, nicht etwa, dass sie Verwerfliches, sondern dass sie es vergebens gewollt haben. Da werden sie denn von Reue gepackt über ihr Beginnen und von Angst vor einem neuen Anfang, und es stellt sich jener schwankende Gemütszustand ein, der keinen Ausweg findet, weil sie ihre Begierden weder zu beherrschen noch ihnen nachzugeben vermögen; daher denn auch die Hemmung des einer festen Entscheidung unfähigen Lebens und das Einrosten der inmitten vereitelter Wünsche erstarrenden Geisteskraft.
Das alles wird noch drückender, wenn sie aus Hass gegen das ihnen zu so großem Unheil ausschlagende Geschäftsleben ihre Zuflucht zur Muße nehmen, zu weltfremden Studien, die sich nicht vertragen mit einer von vornherein auf staatsmännische Tätigkeit angelegten Sinnesart, der es aufs Handeln ankommt und der die Unruhe natürliches Bedürfnis ist; hat sie doch in sich zu wenig, was ihr Trost gewähren könnte. Werden einem so Gearteten die erfrischenden Anregungen entzogen, die das Geschäftsleben mit all seinem bunten Hin und Her ihm gewährt, so kann er sich mit dem Haus, mit der Einsamkeit, mit seinen vier Wänden nicht zufrieden geben: es macht ihm Unbehagen, sich sich selbst überlassen zu sehen. Daher denn jener Widerwille, jenes Missfallen an sich selbst, jenes hin und her Schwanken des nirgends einen festen Halt findenden Gemütes; daher jenes trübselige und krankhafte sich hin schleppen in der Muße; schämt er sich vollends, die Ursachen seines Unbehagens einzugestehen, treibt ihn also die sittliche Scheu, die Qualen sich ganz nur in seinem Inneren abspielen zu lassen, dann erwürgen sich die so in die Enge getriebenen Leidenschaften, vergebens nach einem Ausweg suchend, einander selbst. Daher die Trübseligkeit, die Mattigkeit, das tausendfältige hin und her Schwanken der ihrer Selbstgewissheit völlig verlustig gegangenen Seele, die, wenn sich Hoffnungen auftun, gleich oben hinaus will, sind sie fehlgeschlagen, dann in Verzagtheit und Trauer versinkt; daher die Stimmung, die sie dazu bringt, ihre Muße zu verwünschen und zu jammern, dass sie nichts mehr zu tun haben, daher der grimmige Neid über das Emporkommen anderer. Denn die Scheelsucht wird genährt durch den unseligen Müßiggang: man wünscht allen den Sturz, weil man sich selbst nicht in die Höhe bringen konnte; aus diesem Widerwillen gegen die Fortschritte anderer und der Verzweiflung am eigenen Fortkommen entspringt dann der Ingrimm gegen das Schicksal, der über den Zeitgeist jammert, sich Zu verstecken sucht und über seine eigene Strafe hin brütet, in Scham und Verdruss über sich selbst. Denn von Natur ist der menschliche Geist voll Regsamkeit und Bewegungsbedürfnis. Jede Gelegenheit sich zu regen und aus sich selbst herauszutreten ist ihm willkommen, am willkommensten den durchtriebensten Geistern, die ihre Freude daran finden, sich von einem Geschäft ins andere zu stürzen. Wie gewisse Geschwüre es an sich haben, nach an sich ihnen schädlichen Betastungen zu verlangen, und es begrüßen, wenn eine Hand sie ihnen gewährt, und wie die hässliche Krätze am Körper ein wahres Entzücken empfindet, wenn man sie durch Reiben reizt, ebenso, möchte ich behaupten, sind den Geistern, an denen Leidenschaften wie böse Geschwüre ausbrechen, Mühe und Plackereien ein Genuss. Gibt es ja doch mancherlei, was auch unserem Körper Lust und Schmerz zugleich bereitet, zum Beispiel, sich im Liegen umzudrehen und sich auf die noch nicht müde Seite zu legen und wechselnd bald diese, bald jene Lage zu wählen, wie Achilles bei Homer, der sich bald auf die Brust, bald auf den Rücken legt und sich selbst die verschiedensten Lagen gibt nach Art des Kranken, der es nicht in einer Lage aushält und jede Veränderung wie eine Erlösung begrüßt.
Auch Reisen unternimmt man dahin und dorthin, durchwandert auch das Küstengelände, und bald zu Wasser bald zu Lande versucht sich der dem Gegenwärtigen immer abholde Veränderungsdrang. »Jetzt ist Kampanien die Losung.« Doch nicht lange, so hat man die Überkultur satt. »Urwüchsiges Gelände lasst uns beschauen, durchwandern wir denn die Bergwaldungen Bruttiums und Lukaniens.« Doch inmitten dieser Einöden darf es auch nicht an einer erfreulichen Entschädigung fehlen, an einem Ort, wo verwöhnte Augen sich wieder erholen können von dem schaurigen Blick auf grauenhaft wilde Länderstrecken. »Auf denn, nach Tarent mit seinem gefeierten Hafen, mit seinem milden Winter, eine Gegend, die selbst für die große Masse der Bevölkerung reichlichen Ertrag lieferte.« Gar zu lange schon hat das Ohr auf das Beifallklatschen und das Jubelgetöse verzichten müssen; es regt sich wieder die Lust, auch Menschenblut (im Zirkus) fließen zu sehen: »Lasst uns also den Kurs wieder auf Rom richten.« Eine Reise folgt auf die andere, ein Schauspiel auf das andere, wie Lukrez sagt:
So sucht jeder die Flucht vor sich selbst.
Aber was hilft es, wenn er sich nicht selber entfliehen kann? Er folgt sich selbst und ist sein eigener lästigster Begleiter. Es ist also – darüber müssen wir uns klar sein, nicht des Ortes Schuld, sondern unsere eigene, unter der wir leiden: wir ermangeln der Kraft, alles zu erdulden, weder mit Mühsal noch mit Lust, weder mit uns noch mit irgend einer Sache können wir auf die Dauer uns abfinden. Manche hat das in den Tod getrieben, dass sie, ihren Vorsatz häufig ändernd, doch immer wieder auf das Nämliche zurückkamen und zu nichts Neuem mehr kommen konnten: sie wurden des Lebens und der Welt überdrüssig, und es drängte sich ihnen auf die Lippe die Frage der heillosen Genussmenschen: »Ach, wie lange noch immer wieder dasselbe?«
III