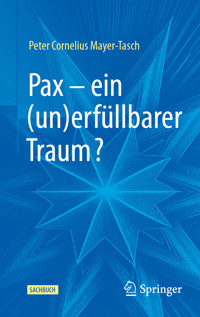Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Unter Berufung auf die Gnade als göttlichen Erleuchtungs- und Ermächtigungsquell wird und wurde sowohl geistliche Lehr- und Heilsautorität als auch weltliche Herrschaft begründet. Für das Christentum ist die Vorstellung eines spirituellen Gnadentransfers und einer darauf basierenden sozialen Gnadenverwaltung von existentieller Bedeutung. Durch die Glaubwürdigkeitskrise infolge der Missbrauchsskandale und wachsende religiöse Indifferenz gerät aber auch der Begriff der Gnade stärker ins Visier eines kritischen Zeitgeistes. Um welche Frag-Würdigkeiten es dabei geht, wird in der vor dem Hintergrund eines breiten historisch-philosophischen Wissens verfassten Schrift auf knappem Raum eindrucksvoll beleuchtet. Ein Tiefenblick auf die Politische Theologie des Abendlandes, der zur rechten Zeit kommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Cornelius Mayer-Tasch
Von Glanz und Elend der Gnade
Ein Beitrag zur Politischen Theologie
Verlag Friedrich PustetRegensburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3395-1
Umschlaggestaltung: www.martinveicht.de
Umschlagbild: Konzil von Nizäa, Mégalo-Metéoron-Kloster, Griechenland
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2023
eISBN 978-3-7917-6240-1 (epub)
www.verlag-pustet.de
Inhalt
Zum Geleit
Gnade – ein Anachronismus?
Gnade als Inbegriff des Willkommenen
„Gott“ als Urquell jeglicher Gnade
Das „Gottesgnadentum“ als Herrschaftslegitimation
Ein Gott von Kaisers Gnaden?
Vom Geheimnis der Gnade
Jenseits von Glanz und Elend. Ein Epilog
Bildnachweis
Anmerkungen
„Auch wir werden Alle nach und nach
aus einem Christentum der Worte und des Glaubens
zu einem Christentum der Gesinnung und der Tat kommen.“
(Johann Wolfgang von Goethe am 11. März 1832 zu Eckermann)
Zum Geleit
Gnade – welch ein hehres Wort! Ist es aber nicht auch ein eher in die Vergangenheit weisendes als der Gegenwart zugehöriges Wort? Setzt sein Gebrauch nicht letztlich stets den vertrauensvoll-gläubigen Blick nach „oben“ voraus, zum „Himmel“ also, der Zielvorstellung des mittelalterlichen Homo viator, des Wanderers zu Gott? Eine Vorstellung dies, die heute – zumindest in unserem westlichen Kulturkreis – zunehmend nüchtern und skeptisch, wenn nicht gar als gänzliches „Wolkenkuckucksheim“ (Aristophanes)1 betrachtet wird. Haben wir uns außerhalb gewisser, feierlich überhöhter Stunden nicht längst daran gewöhnt, ohne diesen Blick nach oben und damit auch ohne die mentale Dimension der Gnade auszukommen? Haben wir nicht unsere Lebensbedingungen inzwischen gründlich ausgelotet, nach allen wissenschaftlichen Richtungen hin durchkämmt und durchforscht? Wissen wir nicht ziemlich genau, warum, wie und wohin der sprichwörtliche Hase (und mit ihm der Mensch) läuft? Haben wir nicht im Großen und Ganzen alles mehr oder minder im Griff? Von solchen Beiläufigkeiten abgesehen freilich wie Atomkriegsängsten, Hunger- und Umweltkatastrophen, Klimawandel und globalen Pandemien …
Wohl keine frühere Menschheitsepoche war weniger schicksalsergeben und schicksalsbereit als die unsere, ach so hochstirnig-bebrillte. Keine erhob weniger intensiv den Blick zu jenen imaginären Mächten, in deren Wissen und Wollen ein Großteil der Menschheit seit eh und je auch ihr irdisches Schicksal geborgen sah und deren Gnade oder Ungnade sie sich daher auch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert glaubte. Nachdem jedoch die – sich (nach Auskunft ihrer Dichter) so intensiv in die Geschichte der Menschen einmischenden – Götter der Antike längst im Dunkel der Vergangenheit entschwunden sind und Nietzsches Kunde, dass nun auch der Gott des nachantiken Abendlandes „tot“ sei2, weite Verbreitung gefunden hat, bestünde eigentlich kein triftiger Grund mehr, über Gnade und Ungnade des Himmels nachzudenken.
Was jedoch ungeachtet all dieser soziokulturellen Entwicklungen blieb, war die unabweisbare Tatsache, dass manchen Menschen ein gütiges und anderen ein düsteres Schicksal beschieden war. Nicht ausbleiben konnte es daher auch, dass stets aufs Neue Erklärungen für diese augenfällige Diskrepanz gesucht wurden, die jenseits der üblichen Kausalitätsanalysen und Begründungshypothesen lagen – Erklärungen, die (spätaufklärerischer Skeptizismus hin oder her) dann doch wieder im undurchdringlichen Nebel unterschiedlicher Jenseitsvorstellungen landeten.
Mit anderen Worten: All das in Frage zu stellen und nach Möglichkeit auszuleuchten, was sich hinter dem schwer fassbaren Begriff der Gnade verbirgt, bleibt zumindest solange ein ewiges Menschheitsthema, solange wir uns auf der gegenwärtigen Evolutionsstufe befinden. Der im Folgenden gewählte Zugang zu dieser Thematik erfolgt über den Versuch, verschiedene Aspekte des individuellen und kollektiven (d. h. also sozialen und politischen) Umgangs mit dem Begriff der Gnade auszuloten. Dass es insbesondere spektakuläre, zwischen Aufstieg und Niedergang pendelnde Zeitläufte und Lebensläufe sind, die dazu animieren, sich ihr zuzuwenden, liegt nahe. Gerade die Wahrnehmung von Hoch-Zeiten und Abstürzen nämlich bietet die Möglichkeit zur Reduktion einer sonst fast undurchdringlichen Komplexität von Lebenszusammenhängen. Wer will, mag sowohl die Umstände als auch das Motiv für die vorliegende, auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie verfasste Schrift in diesem Lichte sehen.
München, im Winter 2021/22
Peter Cornelius Mayer-Tasch
Gnade – ein Anachronismus?
Auf den ersten Blick mag es vielleicht merkwürdig erscheinen, sich in einen Begriffsraum zu begeben, den ein Großteil unserer Zeitgenossen schon sprachlich als einen Anachronismus, als ausgesprochen „gestrig“ also, empfinden dürften. Trotz der hohen Bedeutung, die diesem Begriff in seiner weit ausstrahlenden soziokulturellen und soziopolitischen Bedeutung seit eh und je zukam, wurde er in den „trefflich fein“ mahlenden Mühlen geistes- und sozialwissenschaftlicher Differenzierungsartistik bis zur Unkenntlichkeit zergliedert. Aus der ihm ursprünglich zukommenden Anmutung ganzheitlicher Fülle entfaltete sich im Gefolge des aufklärerischen Szientismus ein breiter Fächer von Eigenschafts-, Befindlichkeits- und Zustandsbeschreibungen. Am ehesten erhalten hat sich die ursprüngliche Bedeutung wie auch der Umgang mit dem Begriff der Gnade noch im Selbstverständnis und im Einflussbereich der Institution, die in ihrem – wenn auch inzwischen stark eingeschmolzenen – Kern allen Stürmen der Aufklärung getrotzt hat. Ihre Stärke, zugleich aber auch ihre Schwäche mag man darin sehen, dass sie im Hinblick auf die Grundlagen ihrer Dogmatik von des erkenntniskritischen, und im Hinblick auf ihren Organisations- und Aktionsstil von des sozialkritischen Gedankens Blässe weitgehend unberührt geblieben zu sein scheint.
Gemeint ist die christliche und insbesondere die sich als allumfassend (gr. „katholisch“) verstehende abendländische Traditionskirche samt ihren diversen orientalischen und zum Teil auch „reformierten“ Schwesterkirchen. Dass unter ihrem „Schutz und Schirm“ seit eh und je viel Gutes, aber auch viel Schlechtes bewirkt wurde, ist unabweisbar. Die Dokumentation dieser ihrer humanen Aktiva und inhumanen Passiva füllt ganze Bibliotheken. Tendenziell freilich gilt dies – wenn auch nicht mit solcher Trag- und Reichweite – für viele (wenn nicht die meisten) Institutionen, die sich zur Meisterung des menschlichen Zusammenlebens gebildet haben. Und insbesondere gilt es auch für die bedeutendste der das menschliche Leben und Zusammenleben sichernden und regelnden Institutionen – den Staat in all seinen Formen und Gliederungen.
Die Sonderstellung (wie auch das sich hieraus ergebende Sonderproblem) der christlichen Kirche freilich liegt darin begründet, dass sie mit dem ausdrücklichen Anspruch göttlicher Legitimation auftritt und sich als hierzu autorisierte Vermittlerin himmlischer Gnadenerweise – der sogenannten Sakramente – versteht, die sie laut angeblichem neutestamentlichem Ermächtigungsauftrag nach Gutdünken gewähren oder verweigern kann. In den Augen der Christgläubigen kommt ihr daher neben ihrer – sich als Segnungsmacht darstellenden – Gnadenfülle eine Art von Gnadenverteilungsmonopol zu. Dieser Abglanz der im christlichen Verständnis aus dem „Reich des Vaters“ stammenden „Kraft und Herrlichkeit“ ist gewiss nicht gering – aber heute zumindest weniger „allumfassend“ als in den Hoch-Zeiten kirchlicher Machtentfaltung, als dem Gnadenverteilungsmonopol mit dem Ritual der Exkommunikation auch noch ein Quasi-Verfluchungsmonopol zur Seite stand, das im Verlauf der mittelalterlichen Machtkämpfe zwischen Thron und Tiara von den Päpsten häufig als politische Waffe ge- und missbraucht wurde.
In den Hoch-Zeiten der christlichen Kirche war das kulturelle Bildungs- und das soziale Bedeutungsgefälle zwischen einer geistlichen Elite und der mit ihr zur wechselseitigen Machtsicherung parasymbiotisch verbundenen Machtelite zum „Fußvolk“ der Christgläubigen so groß, dass auch schlimme Missbräuche der in Anspruch genommenen Heiligungs- und Entheiligungsautorität von den jeweils Betroffenen in aller Regel (mehr oder minder demutsvoll) hingenommen werden mussten. Nicht zuletzt das Organisationstalent der – laut Clemensbrief an die Korinther (kurz vor dem Jahr 100 n. Chr.; Papst Clemens I. Romanus wird als der dritte oder vierte Nachfolger des Apostels Petrus als Bischof der römischen Christengemeinde gezählt) nach dem Vorbild der römischen Heeresordnung organisierten – Institution hat dabei eine große Rolle gespielt. Und dies umso mehr, als es der mit dem auratischen Standortvorteil der Metropole gesegneten römischen Zentrale im Lauf der auf die Konstantinische Wende folgenden Jahrhunderte gelang, (fast) alle Christengemeinden nach diesem Organisationsmuster zu organisieren und unter der Oberhoheit des Bischofs von Rom zu integrieren.
Wie wir wissen, hat sich dieses Organisationsmuster im Wesentlichen über annähernd zwei Jahrtausende hin zu erhalten vermocht – eine institutionelle Erfolgsgeschichte par excellence. Nun aber scheint es – zumindest in den westlichen, vergleichsweise aufgeklärten, rechts-, volks- und sozialstaatlich verfassten Gesellschaften an seine Grenzen zu stoßen, weil der „Markenkern“ dieser Institution, ihre Glaubwürdigkeit als Vermittlerin göttlicher Segnungskraft, zusehends dahinschwindet. Mannigfache, insbesondere aber sexuelle Übergriffe von kirchlichen Amtsträgern3, die von der kirchlichen Hierarchie trotz aller Lippenbekenntnisse nicht mit hinreichender Stringenz geahndet, mehr oder minder verharmlost oder gar gedeckt wurden, hat es zwar sicher schon immer gegeben, sie werden aber im Zeitalter hoher Informations- und Kommunikationstransparenz nicht mehr ohne Weiteres hingenommen. Hinzu kommt das innerhalb wie außerhalb der Institution weit verbreitete Unbehagen an dem von Papst Gregor VII. (reg. 1073–1085) aus nachvollziehbaren Gründen eingeführten, jedoch heute nur noch bedingt zeitgerechten Zölibat, sowie auch die im Zeitalter der Gleichberechtigung wachsende Unzufriedenheit christlicher Frauen über ihren Ausschluss vom Priesteramt. Gewürzt wird dieses mehrfach motivierte Unbehagen überdies auch noch durch die Quasi-Zwangseintreibung der Kirchen„steuer“ durch den Staat – ein zwar banales, aber wahrscheinlich für einen Großteil der Kirchenaustritte entscheidend wichtiges Zusatzmotiv. Die Tatsache, dass unter solchen Vorzeichen das Interesse am Priesterberuf stark abgenommen hat und inzwischen sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche ein Priester- bzw. Pfarrermangel eingetreten ist und auch nur bedingt durch den – vielfach kulturelle Akzeptanzprobleme erzeugenden – Priesterimport aus Afrika und Asien hinreichend gedeckt werden kann, führt zu einer weiteren Verschärfung dieses Problems. Und dies, obwohl dieser Weg in den Priesterexport-Ländern selbst dank des Rückstroms von Devisen vielfach noch als eine die Existenz ganzer Großfamilien sichernde (Über-)Lebenschance gilt.
Abb. 1: Clemens von Rom (um 50–97 oder 101); Mosaik aus dem 11. Jahrhundert in der Sophienkathedrale (Kiew)
.
Der in Deutschland und anderen europäischen Ländern auftretende Priestermangel wiederum zwingt die Diözesen und Kirchenprovinzen zur Zusammenfassung von Kirchengemeinden zu „Pfarrgemeinschaften“, was deren Attraktivität zusätzlich mindert, weil sie erhebliche Kommunikations- und Geborgenheitsdefizite aufwirft, die dann anderweitig gedeckt werden müssen. Zu der – vor allem durch die Missbrauchsskandale, neuerdings aber auch noch durch fragwürdiges Verhalten hoher kirchlicher Amtsträger im Zusammenhang mit den Anti-Corona-Impfungen angeheizten – Glaubwürdigkeitskrise gesellt sich also auch noch eine durch andere Faktoren befeuerte allgemeine Attraktivitätskrise der abendländischen christlichen Kirche(n). Der jahrhundertelang für unmöglich gehaltene Zerfall dieser in ihrem Selbstverständnis bis auf den „Jüngsten Tag“, d. h. also bis auf das mit der erhofften Wiederkehr ihres spirituellen Gründers verbundene Große Weltgericht, hin angelegten Institution rückt mithin in den Bereich der Denkbarkeit, wenn nicht Wahrscheinlichkeit. In einem – am 11. Februar 2021 publizierten Interview der „Augsburger Allgemeinen“ mit dem Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Augsburg, Martin Kaufhold, nach eigenem Bekunden selbst Katholik, erklärte dieser rundweg: „Ich gebe der Kirche (in ihrer gegenwärtigen Verfassung) noch 20 Jahre“.
Angesichts der soziokulturellen, sozioökonomischen und soziopolitischen Beharrungskräfte, die die christliche Kirche über die Jahrhunderte hin bewiesen hat, mag diese Prognose (zurückhaltend ausgedrückt) allzu kühn erscheinen, zumal Totgesagte nach einer alten Volksweisheit „länger leben“ und der Amtskirche ihr Ende von einem berühmten Theologen bereits für das Jahr 1260 vorausgesagt worden war … Gänzlich abwegig jedoch ist Kaufholds Prognose dennoch keineswegs, zumal sich auch in der Daseins- und Entwicklungsgesetzlichkeit dieser Institution die Wirkweise des Hermetischen Gesetzes („Wie außen, so innen, wie unten so oben“)4 immer deutlicher manifestiert. Im selben Maße nämlich, in dem sich die Kirche mangels hinreichender Selbstreinigungskraft auf den Modus des freien Falls zu bewegt, gerät für viele, sich der Kirche kraft Sozialisation und Neigung noch immer zugehörig Fühlende und ihr auch noch immer als Mitglieder institutionell Verbundene, nicht nur die Glaubwürdigkeit ihrer Vertreter, sondern auch die Glaubwürdigkeit ihrer theologischen Grundlagen ins Visier kritischen Fragens. Die Vorstellung, dass eine nicht unerhebliche Zahl der angeblich zur Gnadenvermittlung – d. h. also zur Vermittlung göttlichen Wohlwollens und göttlichen Segens – einzig Berufenen, sich dieses ihres vornehmsten Auftrags unwürdig erweisen, lässt auch die ins Herz der Kirche zielende, weil ihre Existenzberechtigung zur Diskussion stellende, Frage nach ihrer Tauglichkeit als Brückenbauerin in die Transzendenz immer lauter werden. Eine Frage dies, die Thomas Münzer (um 1490–1525), ein Vertreter des linken Flügels der Reformation, schon vor einem halben Jahrtausend für sich auf radikale Weise beantwortete, als er ausrief „Was Bibel, Bubel, Babel – man muss in einen Winkel kriechen und mit Gott reden!“5
Auch bei solchem „Reden“ mit Gott wird es wohl in dieser oder jener Weise um die Gewährung von Gnade(n) – aber eben nicht durch Vermittlung irgendwelcher (angeblich) hierzu einzig Berufener gewährte – Gnade(n) gehen. Genau hier jedoch liegt der letztlich über ein auch weiterhin zukunftsfähiges Sein oder Nichtsein der Kirche entscheidende „springende Punkt“. Wenn der kalabresische (zunächst Zisterzienser-, dann Floriazenser-) Abt und Seher Joachim von Fiore (um 1132–1202) in seiner geschichtsphilosophischen Vision von den drei Reichen die Heraufkunft des – auf das alttestamentliche „Reich des Vaters“ und das neutestamentliche „Reich des Sohnes“ folgende „Reich des Heiligen Geistes“ prognostiziert, so eröffnet er bereits an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert den Blick auf den Zerfall der hierarchisch gegliederten Amtskirche und deren (von ihm schon für die Mitte des 13. Jahrhunderts erwarteten) Übergang in eine vom Ideal der Armut geprägte Geistkirche. Im dritten „Reich des Heiligen Geistes“ – so Joachims Erwartung – werden sich dann wahrhaft erleuchtete Christen zu einer Ecclesia spiritualis von ganzheitlich Fühlenden, Denkenden und Handelnden zusammenfinden. Im Grunde sah Joachim von Fiore den mittelalterlichen Homo viator, den Wanderer zu Gott, auf einem unaufhaltsamen und eigenständigen Gnadenweg zur Transzendenz, der die Klerikerkirche samt deren Gnadenvermittlungsmonopol letztlich als Zwischenstation hinter sich zu lassen vermag.6