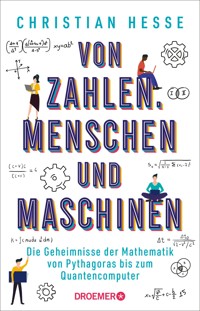12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eine unterhaltsame wie kurzweilige Reise durch die Welt der Zahlen präsentiert von einem Erfolgsduo: Der Mathematik-Professor und Bestseller-Autor Christian Hesse und der beliebte Fernseh-Moderator Karsten Schwanke vermitteln Spaß an Mathematik. Ist Glück beim Lotto spielen berechenbar? Warum ist 2:1 das häufigste Ergebnis beim Fußball? Was ist das Einmaleins der Politik? Christian Hesse und Karsten Schwanke geben Antworten auf diese und viele andere Fragen und präsentieren Praktisches aus der Welt der Mathematik – etwa Tipps und Tricks für die vier Grundrechenarten, eine einfache Eselsbrücke für das Bestimmen von Wochentagen und ein Verfahren, um die Anzahl der Fische in einem Aquarium zu ermitteln. Sie erzählen Faszinierendes über die Bedeutung der Zahlen beim Wetter, in der Pflanzenwelt und in der Medizin und garnieren alles mit mathematischen Rätseln und Wissenswertem über Primzahlen, Bruchzahlen und andere wichtige Zahlen – Wissen light für alle, die Zahlen und die Mathematik lieben. Christian Hesse lehrt als Mathematik-Professor an der Universität Stuttgart. Karsten Schwanke moderiert das "Wetter vor acht" und andere Wettervorhersagen und wurde mit Sendungen wie "Kopfball" und "Abenteuer Wissen" bekannt. 2022 wurde er mit der Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet. Zusammen haben die beiden Autoren in der Sendereihe SMS – Schwanke meets Science ihr Publikum mit mathematischen Phänomenen unterhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Christian Hesse / Karsten Schwanke
Von Glückszahl bis Geheimzahl
Mit Mathe die Rätsel des Alltags lösen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Mathematik-Professor und Bestsellerautor Christian Hesse und der beliebte Fernsehmoderator Karsten Schwanke vermitteln Spaß an Mathematik präsentieren Überraschendes aus der Welt der Zahlen – etwa Tipps und Tricks für die vier Grundrechenarten, die Geheimnisse der Verschlüsselung und die Anordnung von Pflanzenblättern an einem Blumenstängel. Sie erzählen Faszinierendes über die Bedeutung der Zahlen beim Wetter, in der Musik und in der Geographie und garnieren dies alles mit mathematischen Rätseln und Wissenswertem über Primzahlen, Bruchzahlen und andere wichtige Zahlen – Wissen light für alle, die Zahlenspiele und Geschichten über Zahlen lieben.
Inhaltsübersicht
Riskanter Geburtstag
Doppelter Geburtstag
Wer reist, lebt gefährlich
Die Frauenfrage
Warum vertauscht ein Spiegel links und rechts?
Der Fußballgott würfelt
Vielseitig einseitig
Wie viele Fische schwimmen im Teich?
Kombiniere!
Daniels Lieblingszahlen
Jeder hat ein Doppelleben
Meilenweit und metergenau
Die Vermessung der Welt
Von Hackern und Heuschrecken
Die Sonnenblume als Zahlentheoretikerin
Das Ein-Grad-Problem
Gedächtnisakrobatik
Krank oder gesund?
Der Zauber des Papiers
Kopfrechnen leicht gemacht
Der Teiler-Vorteil
Die lustigste Zahl im Universum
Vom Händeschütteln
Wo steckt der Goldbarren?
Null und eins
Nur Bares ist Wahres?
Der Schlüssel zur Geheimzahl
Mathematik des Glücksspiels
Der Code des Kamasutra
Das Wetter in Zahlen
Der Janus-Angriff
Deutsch oder Mathe?
Musik und Mathe
Warum 42?
Die ewige Wiederkehr des Gleichen
Vom Treppen-Trip zur Weltformel
Sofia und die Mathematik
Die Tango-Technik
Riskanter Geburtstag
1:1000000 – ein Millionstel. Es bezeichnet den millionsten Teil von etwas. Handelt es sich dabei um eine Wahrscheinlichkeit, dann ist es der millionste Teil von 100 Prozent Wahrscheinlichkeit. Der millionste Teil von absoluter Sicherheit also. Das ist nicht viel.
Eine naheliegende Frage ist, ob und wie man sich diese winzige Wahrscheinlichkeit vorstellen kann. Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie eine Münze zwanzigmal werfen und jedes Mal kommt Kopf, dann ist ein Ereignis eingetreten, das ziemlich genau diese Wahrscheinlichkeit hat. Halten Sie dieses Münzwurfereignis für extrem unwahrscheinlich? Dann funktioniert Ihre Intuition sehr gut.
Eine andere bildliche Vorstellung ist lebendiger, da wesentlich lebensbezogener. Allerdings hat sie eigentlich nicht direkt mit dem Leben zu tun, sondern vielmehr mit dem Ableben, mit dem Sterben. Denn ein Millionstel ist eine konkrete Sterbewahrscheinlichkeit. Es ist das Sterberisiko eines ottonormalen 25-jährigen Menschen an einem ottonormalen Tag, die Wahrscheinlichkeit im Alter von 25 morgens aufzustehen und den Tag nicht zu überleben. Bei uns in Mitteleuropa, nicht in Kriegs- oder Krisenregionen, in denen die Sterbewahrscheinlichkeit deutlich höher ist. Der Tag unseres 25-Jährigen sollte nicht mit irgendwelchen riskanten Elementen gespickt sein.
Mathematiker können also die Risiken fürs Sterben messen. Sie haben dafür eine Maßeinheit entwickelt, das MikroMort. Mikro ist eine Vorsilbe, die in der Wissenschaft für den millionsten Teil steht. Ein Mikrometer etwa ist der millionste Teil eines Meters, also der tausendste Teil eines Millimeters. Ein normales menschliches Haar misst 50 Mikrometer im Durchmesser, eine Spinnfaser sechs Mikrometer, und die größten Bakterien wachsen bis etwa einen Mikrometer.
Doch wir waren ja bei MikroMort. Mort ist das französische Wort für Tod. Ein MikroMort ist also ein Millionstel statistischer Tod.
Mit 25 stehen die meisten Menschen voll im Leben. Ein normales Leben mit 25 mitten in Europa ist in der Praxis und zum Glück nicht sehr gefährlich. Dabei ist 25 nicht einmal das risikoärmste Lebensalter. Statistisch gesehen ist man dem geringsten Sterberisiko im Alter von zehn Jahren ausgesetzt. Es beträgt ein Viertel MikroMort.
In diesem Alter ist die Säuglingssterblichkeit überwunden, und gefährliche Kinderkrankheiten treten nur noch sehr selten auf. Die Kinder werden von den Eltern noch im Straßenverkehr beaufsichtigt und nehmen noch nicht als rasante Motorradfahrer am Straßenverkehr teil. Im Gegenteil. Helikoptereltern fahren sie sogar zur Schule und holen sie dort auch wieder ab. Hat man sein Pausenbrot vergessen, fahren sie noch mal hin, klopfen ans Klassenzimmer und bringen es dem – natürlich – hochbegabten Sprössling während des Unterrichts, dem das »voll peinlich« ist. Egal: All das macht das Alter von zehn Jahren zum ultimativen Risiko-Paradies: Weniger gab’s nicht und gibt’s nicht.
Von zehn Jahren aus betrachtet steigt die Risikokurve an. In die eine Richtung bis zurück zur Geburt. Und zwar bis hin zum allerersten Tag. Der hat es tatsächlich in sich. Bei der Geburt und kurz danach beträgt das Sterberisiko satte 1300 MikroMort. So riskant ist ein normaler Tag des Lebens erst im Alter von glatten 100 Jahren wieder. Was das Risiko angeht, sind also Säuglinge mit Greisen vergleichbar. Bei uns in Deutschland jedenfalls. In den Entwicklungsländern ist die Säuglingssterblichkeit wesentlich höher, das Risiko größer, und 100-Jährige gibt es dort sehr selten, wenn überhaupt.
Doch wir wollen nicht vorgreifen. Nach dem ersten Tag klingt das Risiko zum Glück ziemlich schnell ab. Ein Jahr später ist es schon auf fünf MikroMort heruntergegangen, nach zwei Jahren sogar auf zwei Drittel MikroMort. Es fällt sogar noch weiter, kontinuierlich geht es bergab bis auf ein tägliches Sterberisiko von einem Viertel MikroMort im zehnten Lebensjahr. Von da an geht es bergauf, und zwar immer. Das Leben wird von nun an riskanter. Das macht hoffentlich niemandem Angst. Wir treffen nur eine ganz sachliche Feststellung.
Mit 25 Jahren erreichen wir den bereits erwähnten Schwellenwert von einem MikroMort. Von da an verdoppelt sich unser Sterberisiko im Schnitt alle sieben Jahre. Mit 32 sind es zwei MikroMort, mit 40 etwa vier MikroMort. Werden wir 60, schultern wir 28 Mikromort, mit 80 sind wir bei 150 angekommen, und mit 90 stehen jeden Tag satte 500 MikroMort dem Weiterleben entgegen. Im goldenen Alter von 100 Jahren sind es wieder 1300 MikroMort.
Vielleicht fragen Sie sich nun, welches der riskanteste Tag eines Jahres ist? Was ist das wahrscheinlichste Todesdatum? Vor welchen Tagen sollten wir uns besonders in Acht nehmen?
Wenn Sie Geburtstage mögen, kommt jetzt eine schlechte Nachricht. Kurioserweise sind es unsere Geburtstage, die das Leben gefährlicher machen. Eine groß angelegte Studie, bei der die Lebensdaten von vielen Millionen Menschen abgeglichen wurden, ergab, dass am eigenen Geburtstag das Sterberisiko gegenüber anderen Tagen des Jahres um 14 Prozent erhöht ist. Das ist bei Frauen und bei Männern übrigens gleich.
Einen interessanten Unterschied gibt es aber zwischen den Geschlechtern. Bei Frauen ist das Sterberisiko am Geburtstag und in der gesamten Woche danach erhöht. Bei Männern dagegen ist es am Geburtstag und in der Woche davor erhöht. Für die Erklärung dieses Effekts muss die Psychologie bemüht werden. Generell bilden Mathematiker und Psychologen ein Dream-Team. Die einen sind Experten fürs Rationale und die anderen fürs Emotionale.
Die Psychologen erklären diesen Umstand so, dass Geburtstage emotionale Ereignisse sind. Bei älteren Frauen sind sie emotional sehr positiv besetzt. Sie freuen sich darauf. In der Regel kommt die Familie zusammen, man sieht sich mal wieder. Meist sind ältere Frauen außerdem mit den Vorbereitungen beschäftigt, was zusätzlich die Vorfreude steigert, positiven Stress ausübt und sie auf diese Weise dynamisiert. Am Geburtstag selbst ist es dann aber oft zu viel mit dem Stress. Ein zu großer Hype. In der Woche danach fällt der positive Stress ab und weicht der Erschöpfung und Ermattung. Ist man nicht mehr ganz jung, kann das für den Körper ziemlich ungut sein. Und den entscheidenden Unterschied machen.
Bei Männern ist das psychologische Muster anders. Für viele ältere Männer sind Geburtstage emotional eher negativ besetzt, meinen die Psychologen. Naht ein solches Datum, wird verstärkt über das Leben reflektiert. Der Mann muss sich eingestehen, dass sich anfängliche Erwartungen nicht erfüllt haben. Was hatte man in der Jugend für Pläne und Träume! Und was ist daraus geworden? Er sieht sich hinter seinen selbst gesteckten Zielen zurückgeblieben.
Bei vielen älteren Männern beherrscht dieses nicht zu unterschätzende Lebensgefühl die Woche vor dem Geburtstag. Die Stimmungslage wirkt sich offenbar bei einigen psychosomatisch aus. Am Geburtstag selbst kommt auch bei Männern eine Dosis ungewohnter Stress dazu. Überdurchschnittlicher Alkoholkonsum und die daraus resultierende erhöhte Unfallgefahr tun ein Übriges.
Im Alter von 90 Jahren mit den per se bestehenden 500 MikroMort an normalen Tagen führen die zusätzlichen 14 Prozent am Geburtstag zu 70 zusätzlichen MikroMort. Kurzum: Für betagte Menschen sind Geburtstage Hochrisikotage.
Nehmen wir nur die wahre Geschichte von drei betagten Brüdern, von denen die beiden älteren ihren 90. Geburtstag feierten und beide am Abend dieses Tages starben. Das veranlasste den Jüngeren der drei dazu, sich zu seinem eigenen 90. Geburtstag jegliche Feier zu verbitten. Alle, die ihm gratulieren wollten, empfing er in den Wochen danach, jeweils nur einzeln und immer nur für eine kurze Zeitspanne. Er wurde über 100 Jahre alt.
Halten wir fest, dass bestimmte Aktivitäten unser Risiko erhöhen. Um wie viel das Risiko steigt, hängt natürlich davon ab, was wir tun und wie wir es tun. Dazu später mehr.
Doppelter Geburtstag
Was glauben Sie? Wie viele Menschen müssten Sie zusammenbringen, damit die Chance 50:50 ist, dass mindestens zwei Personen (unabhängig vom Alter) am gleichen Tag Geburtstag haben? Also am gleichen Tag und im gleichen Monat?
Wir verraten es Ihnen. 23!
Die erste Reaktion der meisten Leute ist: »Wie, nur so wenige?« Wir glauben eigentlich, dass viel mehr Personen nötig wären. Sollte die Chance 100 Prozent betragen, bräuchten wir immerhin 366 Menschen, damit zwei am gleichen Tag Geburtstag haben. Lassen wir Schaltjahre unter den Tisch fallen und streichen den 29. Februar, haben wir ein Jahr mit 365 Tagen. Damit sicher eine Person mit einer anderen Person Geburtstag feiert, brauchen wir also 365 + 1 Personen, das macht 366.
Doch bereits 23 Leute reichen für eine 50-prozentige Chance, dass darunter zwei Menschen mit dem gleichen Geburtstag sind. Eine kleine Umkehrrechnung bestätigt das.
Wie wahrscheinlich ist es, dass alle 23 Personen verschiedene Geburtstage haben? Die erste Person hat irgendeinen Geburtstag. Dann bleiben für die zweite Person noch 364 Möglichkeiten und eine Wahrscheinlichkeit von 364/365, dass sie an einem anderen Tag Geburtstag feiern kann. Für die dritte Person verbleiben 363 Tage und die Wahrscheinlichkeit von 363/365 für einen eigenen Geburtstag. So geht es weiter bis zur 23. Person mit der Wahrscheinlichkeit 343/365.
Jetzt multiplizieren wir all diese Wahrscheinlichkeiten, also alle Brüche. Was kommt dabei am Ende heraus? 0,5!
Eine Wahrscheinlichkeit von 0,5 bedeutet eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für die Chance, dass alle 23 Geburtstage verschieden sind. Daraus ergibt sich auch eine 50-prozentige Chance auf das Gegenteil, dass nämlich mindestens zwei Geburtstage gleich sind.
Das wiederum bedeutet, dass im Schnitt bei jedem zweiten Fußballspiel mit 2 x 11 Spielern plus 1 Schiedsrichter auf dem Feld zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag feiern. Nehmen wir doch mal die 23 Spieler, die Jogi Löw für die Fußball-WM 2018 nominiert hatte. Tatsächlich: Niklas Süle und Jerome Boateng haben am gleichen Tag Geburtstag, am 3. September.
Leider hat das, wie wir alle wissen, nicht zum Weltmeistertitel gereicht, aber das wollen wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen.
Wer reist, lebt gefährlich
Der bzw. die Durchschnittsdeutsche ist 43 Jahre alt, heißt mit Nachnamen Müller und mit Vornamen Thomas oder Sabine. Das waren die häufigsten Vornamen Mitte der 1970er-Jahre. Jedes Jahr macht er oder sie eine Urlaubsreise von mehr als 5 Tagen, die 1100 Euro kostet. Dazu kommen Kurzurlaube mit bis zu vier Tagen, die sich 2018 bei allen Deutschen zu 88 Millionen Reisen addierten und insgesamt 23 Milliarden Euro kosteten.
Das beliebteste Urlaubsland der Deutschen ist Deutschland. 27 Prozent der Deutschen verbrachten ihren Urlaub letztes Jahr im Inland, gefolgt von Spanien (14 Prozent), Italien (8 Prozent), der Türkei und Österreich (je 5 Prozent).
45 Prozent der Deutschen fahren mit dem Auto in den Urlaub, 41 Prozent steigen in einen Flieger, und je 6 Prozent nehmen Bus oder Bahn.
Für die große Mehrheit der Deutschen spielt Sicherheit beim Reisen und im Urlaub die wichtigste Rolle. Sie will sich keinen unnötigen Reiserisiken aussetzen. Doch unser Leben ist gespickt mit Risiken. Und das Leben ist irgendwie auch eine Reise.
Der lateinamerikanische Schriftsteller Jorge Luis Borges hat in einer schönen Geschichte einmal das Leben als »Pfad im Garten der sich gabelnden Wege« bezeichnet. An den Gabelungen können wir uns für den einen oder einen anderen Weg entscheiden. Aber manchmal haben wir gar keine Entscheidungsfreiheit. Dann werden wir vom Schicksal einfach irgendwo hingeschoben.
Eine Reise als Pfad in einem Garten der sich gabelnden Wege. Das ist sehr poetisch ausgedrückt. Weniger poetisch als ein Dichter würde es eine DIN-Norm sagen, die es ja heutzutage für alles gibt. Die würde möglicherweise so lauten: Eine Reise ist eine der Erreichung eines bestimmten Ziels dienende Fortbewegung über eine gewisse Entfernung.
Na gut, die Reise unseres Lebens beginnt mit der Geburt. Klar, auch die Geburt lässt sich als ein Stück dieser Reise auffassen. Und auch als ein Stück Risiko. Für die allermeisten von uns ist es die gefährlichste Aktivität, die wir je machen, das gefährlichste Stück Weg, das wir je zurücklegen, um es einmal so auszudrücken. Doch was wäre die Alternative?
Leben ist nun mal lebensgefährlich. Das ist erst einmal nur eine qualitative Einschätzung. Mathematiker aber lassen nicht eher locker, bis sie es genau sagen können. Wann ist was wie gefährlich? Und was heißt hier ungefährlich?
An anderer Stelle hatten wir das MikroMort als Maß für das Risiko erwähnt, das die Mathematiker benutzen, um Sterberisiken altersspezifisch zu messen. Und zwar auf einer Skala mit einem Zahlenwert und einer Einheit. Ein 25-Jähriger hat an einem normalen Tag ein Sterberisiko von 1:1000000. Das ist genau 1 MikroMort.
Man kann dieses Maß auf jede andere Aktivität anwenden. Eine Aktivität hat ein Risiko von 1 MikroMort, wenn man bei ihrer Ausübung mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million stirbt.
Nehmen wir das Rauchen. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass es ungesund ist. Aber wie ungesund eigentlich genau? Wie viele Zigaretten kann ich an einem Tag rauchen, bis ich ein weiteres Risikopaket von 1 MikroMort angesammelt habe? Die Antwort gibt zu denken: Es sind nur drei Zigaretten. Das ist nicht viel. Drei Kippen am Tag, und unser ottonormaler 25-Jähriger belastet sich mit einem weiteren MikroMort Sterberisiko. In seinem Fall bedeutet es sogar, dass er sein Tagesrisiko verdoppelt.
Rauchen ist ein nachgewiesener Risikofaktor für Lungenkrebs, und der verkürzt unser Leben. Wer mit 17 Jahren anfängt, jeden Tag 15 Zigaretten zu rauchen, verkürzt sein Leben statistisch gesehen um volle 7 Jahre.
Dass diese Tatsache nicht bei allen Menschen die beabsichtigte Wirkung hat, liegt daran, dass jeder jemanden kennt, der sein ganzes Leben geraucht hat wie ein Schlot und trotzdem steinalt geworden ist. Sie bestimmt auch, oder? Wie zum Beispiel Helmut Schmidt. Wir vergessen dabei gern, dass das seltene Einzelfälle sind.
Die Statistik der großen Masse spricht eine andere Sprache. Was sagt sie uns genau?
Rechnet man die 7 Jahre eingebüßter Lebenszeit aufgrund von 15 täglichen Zigaretten seit der Jugend auf eine einzelne Zigarette um, dann verkürzt jede Zigarette das Leben um 10 Minuten. 10 Minuten hergeben, um 20-mal an einem Glimmstängel zu ziehen? Für einen fraglichen Genuss, der noch dazu die Lunge teert? Hm.
Die drei Zigaretten, mit denen sich der Raucher ein weiteres MikroMort aufbürdet, verkürzen sein Leben demnach um 30 Minuten. Bei normaler Lebenserwartung ist das etwa der millionste Teil des Lebens. Der britische Statistiker David Spiegelhalter hat für diese Zeitspanne deshalb den Begriff »MikroLife« eingeführt, also MikroLeben. Das erlaubt die kompakte Faustregel: Ein zusätzliches MikroMort kostet ein MikroLeben.
Das kann man sich auch so klarmachen. Was heißt das für unseren durchschnittlichen 25-Jährigen? Sein Tagesrisiko beläuft sich auf ein MikroMort. Das wissen wir schon. Was macht dieses Risiko mit seiner Lebenserwartung?
Nun, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Millionstel ereilt ihn der statistische Tod, und sein Leben endet. Mit der Gegenwahrscheinlichkeit von 999999 Millionstel passiert nichts, und er hat die normale weitere Lebenserwartung, die man mit 25 Jahren hat. Das sind 55 weitere Jahre. Insofern verkürzt das eine MikroMort die Lebenserwartung um 1 Millionstel von 55 Jahren, was wiederum 30 Minuten sind, also 1 MikroLife.
Rauchen ist natürlich nicht das einzige Laster, dem man frönen kann und für das man mit einer statistischen Portion seines Lebens zahlt. Trinken Sie jeden Tag einen halben Liter Bier? Das hat dieselbe Wirkung. Selbst an sich nützliche Unternehmungen wie eine Röntgenaufnahme kosten aufgrund möglicher Spätfolgen (Krebs) 1 MikroLeben. Ebenso verhält es sich mit jedem einzelnen Tag, an dem Sie 5 Kilogramm Übergewicht mit sich herumschleppen.
Sogar ein Marathonlauf, der nach verbreiteter Ansicht eigentlich gesund ist, hat es in sich. Nicht nur die ganze Plackerei und der Stress für Knie- und Fußgelenke, sondern Sie bekommen darüber hinaus satte 7 MikroMort aufs Risikokonto gebucht. Eine Entbindung ist für die Mutter mit 120 MikroMort zu veranschlagen, ein Kaiserschnitt mit 170. Das ist ein recht beachtliches Risiko, trotz der modernen Medizin. Zum Vergleich: Ein Tag als Soldat in Afghanistan schlägt vergleichsweise nur mit 33 MikroMort zu Buche.
In einem anderen Beitrag haben wir erklärt, dass bei 90-Jährigen allein das Feiern des Geburtstages 70 zusätzliche MikroMort ausmacht. Rein risikotechnisch entspricht das zwei Tagen als Soldat in Afghanistan. Hätten Sie die Wahl zwischen beidem, würden Sie nicht auch lieber Ihren Geburtstag feiern und es dabei richtig krachen lassen?
Es geht uns nicht darum, Risiken auf die leichte Schulter zu nehmen. Oder jedenfalls nur ein wenig. Vielmehr soll die Vermessung der Risiken bei uns allen zu einer Risiko-Mündigkeit führen. Etwa auch in Bezug auf das Reisen. Womit wir wieder beim Thema wären.
Sie kennen die Frage, was das sicherste Beförderungsmittel ist? Flieger, Bahn oder Auto? Mit der Messgröße MikroMort kann man diese Frage beantworten. Dazu müssen wir wissen, wie viele Kilometer wir jeweils zurücklegen können, um ein weiteres MikroMort anzusammeln. Beim Autofahren sind das nur 500 km, beim Bahnfahren 10000 km, und als Passagier im Flugzeug stellt sich diese Risiko-Portion erst nach 12000 km ein.
Dramatisch anders verhält es sich beim Motorradfahren. Dabei haben Sie wahrscheinlich ohnehin vermutet, dass motorisierte Zweiräder nicht ungefährlich sind. Und tatsächlich, alle 40 km einer flotten Motorradfahrt kommt ein weiteres MikroMort zusammen. Aber hätten Sie gedacht, dass das beim Fahrradfahren schon nach 15 km der Fall ist? Wahrscheinlich nicht.
Die Zahlen verraten uns, dass Fliegen rein risikotechnisch scheinbar am sichersten ist. Das ist auch fast richtig, aber eben nur fast. Das Fliegen liegt nur auf Platz 2. Es gibt Beförderungsmittel, die noch mehr Sicherheit bieten, das sind Aufzüge. Aufzugfahren ist noch sicherer als Fliegen. Doch man kommt leider so schlecht mit einem Aufzug in den Urlaub. Außer, man will den auf der Dachterrasse eines Hochhauses verbringen. Vielleicht ist diese Überlegung der Anfang von einem neuartigen Geschäftsmodell, eine kreative Urlaubsidee für ganz besonders risikoscheue Naturen.
Fazit: Ein Leben ohne Risiko ist unmöglich, selbst wenn Sie sich in die sprichwörtliche Watte packen. Das killt dann aber auch die Lebensfreude. Sinnvolle Lebensgestaltung besteht für jeden von uns darin zu entscheiden, welche Risiken wir möglichst vermeiden wollen und welche wir für den Spaß am Leben bereit sind einzugehen. Wer das kompetent machen möchte, muss die Risiken richtig einschätzen. Dabei haben wir hoffentlich ein bisschen geholfen.
Warum vertauscht ein Spiegel links und rechts?
Hm, das ist eine interessante Frage. Aber sie ist leider falsch. Ja, auch Fragen können falsch sein, nämlich falsch gestellt. Wie in diesem Fall. Denn sie geht offensichtlich davon aus, dass ein Spiegel tatsächlich links und rechts vertauscht. Aber tut er das wirklich?
Es gibt übrigens viele Menschen, die das denken. Vielleicht ist es sogar die Mehrheit. Wenn Sie zu dieser Mehrheit gehören, dann wundern Sie sich möglicherweise, warum ein Spiegel nicht auch oben und unten vertauscht?
Dass er das nicht tut, könnte natürlich an uns liegen. Etwa daran, dass unsere Augen nebeneinander angeordnet sind und nicht übereinander. Aber so einfach ist es nicht. Denn wenn wir ein Auge schließen und nur durch das andere schauen, sehen wir immer noch dasselbe Spiegelbild. Auch Menschen, die zeitlebens nur ein funktionierendes Auge hatten, haben bei Spiegeln denselben Eindruck wie wir. Es passiert etwas mit links/rechts, aber nicht mit oben/unten.
Würde ein Spiegel jedoch nur links und rechts vertauschen, wäre das wirklich kurios, nicht wahr? Dann würde er die Waagerechte anders behandeln als die Senkrechte. Wir müssten uns fragen, woher er weiß, was senkrecht und was waagrecht ist. Denn er ist in seinen beiden Ausdehnungsrichtungen völlig gleich gebaut. Außerdem würde sich der Effekt mitdrehen, wenn wir den Spiegel aus der vertikalen Position auf die Seite legen. Das ist aber nicht der Fall. Wenn Sie Lust haben, können Sie das ja ausprobieren.
Nach diesem ganzen Vorspiel wollen wir Sie nun nicht länger auf die Folter spannen. Kommen wir zur Auflösung des sogenannten Spiegelparadoxons. Da können wir Ihnen guten Gewissens versichern, dass Spiegel wenig paradox sind. Denn der Spiegel vor uns an der Wand vertauscht weder links und rechts noch oben und unten.
Beides nicht!
Sie sind nicht einverstanden mit dieser Behauptung? Dann werden wir versuchen, sie plausibel zu machen.
Zeigt jemand, der in den Spiegel schaut, mit seinem linken Arm nach links, dann zeigt auch im Spiegelbild sein Arm – vom Original aus betrachtet, also von der Person vor dem Spiegel aus gesehen, nach links. Entsprechend verhält es sich, wenn sie mit dem rechten Arm nach rechts zeigt. Also kein Vertauschen.
Aber was tut ein Spiegel dann? Denn irgendetwas passiert offensichtlich. Das wird deutlich, wenn wir ein beschriebenes Blatt Papier vor den Spiegel halten. Die Schrift geht in Spiegelschrift über, und man kann sie nur noch schlecht oder gar nicht mehr lesen. Dass wir meinen, da sei etwas komisch mit links und rechts, beruht auf einer psychologischen Täuschung.
Und jetzt kommt’s! Ein Spiegel vertauscht vorne und hinten! Im Ernst. Das können Sie am einfachsten nachvollziehen, wenn Sie mit einem Zeigefinger auf den Spiegel zeigen. Dann ist im Original, also bei Ihnen und auch von Ihnen aus gesehen, Ihre Fingerspitze hinten und der Anfang des Fingers davor, also näher bei Ihnen.
Vom Spiegelbild zeigt ein Finger auf Sie zurück. Beim Finger im Spiegelbild ist von Ihnen vor dem Spiegel aus gesehen die Fingerspitze vorn, also näher an Ihnen, als der Anfang des Fingers, der dahinter ist. In der virtuellen Welt des Spiegels ist es demnach genau andersherum als in der richtigen Welt vor dem Spiegel.
Und was ist mit der Schrift im Spiegel?
Im Spiegel sieht man das gleiche Bild von der Schrift, als ob man sie durch ein sehr dünnes Blatt Papier von hinten betrachtet. Der Spiegelschrifteindruck entsteht also ebenfalls durch das Vertauschen von vorne und hinten.
Damit ist aber noch nicht alles geklärt. Denn wir würden gerne noch verstehen, woher die Täuschung kommt, dass ein Spiegel scheinbar links und rechts vertauscht.
Diese Täuschung verursachen wir selber. Sie findet in unserem Kopf statt. Weil wir uns in die Person im Spiegel hineinversetzen. Immer, wenn uns jemand so gegenübersteht wie die Person im Spiegel, dann befindet sich dessen linke Hand unserer rechten Hand gegenüber und die rechte Hand unserer linken.
Da wir selbst diese Person im Spiegel sind, stellen wir uns vor, wie wir in eine solche Position geraten könnten. Nämlich, indem wir uns auf einem Halbkreis um 180 Grad um eine vertikale Achse drehen. Dabei kehren sich alle Links-rechts-Verhältnisse um. Denn die hängen davon ab, wie man steht.
Oben und unten bleiben aber unverändert, denn unten ist der Boden, auf dem wir stehen, und oben ist immer in Richtung Himmel. Das bleibt auch bei einer Drehung um eine vertikale Achse so.
Also: Die Vertauschung von vorne und hinten, die der Spiegel einfach dadurch betreibt, dass er Licht reflektiert, entspricht in unserem Kopf einer Drehung um 180 Grad auf einem Halbkreis um eine vertikale Achse.
Sind Sie damit zufrieden? Oder sollen wir noch ein bisschen über Spiegelbilder nachdenken?
Sehen wir uns zum Beispiel Löffel an. Die spiegeln auch unser Bild. Wenn wir auf die Innenseite des Löffels schauen, entdecken wir das Bild unseres Kopfes, für mehr ist kaum Platz, und zwar diesmal auf dem Kopf. Vom Löffel werden tatsächlich oben und unten vertauscht.
Weil die Löffelinnenseite eine andere Art von Spiegel ist. Ein Hohlspiegel – wegen der Krümmung. Dieser Hohlspiegel wirft das Licht schräg zurück. Und zwar so, dass das Licht von unserem Kinn dahin gespiegelt wird, wo die Stirn ist, und umgekehrt.
Eine Umkehrung gibt es jedoch sogar bei glatten spiegelnden Flächen, wenn sich die vor uns auf dem Boden befinden. Dort liegen Spiegel normalerweise selten. Ein Bergsee tut’s auch! Wenn Sie an seinem Ufer stehen, zeigt sich derselbe Effekt. Der Berg hinter dem See hängt scheinbar mit der Spitze nach unten im Wasser.
Das liegt daran, dass Licht von der Bergspitze auf die Wasseroberfläche trifft, von dort gemäß Reflexionsgesetz (Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel) auf unsere Netzhaut weitergeleitet und vom Gehirn zu einem Bild verarbeitet wird.
Unser Gehirn weiß aber nichts von der Umlenkung des Lichtstrahls und setzt ihn einfach rückwärts auf geradem Wege durch die Wasseroberfläche hindurch fort. Die Bergspitze scheint für uns unter Wasser zu sein. Warum? Die tiefer liegenden Teile des Berges senden Licht aus, das in kleineren Winkeln auf die Wasseroberfläche trifft. Weshalb das Bild in unserem Kopf weniger tief im Wasser zu sein scheint. So sehen Sie ein Spiegelbild, das zwar seitenrichtig, aber höhenvertauscht ist.
Solche Arten von Spiegeln waren wahrscheinlich die ersten, die vor vielen Tausend Jahren unsere Vorfahren betrachtet haben. Vielleicht haben sie sich damals gewundert, warum das Bild im See auf dem Kopf steht. Wir wundern uns heute eher über unsere Wandspiegel, die scheinbar links und rechts vertauschen. So ändern sich die Zeiten.
Sie wissen jetzt, dass jeder Spiegel seine Kunststücke dadurch ausführt, dass er Licht reflektiert. Dinge, die das gesamte Licht reflektieren, sehen für uns weiß aus. Deshalb sollte ein idealer Spiegel eigentlich die Farbe Weiß haben. Dann würde er alle Wellenlängen von Licht vollständig reflektieren.
Doch ein realer Spiegel reflektiert das Licht nicht vollständig. Einige wenige Prozent werden vom Spiegel geschluckt und nicht wieder abgegeben. Dieser Reflexionsanteil hängt ein bisschen von der Wellenlänge des Lichts ab.
Am stärksten reflektiert ein Spiegel das Licht mit der Wellenlänge von 510 Nanometern. Wenn Licht dieser Wellenlänge in unsere Augen fällt, sehen wir die Farbe Grün. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Wellenlängen beim Reflexionsanteil ist allerdings so klein, dass uns ein Grünschimmer beim Spiegel meist nicht auffällt.
Anders ist es, wenn wir zwei Spiegel so anordnen, dass sie sich parallel gegenüberstehen. Diese Anordnung heißt Unendlichkeitsspiegel. Denn das vom ersten Spiegel gespiegelte Licht wird auf den zweiten zurückgespiegelt, dann wieder auf den ersten. Das geht endlos so weiter. Es bildet sich ein Spiegeltunnel, in dem bei wiederholter Reflexion die am stärksten reflektierte Wellenlänge von 510 Nanometern immer dominanter wird, sodass die Bilderfolge für uns zunehmend ein bisschen grüner wird.
Wenn Sie also jemand fragen sollte, welche Farbe ein Spiegel hat, können Sie sagen, ohne mit der Wimper zu zucken: Grün! Uns hat allerdings bisher noch keiner gefragt.
Der Fußballgott würfelt
Ist Elfmeterschießen eigentlich gerecht? Das ist so eine Frage, die sich jeder Fußballfan irgendwann stellt. Bevor wir uns um die Antwort kümmern, betrachten wir zuerst einmal das Spielfeld aus mathematischer Sicht. Wissen Sie, warum das Tor genauso groß ist, wie wir es kennen? Warum der Strafstoß vom Elfmeterpunkt geschossen wird?
Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir den Blick Richtung England richten, ins Mutterland des Fußballs, und uns mit englischen Längenmaßen beschäftigen. Das Tor hat eine Breite von 7,32 Metern, womit natürlich niemand etwas anfangen kann, dem das metrische Längensystem vertraut ist. Umgerechnet sind es genau 8 Yards – und schon ergibt die Größe des Tors einen Sinn. Natürlich hat auch der Elfmeterpunkt englische Wurzeln. 12 Yards sind exakt 10,97 Meter. Genau genommen dürfen die Spieler das »Spielgerät« also 3 Zentimeter dichter ans Tor legen, als wir bisher dachten.
Das ändert allerdings nichts an dem Zweifel daran, ob Elfmeterschießen gerecht oder ungerecht ist. Offensichtlich haben alle dieselben Bedingungen. Gleiches Tor, gleicher Abstand des Elfmeterpunktes, gleicher Ball.
Doch statistische Untersuchungen vieler Tausend Elfmeterschüsse zeigen ein anderes Bild. Das Team, das den Münzwurf gewinnt, sollte zuerst schießen, es hat dann eine 60:40-Chance, das Elfmeterschießen zu gewinnen.
Natürlich ist Sport eine Mischung aus Können und Glück. Aber Big Data hat natürlich auch hier Einzug gehalten und offenbart interessante Aspekte, nicht nur für uns, sondern auch für Spieler und Trainer.
Fußball ist grundsätzlich ein Fifty-fifty-Spiel. Jedes zweite Tor hat einen großen Zufallsanteil, war ein Abpraller oder ging erst von Latte oder Pfosten ins Netz.
Der Zufall beim Fußball ist von ganz besonderer Struktur, die auch in anderen Zusammenhängen auftritt. Tore fallen so, wie Blitze in einer Region oder Verkehrsunfälle in einer Stadt vorkommen. Es gibt oft nur wenige Tore oder Blitze, selten aber auch mal viele. Diese Art von Zufall ist nach dem französischen Mathematiker Siméon Denis Poisson benannt und als »Poisson-Verteilung« bekannt.
Faszinierend daran ist, dass allein mit den Mittelwerten die Anteile von Mehrfachereignissen bestimmt werden können. In der Bundesliga gibt es im Mittel 2,9 Tore pro Spiel (1,65 fürs Heimteam, 1,25 für den Gast). Gemäß Poisson sollten deshalb 6 Prozent der Spiele torlos enden, in 16 Prozent sollte ein Tor, in 23 Prozent zwei Tore und in 22 Prozent drei Tore fallen etc. In der Wirklichkeit enden 7 Prozent torlos, und 14 Prozent bzw. 24 Prozent bzw. 22 Prozent enden mit einem, zwei bzw. drei Toren.
Die nach der Poisson-Rechnung häufigsten Ergebnisse sind 1:1 (11,4 Prozent) und 2:1 (9,3 Prozent). In der Realität treten diese Spielausgänge mit 11,6 und 9,0 Prozent auf. Es herrscht also insgesamt eine fantastische Übereinstimmung zwischen mathematischer Theorie und spielerischer Praxis.
Einstein meinte zwar, Gott würfelt nicht. Den Fußballgott aber kann er damit nicht gemeint haben, denn der würfelt mit einem Poisson-Würfel.
Vielseitig einseitig
Einseitig hat als Wort einen negativen Touch. Vielseitig hört sich jedenfalls bedeutend besser an. Nun gut, das mag sein. Wir möchten Ihnen zeigen, dass Einseitigkeit etwas unglaublich Faszinierendes sein kann. Sogar dann, wenn das Thema mit der Mathe-Brille betrachtet wird.
Na, dann los. Starter, die Fahne!
Stellen Sie sich einen Würfel vor, einen ganz normalen Spielwürfel. Jeder weiß, dass der sechs Seiten hat. Ecken und Kanten natürlich auch, acht Ecken und zwölf Kanten. Das lässt sich leicht gedanklich abzählen. Jede Kante trennt zwei benachbarte Seiten.
Es gibt natürlich Objekte, die haben gar keine Ecken und nur eine Kante. Kreise zum Beispiel. Doch uns interessieren nicht die Ecken oder Kanten. Sondern die Seiten. Speziell und im wahrsten Sinne des Wortes die Einseitigkeit. Wenn ich etwas Kreisförmiges aus Papier ausschneide, dann entsteht eine Fläche, die zwei Seiten hat. Das scheint bei Flächen das Minimum zu sein.
Schwer vorstellbar, dass es Objekte mit nur einer Seite gibt, oder? Wie sollten die aussehen?
Weil die Frage schon im Raum steht, wollen wir sie gleich anpacken und die Antwort liefern. Wir basteln uns ein einseitiges Objekt. Beweisen durch Basteln. Hier kommt die Bastelanleitung.
Man nehme einen langen dünnen Papierstreifen. Der und ein bisschen Klebstoff genügen als Requisiten. Kleben Sie Ihren Papierstreifen entlang der Schmalseiten zusammen. Also fein säuberlich eine Schmalseite ein Stück weit über die andere legen und kleben. Dann haben wir … ach: ein Stück von einem Zylinder. Und der hat ja doch zwei Seiten! Eine Innenseite und eine Außenseite. Erster Versuch gescheitert. Aber es war ja erst der erste Versuch.
Alles auf Anfang. Nehmen Sie einen langen, dünnen Papierstreifen, führen Sie die beiden schmalen Enden aneinander. Bevor Sie sie etwas übereinanderlegen, verdrehen Sie das eine Ende um 180 Grad, also um eine halbe Drehung. Dann die Enden zusammenkleben. Fertig. Schneller als die Fünf-Minuten-Terrine.
Jetzt haben wir einen verdrillten Gegenstand vor uns. Wie sieht’s bei dem mit der Seitenanzahl aus? Die ist gar nicht so leicht festzustellen, aber wir haben einen Trick im Köcher. Nehmen Sie einen Stift, setzen Sie ihn irgendwo mittig auf den Streifen und ziehen Sie entlang der Mitte eine Linie. Einfach gnadenlos immer weiter ziehen, bis Sie wieder am Ausgangspunkt sind.
Wenn wir jetzt den Streifen inspizieren, ist die eingezeichnete Linie überall in der Streifenmitte vorhanden, egal, ob ich mir eine Stelle anschaue oder den Streifen umdrehe. Das kann nur eines bedeuten: Unser Objekt hat nur eine einzige Seite.
Ist das sicher? Ja, denn beim Zeichnen der Linie sind wir nie an den Rand gekommen, sind nie darüber hinweggegangen und haben anschließend auf dem gegenüberliegenden Stück weitergezeichnet. Es ist offensichtlich so: Setzen wir den Stift auf einem beliebigen Punkt der Fläche auf, erreichen wir durch Entlangfahren auf dem Streifen jeden beliebigen Punkt der Fläche einschließlich der gegenüberliegenden Punkte ohne Randüberquerung. Das kann nur bedeuten, dass das Ding einseitig ist. Wie krass ist das denn!!
Diese einseitige Fläche im dreidimensionalen Raum ist das Möbius-Band. Benannt wurde es nach dem Leipziger Mathematiker August Ferdinand Möbius (1790–1868), der sich 1858 intensiv damit beschäftigte. Um genau zu sein, wollen wir erwähnen, dass der Göttinger Mathematiker Johann Benedict Listing (1808–1882) dieses Band zwei Monate früher als Möbius beschrieb. Wahrscheinlich waren auch diese beiden Mathe-Macher nicht die Ersten, die einen Streifen Papier verdreht und zusammengefügt haben. Doch keiner hatte vor ihnen daraus ein mathematisches Forschungsobjekt gemacht.
© Yesaulov Vadym/Shutterstock.com
Das Möbius-Band ist das einzige bekannte Objekt im Universum, das nur eine einzige Seite hat. Ein super Alleinstellungsmerkmal!
Wäre das alles, was über Möbius-Bänder gesagt werden könnte, wäre es auch schon faszinierend genug. Doch wir wollen uns noch ein paar weitere Gedanken machen.
Und zwar erst mal fragen, ob das Ganze nur eine mathematische Kuriosität ist oder ob es vielleicht sogar praktische Anwendungen dafür gibt?