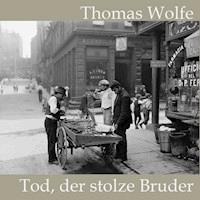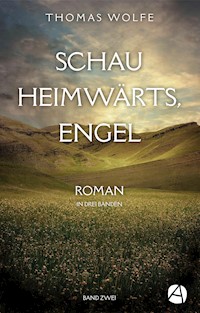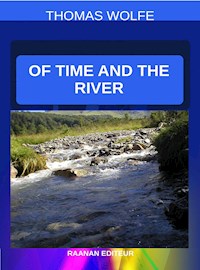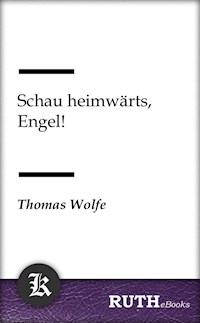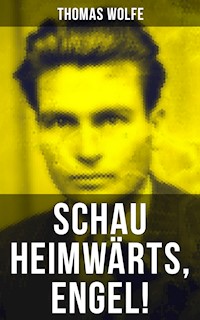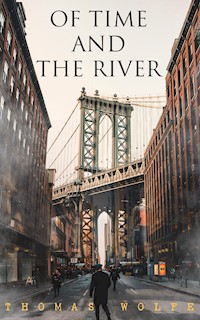Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Thomas Wolfes 'Von Zeit und Strom' ist ein epischer Roman, der die Geschichte des jungen George Webber erzählt, der versucht, sich in der Welt der Literatur und des Lebens zurechtzufinden. Das Buch ist bekannt für seinen ausführlichen Stil und seine detaillierte Darstellung von Webbers inneren Gedanken und Gefühlen. Wolfe gilt als einer der wichtigsten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts, der die literarische Welt mit seinem innovativen Ansatz und seinem einzigartigen Stil beeinflusst hat. Sein meisterhaftes Werk fängt die Turbulenzen der menschlichen Existenz ein und erforscht die Themen Identität, Liebe und Verlust auf tiefgründige Weise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1897
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von Zeit und Strom
Inhaltsverzeichnis
Wer weiß, ob der Odem des Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes unterwärts unter die Erde?
Maxwell Evarts Perkins
dem großen Redakteur und dem tapferen, ehrenhaften Mann, der dem Verfasser dieses Buches in Zeiten der bittern Hoffnungslosigkeit unentwegt beistand und es nicht zuließ, daß dieser seinen Zweifeln unterlag, ist das Werk, das »von Zeit und Strom« heißen soll, gewidmet, in der Hoffnung, daß es als Ganzes der ergebenen und geduldigen Betreuung wert sei, die der standhafte Freund jedem seiner Teile angedeihen ließ, so sehr, dass ohne diese Betreuung keiner dieser Teile hätte geschrieben werden können.
»Kriton, mein lieber Freund Kriton, dies, glaube mir, dies ist es, was ich zu hören scheine, so wie die Korybanten Flötengetön in den Lüften hören, und der Klang jener Worte hallt und widerhallt mir im Ohr, und etwas anderes vermag ich nicht zu vernehmen.«
Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, Kennst Du es wohl? Dahin! Dahin Möcht' ich mit Dir, o mein Geliebter, ziehn!
Kennst Du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man Dir, Du armes Kind, getan? Kennst Du es wohl? Dahin! Dahin Möcht' ich mit Dir, o mein Beschützer, ziehn!
Kennst Du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Flut:
Erstes Buch Orest: Flucht vor der Wut
... vom immerwährenden Wandern und abermals von der Erde ... von der Aussaat, der Blust und dem fallmürben Herbst. Und von Blumen, den großen, den üppigen, den seltsam unbekannten Blumen.
Wo rasten die Wegmüden? Wann kehren die Einsamen heim? Wer von uns findet seinen Vater und kennt ihn am Gesicht? Wann wird das sein, wo und in welchem Land? Wo? Dort, wo die Wegmüden ruhen können, wo die Herzmüden Frieden finden können, wo der Aufruhr und das Fieber und das Getriebe auf immer erstummt sind.
Wer besitzt denn die Erde? Haben wir sie gewollt, um auf ihr zu wandern? Haben wir ihrer bedurft, um nie auf ihr still zu sein? Wer der Erde bedarf, soll sie haben. Er soll still sein auf ihr; in einem Erdfleck soll er ruhn, in einem Erdeckchen auf immer hausen.
Hat er geglaubt, ihm seien tausend Zungen vonnöten, so daß er deshalb auf die Suche ging durch den Lärm und Schreck von tausend tobenden Straßen? Keine Zunge mehr soll er vonnöten haben, denn einer Zunge bedarf er nicht, um still zu sein mit der Erde. Kein Wort mehr soll er sprechen mit wurzelfasrigem Mund; das kalte Aug der Schlange wird auslugen für ihn aus den Höhlen des Schädelbeins; das Herz, dem der Weinstock entquillt, schreit keinen Schrei.
Die Tarantel kraucht durch die verwitterte Eiche; die Natter lispelt gegen die Brust, Trinkschalen fallen ... auf immer aber dauert die Erde. Die Blume der Liebe lebt in der Wildnis; und Ulmwurzeln umklammern die Gebeine begrabener Liebespaare.
Die tote Zunge verwest, es verrottet das tote Herz, blindes Gewürm frißt sich durchs Fleisch der Begrabenen ... auf immer aber dauert die Erde. Das Haar auf der Brust des Begrabenen hat ein Wachstum wie der April, und aus den Höhlen des Schädelbeins kommen die Todesblumen, die unverderblichen, auf.
O Blume der Liebe, deren Lippen uns tranken unterwärts in den Tod, ding-ferne, ding-flüchtige Du, die unsere zwanzigtausend Tage bezaubert! – ins Hirn schießt Wahnsinn und das Herz krampft sich und bricht bei deinem Kuß! – Ruhm aber, Ruhm und abermals Ruhm! Du überdauerst! – Unsterbliche Liebe – allein und gepeinigt in der Wildnis schrien wir nach Dir; abwesend warst Du uns Einsamen nicht.
I
Vor ungefähr fünfzehn Jahren, zu Ende der zweiten Dekade dieses Jahrhunderts, standen vier Leute zusammen vor einem kleinen Bahnhof im Bergland von West-Catawba. Diese Station, eigentlich nur Vororthaltestelle, zu einer größeren Stadt gehörig, die, hinter einer Hügelwelle versteckt, sich nach Westen und Norden ausdehnte, hatte in letzter Zeit den zwei Meilen westwärts gelegenen Hauptbahnhof an Beliebtheit überflügelt, und fast der gesamte Reiseverkehr mit den Großstädten im Osten der Vereinigten Staaten spielte sich hier ab. An diesem Nachmittag hatte sich eine beträchtliche Menge Menschen an der Bahn eingefunden, und die in Wort und Gebärde maßvoll unterdrückte Spannung dieser Menge elektrisierte die schläfrig durchsonnte Oktoberluft so stark, daß Schauer und Drohung der Zuganfahrt bereits spürbar waren.
Einem Beobachter wäre die Zusammensetzung dieser Menschenmenge bestimmt aufgefallen – da war Fremdes neben Einheimischem, Kosmopolitisches neben Provinziellem, Ungewöhnliches neben Alltäglichem. Das Ganze bot durchaus nicht den Eindruck der einheitlichen Zugehörigkeit zum nächsten Wohnbezirk, wie man ihn sonst fast überall auf den Kleinstadtbahnhöfen des Staates Catawba von den Menschen auf dem Bahnsteig empfängt. In dieser Ansammlung war ein Zuschuß unverkennbar, ganz offensichtlich eine Note von großer Welt und verfeinerten Lebensansprüchen. Folglich hätte der Beobachter geschlossen, daß hier in der Nähe einer jener Orte liegen müsse, wo das mondäne Element von Zugereisten und Erholungssuchern die Ortsbevölkerung stark durchsetzt. Dieser Schluß entsprach denn auch der Tatsache: die etwa eine Meile entfernte Stadt ist der wohlbekannte Kurort Altamont. Aus Altamont also waren diese Leute, Fremde wie Einheimische, zur Bahn gekommen, und der Anlaß hierzu war der allgemeinste und oft erlebte; aber immerhin drehte es sich doch um ein Ereignis, wie es alle Amerikaner stets aufs lebhafteste erregt. Dieses Ereignis ist das Eintreffen eines Zuges.
Hätte nun der Beobachter sein Augenmerk auf jene Gruppe am äußersten Ende des Bahnsteigs gerichtet, dann hätte er ohne weiteres gesehen, daß drei von den vier Leuten – nämlich die beiden Frauen und der junge Bursch – Blutsverwandte waren. Ja, der erste Blick hätte ihm gesagt, der Bursch und die jüngere Frau sind Geschwister und die ältere Frau ist die Mutter der beiden. Diese Tatsache war in allen wesentlichen Stücken und im ganzen Verhalten dieser drei Menschen zueinander gegeben. Die Mutter war klein und von kräftig-gedrungener Gestalt. Obschon sie fast sechzig Jahre zählte, besaß ihr Haar noch seinen tiefschwarzen Glanz, und das lebhaft-energische Antlitz war noch glatt und unversehrt wie ein Jungmädchengesicht. Sie trug ihr Haar glatt zurückgekämmt, wodurch die hohe, sehr weiße Stirn nackt wirkte; ihre braunen, freilich etwas altersschwach und stumpf gewordenen Augen blickten unablässig gedankenvoll und unablässig aufmerksam; dieser Blick, zusammen mit der prallen Nacktheit der Stirn, gab dem Gesicht einen Ausdruck von Echtheit und angeborener Intelligenz, überdies aber den einer unmittelbaren, tiefernsten Kinderunschuld. Dieses zarte, milchhäutige Gesicht hatte nicht den geringsten Anflug von Farbe, bis auf die breit und fleischig angesetzte, merkwürdig männliche Nase, die leicht gerötet war.
Ein Fremder hätte bei der ersten Begegnung irgendwie gespürt, daß diese Frau einer weitverzweigten, zahlreichen Familie angehörte und daß ihr Gesicht ein ausgesprochenes Sippengesicht war. Der Fremde hätte vermutlich sogar gemerkt, daß diese Frau bestimmt Brüder hatte, mehrere Brüder, die ihr ähnlich sahen. Abgesehen von der Nase war äußerlich nichts Männliches an ihr, ganz im Gegenteil, sie war so weiblich beschaffen, wie es eine Frau nur sein kann. Da sie trotzdem männlich wirkte, konnte es nur so erklärt werden, daß sie ein entschieden männlich geprägtes Sippengesicht trug.
Der abschließende Eindruck von dieser Person wäre wohl folgender gewesen: – ein Mensch, auf den die moralischen Maßstäbe, nach denen allgemein gerichtet und verdammt wird, nicht passen – eine Frau, die, wie sie auch immer gelebt haben mochte, stets außerhalb der Zufälle von Zeit, Erziehung und Umständen gestanden haben mußte – ein Wesen, das, gleichviel welch folgenschwere, aus Irrtum, Geiz, Unwissenheit oder Fahrlässigkeit begangne Verbrechen ihr zur Last gelegt werden konnten, unschuldig war wie ein Kind, unschuldig wie ein Fluß, eine Lawine oder sonst eine Naturgewalt.
Die jüngere der beiden Frauen war ungefähr dreißig. Sie war beinah sechs Fuß hoch, breit und hager, und hatte knochige, losesitzende Glieder. Ganz augenscheinlich war auch sie eine erschreckend energische Person. Während sich aber bei der Mutter die Energie als stete, ruhig fließende, schier unversiegliche Kraftquelle äußern mußte, gehörte die Tochter ganz offenbar zu jenen erdhaft-jähen, völlig ungebändigten Wesen, deren ganze Lebensfülle sich jederzeit unberechenbar und verschwendungssüchtig auf den Menschen, den Gegenstand oder die Unternehmung ihrer jeweiligen, jederzeit großartigen Zuneigung wirft.
Dieser Unterschied zwischen den beiden Frauen drückte sich auch in den Gesichtern aus. Zwar war das Gesicht der Mutter auffallend beweglich in den Mienen, zwar hatte ihr Auge die von Gegenstand zu Gegenstand schießende Hurtigkeit des wachsamen Tierblicks, zwar war ihr Mund aufs erstaunlichste biegsam, so sehr sogar, daß sie im Widerspiel ihrer Gedankengänge ständig die Lippe schürzte oder dehnte oder die Mundwinkel herabzog – aber trotz alledem war in diesem Antlitz eine beinah urtümliche Gehaltenheit von Sammlung, Festigkeit, Ruhe und Geduld. Das große, hochknochige, freigiebige Gesicht der Tochter dagegen trug bereits Spuren eines in innerer Unrast gelebten Lebens. Zuweilen war der furchtbare, nervös überspannte Ausdruck von Hysterie unverkennbar, ein Ausdruck von qualvoller Ungeduld und heftiger seelischer Entzweiung, von drohender Erschöpfung und nahem Zusammenbruch. Und dann wieder war dieses Gesicht wie im Nu verwandelt, erhaben, weise, still, ja, wunderbar beschwichtigt, hoffnungshold, strahlend schön.
Nun waren diese beiden Frauen, jede auf die ihr eigne Weise, damit beschäftigt, die Umherstehenden und Neuhinzukommenden auf dem Bahnsteig zu mustern, und ihre heißhungrige Teilnahme am Mitmenschen vollzog sich unter einem an allumfassende Ortskenntnis gemahnenden Aufwand von Wissen, Bemerkung und Vermutung.
»... aber ja, Kind, ich sage Dir's doch!« bemerkte die Mutter ungeduldig und ließ den Blick von der Gruppe, von der gerade die Rede war, weitergleiten, »also klipp und klar kann ich Dir das sagen! Ich muß es doch wissen! Ich bin doch mit diesen Leuten auf gewachsen! Emma Smathers war doch eine Jugendfreundin von mir! Also: dieser Junge ist ganz bestimmt ein Kind aus jener ersten Ehe mit Emma Smathers!«
»Das ist mir neu«, entgegnete die Tochter, »wirklich vollkommen neu. Ich habe nie ein Wort davon gehört, daß Steve Randolph zweimal verheiratet war, ich dachte immer ...«
»I wo! wenn ich Dir's doch sage!« wandte die Mutter ein. »Außer der Lucilla hat Steve Randolphs jetzige Frau überhaupt keine Kinder. Die übrigen Kinder aus dem Haushalt sind alle von Emma Smathers, und dieser Junge, von dem wir gerade sprechen, auch. Versteh doch: die Emma, seine erste Frau, ist ihm im Wochenbett gestorben, damals als die Berenike zur Welt kam, und kein Mensch dachte daran, daß Steve Randolph sich nochmal verheiraten würde, und als er dann doch heiratete, dachte kein Mensch, daß er aus zweiter Ehe noch Kinder bekommen würde, denn seine jetzige Frau ist fast so alt wie er, und auch sie war bereits Witwe, als er sie damals kennenlernte, irgendwo im Westen, in Wyoming, oder Nevada, oder Idaho, weißt Du ... und ihre erste Ehe war doch kinderlos gewesen; sie hatte, wie man so sagt, weder Kind noch Küken gehabt, und da dachte wahrhaftig kein Mensch, daß sie nun von Steve noch Kinder bekommen würde, denn tatsächlich, als dann die Lucilla auf die Welt kam, da war diese Frau doch ihre vollen vierundvierzig Jahre alt!«
»Ja ... wirklich ...«, murmelte die Tochter, plötzlich sehr aufmerksam, und griff sich ans Kinn. »Also da habe ich wirklich was hinzugelernt ... und vierundvierzig, sagst Du, ist sie gewesen, als die Lucilla auf die Welt kam ...?«
» Volle vierundvierzig, ganz bestimmt, und womöglich noch ein bißchen älter«, sagte die Mutter.
»Na, da siehst Du«, sagte die jüngere Frau nun zu ihrem stillschweigenden Gatten Hugo Barton, »da haben wir ja auch noch Aussichten. Also freu Dich, Lieber, solang man lebt, soll man hoffen!« Ihre Stimme klang scherzhaft, war aber plötzlich heiser, und in ihre Augen war ein tieftrauriger, gepeinigter Ausdruck gekommen.
»Aussichten! Na, natürlich habt Ihr noch Aussichten!« legte die Mutter nun los. Sie zog einen fast zornigen Mund. »Wenn ich nochmal in Deinem Alter wäre, dann könnte ich sicher noch ein Dutzend Kinder bekommen und würde mir nicht das Geringste dabei denken!« Sie schwieg und schürzte nachdenklich die Lippe. Alsdann erschien ein kleines, schlaues Lächeln an ihren Mundwinkeln, und mit scherzhaft-geheimnisvoller Miene wandte sie sich an ihren Sohn:
»Nun, Junge, da hast Du's ja gehört«, sagte sie. »Es gibt einen Haufen Dinge, von denen Du noch nichts weißt ... Du hast doch gewiß geglaubt, daß Du der Jüngste wärst, nicht wahr?«
»Nun, bin ich's vielleicht nicht?« sagte der Sohn.
»Hm!« Sie lächelte herablässig. »Es gibt einen Haufen Dinge, die ich Dir da erzählen könnte ...«
»Ach Du mein Gott!« stöhnte er und blickte seine Schwester flehentlich an. »Mehr Geheimnisse! Nächstens wird es herauskommen, daß es nach meiner Geburt bei uns im Haus noch fünfmal Drillinge gab!« Er wandte sich ungeduldig an die ältere Frau. »Rück 'raus mit der Sache, Mama! Mach Schluß mit den ewigen Anspielungen! Wieviel also waren's?«
»Hm!« machte sie, scherzhaft, verächtlich, bedeutungsvoll lächelnd.
»Herrgott!« stöhnte er. Er sah die Schwester flehentlich an und fragte: »Weißt Du was davon?«
»Hi-hi-hi!« kicherte die jüngere Frau höhnisch und gickste den Bruder mit knochigen Fingern in die Rippen. »Wieder so spukiges Zeug, wie? Ach, Du weißt ja noch nicht mal die Hälfte. Nächstens wird sie Dir erzählen, daß Du eigentlich ihr vierzehntes Kind warst!«
»Hm!« Die Mutter schürzte die Lippe. Wieder erschien das verächtliche Lächeln. Die Miene wurde geringschätzig. »Das vierzehnte? Pah! Als ob das alles wäre!«
»K-k-k-k!« machte die jüngere Frau und gickste den Bruder in die Rippen.
»Und nun, Junge«, fuhr die Mutter bestimmt fort, »werde ich Dir was erzählen, wovon Du überhaupt keine Ahnung hast.« Sie hatte auf ihre instinktiv männlich-forsche Art den Zeigefinger ausgestreckt und starrte den Sohn mit dem ganzen Ernst ihrer altersschwachen Augen an. »Es gibt wirklich einen Haufen Dinge, von denen Du nichts gehört hast. Damals, nicht allzulang nach Deiner Geburt, Kind, damals, als ich Dich und Deine Geschwister mit nach Saint Louis genommen hatte auf die Weltausstellung ...« Sie schürzte heftig die Lippen, schüttelte angewidert den Kopf. Ihr Gesicht wurde abweisend und traurig. Schließlich erklärte sie flüsternd: »Ach, wenn ich bloß dran denke, wenn ich bloß dran denke, was ich damals durchgemacht habe ... furchtbar, furchtbar, weißt Du ...«
»Ich bitte Dich um Gottes willen, Mama! Ich will's ja nicht wissen!« fuhr er verzweifelt auf. »Gott verdammt, warum können wir denn nicht einmal Frieden haben? Nicht einmal jetzt, wo ich wegfahre!« meinte er bitter, unlogisch, verstört. »Warum diese düsteren Enthüllungen? Diese Pentlandsche Gespenstigkeit? Dieses Drum-herum-Gerede? Diese verfluchte Art, sich vor einen Menschen hinzustellen und ihm zuzuflüstern: ›Ja, wenn ich nur wollte, da könnte ich Dir etwas sagen ...!‹ Es will's ja kein Mensch wissen! Wer schert sich denn um das Zeug? Ich jedenfalls nicht!« versicherte er, völlig außer sich.
»Aber Kind, aber Kind!« fiel sie hastig-vermittelnd ein. »Ich habe doch bloß gesagt ...«
»Schon gut! schon gut! schon gut!« murmelte er, »also wirklich, ich will's nicht wissen.«
»... ich habe doch bloß gesagt ...«, begann sie wieder.
»Ich will's doch nicht wissen!« wehrte er fast aufschreiend ab. »Frieden! Frieden! Frieden! ...«, murmelte er wie besessen vor sich hin. Er wandte sich an seine Schwester: »Frieden auf einen Augenblick! Frieden für uns alle! Einen Augenblick Frieden, ehe wir sterben, Frieden, Frieden, Frieden ...«
»Aber Junge, Junge!« mahnte die Mutter verletzt. Sie starrte ihn vorwurfsvoll an. »Was in aller Welt ist über Dich gekommen? Beschwören, ja, beschwören will ich's, daß Du Dich wie ein Verrückter benimmst!«
»Frieden!« murmelte er abermals. Er fuhr sich wild mit der Hand durchs Haar. »Ich flehe um einen Augenblick Frieden, ehe wir untergehn.«
»K-k-k!« kicherte die Schwester und stocherte ihn mit steifem Finger in die Rippen. »Den Frieden, den Du da meinst, gibt's nicht! Alles ist wie ein Fluß und geht weiter, immer weiter ...« Ein humorig-wüstes Lächeln spielte flüchtig um die Winkel ihres großen, ausdrucksvollen Munds. »Das siehst Du doch ein, nicht wahr?« meinte sie herausfordernd. »Sieh mal, Du hast schließlich Glück. Du fährst weg! Du bist so gescheit und fährst nach Boston, und dort gehst Du auf die Harvard-Universität und studierst, was Dir beliebt. Aber was Du dort tust, ist letzten Endes gleichgültig, jedenfalls bleibt eins sicher: Du bist weg. Wenigstens die meiste Zeit. Wie ich es hier aber die ganze Zeit aushalte, Tag für Tag aushalte ... sag' mal, kannst Du Dir das vorstellen?« Sie hielt antwortheischend inne, fuhr aber dann, gutmütig Verzicht leistend, fort: »Ich muß es doch die ganze Zeit aushalten, die ganze Zeit! Wenn ich nur dann und wann mal fünf Minuten Frieden hätte, da könnte ich mich zusammennehmen und zu mir selbst kommen. Aber so wie Dir jetzt, geht's mir die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit.« Sie hatte sich heiser geredet und war nun sichtbar erschöpft. »Vergiß den ganzen Kram!« rief sie tief resigniert. »Ich weiß ja ... Reden hilft nichts ... Du mußt vergessen ... die paar Tage hier mußt Du Dein Bestes versuchen ... ich habe früher immer geglaubt, man könnte was dagegen tun ... das habe ich aber längst aufgegeben ...« Diese letzten, unzusammenhängenden Sätze hatte sie nur noch gemurmelt.
»Wie war das? Was meinst Du?« fragte nun die Mutter behend. Ihr hurtiger, neugierig-betroffener Vogelblick flitzte von einem Kind zum andern. Da ihr keins antwortete, begann sie abermals: »Also wovon sprecht Ihr da? Ich dächte doch ...« Aber die peinliche Szene, die jählings das bestürzte, tragisch-blinde, seelisch-verworrene Leben dieser drei Menschen erhellt hatte, wurde hier zum Glück unterbrochen.
In eine der in der Nähe stehenden Gruppen war plötzlich Bewegung gekommen, jemand hatte laut wiehernd gelacht, und dies hatte die Aufmerksamkeit der beiden Frauen sofort angezogen. Und wieder erschallte das große Gewieher, ein Hah-hah-hah so kraftvoll-gediegen, so tierhaft-behaglich, so überschwenglich-ansteckend, daß mehrere Leute auf dem Bahnsteig bereits zu schmunzeln anfingen und sich wohlwollend nach dem Eigentümer dieses Lachens umdrehten.
Die jüngere Frau hatte ihre tiefbekümmerte Schicksalsergebenheit im Nu vergessen. Sie hatte sich unverzüglich nach der Gruppe, aus der das Lachen erschallt war, umgedreht. Nun griff sie sich nachdenklich ans Kinn, lachte geistesabwesend mit und sprach: »Hah-hah-hah! ... Das ist Georg Pentland ... Den kennt man am Lachen!«
»Ei gewiß ist das der Georg!« bestätigte die Mutter geflissentlich. »In stockfinsterer Nacht würde ich ihn am Lachen erkennen. Weißt Du übrigens, daß er schon immer so gelacht hat? Schon als Junge, damals als er mit Deinem Bruder Steve spielte? Immer und überall platzte er heraus mit seinem Lachen. Schon im Kindergottesdienst, und dann in der Kirche, während der Pfarrer das Gebet sprach und der Klingelbeutel herumging. Weiß Du, so ein mächtiges, lautes Lachen, das obendrein noch, wie man so sagt, von hierhin bis dorthin trägt ... ich möcht nur mal wissen, wo er es her hat, aus unsrer Familie bestimmt nicht ... Natürlich lachen wir alle gern und herzhaft, aber so wie er hat noch kein Pentland gelacht, wahrhaftig nicht ... Eins ist ganz sicher, sein Vater, mein Bruder Will, hat im Leben nicht so gelacht ... und doch meinte die Pett, weißt Du, Deine Tante Pett ...« Hier, als sie die Gattin ihres Bruders erwähnte, schnitt die ältere Frau ein boshaft-verächtliches Gesicht, und ihre Stimme bekam den affektiert-weinerlichen Ton, in dem Frauen die Stimmen anderer Frauen, die sie nicht leiden können, nachahmen. »– also die Pett war eines Tags furchtbar geladen auf den Georg, weil er wieder mal in der Kirche 'rausgeplatzt war, und da nahm sie den Jungen auf der Stelle nach Haus und wichste ihn durch, und dann nachmittags, Du weißt ja, da sagte sie zu mir: ›Ich könnte ihm den Hals 'rumdrehn‹, sagte sie, ›er wird uns alle noch in Schimpf und Schande bringen, wenn ich ihm das nicht abgewöhne. Da ist er wieder 'rausgeplatzt in der Kirche, gebrüllt hat er vor Lachen, und ich habe kein Wort verstanden von dem, was der Pfarrer Baines gebetet hat. In Grund und Boden habe ich mich geschämt wegen seines Benehmens, und ich hätte ihn bis aufs Blut gezüchtigt, wenn ich eine Peitsche zur Hand gehabt hätte. Wenn ich nur einmal wüßte‹, sagte sie und rümpfte die Nase –« Hier rümpfte die Erzählerin ebenfalls die Nase und ahmte mit vipernhafter Gehässigkeit die Stimme der Schwägerin nach: »› ... wenn ich nur einmal wüßte, wo er das her hat; das kann doch nur von dem gewöhnlichen Pentland-Blut kommen, das er in sich hat‹ ... na, aber da habe ich sie stracks angeblickt und gesagt: ›Hör mal, Pett‹, habe ich gesagt, ›ich weiß nicht, wo's der Junge her hat, aber Deinen letzten Dollar kannst Du drauf verwetten, daß es nicht von seines Vaters Seite ist. Von den Pentlands hat keiner so gelacht, weder Will, noch Jim, noch Sam, oder Georg, oder Ed, oder mein Vater, oder unser Onkel Bacchus, oder auch der alte Bill Pentland, der Urgroßvater Deines Jungen, denn ich habe sie alle gekannt und lachen hören ... und nun höre mich mal an, Pett –‹, habe ich gesagt, und habe ihr fest ins Auge geblickt und mal klipp und klar die Meinung gesagt: ›von dem gewöhnlichen Pentland-Blut, von dem Du da sprichst, habe ich noch nie jemand reden hören, denn wir waren stets geehrt und geachtet in der Gemeinde, und wir alle empfanden es als Herablassung, als Will eine Creasman heiratete!‹«
»Aber Mama! Das kannst Du doch unmöglich gesagt haben!« protestierte die Tochter lachend. Sie hatte nur halb zugehört, und dabei verträumt-neugierig die Leute auf dem Bahnsteig gemustert. Unablässig strich sie sich mit der großen Hand über das große Kinn. Nun grüßte sie mit komisch-förmlichem Lächeln, verbindlicher Kopfneigung und einem automatisch gemurmelten »Wie geht's?« irgendeine Bekannte.
»Hah-hah-hah!« Wieder schallte das leere, tierisch behagliche Lachen über den Bahnsteig. Diesmal wandte sich Georg Pentland von seiner Gruppe ab; er bleckte die Zähne vor Heiterkeit, sah sich mit stierem Blick um und stieß sich zwei Finger seiner kräftigen, sonngebräunten Linken wie einen Dolch in den muskelstrammen Oberschenkel. Eine instinktiv-unbewußte Reflexbewegung war das bei ihm; er tat es immer, wenn ihn etwas ungeheuer erheiterte.
Er war Anfang der Dreißig, ein schöner stattlicher Mann mit kohlschwarzem Haar, stiernackig, breitschultrig, ganz wie ein Athlet gebaut. Er hatte ein sinnlich-rotes, tierisch-leidenschaftliches Gesicht, und wenn er seinen großen Schwall herauslachte, entblößte er zwischen roten Lippen zwei Reihen von Zähnen, die weiß, regelmäßig und von elfenbeinerner Gediegenheit waren.
Der gedankenlos-wüste Lachanfall hatte sich gelegt, und nun bemerkte Georg Pentland plötzlich seine Verwandten. Er winkte jovial mit dem Arm herüber, entschuldigte sich bei seiner Gruppe – jüngeren Leuten, die durch Kleidung und Gehaben ihre Zugehörigkeit zum vornehmsten Sportklub der Stadt verrieten – und kam mit seinem träg-schwingenden Schritt auf seine Gesippen zu, wobei er, der offenbar sich bei aller Welt großer Beliebtheit erfreute, die herzliche Begrüßung vieler Bekannter herzhaft erwiderte.
Er kam näher, bleckte die Zähne zum Gruß und rief in seiner üppig-dröhnenden, langgedehnten Stimme, in der unverkennbar die Pentland-Eigenschaften, nämlich Sinnenfülle, Humor, Lebenssicherheit und die feine, weidlich-feiste Note der Selbstzufriedenheit waren:
»Hallo! Tante Eliza! Wie geht's? Hallo, wie geht's, Helene? Na, und Dir, Hugo?« Freundschaftlich-gönnerhaft legte er eine Hand auf Hugo Bartons Arm. »Was in aller Welt treibt Ihr denn überhaupt die ganze Zeit?« Sein kräftiger Mannestenor klang anklagend. »Warum kommt Ihr denn nicht mal 'rüber und schaut bei uns 'rein? Erst vor ein paar Tagen hat sich Ella wieder mal nach Euch allen erkundigt, sie wollte von mir wissen, warum Ihr Euch eigentlich nie sehen laßt.«
»Also Georg, ich will Dir offen und ehrlich sagen, wie es ist«, erwiderte die jüngere Frau ernst. »Hugo und ich hatten mindestens hundertmal vor, zu Euch zu kommen, aber es hat nie geklappt. Den ganzen Sommer über ist eine verdammte Schererei nach der andern aufgekommen, weißt Du ... ach, wenn ich nur einmal einen Augenblick meine Ruhe hätte und zu mir selbst kommen könnte ... Du weißt doch, wie ich das meine, Georg?« sagte sie mit heiserer Stimme, begierig, ihn in ihr sympathisches Vertrauen einzubeziehen. »Wenn die andern mich nur einmal mit ihrem Kram in Ruhe lassen wollten! Aber nein, sobald irgend etwas schiefgeht, kommen sie alle zu mir. Sie lassen mir einfach keine Ruhe, manchmal ist's zum Verrücktwerden. Wirklich, manchmal bin ich so außer'm Häuschen, daß ich nicht mehr weiß, ob Samstag ist oder Montag.« Auf ihrem großen hageren Gesicht erschien die dumpfe Gespanntheit der Hysterie.
»Sie hat sich wirklich zuviel zugemutet diesen Sommer«, bestätigte Barton in seinem ernsten Baß. »Es war ... es war«, er hielt bedächtig inne, suchte nach dem rechten Wort, sah zu Boden, schnickte die Asche von seiner langen Zigarre ab. »Es war eben einfach zuviel«, fuhr er dann fort. »Alles liegt auf ihren Schultern.«
»Ach Gott, Georg, was ist es nur? Kannst Du mir sagen, ob das lebenslänglich so fort geht? Gibt es denn irgends Frieden und Glück? Gibt's denn auf der weiten Welt nichts als Kummer und Sorge, Aufregung und Schererei?« Die jüngere Frau hatte das schlicht und ruhig gefragt, mit der Miene eines Menschen, dem es ernstlich um eine Auskunft zu tun ist.
»I wo!« sagte Georg Pentland herablassend. »Ich habe mehr auszustehen gehabt, als mir irgendeins von Euch glaubt ... Genug, um zwölf Leute ins Grab zu bringen ... Aber eines Tages merkte ich, daß mich so etwas nicht umbringen kann ... na ja, und da habe ich eben aufgehört, mir was draus zu machen. Mach's doch auch so, Helene«, riet er herzhaft, »mache Dir einfach nichts draus! Scher Dich nicht drum! Es nützt ja nichts und bringt einen nicht weiter! Und Du wirst sehen, sobald Du Dir nichts draus machst, bist Du vollkommen in Ordnung.«
»O ja, schon gut, Georg, weißt Du, ich käme ja über alles andre weg, wenn nur nicht diese ewige Sorge um Papa wäre. Wie mich das quält, daß er so leiden muß! Glaub' mir, manchmal bringt es mich an den Rand des Wahnsinns. Diesen Sommer war es dreimal soweit, daß er sich aufgegeben hatte und gestorben wäre, wenn ich nicht – ich kann das ehrlich behaupten – mit aller Kraft und Entschlossenheit ihn am Leben erhalten hätte. Ich konnte ihn einfach nicht sterben lassen! Wahrhaftig, ich glaube, wenn sein Herz ausgesetzt hätte, hätte ich es irgendwie fertiggebracht, es wieder zum Schlagen zu bringen. Alles mögliche hätte ich versucht, um ihn hier zu halten, meinen Atem, mein Blut, meine Lebenskraft hätte ich drangesetzt ...« Ihre großen Hände verkrampften sich in einer verzweifelten Gebärde.
»Ein um das andre Mal hat sie ihm das Leben gerettet, tatsächlich«, bestätigte Hugo Barton langsam. Er schnickte vorsichtig die Asche von seiner Zigarre, sah zu Boden, suchte nach Worten. »Mein Schwiegervater läge längst unter der Erde, wenn sie nicht wäre.«
»Ja gewiß, ich weiß das«, gab Georg Pentland gönnerhaft zu. »Ich weiß, wie sehr sie meinem Onkel beigestanden hat, und ich glaube, er selber weiß es am besten.«
»Ach, darauf kommt es mir nicht an, daß er es anerkennt«, versicherte die jüngere Frau heftig. »Ich würde mein Leben hergeben, zwanzigmal hergeben, wenn ich könnte, um den Vater zu retten. Aber die ständige Sorge um ihn, weißt Du, die Sorge, das ist's, was mir zusetzt! Monat um Monat, Jahr um Jahr liege ich nachts wach und mache mir Gedanken und sorge mich und frage mich, ob er denn auch wirklich gut aufgehoben ist in Mamas Haus, und ob er es auch richtig warm hat in dem alten kalten Bau da drüben ...«
»Aber wie! Aber wie!! Kind!« fiel die ältere Frau hastig ein. »Den ganzen Winter über hat ein ordentliches Feuer in seinem Zimmer gebrannt; das wärmste Zimmer im Haus war es, das wärmste ...«, protestierte sie, aber die Redeflut der Tochter ging über ihren Einwand hinweg.
»... und ob er wieder einen Anfall hat, Blutungen, und mich braucht. Ach, Georg, es macht mich krank, wenn ich nur dran denke! Da liegt der alte Mann allein und verfault am Krebs, und dieser entsetzliche Geruch immer um ihn! Alles, was er anhat, wird steif von diesen fauligen Absonderungen! Weißt Du denn, was es heißt, so einen Menschen Jahr für Jahr dahinsiechen zu sehen, mit ansehen und nachfühlen zu müssen, wie er stirbt, wie sein Leben an einem Faden hängt?«
»Gewiß weiß ich das, Helene«, erklärte Georg mitfühlend. »Und ich weiß, daß es Dich furchtbar mitnimmt ... Und wie geht's dem Onkel denn jetzt? Besser?« fragte er nach einer Weile.
»Nun, es scheint, daß er sich ein wenig erholt hat ...«, fing die Mutter an, aber die Tochter schnitt ihr sofort das Wort ab:
»Ja, das schon«, sagte sie. »Nach dem letzten Anfall hat er sich wenigstens genügend erholt, um nach Baltimore reisen zu können. Und vor einer Woche ist er dann wieder hingefahren, zur Nachbehandlung. Aber allen Ernstes, Georg, es hilft ihm eigentlich nichts mehr. So etwas läßt sich nicht heilen. Das haben uns die Ärzte gesagt. Verzögern, hinausziehen, hinhalten, ihm kleinere Erleichterungen verschaffen, das können sie. Das geht dann, bis wieder ein Anfall kommt. Ach, der arme alte Mann!« stöhnte sie. Ihre Augen waren feucht. »Ich würde wirklich alles für ihn hingeben. Aber sein Schicksal ist besiegelt. Zu retten ist er nicht mehr. Er stirbt.«
Georg blickte ihr mit teilnahmsvollem Ernst in die Augen, plötzlich zog er die Luft durch die Zähne zurück, schnitt eine katzenhafte Grimasse, stieß sich mit zwei Fingern in den Schenkel. Dann fragte er beiläufig:
»Wer hat denn den Onkel nach Baltimore gebracht?«
»Ei, Lukas ist dort bei ihm«, sagte die Mutter. »Gestern hatten wir einen Brief von ihm. Er schreibt, sein Vater sähe bereits ein bißchen besser aus, hätte einen guten Appetit, war bei guter Laune ...«
»Aber um Gottes willen, Mama!« unterbrach die Tochter. »Das ganze Gerede von Besserwerden hat doch gar keinen Sinn! Papa ist ein unheilbar kranker Mann, an ein Besserwerden ist im Ernst doch gar nicht mehr zu denken! Er ist ein Sterbender! Bin ich denn der einzige Mensch, der da klar sieht?!«
»Na, na, ich habe ja doch bloß gesagt und behauptet, daß Lukas dort bei ihm ist und sich um ihn bekümmert. Und der Eugen fährt jetzt 'nauf nach dem Norden auf die Universität, und da wird er morgen seine Fahrt in Baltimore unterbrechen und auch mal nach seinem Vater sehn.«
»So, der Eugen!« rief Georg Pentland herzhaft-belustigt aus. »So, Du also!« Er wandte sich nun zum erstenmal an den jungen Menschen und packte ihn fest am Arm. »Was sind denn das eigentlich für Sachen, die ich da von Dir höre, Söhnchen? Sag' mal, genügt Dir eine Universität nicht?«
Der junge Mensch grinste, errötete verlegen, sagte nichts.
»Na, Söhnchen, dann gib nur acht, daß Du nicht so hochgebildet wirst, daß Du so ein biedres Rauhbein wie mich noch verstehen kannst«, fuhr Georg freundlich spottend fort. Er wandte sich an die Mutter:
»Wo schickst Du ihn eigentlich hin, Tante Eliza?«
»Ei, nach Harvard«, sagte sie und schürzte die Lippe. Sie schüttelte den Kopf. »Er will halt durchaus hin, er tut es nicht anders, und da schicke ich ihn auf ein Jahr. Dann soll er sehn, wie er weiterkommt. Es wird schon gehn, denke ich.«
»Harvard, Donnerwetter! Na, Junge, hast Du aber hochfliegende Pläne im Kopf! Was willst Du denn eigentlich dort?«
Der junge Mensch, zornrot im Gesicht, stammelte:
»Ich nehme an ... ich nehme an, studieren.«
»Na! Das nehme ich aber auch an«, donnerte Georg. »Deine Mutter würde Dir schon das Fell versohlen, wenn Du dort auf ihre Kosten bummeln gingst!«
»Ja, ich habe ihm auch klipp und klar gesagt«, bemerkte die Mutter und nickte ernst, »daß das eine Gelegenheit ist, die er sich in jeder Beziehung zunutze machen muß, zu seinem Vorwärtskommen.«
»Schön, also Harvard«, sagte Georg Pentland und sah seinen jungen Vetter von Kopf zu Fuß an. »Also gib acht, daß Du nicht zu hoch fliegst, sonst verlierst Du uns Erdenbürger aus den Augen.«
»Na, Georg, sieh Dir erst mal seine Füße an!« wandte die junge Frau halblaut ein. »Du bildest Dir doch nicht wohl ein, daß er mit diesen Trittchen sogar hochfliegen könnte, was?«
Georg Pentland ging auf den Scherz ein. Er sah sich die Füße seines Vetters an, schüttelte verwundert den Kopf und sagte schließlich: »Nein, wirklich nicht. Mit solchen Füßen kommt er nicht vom Erdboden weg. Aber wenn er sich die Füße abnehmen läßt, dann trägt ihn jeder Windstoß hoch wie einen Luftballon. Nicht wahr? Hah-hah-hah!« Und die Zähne bleckend, sich mit zwei Fingern in den Schenkel stoßend, überantwortete er sich seinem wilden Lachschwall.
»K-k-k«, kicherte die Schwester, als sie das zornrote Gesicht des Bruders sah. »K-k-k, Du kleiner Harvardstudent«, hänselte sie und gickste ihn in die Rippen.
»Laß Dich ja nicht zum besten halten, Söhnchen«, meinte Georg nun gutmütig. »Und nun: halte Dich munter, und viel Glück, und zeige den Leuten dort in Harvard, was Du für ein Kerl bist. Und glaube mir, wir sind alle stolz auf Dich, daß Du Dich als einziger von uns Vettern durchs College schaffst. Und wenn Du nach Boston kommst, sagst Du dem Onkel Bascom und der Tante Louise einen schönen Gruß, gelt? Und in Baltimore einen schönen Gruß an Deinen Vater und Lukas! Somit, leb wohl, Eugen, ich muß mich jetzt trollen.« Er schüttelte dem jungen Vetter kräftig die Hand und schickte sich an zu gehen. »Und ihr andern«, sagte er abschiednehmend, »Ihr müßt Euch nun wirklich bald mal sehen lassen. Ella und ich, wir freuen uns wirklich drauf!« Damit ging er weg.
In diesem Augenblick hatten sich überall auf dem Bahnsteig Gesichter umgedreht und Hälse gereckt nach einem jungen Menschen, der in erregter Stimme, laut und mit abgehackten Sätzen höchst verwundert versicherte: »Nein! Nein!! Unmöglich!!! Du kannst das beschwören!? Du hast es mit eignen Augen gesehn! Wirklich ... ähä ... ei verdammt!« Der junge Mensch, der die Rufe des Erstaunens ausgestoßen hatte, mit einer Stimme, die ab und zu in ein meckerndes Falsett überschnappte, sah sich ohne zu sehen um, steckte die eine Hand zappelig in die Tasche, fuhr sich mit der andern aufgeregt über sein glattes Haar und murmelte nun in einem fort ein ungläubig verzweifeltes »Herrgott ... es ist ja nicht möglich ... ich versteh's einfach nicht.« Er war hochgewachsen, hatte einen feinen, wohlgeformten Kopf und feingliedrige, nervöse Hände. Sooft er die Hand in die Tasche steckte, tat er es so, daß man die große rautenförmige Nadel auf seiner Brust, das Abzeichen der Akademischen Bruderschaft vom Delta-Kappa-Epsilon sah. Plötzlich erspähte er am andern Ende des Bahnsteigs den jungen Menschen, der dort mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Schwager stand. »Augenblick ... gleich wieder da ... ich muß da jemanden sprechen ...« sagte er zu seinen Freunden, die sich über die Sprunghaftigkeit seines Wesens zu wundern schienen.
Er drehte sich auf dem Absatz um und schob stracks auf sein Ziel zu, starr blickend, mit hurtig-kokettem Schritt, so als hinge alles in der Welt davon ab, daß er möglichst schnell dort ankäme. Ohne zu grüßen, ohne sich zu entschuldigen, fuhr er den andern jungen Menschen in seiner heftig-fahrigen, explosiven Art an:
»Fährst Du auch mit dem Zug? ... Heut? ... Was für 'ne Universität? ... Hast Du Dich entschieden? ... Pett Barnes sagt, Du gingst nach Harvard? ... Stimmt's?«
»Ja, es stimmt.«
»Herrgott, Herrgott!! Ähähä! ... Wie kannst Du nur ... Wie kommst Du nur drauf!? ... Du gingst gescheiter mit mir ... Was willst Du denn dort ...«
»Wie? Was meinen Sie?« fiel da die Mutter ein, die mit überraschtem Blick die beiden gemessen hatte. »Sie kennen sich wohl, wie? Und Sie nehmen auch diesen Zug, sagten Sie gerade?«
»Ja, ähähä«, lachte der junge Mensch plötzlich, grinste, machte eine flinke feine Verbeugung und erklärte respektvoll und mit gewinnender Höflichkeit: »Ja, gnä' Frau, gewiß ... ähähä ... Guten Tag, Mrs. Gant ...« Er reichte ihr schnell die Hand, lachte sein nervös-gebrochenes ähähä, und verbeugte sich, die übliche Grußformel murmelnd, gegen die jüngere Frau und ihren Gatten.
Die ältere Frau, die die Hand des jungen Menschen in der ihren behalten hatte, schürzte ruhig-nachdenklich die Lippe und sagte nach einer Weile der Besinnlichkeit: »Nun, ich kenne Sie. Ihr Gesicht ist mir bekannt.« Und in einem Ton, der jeden Irrtum ihrerseits für ausgeschlossen erklärte, wiederholte sie: »Gewiß kenne ich Sie. Einen Augenblick, und ich werde Ihnen Ihren Namen sagen.« Sie dachte nach.
Der junge Mann grinste verbindlich und sprach ehrerbietig: »Ja, gewiß, gnä' Frau ... ähähä ... Robert Weaver.«
»A-ha-hah, ja das ist's!« rief sie aus und schüttelte ihm mit großer Wärme die Hand. »Sie sind Judge Weavers Sohn. Ei natürlich!«
»Ähähä ... gewiß, gnä' Frau ...« meckerte Robert verbindlich. »Das stimmt ... ähähä ... Eugen und ich gingen zusammen auf die Schule ... ähähä ... und dann auf der Staatsuniversität waren wir im selben Kurs.«
»Ei natürlich«, rief sie, nun völlig im Bild, und beschwören will ich's, daß ich Sie auf der Stelle erkannt habe. Nur der Name war mir entfallen, ei natürlich ... Sie sind Robert Weavers Sohn!« Irgend etwas schien sie verstört zu haben. Sie hielt die Hand des Jungen noch mütterlich in der ihren, ein Lächeln huschte um ihre Mundwinkel, sie sah den Jungen an und sagte: »Sie glauben nun gewiß, ich hätte ein schlechtes Gedächtnis für Namen und Gesichter, und darum will ich Ihnen eine Probe geben dafür, daß ich mehr von Ihnen weiß, als Sie annehmen.«
»Ja, gnä' Frau ... ähähä«, meckerte Robert respektvoll.
»Sie sind geboren« – absichtlich langsam kramte sie es aus – »am 2. September 1898, und so sind Sie zwei Jahre, einen Monat und einen Tag älter als mein Sohn Eugen hier. Stimmt das?«
»Ähähä ... ja, gnä' Frau ... das stimmt, das stimmt ganz genau«, rief Robert erstaunt und verwundert aus. »Stimmt wirklich ganz genau ... muß ich schon sagen ... ähähä ... das übertrifft wirklich alles, was mir vorgekommen ist ... wie in aller Welt konnten Sie sich daran erinnern?«
Seine Frage und der bewundernde Ton in seiner Überraschung taten ihrer Eitelkeit gut. Sie lächelte selbstgefällig und erklärte: »Also, hören Sie, ich erinnere mich an Ihren Geburtstag, weil an diesem Tag eines meiner Kinder, nämlich mein Sohn Lukas, zum erstenmal aufstehen durfte, nachdem er lange mit Typhus gelegen hatte. An diesem Tag kam mein Mann heim und sagte bei Tisch: ›Ich hab' heut Robert Weaver auf der Straße getroffen, alles ist gut gegangen in seinem Haus, und seine Frau ist heut morgen von einem kleinen Buben entbunden worden, und er sagt, Mutter und Kind wären außer Gefahr.‹ Und da sagte ich zu ihm: ›Also, das ist heute ein glücklicher Tag für zwei Familien. Doktor McGuire war heute früh da und sagte, Lukas dürfte nun aufstehen. So ist auch er außer Gefahr.‹ Deswegen, glaube ich, hat jener Tag so einen Eindruck auf mich gemacht, daß sich mir das Datum einprägte, aber natürlich muß ich dazu sagen, daß Lukas damals furchtbar krank gewesen war«, versicherte sie kopfschüttelnd und mit ernstem Gesicht, »wir hatten ihn ein paarmal schon fast aufgegeben, und als er dann an Ihrem Geburtstag aufstehen durfte, da war es ein großer Freudentag, das kann ich Ihnen versichern.«
»Ähähä ... wirklich fabelhaft ... erstaunlich in der Tat!« Robert lächelte, ehrerbietig gewinnend, kam nicht aus dem Staunen heraus, erklärte schließlich mit feierlichem Ernst: »Das ist die tollste Sache, die mir vorgekommen ist.«
»So, wenn Sie also Ihren Vater das nächste Mal sehen«, sagte die ältere Frau mit der stillen Befriedigung der Allwissenheit, »dann sagen Sie ihm, Sie hätten Eliza Pentland getroffen – oh, er weiß schon, wer ich bin, wir sind hier in der Stadt miteinander aufgewachsen – ja, und da sagen Sie ihm, daß ich Sie gleich erkannt hätte am Gesicht, und ich hätte Ihnen sogar die Stunde und die Minute gesagt, in der Sie geboren seien ... ja, das sagen Sie ihm.«
»Ja, gewiß, gnä' Frau«, sagte Robert ehrerbietig, »ganz bestimmt werde ich ihm das sagen ... wirklich die tollste Sache, die mir vorgekommen ist ... Ähähä ...« Er verbeugte sich lächelnd gegen die jüngere Frau und ihren Gatten, murmelte »Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben«, wandte sich zur Mutter: »Ich werd' es ihm gewiß sagen ... ich muß mich nun empfehlen, gnä' Frau ... ähähä ... bin hier verabredet ... Wiedersehn«, wandte sich an den Sohn: »Wir sehn uns nachher im Zug, hähähä ... Wiedersehn ... wirklich eine ganz erstaunliche Sache ...« drehte sich jäh auf dem Absatz um und ging mit seinem merkwürdig zielbeseßnen, hurtig-koketten Schiebeschritt davon.
Die jüngere Frau folgte ihm nachdenklich mit den Augen, strich sich das Kinn, erklärte kopfnickend: »So, das ist Judge Robert Weavers Sohn. Gute Manieren, muß man sagen. Tadellos. Sieht aus wie ein Gentleman und benimmt sich auch so. Man merkt die gute Kinderstube.« Mit einem entschiednen »Mir gefällt er« schloß sie ihr Urteil ab.
Auch die Mutter hatte, bedächtig den Kopf schüttelnd, die Hände lose vor dem Bauch verschränkt, mit tiefnachdenklichen Augen dem jungen Mann nachgeblickt. »Ei ja, zugegeben, er sieht nett aus«, gestand sie ein. »Und gescheit scheint er auch zu sein.« Sie verstummte, schürzte die Lippe, nickte einmal langsam und entschied dann: »Ja, da ist nichts dagegen zu sagen, der Junge ist völlig in Ordnung, und ich sage wirklich nicht, daß es nicht so wäre ... Wenn er nur auch in Ordnung bleibt nach all dem ...«
»In Ordnung? Wieso in Ordnung?« begehrte die Tochter stirnrunzelnd auf. »Was meinst Du denn mit dem in In-Ordnung, Mama?«
Die Mutter schwieg eine Weile. Dann erklärte sie mit gewichtigem Ernst: »Ich hoffe und wünsche es ihm wirklich, daß er in Ordnung bleibt ...«
»O mein Gott!« rief die Tochter ungeduldig, »was soll das denn heißen, Mama?«
»Du bist zu jung, um selber von diesen Sachen zu wissen«, sagte die Mutter und sah die Tochter vorwurfsvoll und streng an. Und dann, durch eine machtvolle Fingergebärde bekräftigt, kam die Feststellung:
»In der Familie dieses Jungen sind seit Generationen Fälle von Wahnsinn vorgekommen.«
»O mein Gott, ich hab's ja gewußt«, stöhnte die Tochter.
»Jawohl, das ist Tatsache«, fuhr die Mutter unentwegt fort. »Zwei Schwestern seines Vaters sind im Zustand der Tobsucht gestorben, und die Großmutter dieses Jungen, Judge Robert Weavers Mutter, hat vor ihrem Tod zwanzig Jahre in völliger Umnachtung gelebt, und ich habe es vom Hörensagen, daß die Krankheit noch weiter zurückreicht, viel weiter ...«
Die Tochter fiel ein: »Ach, verschone mich damit! Bitte, verschone mich! Ich will nichts davon wissen! Grabe nicht die Vergangenheit aus und laß gewesene Dinge gewesen sein!« Sie wandte sich an den Bruder:
»Da siehst Du's wieder, nicht wahr? Sobald irgend jemand auftaucht, muß eine kleine Gräßlichkeit aus seiner Familie aufgetischt werden. Hat der Trick schon jemals versagt?« Sie lächelte unter zornig gerunzelter Stirn: »Also, ich rate Dir: mach Dir nichts draus. Mich würde so etwas auch nicht im geringsten scheren. Halte Dich mit so Leuten, das ist guter Umgang, verstehst Du? Er ist wirklich nett, und ...« sie blickte sich vergewissernd nach der Gruppe um, bei der Robert Weaver stand – »... er verkehrt mit den rechten Leuten. Ich bin durchaus für ihn.«
Nun wollte die Mutter mit ihm sprechen; der Sohn merkte es an ihrem beschäftigten Mienenspiel.
»Also mein Junge«, begann sie. Sie schüttelte den Kopf, verzog den Mund, spitzte ihn wieder, lächelte. Tränen traten ihr in die Augen. »Also, mein Junge, Du gehst nun, wie man so sagt, als ein Fremder unter Fremde in fremdes Land. Und lange, lange kann es dauern, bis Du wieder heimkehrst ...« Ihre Stimme bebte. Sie lächelte ein pathetisch-tapferes Lächeln, das den Sohn einem herzzerreißenden Mitleid mit seiner Mutter und gleichzeitig einer jähen Verzweiflung über sie auslieferte. »Ich hoffe, wir werden noch alle am Leben sein. Man kann ja nie wissen.«
»Mama, ich bitt' Dich um Christi willen, Mama!« rief der Sohn aus. Er hörte sich selber sprechen, hörte, wie seine Stimme fern und belegt klang. »Mußt Du denn jedesmal so einen Aufzug machen, wenn eins von uns wegfährt? Ich bitt' Dich, laß es doch dieses eine Mal!«
»Hör doch auf damit, Mama! Wirklich, hör auf damit!« sagte die Schwester nun in einem Ton, der befehlerisch rauh, aber auch herzhaft begütigend war. Auch ihr Gesicht sah nun ernst und bekümmert aus. »Sieh mal, Mama, er geht doch nicht auf ewig weg. Und da stellst Du Dich an, als wäre jemand gestorben! Boston ist doch nicht außer der Welt; wenn Du willst, kannst Du jeden Tag mit dem Zug hinfahren, weißt Du ... Und außerdem« – behauptete sie plötzlich scherzhaft, aber mit einer so anmaßenden Sicherheit, daß es den Bruder sofort wütend machte – »fährt er ja heute noch gar nicht! Nicht wahr, Du denkst doch gar nicht dran, fortzufahren, was?« wandte sie sich an den Bruder. Und mit einer Beharrlichkeit, die den Bruder verrückt machte, versicherte sie der Mutter abermals: »Er hat ja nur Spaß gemacht. Er fährt erst morgen. Ich wußte das die ganze Zeit, weißt Du, er wollte Dich bloß mal zum besten haben.«
Der junge Mensch stampfte so heftig mit den Füßen auf, daß sich die Leute auf dem Bahnsteig grinsend nach ihm umblickten. Er war außer sich.
»Herrgott, Helene!« krächzte er. »Was fällt Dir denn ein! Gottverdammtnocheinmal! Wo ich hier mit meinem Gepäck herumstehe und auf den Zug warte! Du weißt genau, daß ich heut fahre, heut, heut!«
»Hi-hi-hi-hi!« Die Schwester lachte und gickste ihn in die Rippen. Dann machte sie eine abweisende Bewegung, fuhr sich mit der Hand ans Kinn und sagte: »Na, meinetwegen mach's wie Du willst. Ich will Dich ja nicht halten. Ich sehe nur nicht ein, warum Du nicht auch morgen noch fahren kannst.«
»Jaja, das meine ich auch«, wandte die Mutter nun ein. Und vertrauensvoll und ernst blickte sie ihn an. »Weißt Du, ich bin ja nie auf einer Universität gewesen, aber ich bin fest überzeugt, daß sie Dich dort auch einen Tag später noch annehmen, wenn Du Deine Gelder ordentlich einzahlst.« Das Gespenst ihres Lächelns huschte um ihren Mund. Sie nickte langsam. Dann sah sie ihn fest an. »Wirklich, deswegen brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen, wenn man ordentlich bezahlt, wird man überall 'reingelassen, glaube ich ...«
»Aber Mama, ich bitte Dich«, sagte er leise. »Ich bitte Dich, wirklich ...« Er war tief verstört.
»Es ist ja schon gut, schon gut«, beschwichtigte die Mutter schnell. »Ich hab' ja doch bloß sagen wollen ...«
»Bitte, bitte, sei so gut, Mama!«
»K-k-k-k-k«, kicherte die Schwester und stocherte ihn in die Rippen.
Aber nun kam der Zug. Auf dem großen glänzenden Gleisbogen, eine halbe Meile außerhalb des Bahnhofs, kam der riesenhafte schwarze Rüssel der Lokomotive in Sicht, und durch die golddurchstäubte Luft des warmen Herbstnachmittags sahen sie den Zug kommen, hörten sie ihn mit kurzen Fauchstößen und rhythmischem Gerumpel herandonnern und verstummten mit furchtsamen, verzückten, sorgenschweren Herzen.
Schreck und Schauer der Zuganfahrt bestürzten den jungen Menschen so ungeheuer, daß ihm alle Dinge ringsum augenblicklich zur Bewußtheit kamen und sinnlich-heftig und unerträglich-scharf auf ihn eindrangen, ganz so wie es einem Verurteilten geht, der vom Todesgerüst herab seinen letzten Blick auf die Welt wirft. Er fühlte nun, schmeckte nun, roch nun, sah nun in einem Nu stillster Stille, in einer auf immer unauslöschlichen Schau die klumpigen Massen herbstlicher Bäume zur Linken des Bahnkörpers; roch den warmen Teer- und Holzgeruch der Schienenschwellen; sah einen stumpfrostroten leeren Frachtwagen gähnen, Mehlstaub am Boden; einen neuen Lagerschuppen daneben, roh, aus Betonklötzen gebaut, wie hingeschmissen – so empfand er mit einem plötzlichen Gefühl der Vereinsamung – in das üppig-dickblättrige, fruchtbare, schwere, namenlose Kraut und Unkraut, das die Scholle des Südens nährt.
Die Lokomotive schnaubte heran, sie brauste, ein Ungeheuer, vorbei ... in Manneshöhe arbeitete das furchtbare Stoßwerk der acht Kolbenstangen ... auf eine Sekunde stand der Maschinist da, die behandschuhte Hand am Drosselventil ... Schaltvorrichtungen und blanke Maschinenteile blitzten auf ... aus der Heizluke schlug eine wüste Flackerflamme ... aus dem Schlauch des Ablassers zischte scharf der dicke Dampf. Als die Wagen hinterherrollten und langsam, Stahl auf Stahl knirschend, die Räder zu Halt kamen, sah der Sohn das weiße bestürzte Gesicht seiner Mutter, sah er die schreckhaft-nackte Unschuld ihrer Augen, spürte er, wie sie sich mit rauher Hand an seinen Arm klammerte, hörte er die Angst in ihrer Stimme, als sie schnell fragte:
»Wie? Was? Ist das Dein Zug?«
Ja, es war sein Zug. Sein Zug, der gekommen war, um ihn ins fremde, geheimnishafte Herz der großen Nordstaaten zu bringen, in den Norden, den er nie gesehen hatte, den Norden, dessen düstere Einsamkeit, dessen herb-hehre Schönheit, dessen Glutfröste und Eisfeuer von Kind auf in seinen Vorstellungen brannten. Träume, wie sie nur ein Mensch aus den Südstaaten träumen kann, hatte er von dieser Nordwelt geträumt, ekstatisch-glückhafte, gierig-hungrige, unerträglich-wilde Sehnsuchtsträume. Die ungeheure Zaubermacht dieser fremden, stolz verschloßnen Nordwelt hatte er mit Herz und Hirn gespürt; und er hatte immer gewußt, daß er diese Nordwelt einst finden müsse, daß sie seines Herzens Hoffnung, seines Vaters Heimat, seiner Seele verlorne, aber unvergeßne Hälfte sei.
Nun war der Tag da und aus dem schwärmenden Blut erhoben sich ihm die zwei Daseinsgesichte – die beiden Wetterstimmungen und Seelenbelichtungen seines Ichs –: der weltferne, verlorene, einsame Süden und der stolze, glänzende, geheimnishafte Norden. Und so wie er die tausend Bilder des Südens, die er von Kind auf kannte, in Visionen sah, so schaute er nun auch den Norden in Wahrbildern: Kühne strahlende Städte mit ihren schwellenden Lebenszeiten ... Häfen voll Hafenluft und ein und aus fahrenden Schiffen ... Landschaften, felsenhart und schollenlocker, lieblich im holden Grün, zart in der Ahnungsvergangenheit des Wetters, heimlich-verzückt in der Spannung der Schneeluft. Die Musik dieser Gesichte begehrte auf in ihm mit herzsprengender, adernberstender, sehnenzerreißender Gewalt; er spürte den Zwang und Drang, rettende Worte zu finden, um das zu bannen, was ihn gepackt hatte; fand jedoch kein Wort. Jählings aber, in einem Gefühlssturz der Erlöstheit, wurde ihm bewußt, er würde nun wegfahren, die Straße in die Freiheit läge offen da, die Einkehr in fremde Einsamkeiten und ins gelobte Zauberland stünde ihm nun bevor. Diese leidenschaftlich ringende, Musik gewordene Bewußtheit, die er aussagen wollte und wiederum nicht aussagen konnte, riß ihm einen Schrei aus der Kehle, einen Tierschrei der Wut, einen Qualschrei um alles Verlorene, einen tödlich-verzückten, ekstatisch-beseßnen Freudenschrei. Er stieß die Arme in die Luft, schrie wild, und die Welt drehte sich um ihn in einem kaleidoskopischen Taumel von gleißenden Schienensträngen, schweren Laubmassen und starr-bleichen Menschengesichtern.
Plötzlich fand er sich wieder; er stand unter seinen Angehörigen auf dem Bahnsteig; die Welt schwamm in ihre rechten Formen und Maße zurück. Er konnte die Stimme seiner Mutter hören und das Getick des Morseapparats aus dem Stationszimmer; er konnte die Lokomotive erkennen, den schwarzen stumpfen Vorbau mit dem dicken, niederen Schornstein, aus dem in kurzen harten Stößen Rauch hochpuffte; er sah vor sich, ungeheuer groß in einer heischenden Gegenwärtigkeit, den Zug.
II
Die Reise von dem Gebirgsstädtchen Altamont nach der Weltstadt New York, deren Turmhäuser wie Mäste auf dem Felseiland Manhattan schwanken, dauert für amerikanische Verhältnisse nicht lange. Die Entfernung beträgt etwas mehr als siebenhundert Meilen, das sind rund elfhundert Kilometer, und für diese Strecke braucht der Zug zwanzig Stunden und ein paar Minuten. Aber die Eigenschaften von Zeit und Raum sind so relativ, und die flüchtigen, von Zeit und Raum bewirkten Eindrücke werden so vielfältig faßbar, daß ein Mensch auf dieser Reise ein ganzes Leben leben kann. Er kann ein ganzes Leben leben, und an zehn Millionen anderer Leben kann er in Augenblicken teilnehmen, und die endlose Gesamtflucht jener Bilder, die die Geschichte einer Nation darstellen, kann er beobachtend an sich vorüberziehen lassen.
Zunächst einmal bieten schon Übergang und Wechsel der Umwelt dem Reisenden Seltsames und Wunderbares genug. Er steigt nachmittags in den Zug und erlebt es mit ungläubigem Staunen, daß das vertraute Gesicht seiner Heimatgegend aus seinen festumfassenden Scheideblicken entschwindet. Im Laufe des Nachmittags ringt sich der Zug, Kurve um Kurve, durchs Gebirge und schleppt sich über Pässe. Allenthalben ragen die Berge auf, mächtige Erhebungen in der Bräune und den Schmelzgluten der Herbstfärbung. Die Gipfel, einsam und wild, freudig und verwegen, werden bereits von den Vorahnungen des Winters heimgesucht. Die Talstürze mit Klammen, Klüften und Felsrinnen schießen jäh und mit schreckhafter, schwindelerregender Steile ab. Und der Zug, die ungeheure, zählebige Schlange, windet sich langsam und mühselig über Steigung und Gefälle dahin. Diese ausgesprochen mühselige Langsamkeit des Zugs und die eindrucksvolle Stummheit und Nähe der wunderbaren Berge wirken zusammen; gemeinsam bewegen sie das Gemüt des Reisenden auf eine unerklärliche Art, und er hat Empfindungen, wie sie jedermann vertraut sind, Empfindungen des scharfandringenden Schmerzes und der wilden Lust zugleich, des bekümmerten Abschiedswehs und der sieghaften Ankunftsfreude.
Der Zug schafft sich bergan, er biegt um eine Kurve, hart und metallisch klingen die kurzen Puffstöße aus dem niedern Schornstein der Lokomotive gegen das Gefäll des Felseinschnitts. Der Reisende blickt aus dem Fenster, er sieht wie Einschnitt und Abschrägung langsam vorbeiziehen; der alte Fels glänzt feucht vom Leckwasser eines begrabenen Bergquells; der Zug fährt langsam über die Überführung einer Schlucht; tief drunten sieht und hört der Reisende das felshelle Bergwasser schäumen und tosen; neben dem Gleis steht vor seiner Bahnwärterhütte ein Weichensteller und betrachtet den Zug mit dem langsamen, verwunderten Blick, der den Bergbewohnern eigen ist. Die kleine Hütte, in der der Mann wohnt, steht hart und gefährdet am Rand der abschüssigen Steile. Schlampig, das Haar glatt über den Kopf zu einem wirren Wuschel zurückgebunden, einen Schnupfstecken im Mund, ein schmutziges Kindchen auf dem Arm, steht die Frau des Bahnwärters in der Tür der Hütte; sie hat denselben hageren, harten, langsam-verwunderten Blick wie ihr Mann.
Das alles ist so nah, fern, furchtbar, schön und wirkt so unmittelbar vertraulich, daß es dem Reisenden zumute ist, als hätte er diese Bahnwärtersleute von jeher gekannt, als müsse er ihnen nun durchs Fenster des üppig-bequemen Pullmanwagens die Hand zustrecken und mit ihnen reden. Es ist ihm, als wäre – wieso weiß er nicht – das ganze bittre und wunderbare Geheimnis des Lebens in diesem Augenblick aus Gruß und Lebewohl beschlossen. Einmal hat er dies gesehen, und im Augenblick des Sehens wurde es ihm entrückt, und es gehört ihm nun auf immerdar, und er kann es niemals vergessen. Der Zug fährt an diesen Gesichtern vorbei, der Zug fährt weiter, und im Herzen des Reisenden bleibt etwas Unsägliches zurück.
Schließlich hat der Zug die letzte Steigung überwunden, auf den glänzenden Serpentinenbogen der Gleisspur ist er bergab gefahren und hat mit dem einbrechenden Abend die Ebene erreicht. Die Sonne, ein ungeheurer orange- und pollenfarbener Ball, geht unter. Die taumelnden Bergketten, in ein überrauchtes, zaubrisches Purpurrot getaucht, verdämmern. Die Nacht kommt, die großsternige, sammetbrüstige Nacht. Und nun rollt der Zug mit gleichmäßigem Rhythmenstoß durch das breit aufgerollte Flachland des Staates Catawba.
Gegen neun Uhr kommt eine Pause: Rangieren und Lokomotivenwechsel an einem Eisenbahnknotenpunkt. Der Reisende, erregt und erwartungsvoll, von seiner inneren Unrast getrieben, steigt aus. Er geht auf dem Bahnsteig auf und ab, geht in den Wartesaal, geht hinaus auf die Straße. Er tut das, um sich Zigaretten und ein belegtes Brot zu kaufen, es ist ihm aber völlig bewußt, daß er es in Wirklichkeit tut, um auf einen Augenblick mit einer andern Stadt in Berührung zu kommen. Er betrachtet sich die riesenhaften Lokomotiven auf den Rangiergleisen, er sieht die Heizer und Lokomotivführer, die im Dampf und Rauch und im Widerschein des Feuers an der Maschine zu tun haben, er sieht die gefurchten, berußten, einsamen Gesichter dieser Männer – und ein paar Minuten später fährt er wieder über das kunstlos-rohe, geheimnisträchtige Gesicht der mächtigen, dunklen Erde, der einsamen Erde des alten Catawba.
Um Mitternacht hält der Zug wieder, diesmal an einer größeren Stadt, der letzten Station in Catawba. Und wieder, von denselben Gefühlen bestimmt, von denselben Regungen getrieben, steigt der Reisende aus, geht auf dem Bahnsteig auf und ab, betrachtet die Lokomotive, geht in den Bahnhof. Er sieht allen Leuten, die vorübergehn, ins Gesicht. Jedesmal ist es Begegnung – sofortige Vertrautheit, Gruß und Lebewohl –, Begegnung in dem eigenartig-einsamen, schmerzhaft-weltfremden Lebensgefühl, das der amerikanische Mensch so gut kennt. Dann sitzt er wieder im Pullman, die letzten Außenposten der Stadt entgleiten seinem Blick, und die Fahrtrichtung des Zuges, die den ganzen Nachmittag über westwärts war, ist nun nordwärts, den geheimen Grenzen Virginiens entgegen, den großen Weltstädten der Hoffnung entgegen, den Fabelbezirken der Kindheit und des geheimen Herzenshungers entgegen, der Welt entgegen, nach der dieser Reisende mit Geist und Leben verlangt.
Die kleine Vaterstadt in dem großen Gebirge, die Gesichter und Stimmen der Verwandten und Freunde, die wohlbekannten Formen heimatlicher Dinge, das alles erscheint dem Reisenden nun fern und seltsam wie Träume, verloren in der millionengesichtigen Meerestiefe der dunklen Zeit, verloren an das sonderbare und bittre Geheimnis des Lebens. Er kann es sich nicht denken, daß er je in jenen fernen verlornen Bergen gewohnt hat, und er kann es sich nicht denken, daß er jene Berge je verließ, und so wird ihm sein ganzes Leben seltsamer als der Traum von der Zeit, und der große Zug fährt und fährt über das unendliche und einsame Gesicht der amerikanischen Erde, dröhnt dahin mit seinem Gebraus von großer Eintönigkeit, einem Geräusch, das zum Laut der Stille und der Ewigkeit wird. Und im Zug und in zehntausend kleinen Städten schlafen die Schläfer auf Erden.
Und nun steigen Gram und Einsamkeit und Lust in ihm auf und schwellen ihm die Kehle, aus dem Innersten seines Herzens kommt der unstillbare Hunger und erobert ihn, eine wilde, wortlose Wut reitet ihn, und in den dunklen Wachestunden um Mitternacht kommt er an die Grenzen der alten Erde Virginiens.
Wer sah die Wut, die das Gebirge ritt? Wer sah die Wut, die im Sturm brauste? Wer ist in seiner Jugend wahnsinnig gewesen vor Wut, rastlos, friedlos und ohne Gewißheit vor Wut, wen hat die Wut auf Erden umgetrieben, bis der große Weinstock des Herzens brach ward, bis das Gehäuse aus Blut, Knochen, Sehnen, Mark, Hirn und Nerven, in dem die Wut wütete, verzerrt war, zerrenkt, schal, abgenutzt, erschöpft von der Wut, die sich nicht abwerfen ließ? Wer kannte die Wut, wer wußte, woher sie, die Furie, kam?
Kam sie mit dem Atem, der Speise, dem Trank, so daß sie nun in uns ist, so sehr, daß wir ihrer nicht ledig werden, wo auch immer wir weilen? Sie ist ein feiner, sonderlicher Wurm, der uns ständig am Herzen zehrt. Sie ist ein Wahnsinn, der unser Hirn besitzt; ein Hunger, der vom Essen kommt, wenn wir den Hunger stillen; ein Teufel, der auf unseren Blutbahnen einherfährt; ein wilder, dunkler, unbezähmbarer Geist, der uns die Seele schwellt; und nun sitzt sie im Sattel, die Wut, reitet unser Leben, stößt uns den Sporn ihrer unersättlichen Gier in die nackten, wehrlosen Weichen; sie ist unser Herr und Meister, sie ist der verrückte, grausame Tyrann, der uns zwingt, Schritt für Schritt weiterzugehen in den blinden rohen Wandelhöhlen unsrer aus den ewig-gleichen Spielbildern zusammengestückten Tage, an deren Ende dann das blinde Maul der Grube ist, Dunkelheit, und sonst nichts. Sonst nichts.
Dann aber, dann wird die Wut von uns weichen. Sie wird ablassen von dem Leben, auf dessen roten Blutbahnen sie sich ständig umtrieb. Ein Wurm anderer Art wird an dem großen Weinstock zehren, von dem sich die Wut genährt hat. Dann, ja dann muß die Wut nachgeben, sie muß ihr Zelt abschlagen und den Rückzug antreten, denn im Hirn des Toten ist kein Platz mehr für Wahnsinn, im Fleisch des Toten ist kein Raum mehr für Hunger, im Herz des Toten ist keine Stätte mehr für Begier.
Wann und wo war es, daß er der wartenden Wut ausgeliefert ward? War es in einer sammetbrüstigen Nacht vor langer Zeit, einer Nacht im Bergsommer, als auf der dunklen Straße ein Liebespaar näher kam und er die Stimme des Mannes hörte, eine tiefe, halblaute, selbstverständliche, vertrauliche Mannesstimme, und dann plötzlich ein üppig-aufquellendes, tiefes Frauenlachen, das zärtlich und sinnenlüstern in die Nacht schwang und davonschaukelte und unterging in der selig summenden Stille?