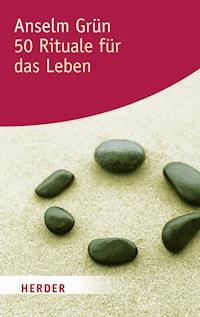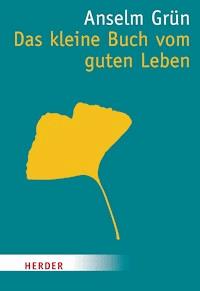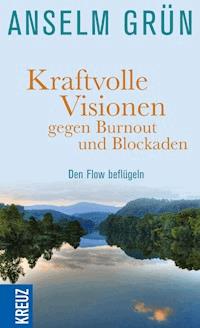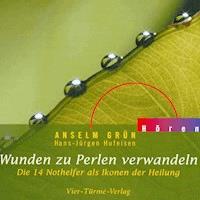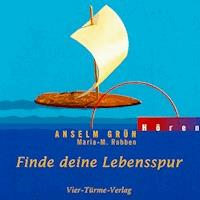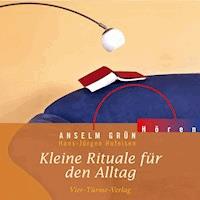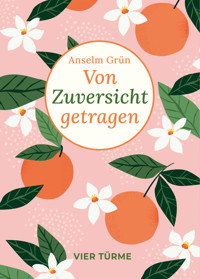
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wenn die Welt aus den Fugen zu geraten droht und uns ein scharfer Wind ins Gesicht weht, müssen wir alle Energie zusammennehmen, um in unserer Mitte zu bleiben. Anselm Grün schreibt über die Kraft der Gedanken, über innere Balance, über Geborgenheit und Gottvertrauen, über all das, was uns immer wieder neu den Mut zum Weitergehen gibt. Denn Gott und dem Leben zu vertrauen – das ist es, was uns durch herausfordernde Zeiten trägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie. Detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Printausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2025
ISBN 978-3-7365-0651-0
E-Book-Ausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2025
ISBN 978-3-7365-0676-3
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Erstellung: Sarah Östreicher
Lektorat: Antonie Hertlein
Covergestaltung: Chandima Soysa
Covermotiv: Angelina Bambina/shutterstock
www.vier-tuerme-verlag.de
Anselm Grün
Von Zuversicht getragen
Kleine Bibliothek der Lebenskunst Band 3
Vier-Türme-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Ich bleibe dennoch voll Zuversicht
Angst und Dunkelheit überwinden
Sehen, was mich trägt
Nach vorne schauen
Lichtblicke
Der Blick fürs Wesentliche
Was Zuversicht verleiht
Guide
Cover
Impressum
Buchtitel
Ich bleibe dennoch voll Zuversicht
Heute angesichts der Unsicherheit, die unsere Welt beherrscht, angesichts der Kriege und einer ungewissen Zukunft von Zuversicht zu sprechen, scheint unangebracht. Die Menschen haben heute eher Angst vor der Zukunft. Sie schauen nicht mit Zuversicht auf das, was kommen wird, sondern in banger Erwartung. Auf sie trifft eher zu, was Jesus in seiner Endzeitrede sagt: »Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden« (Lukas 21,26). Aber gerade in dieser aufgewühlten Situation unserer Zeit brauchen wir die Zuversicht, um bestehen zu können.
Zuversicht ist das feste Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft. Ich sehe voll Vertrauen auf das, was auf mich zukommt. Ich vertraue darauf, dass es gut wird. Der Volksmund hat schöne Formulierungen von der Zuversicht, zum Beispiel »Zuversicht ist das Geheimnis des Alters«. Alte Menschen schauen voll Zuversicht in die Zukunft. Sie haben genug in der Vergangenheit gesehen, sodass sie aus dem Gesehenen Vertrauen schöpfen, dass auch die Zukunft trotz aller düsteren Voraussagen etwas Gutes bringen wird.
Eine andere Formulierung des Volksmundes: »Mit der Einsicht steigt die Zuversicht«. Wenn ich tiefer sehe, wenn ich in die Dinge hineinsehe, habe ich Zuversicht, dass das Äußere, das uns heute so viel Angst macht, nicht das Letzte ist. Wenn ich mit Zuversicht an die Dinge herantrete, strahle ich Vertrauen aus, das mir hilft, die Probleme zu lösen und mich von ihnen nicht lähmen zu lassen.
Der stoische Philosoph Epiktet, der von den frühchristlichen Autoren gerne zitiert wird, verbindet Vorsicht mit Zuversicht: »Wir sollten alles gleichermaßen vorsichtig wie auch zuversichtlich angehen.« Zuversicht ist also nicht blind. Sie braucht die Verbindung mit der Vorsicht. Vorsicht bedeutet auch: voraussehen, nach vorne sehen, sich aber auch bewusst machen, dass man nicht einfach vorangehen kann. Man sollte auch voraussehen, wohin der Weg führt. Die Bibel spricht häufig von der Zuversicht, die wir haben dürfen, weil wir auf Gott vertrauen. So heißt es im Psalm 23,4: »Muss ich auch gehen in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.« Und auch wenn Menschen gegen uns toben, ja selbst wenn ein Krieg mich bedroht, so kann der Psalmist trotzdem sagen: »Ich bleibe dennoch voll Zuversicht« (Psalm 27,3).
Angesichts der Kriege, die heute unsere Sicherheit und unser Vertrauen in die Welt erschüttern, bräuchten wir die Zuversicht, mit der der Psalmist auf alle Gefahren schaut, die ihn bedrohen. Ein alter Mensch ist sich sicher: »Du bist ja meine Hoffnung, o Herr, Herr, meine Zuversicht von Jugend auf« (Psalm 71,5). Wer mit dieser Zuversicht auf seine Lebensgeschichte schaut, der kann auch voller Vertrauen in die Zukunft gehen.
Paulus lebt voller Zuversicht, auch wenn der Tod ihn bedroht. Denn der Tod ist für ihn kein Ende, sondern ein Hinübergehen zu Jesus, um immer beim Herrn zu sein. »Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein« (2 Korinther 5,8). Gerade der Hebräerbrief mahnt seine Leser und Leserinnen, dass sie voller Zuversicht leben sollen. Bibelwissenschaftler meinen, der Hebräerbrief stammt von einem Autor, der erlebt hat, dass die Christen auf ihrem Weg müde geworden sind. Mit einer neuen Theologie möchte er den ermüdeten Christen wieder neue Zuversicht schenken: »Lasst uns also voll Zuversicht hintreten zum Thron der Gnade« (Hebräer 4,16). Und er mahnt uns, unsere Zuversicht nicht wegzuwerfen (Hebräer 10,35).
Wir bitten Gott darum, dass er uns in dieser hoffnungsarmen Zeit Zuversicht schenkt, damit wir uns von den Bedrängnissen und Gefährdungen nicht erschrecken lassen, sondern voll Vertrauen in die Zukunft gehen, in der Hoffnung, dass die Zukunft in Gottes Hand ist und nicht in der Hand der Mächtigen.
Das ist die Frohe Botschaft Jesu. Er steht immer vor unserer Tür und klopft an. Doch es liegt an uns, das Klopfen zu hören und unsere Tür für ihn zu öffnen.
IhrP. Anselm Grün
Angst und Dunkelheit überwinden
Eine Grunderfahrung des Menschen ist heute Angst. Es sind viele Ängste, die uns bedrängen: Angst vor der Zukunft, Angst vor Terror und Krieg, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Versagen, Angst vor Krankheit und Tod, Angst vor der Sinnlosigkeit des Daseins.
Mit der Existenz des Menschen ist eine Grundangst verbunden, die auch von der Psychologie nicht aufgelöst werden kann. Es ist die Angst, die durch seine Endlichkeit gegeben ist, die Angst, kein Recht auf sein Dasein zu haben, nicht in sich zu ruhen, sondern angewiesen zu sein auf einen anderen.
Diese Grundangst des Menschen kann keine Psychologie aufheben, sie kann nur in einem tiefen Vertrauen auf Gott überwunden werden, der uns hält und uns den Grund unseres Daseins schenkt, der uns aus Liebe geschaffen hat und uns aus Gnade leben lässt.
»Bei dir, o Herr, suche ich Zuflucht, lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit! Sei mir ein bergender Fels, zu dem ich allzeit kommen darf. Du hast entschieden, mich zu retten, du bist ja mein Fels und meine Feste.« (Psalm 71,1.3)
So betet der Psalmist: »Wirke das Wunder deiner Liebe! Du rettest, die sich an deiner Rechten bergen vor dem Feind. Hüte mich wie den Stern deines Auges. Verstecke mich im Schatten deiner Flügel« (Psalm 17,7–8).
Hier bieten die Flügel Schutz vor dem Feind, der mich bedrängt. Das gilt nicht nur für die Menschen, die mich von außen anfeinden, sondern auch für die inneren Feinde. Ich brauche die Erfahrung Gottes, der mich mit seinen Flügeln bedeckt und beschützt vor den Feinden in meiner Seele, etwa vor der Angst, die mich in Griff nehmen will, vor der Verzweiflung, vor den Selbstbeschuldigungen und Selbstentwertungen. Gottes Flügel bewahren mich vor den destruktiven Tendenzen meiner Psyche, vor den krankmachenden Lebensmustern.
Im Psalm 61 werden beide Bilder zusammen gesehen: der Turm, der mich schützt, und die Flügel, die mich bergen: »Denn du bist meine Zuflucht, ein fester Turm vor dem Feinde. In deinem Zelt möchte ich Gast sein auf ewig, im Schutz deiner Flügel mich bergen.« (Psalm 61,4–5)
Was wir heute an Bösem erleben, das durch terroristische Akte ausgedrückt wird, hat oft als Ursache die Angst. Es ist die Angst vor der Bedrohung der eigenen Weltanschauung, des eigenen religiösen fundamentalistischen Systems. Und aus Angst wehrt man sich ohne Maß und wird blind für das Böse, das man Menschen antut. Der Fundamentalismus und Fanatismus als Ursache des Bösen haben ja letztlich in der Angst vor der eigenen Unsicherheit und in der Angst vor dem eigenen Versumpfen in der Unmoral ihre letzte Ursache.
Die Überwindung des Bösen gelingt daher nur, wenn wir die Angst verwandeln können. Wir können die Angst nie ganz besiegen; sie wird immer wieder in uns aufsteigen. Aber es gibt dennoch Wege, die Angst zu verwandeln. Für Søren Kierkegaard kann die Angst nicht durch einen Menschen aufgelöst werden, sondern allein durch Gott. Trotzdem sind die menschlichen Hilfen wichtig, um die Angst zu überwinden.
Wenn ich heute das Vaterunser bete, so erinnere ich mich immer wieder an meinen Vater, für den dieses Gebet sein Lebensbegleiter, aber auch seine Lebensschule war. Er hat mit diesem Gebet die schwierigen Situationen in seinem Leben bewältigt. Und dieses Gebet war für ihn gerade im Dritten Reich der Weg, innerlich klar zu bleiben und sich nicht von der Nazi-Ideologie anstecken zu lassen. Damals war daher auch die Bitte »Erlöse uns von dem Bösen« für ihn eine Hilfe, sich vom Bösen nicht infizieren zu lassen.
Die Liturgie sieht für das Vaterunser die Gebärde der erhobenen Hände vor. Diese Gebärde ist eine Segensgebärde. Man kann sich vorstellen, dass man so den Segen der Gebetsworte in die Welt hinausschickt.
Vielen Menschen kommen immer wieder Zweifel, Zweifel an ihrer Entscheidung, Zweifel an ihrem Ehepartner, Zweifel an ihrem Beruf. Oft nützt es nichts, die Zweifel zu unterdrücken oder sie sich zu verbieten. Sie werden immer wieder kommen und uns in Angst und Unsicherheit treiben.
Wenn wir den Zweifel zugeben, sagen: Ja, das stimmt, das trifft alles zu, aber … aber trotzdem stehe ich zu der Entscheidung, trotzdem bleibe ich bei meinem Partner, dann nehmen wir den Zweifeln ihre Kraft und sie bedrängen uns nicht mehr. Wir stehen nicht mehr unter dem Druck, die Zweifel mit Argumenten entkräften zu müssen. Wir lassen sie zu und können so gelassen mit ihnen umgehen.
In letzter Zeit ist in den Seelsorgegesprächen, die ich führe, ein Thema aufgetaucht, das mich hellhörig gemacht hat: Immer öfter erzählen mir die Menschen, dass sie sich innerlich leer fühlen.
Bei meiner Beschäftigung mit dem Begriff stieß ich auf zwei ganz unterschiedliche Formen von Leere. Die eine wird von Psychologen als Gefühlsleere beschrieben, die innere Leere als Ausdruck von Depression. Das versuchen Therapeuten mit ihren Klienten zu bearbeiten, sodass sie einen angemessenen Umgang damit finden können.
Diese depressive Leere erleben auch jene, die sich in ihrem geistlichen Leben auf einmal leer fühlen und die Beziehung zu Gott verloren haben.
Daneben hat jedoch die Leere noch eine ganz andere spirituelle Bedeutung. Vor allem Menschen, die Zen-Meditation üben, sprechen von der Leere als dem Ziel ihrer Meditation. Sie ist die Voraussetzung dafür, das Göttliche in sich zu spüren. Diese Form der Leere spielt auch in der mystischen Tradition des Christentums eine wesentliche Rolle. Der mittelalterliche Theologe und Philosoph Meister Eckhart spricht immer wieder davon. Seiner Ansicht nach ist sie die Voraussetzung, dass Gott zu uns kommen und wir mit Gott eins werden können.
Diese beiden Konzeptionen von Leere scheinen sich völlig zu widersprechen. Doch wenn wir die psychische Leere genauer anschauen und mit unserem Bewusstsein in sie hineingehen, so werden wir entdecken, dass auch diese Leere letztlich eine große Sehnsucht nach Fülle ist, nach Transzendenz.
Unterhalb der Leere entdecken wir eine tiefe Sehnsucht nach etwas, das größer ist als wir selbst und das unsere Leere zu erfüllen vermag. Die innere Leere lädt uns ein, unser Ego loszulassen und uns in das Geheimnis Gottes hineinfallen zu lassen.
In einer Zeit, in der alles möglich ist, fühlen sich viele Menschen überfordert, ihre eigene Identität gegenüber anderen darzustellen. Wenn der Anspruch, man selbst sein zu müssen, nicht erfüllt werden kann, fühlt man sich innerlich leer und wertlos. Das führt zum »erschöpften Selbst«. So hat Alain Ehrenberg sein Buch überschrieben.
Für ihn ist unsere »Unterwerfung unter die Normen der Leistungsfähigkeit« daran schuld, dass wir uns ständig überfordert, müde und leer und bedeutungslos fühlen. Die innere Leere ist also eine Reaktion unserer Seele auf den übertriebenen Anspruch, immer mehr leisten und durch unsere Leistung mit anderen konkurrieren zu können.