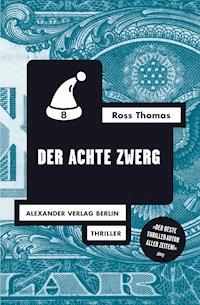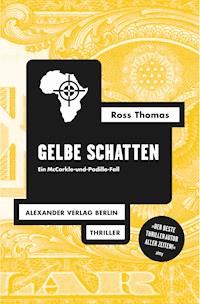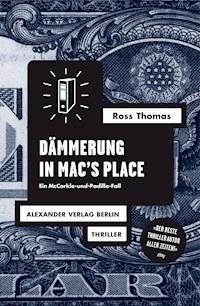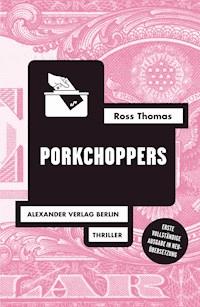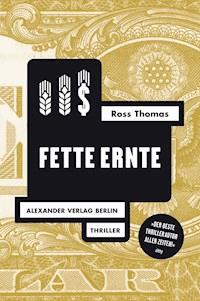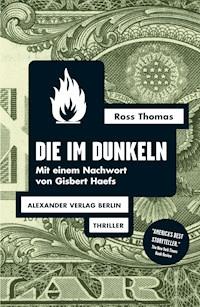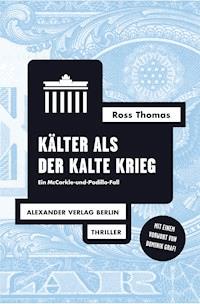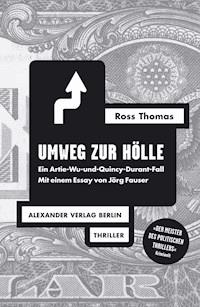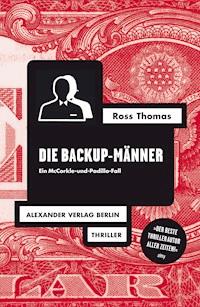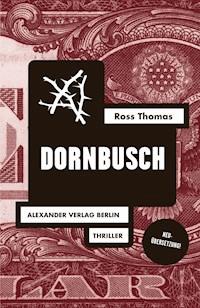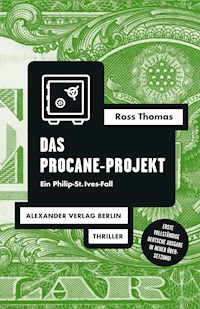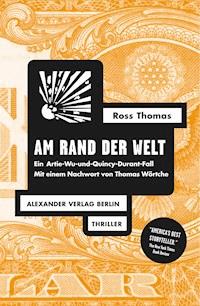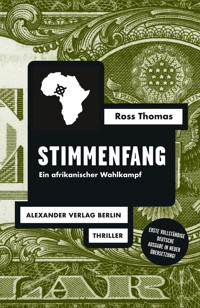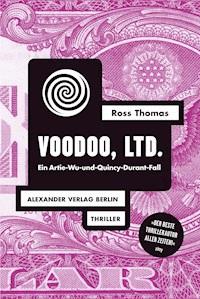
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ross-Thomas-Edition
- Sprache: Deutsch
Bearbeitete Neuausgabe. Der dicke Chinese Artie Wu, sein Geschäftspartner Quincy Durant, der Hochstapler "Otherguy" Overby, der alternde Terrorismusexperte Booth Stalling und die mit allen Wassern gewaschene Ex-Agentin Georgia Blue, das sind die Protagonisten des dritten und letzten Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Falls. "Die Wudu, Ltd. ist eine straff geführte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die für andere das tut, was sie selbst für sich nicht tun können", sagt Artie Wu, Chef der exklusiven Agentur Wudu, Ltd. Mit anderen Worten, sie lösen Fälle für einen Haufen Kohle - Fälle wie den Mord an dem Hollywood-Produzenten Billy Rice. Am Neujahrsmorgen 1991 wird die Film-Diva Ione Gamble volltrunken und mit abgefeuerter Tatwaffe in der Hand neben der Leiche ihres millionenschweren Ex-Verlobten aufgefunden. Vor dem Hintergrund des ersten Irakkriegs beginnt das Spezialistenteam Wudu, Ltd. mit seinen Ermittlungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Ross Thomas, Voodoo, Ltd.
Ross Thomas
Voodoo, Ltd.
Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Aus dem Amerikanischen
von Walter Ahlers
Alexander Verlag Berlin
Die Ross-Thomas-Edition im Alexander Verlag Berlin
Herausgegeben von Alexander Wewerka
Umweg zur Hölle. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Am Rand der Welt. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Kälter als der Kalte Krieg. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Gottes vergessene Stadt
Teufels Küche
Die im Dunkeln
Die Übersetzung wurde für diese Ausgabe bearbeitet.
2. Auflage 2010
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel Voodoo, Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel Voodoo & Co im Heyne Verlag München.
© 1992 and 2009 by the Estate of Ross E. Thomas
Licensed with The Estate of Ross E. Thomas
© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2009 Alexander Wewerka, Postfach 19 18 24, D-14008 Berlin
www.alexander-verlag.com
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der – auch auszugsweisen – Wiedergabe ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Verlag gestattet.
Druck und Bindung: Interpress, Budapest
ISBN 978-3-89581-209-5
Printed in Hungary (March) 2010
Ebook: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH
1
Bei dem Zweisitzer, der am Neujahrsmorgen kurz nach fünf Uhr mit mehr als 82 Meilen pro Stunde durch Malibu raste, handelte es sich um einen fast neuen Mercedes 500 SL – Preis ab Werk 101414,28 Dollar. Der Wagen wurde mit einer Hand gelenkt, der linken Hand der nicht mehr ganz vollkommenen Schönheit und Doppelverdienerin Ione Gamble, deren Blutalkohol später mit über zwei Promille gemessen wurde, womit ihr nachgewiesen werden konnte – juristisch und auch sonst –, daß sie stark betrunken war, zum zweiten Mal in ihrem Leben.
Die Schauspielerin und Regisseurin, deren zwei Handwerke oder Berufe sie im Hollywoodjargon zu einer Doppelverdienerin machten, lenkte ihr Auto weiter mit der linken Hand, weil die rechte damit beschäftigt war, ein Telefon an ihr Ohr zu halten, mit dem sie gerade dem fünfunddreißigsten und letzten Klingelton lauschte. Dann tauschte sie das Telefon gegen eine Halbliterflasche achtzigprozentigen Smirnoff-Wodka, die auf dem Beifahrersitz lag. Nachdem sie sich die restlichen vierzig Kubikzentimeter einverleibt hatte, ließ sie das rechte Türfenster per Knopfdruck herunter und warf die Flasche nach draußen, wo sie gegen einen geparkten 86er Honda Civic prallte.
Die Gamble war durchaus geneigt, anzuhalten und eine Nachricht zu hinterlassen, daß sie für jeden Schaden aufkommen würde. Aber bis diese Nachricht im Geiste formuliert, überdacht und noch einmal überdacht war, hatte sie den Honda schon eine Meile hinter sich gelassen und näherte sich ihrem Ziel in Carbon Beach. Als sie Sekunden später dort ankam, waren die Botschaft, die zerschmetterte Flasche und der Honda vollständig aus ihrem Gedächtnis gelöscht.
Inzwischen hatte sie den Wagen auf die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 45 Meilen pro Stunde verlangsamt und rollte die linke Spur des Pacific Coast Highway im Leergang entlang. Nebenbei suchte sie nach der elektrischen, von ihr verlegten Fernbedienung, mit der sie die Stahltore öffnen konnte, die das 13-Millionen-Dollar-Haus sicherten, dessen Besitzer beinahe jeden damit verärgerte, daß er es seine Strandhütte nannte.
Die Gamble suchte vergeblich nach dem elektronischen Türöffner. Aber als sie nach links über die beiden Gegenfahrbahnen des Highway bog, erkannte sie im Licht ihrer Scheinwerfer, daß die Tore bereits offen waren. Sie fuhr hindurch und stellte den Wagen vor der Dreifachgarage ab, von deren Türen beinahe eine Woche nach Weihnachten noch immer ein phantasievolles Triptychon von Santa Claus, seinen Rentieren und den Elfen strahlte.
Die Gamble schaltete Motor und Scheinwerfer aus und nahm wieder das Autotelefon zur Hand. Sie rief die Nummer an, die sie bereits vorher angerufen hatte, und ließ es fünfzehnmal läuten. Dann gab sie auf und begann, mehrmals hintereinander auf die Hupe des Mercedes zu drücken, in der Signalfolge dreimal kurz und einmal lang, einer groben Annäherung an den Morsecode für den Buchstaben V – dem einzigen Morsecode, den sie kannte.
Drei Minuten später hörte die Gamble mit dem Lärm auf, ließ das linke Seitenfenster herunter und wartete darauf, daß etwas passieren würde. Sie wäre mit einem wütenden Nachbarn zufrieden gewesen, der sie anbrüllte, sie solle verdammt noch mal ruhig sein. Oder mit Billy Rice, der aus dem Haus gelaufen käme und sie anflehte, um Gottes willen hereinzukommen und einen Drink mit ihm zu nehmen – oder auch nur mit einem plötzlich erleuchteten Fenster irgendwo, das ihr bewiesen hätte, daß es noch Leben gab in Malibu, an diesem Dienstag, dem 1. Januar 1991 um fünf Uhr und elf Minuten am frühen Morgen.
Als es jedoch weder verärgertes Gebrüll noch Einladungen zum Drink oder plötzlich erleuchtete Fenster gab, kletterte die Gamble aus dem Wagen, schlug die Tür so fest sie konnte zu, hoffte, daß etwas zerbrechen würde, und war doch erleichtert, daß alles heil blieb. Sie ging um das Heck des Wagens herum, trat äußerst behutsam drei Schritte zurück, sog soviel Luft wie sie konnte in ihre Lungen und brüllte: »BILLY RICE WAS FÜR’N SCHEISS!«
Sie wartete, lauschte, aber als sie weder ein Dementi noch eine Erwiderung hörte, drehte sie sich um und steuerte auf den Vordereingang zu. Während sie das tat, ging auf der anderen Seite des Highway im zweiten Stock eines gelben Hauses ein Licht an. Es fiel jedoch aus einem schmalen, hohen Fenster, wie Badezimmer sie haben, und die Gamble kam zu dem Schluß, daß es wohl irgendein armer Bursche sein mußte, den seine Prostatabeschwerden aus dem Bett gescheucht hatten.
Eine zweieinhalb Meter hohe Mauer, gebaut aus glasierten Backsteinen, schirmte die Haustür vor neugierigen Blicken ab und diente gleichzeitig als Schallschutz gegen den Verkehrslärm vom Highway. Diese Mauer und die eigentliche Hauswand bildeten einen kurzen, nicht überdachten Durchgang, den die Gamble langsam entlangging, während sie alle drei Taschen ihrer cremefarbenen Wildlederjacke nach dem Schlüssel für Billy Rices Haustür durchwühlte.
Erst nachdem sie jede Tasche zum viertenmal durchsucht hatte, erinnerte sie sich – wenn auch dunkel – daran, daß sie hastig aus ihrem Haus in Santa Monica aufgebrochen war und sich gerade noch die Zeit genommen hatte, die Autoschlüssel und die Wodkaflasche mitzunehmen, nicht aber die braune Lederhandtasche. Und genau dort steckte natürlich der Schlüssel für die Vordertür des Hauses: hinter dem Reißverschluß des Kleingeldfachs der Handtasche.
Die Gamble glaubte immer noch daran, daß es einen Weg geben müßte, Billy Rice wach zu kriegen. Sie konnte gegen die Tür hämmern oder Sturm klingeln und sogar heulen wie ein Kojote, bis sich endlich etwas tun würde. Sie hatte sich gerade für die Imitation des Kojoten entschieden, als sie bemerkte, daß die Tür nur angelehnt war. Erst versetzte sie ihr versuchsweise einen Schubs und dann gleich einen so harten Stoß, daß sie ganz aufflog.
Sobald sie in dem dunklen Haus war, tastete die Gamble nach dem Lichtschalter, von dem sie wußte, daß er an der linken Seite war, fand ihn und schaltete die Lichter ein, die das Marmorfoyer erleuchteten, das zu dem riesigen Wohnzimmer und der nicht minder weiträumigen Terrasse dahinter führte.
Die indirekte Beleuchtung des Foyers war darauf ausgerichtet, zwei Gemälde zur Geltung zu bringen, die sich von zwei gegenüberliegenden Wänden aus anblickten. Links hing der Chagall, rechts der Hockney. Unter dem Hockney stand ein kleiner, quadratischer Tisch aus stark gemasertem Ulmenholz, gerade groß genug für die tägliche Post, drei Autoschlüssel und – in diesem Fall – eine halbautomatische 9-mm-Beretta.
Die Gamble nahm die Pistole zur Hand, untersuchte sie und rief dann aus: »He, Billy, willste nicht runterkommen und zugucken, wie ich mir den großen Onkel abschieße?«
Mit gesenktem Kopf, die Pistole an der rechten Seite nach unten gerichtet, wartete sie, als hoffte sie auf irgendeine Art Protest. Als der jedoch ausblieb, hob sie die Beretta, zielte sorgfältig, drückte den Abzug durch, wie man es ihr auf dem Schießstand in Beverly Hills beigebracht hatte, und schoß ein kleines, sauberes Loch durch das linke untere Viertel des Chagall.
Als der Pistolenschuß weder einen Aufschrei noch ein Winseln auslöste, ging die Gamble vorsichtig durch den letzten Teil des Marmorfoyers und betrat das Wohnzimmer. Durch seine rundum verglasten Außenwände konnte sie die Lichter von Santa Monica und – etwas weiter weg – die schwächeren Lichter von Palos Verdes sehen, wo – daran gab es für sie nicht den geringsten Zweifel – die langweiligsten Menschen Kaliforniens, wenn nicht der ganzen Welt, lebten.
Als sie sich von diesem Anblick abwandte, fiel ihr ein großer heller Haufen in der südwestlichen Ecke des Zimmers auf. Aus irgendeinem Grund sah der Haufen aus, als sei er dort verloren, liegengelassen oder vielleicht auch einfach nur vergessen worden. Neugierig durchquerte die Gamble das Wohnzimmer; die Pistole nahm sie in die linke Hand. Mit der rechten Hand schaltete sie eine Tischlampe ein, und jetzt entdeckte sie, daß es sich bei dem Haufen um William A. C. Rice IV. handelte.
Er lag auf dem Rücken, die blauen Augen offen und auf die mit Balken gestützte Spitzdecke gerichtet. Das lange rechte Bein hatte er am Knie etwas abgewinkelt, das lange linke Bein war ausgestreckt. Arme und Hände waren willkürlich angeordnet, die rechte Hand zeigte nach Norden, die linke in südsüdwestliche Richtung. In der nackten unbehaarten Brust hatte er, gleich links von der rechten Brustwarze, zwei dunkle Löcher. Seine Füße waren ebenfalls nackt, und die weißen Tennisshorts waren schmutzig.
Ione Gamble starrte mindestens eine halbe Minute lang auf den toten Mann, dabei keuchte sie in kurzen Zügen durch den Mund, bis sie zu keuchen aufhörte und sagte: »Ach zum Teufel, Billy, ich wünschte, es täte mir leid.«
Sie wandte sich ab, ein wenig schwankend, und schaffte es bis zu der kleinen gutbestückten Bar, wo sie schätzungsweise sechzig Kubikzentimeter Whiskey in ein Glas kippte und in einem Zug runterspülte. Der Whiskey verursachte einen Hustenanfall. Als er zwei Minuten später vorüber war, stolperte sie quer durch den Raum zu einer Telefonkonsole, ließ sich in einen Sessel fallen, von dem sie wußte, daß es Billy Rices Lieblingssessel war, legte sich die Beretta in den Schoß, nahm den Hörer von der Gabel und tippte die Nummer 911 in die Tastatur.
In der Notrufzentrale der Polizei begann es zu läuten. Nach dem achten Klingeln gähnte sie. Nach dem zehnten Klingeln legte sie den immer weiter einen Klingelton von sich gebenden Hörer auf den Tisch, nahm den Griff der Beretta zwischen beide Hände, schloß die Augen und verlor das Bewußtsein.
Sie war noch bewußtlos und hielt immer noch die Beretta umklammert, als zwei Deputy-Sheriffs um 6.27 Uhr das Wohnzimmer betraten, ihr die Pistole aus den Händen rissen, sie wach rüttelten, ihr ihre Rechte vorlasen und sie festnahmen unter dem Verdacht des Mordes an William A. C. Rice IV., der, seit er 1950 in den ersten Privatkindergarten von Kansas City aufgenommen wurde, von allen, die ihn nicht mochten oder verachteten – und das war, wie später einmal jemand meinte, ›beinahe jeder, der ihn länger als drei Minuten kannte‹ –, Billy der Vierte genannt wurde.
2
Nach Ablauf der dritten Januarwoche des Jahres 1991 war Ione Gamble wegen Mordes an William A. C. Rice IV. angeklagt und befand sich gegen Kaution auf freiem Fuß. Ein Staatsanwalt des Bezirks Los Angeles hatte auf eine Kautionssumme von mindestens zwei Millionen Dollar plädiert, aber der Richter des Obersten Bezirksgerichts in Santa Monica hatte statt dessen 200 000 Dollar festgesetzt und seine Entscheidung mit einer rhetorischen Frage begründet: »Wohin sollte sie sich flüchten, wo sollte sie sich verstecken können, mit einem Gesicht, das man auf der ganzen Welt kennt?«
Jetzt hatte die Gamble sich in ihr fünfunddreißig Jahre altes, im Stil der Missionarszeit erbautes Dreizehn-Zimmer-Haus am Adelaide Drive in Santa Monica zurückgezogen, wenn nicht gar dort versteckt. Sie wohnte allein in dem Haus, einmal abgesehen von dem salvadorianischen Ehepaar in der Garagenwohnung und ihren sechs Katzen, drei Hunden und einem stubenreinen, schlappohrigen Kaninchen, das die meisten seiner wachen Stunden damit verbrachte, die Treppe rauf und runter zu hoppeln.
Die Gamble saß im Arbeitszimmer im ersten Stock, das sie ihr Büro nannte, und beriet sich mit Jack Broach – einer Kombination aus Manager, Agenten und persönlichem Anwalt – über mögliche Strafverteidiger. Broach war ein Produkt der Universität Los Angeles (1968), der Boalt Hall (1971) und der Agentur William Morris (1973–79). Wie so viele Mittvierziger unter den Agenten der Unterhaltungsindustrie sah er aus wie ein sorgfältig gepflegter Charakterdarsteller, der einen jungen schmalgesichtigen Präsidenten ebenso perfekt hätte verkörpern können wie einen alternden schmalgesichtigen Düsenjägerpiloten.
Das Arbeitszimmer hatte drei Bücherwände, deren Regale hauptsächlich mit Romanen und Biographien gefüllt waren, und eine Glaswand, die Aussicht auf den Santa Monica Canyon, ein paar Berge und den Pazifischen Ozean bot. Die Gamble saß hinter ihrem Baumwollmakler-Schreibtisch von 1857 aus Memphis, und Broach hatte neben ihr in einem Bürosessel Platz genommen.
Nachdem sie etwas Dr. Pepper light durch zwei Strohhalme aus ihrer Flasche gesogen hatten, sagte die Gamble: »Bis jetzt hab’ ich mit dem Unitarier aus Massachusetts, dem Juden aus Wyoming, dem Episkopalen aus Texas und dem Baptisten aus New York telefoniert. Was ist der in Washington für einer?«
»Ich bin ziemlich sicher, daß er kein Muslim ist«, antwortete Broach.
»Erzähl mir von ihm – dem Typ aus Washington.«
»Wie all die anderen«, sagte Broach, »hab’ ich auch ihn angerufen und, sinngemäß, gesagt: ›Hallo, ich bin der beste Freund und der persönliche Anwalt von Ione Gamble, und sie braucht den verdammt besten Strafverteidiger, den es auf der Welt gibt. Sind Sie interessiert?‹ Die vier anderen haben gesagt: ›Mann, und ob!‹, aber der Bursche in Washington meinte nur: ›Nicht besonders.‹ Wie immer war ich von dem beeindruckt, der am wenigsten beeindruckt war.«
»Und er ist gut – der aus Washington?«
»Er ist nicht so bekannt wie die anderen, aber ein paar Juristen, die ich besonders verehre, halten ihn für eine Kanone.« »Ist ›Kanone‹ dein Gemeinplatz oder ihrer?«
»Meiner. Ich gebrauche solche Ausdrücke, weil jeder sie versteht. Deshalb heißen sie ja Gemeinplätze.«
Die Gamble schlürfte noch etwas von ihrem Light-Drink und sagte: »Du meinst also, ich sollte ihn nehmen – den Typ aus Washington?«
Broach schüttelte den Kopf. »Ich meine, daß du den nehmen solltest, den du respektierst und zu dem du am meisten Vertrauen hast.«
»Was ist mit mögen?«
»Mit mögen hat das nichts zu tun.«
»Wird er mich fragen, ob ich Billy getötet habe?«
»Keine Ahnung.«
Ione Gamble schaute an die Decke, als könnte sie dort den Text für ihre nächsten Bemerkungen ablesen. Sie schaute immer noch dorthin, als sie sagte: »Ich mochte den Juden, den Baptisten hab’ ich respektiert, und zu dem Episkopalen hatte ich Vertrauen – trotz seiner texanischen Bauernmanieren. Nur der Unitarier schien vor allem von dem Ehrgeiz erfüllt, mich so schnell wie möglich ins Bett zu kriegen.«
»Hast du was gegen Optimismus?«
Ihr Blick kehrte zurück in die Horizontale.
»Hilf mir doch, verdammt.«
Broach schüttelte den Kopf. »Du wirst es rauskriegen – du oder dein Instinkt.«
»Bist du sicher?«
»Absolut.«
Sie hörten die Zweiklangglocke an der Eingangstür. Broach erhob sich und sagte: »Er ist da. Ich gehe runter und bring’ ihn rauf. Wenn ich euch bekannt gemacht hab’, verschwinde ich.«
»Seh’ ich einigermaßen aus?«
Jack Broach hielt es nicht für nötig zu antworten.
Ione Gamble, die mit Jeans, einer karierten Bluse und ausgetretenen Timberlands über nackten Füßen bekleidet war, stand vor ihrer Glaswand und schaute hinaus auf den Canyon und den Ozean, als Broach mit dem Anwalt aus Washington zurückkam. Als sie sich umdrehte, sah sie einen mittelgroßen Mann in
den Vierzigern, der einen teuren, aber schlechtsitzenden, dunkelblauen Anzug trug, dazu schlichte schwarze Schuhe, ein weißes Hemd und eine unauffällige Krawatte. Er hatte außergewöhnlich lange Arme, ein Gesicht, in dem nichts zusammenpaßte, und die klügsten schwarzen Augen, die sie jemals gesehen hatte. Als die Gamble in diese Augen schaute, strömte ein intensives Gefühl der Erleichterung durch ihren Körper.
Jack Broach sagte: »Ione Gamble, Howard Mott.«
Die Gamble lächelte und ging auf Mott zu, die rechte Hand ausgestreckt. »Ich hoffe sehr, daß Sie mein Verteidiger werden, Mr. Mott.«
Howard Mott ergriff die kühle, trockene Hand, erwiderte das Lächeln und sagte: »Warten wir ab, ob Sie nach unserem Gespräch noch immer so denken.«
Mott war um elf Uhr eingetroffen, und um Viertel vor eins ließen sie sich eine riesige Käse-Salami-Pizza bringen. Die salvadorianische Haushälterin und Köchin servierte gleich im Arbeitszimmer, zusammen mit einer Flasche Bier für Mott und einem frischen Dr. Pepper light für die Gamble.
Mott nahm einen Höflichkeitsbissen von der Pizza, trank einen Schluck Bier und sagte: »Erzählen Sie mir, wie Sie ihn kennengelernt haben.«
»Billy Rice?«
Mott nickte und nahm noch einen Bissen Pizza.
»Sie wissen, wer er war, oder? Vorher, meine ich.«
»Vor Hollywood? Ja, aber was meinen Sie, wer er war?« »Er war die Kansas City Post«, antwortete sie.
»Die Zeitung, für die Hemingway nicht gearbeitet hat.«
»Es war außerdem eine der ersten Zeitungen, die in den zwanziger Jahren ins Radiogeschäft eingestiegen sind, und ins Fernsehen in den späten Vierzigern. Dazu gehörten schließlich drei Fernseh- und vier Radiostationen übers ganze Land verteilt, außerdem sechs Tageszeitungen, ein landwirtschaftliches Lagerhaus, eine Druckerei, die einen ganzen Häuserblock groß war, und ein ordentlicher Brocken der Innenstadt von Kansas City. Neunzig Prozent der Anteile an dem ganzen Kuchen gehörten William A. C. Rice dem Dritten, dem Enkel von William A. C. Rice dem Ersten, der das alles aufgebaut hat. Als Billy der Dritte starb, ging alles an Billy den Vierten über.«
»Und wann ist der Dritte gestorben?« fragte Mott. »Vor zehn Jahren?«
»Zwölf«, antwortete sie. »Billy der Vierte behielt das alles acht Jahre lang in Händen, und dann verkaufte er im Frühjahr ’68, als die Preise ganz oben waren. Er nahm mindestens eine Milliarde mit, vielleicht mehr. Dann zog er hierher und verkündete, daß er ein unabhängiger Filmproduzent sei, und da er eine Milliarde oder so auf der Bank liegen hatte, sagte jeder zu ihm: ›Sicher, das bist du.‹«
»Und zu der Zeit haben Sie ihn kennengelernt?«
Sie nickte. »Er hatte ein Büro in Century City – nur er, eine Sekretärin und ein Drehbuchredakteur.«
»Das war wann – 1986, 1987?«
»Ende ’86 – einen Monat nach meinem dreißigsten Geburtstag, und um Ihnen das Nachrechnen zu ersparen: Ich bin jetzt fast fünfunddreißig.«
Mott lächelte nur und trank noch einen Schluck Bier.
»An meinem dreißigsten Geburtstag hab’ ich mich auch betrunken und hatte einen Blackout«, sagte sie, und es war eher eine kühle Feststellung als eine Beichte.
»Warum?«
»Für eine Schauspielerin bedeutet der dreißigste Geburtstag, daß man nicht mehr auf dem Weg nach oben ist, sondern ein Plateau erreicht hat, auf dem man sich – wenn man Glück hat – halten kann, bis man vierzig ist, und dann beginnt der Abstieg, der manchmal langsam vor sich geht, manchmal aber auch schnell, sehr schnell.«
»Mit dreißig ist man doch noch schrecklich jung«, entgegnete Mott. »Sogar mit vierzig noch.«
»Aber nicht mehr mit fünfundvierzig, und deshalb hab’ ich alle Tricks angewandt, um ein paar Jobs als Regisseurin zu kriegen. Das bedeutete Gastrollen in Fernsehkomödien und Abenteuerserien – aber nur, wenn sie mich auch Regie führen ließen. Auf diese Weise hab ich meine Lehrzeit abgedient.«
»Man könnte den Eindruck gewinnen, daß Regieführen für Sie eine Art Altersversicherung ist.«
»Schauen Sie, ich habe vor, auch mit fünfundvierzig, mit fünfundfünfzig und fünfundsechzig noch zu spielen, falls ich so lange lebe, auch wenn die Rollen dann immer rarer werden. Aber eine gute Regisseurin kann beinahe in jedem Alter arbeiten.«
»Und das alles haben Sie mit dreißig beschlossen?«
»Sicher«, antwortete sie. »Ein Schauspieler ist mit dreißig noch jung. Er entledigt sich gerade des letzten Babyspecks, und während der nächsten fünfundzwanzig oder fünfunddreißig Jahre kann er fröhlich weitermachen, Hauptrollen neben Schauspielerinnen zu spielen, die fünfundzwanzig, dreißig oder vierzig sind. Aber kennen Sie eine einzige fünfundfünfzigjährige Schauspielerin, die Liebesszenen mit fünfunddreißigjährigen Männern spielt – es sei denn, es handelt sich um ’ne perverse Inzest-Geschichte? Ich gebe Ihnen eine Stunde Zeit, um mir jemanden zu nennen.«
»Ist Ann Margret schon fünfundfünfzig?« fragte Mott und nahm das letzte Stück Pizza vom Teller.
Die Gamble setzte ein Lächeln auf, das sich schnell in ein Grinsen verwandelte. »Sind Sie ein Fan von ihr?«
»Nur ein Denkmalschützer«, erwiderte Mott und biß in sein Stück Pizza.
»Also, aus dem Grund hab’ ich mir jedenfalls an meinem dreißigsten Geburtstag einen Rausch angetrunken, und deshalb hab’ ich auch seitdem nicht mehr als drei Bier und acht Gläser Wein getrunken – bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres.«
»Kommen wir zurück auf Ihr erstes Treffen mit Mr. Rice.«
»Okay. Er hatte, wie gesagt, dieses Büro in Century City. Und von dort aus rief er Jack Broach an, und Jack rief mich an und schlug mir vor, es doch mal zu versuchen. Also fuhr ich mit dem Fahrstuhl in welchen – den fünfunddreißigsten Stock? –, wo ich in dieses ganz hübsche, aber keinesfalls aufsehenerregende Büro geführt wurde. Billy knipste seinen Charme an und drückte mir ein Drehbuch in die Hand, das auf Lorna Wileys Roman Die Milner-Schwestern basierte.«
Sie schaute Mott etwas besorgt an, bis er sagte, daß er es gelesen habe. Nach einem leisen Seufzer der Erleichterung fuhr sie fort: »Also, nachdem uns jemand einen Kaffee gebracht hatte, sagte Billy: ›Für den Film will ich Sie.‹ Beide Schwestern sind großartige Rollen, aber Louise ist der Trampel, also hab’ ich ihn gefragt: ›Welche von beiden soll ich spielen? Louise oder Rose?‹ Und raten Sie mal, was er geantwortet hat?«
»Keine Ahnung.«
»Er sagte: ›Ich denke, das sollte der Regisseur entscheiden, und da Sie die Regie führen werden, überlasse ich Ihnen die Entscheidung.‹ Ungefähr in dem Moment kam mir der Gedanke, daß ich mich eigentlich in Billy Rice, dieses Arschloch, verlieben könnte.«
»Bis jetzt hört er sich doch ganz vernünftig an.«
»Bis jetzt. Nun, wir machen also Die Milner-Schwestern zusammen, der Film kriegt hervorragende Kritiken und spielt keinen müden Dollar ein. Aber das scheint Billy nicht weiter zu kümmern, er knallt hunderttausend Dollar für die Option auf irgend so einen hundsmiserablen Techno-Thriller auf den Tisch, zahlt dann noch mal ’ne Million für das Drehbuch, übt seine Option auf den Roman aus – was noch mal 1,4 Millionen kostet – und heuert einen vierundzwanzigjährigen britischen MTV-Regisseur an. Ich solle die Rolle der Mavis spielen – der mutigen Heldin, die herumläuft und redet wie ein Kerl–, an der Seite von dem alten Trottel Niles Brand, der dafür fünf Millionen einstreicht. Nun, das Ding kostet zusammen achtunddreißig Millionen und schlägt ein wie ’ne Bombe. Ich gewinne den Preis der Filmkritiker von Los Angeles und werde von der Akademie nominiert, der Oscar geht an mir vorbei, aber wen, außer mir, kümmert das schon?«
»Und dann?«
»Und dann bittet Billy mich, seine Frau zu werden. Das war so ungefähr Anfang letzten Jahres. Und ich, der ewige Trampel, muß natürlich antworten, aber sicher, Billy, liebend gerne, und wir setzen den Termin auf den 30. Dezember. Inzwischen kauft Billy Der böse, tote Indianer, der seit dreizehn Monaten auf der Bestsellerliste steht. Es kostet ihn zwei Millionen. Bar auf den Tisch. Keine Optionen. Eine weitere Million gibt er für Autoren aus und kündigt an, daß seine zukünftige Ehefrau in diesem 65-Millionen-Dollar-Epos über den alten Westen nicht nur an der Seite des alten Trottels Niles Brand die Hauptrolle spielen, sondern obendrein noch Regie führen wird. Kommen Sie noch mit, Mr. Mott?«
»Sie drücken sich im höchsten Maße deutlich aus.«
»Und dann kommt der Weihnachtsabend, vor etwas mehr als einem Monat. Billy gibt eine knappe dreizeilige Pressenotiz heraus, in der er mitteilt, daß er Ione Gamble nun doch nicht heiraten werde und daß sie auch in seinem wundervollen Film über die Ureinwohner Amerikas weder Regie führen noch die Hauptrolle spielen wird. Und ich war wie vor den Kopf geschlagen.«
»Und Sie hatten weder einen Vertrag für den Film noch in irgendeiner Form ein voreheliches Abkommen unterschrieben?«
»Jack Broach war immer noch dabei, den Filmvertrag auszuhandeln. Und als Billy einmal von einem vorehelichen Abkommen sprach, antwortete ich, daß ich eine Ehe will und keine Fusion. Kein besonders origineller Spruch, aber er schien ihn noch nicht zu kennen.«
»Was glauben Sie, weshalb hat Rice seine Meinung geändert?«
»Ich weiß es nicht. Ich hab’ seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen. Zumindest bin ich davon überzeugt.«
»Aber Sie haben’s versucht.«
»Ich muß wohl unzählige Male versucht haben ihn anzurufen, aber ich bin nicht durchgekommen. Und dann, an Silvester, dem Tag nach unserer abgesagten Trauung, hab’ ich zu trinken angefangen. Ich hab’ den ganzen Tag getrunken, dann hab’ ich ein bißchen geschlafen, bin wieder aufgewacht und hab’ weitergetrunken. Ich erinnere mich noch, daß ich mich irgendwann in mein Auto gesetzt hab’, mit einer Flasche Wodka, und zum großen Showdown mit Billy in sein Haus in Malibu gefahren bin. Aber an mehr kann ich mich nicht erinnern, bis mich die beiden Deputy-Sheriffs da oben in seinem Strandhaus aufgeweckt haben, wo Billy tot auf dem Boden lag.«
»Sie hatten einen Blackout?«
»Ja.«
Mott lehnte sich in der Couch mit dem Chintzbezug zurück und musterte die Gamble, die jetzt auf der anderen Seite des Kaffeetisches stand, die Arme auf die Lehne des Bürosessels gestützt. »Das war also Ihr zweiter Blackout«, sagte er. »Was wissen Sie darüber?«
»Bis ich einen Arzt gefragt habe, wußte ich nur, daß sie für überraschende Wendungen in Seifenopern gut sind. Ihr braucht einen Konflikt? Dann laßt sie doch einen Blackout haben. Oder eine Amnesie. Der Arzt hat mir erzählt, daß ein Blackout eine durch Alkohol hervorgerufene Form von Gedächtnisverlust ist und häufig bei Alkoholikern und Quartalssäufern auftritt. Er sagte, daß man Hypnose einsetzen kann, um die Erinnerung zurückzuholen. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Aber falls ich es versuchen möchte, kann er mir mehrere hochqualifizierte Therapeuten nennen, die mit Hypnose arbeiten. Ich hab’ ihm gesagt, ich würde drüber nachdenken.«
»Und? Haben Sie?«
»Sicher. Ich hab’ drüber nachgedacht. Ich hab’ auch drüber nachgedacht, was passieren könnte, wenn ich etwas Peinliches oder strafrechtlich Belastendes gestehen würde – vielleicht sogar den Mord an Billy. Hätte der Hypnotiseur es auf Kassette, könnte er es für einen Batzen Geld verkaufen. Und wenn er es gar auf Videokassette hätte, könnte er es für weiß Gott wieviel Geld verkaufen.«
»Und würde dafür ins Gefängnis wandern.«
»Nicht, wenn er behaupten würde, jemand sei bei ihm eingebrochen und hätte das Band gestohlen. Ich hab’ Watergate noch nicht vergessen – jedenfalls nicht ganz. Dort haben sie doch so was gemacht, oder?«
»So was Ähnliches.«
»Aber er könnte noch etwas anderes mit dem Band machen, und davon würde kein Mensch erfahren«, sagte sie. »Er könnte es an mich verkaufen. Erpressung nennt man das dann wohl.«
Sie lächelte dieses schmale, kühle Lächeln, das Diskussionsteilnehmer oft aufsetzen, nachdem sie ein wichtiges Argument eingeführt haben. Mott kratzte sich den linken Handrücken und sagte: »Und wenn ich für Sie einen garantiert diskreten Hypnotiseur finden würde? Würden Sie gerne versuchen, sich wieder an diese Nacht zu erinnern?«
Die Gamble zog die Brauen zusammen. »Es wäre wichtig, nicht? Meine Erinnerung?«
»Extrem wichtig.«
»Kennen Sie einen Hypnotiseur?«
»Ich weiß von jemandem, der einige kennt.«
»Sie meinen, es ist sein Job, einen Hypnotiseur für Ehefrauen und Freundinnen zu finden, die sich betrinken, einen Blackout haben, ihren Freund oder Ehemann umlegen und sich hinterher den Teufel daran erinnern?«
Mott lächelte. »Er besorgt extrem qualifizierte, extrem diskrete Profis, die alle möglichen extrem heiklen Angelegenheiten erledigen.«
Sie schaute ihn aufmerksam an, zog wieder die Stirn in Falten und sagte: »Bedeuten die vielen Extrems, daß Sie bereit wären, meine Verteidigung zu übernehmen?«
»Wenn Sie wollen.«
»Okay. Was empfehlen Sie mir als mein Anwalt?«
»Einen diskreten und hochqualifizierten Hypnotiseur.« »Dann rufen Sie mal gleich Ihren Mittelsmann an, wer immer das sein mag.«
»Sein Name ist Glimm«, erwiderte Howard Mott. »Enno Glimm.«
3
Die linke Wange von Enno Glimm war von einer verwachsenen Narbe verunstaltet, die beinahe für ein Grübchen durchgehen konnte – so, wie sein Englisch beinahe für Amerikanisch durchgegangen wäre, hätte er seine Ws nicht mit diesen Hauchlauten ausgesprochen, die aus der Wudu, Ltd. eine Voodoo, Ltd. machten.
Quincy Durant, der ein Geschäft witterte, machte keine Anstalten, seinen potentiellen Kunden zu korrigieren. Und was die Narbe betraf, so konnte sie Durants Meinung nach von einem kleinkalibrigen Geschoß stammen – entweder Kaliber .22 oder .25 –, aber ebensogut von einem neunjährigen Heißsporn, der Glimm bei einer Schulhofprügelei seine Schreibfeder durch die linke Wange gestochen hatte.
Es herrschte in diesem Februar eine arktische Kälte in England und im größten Teil Europas. In London waren beinahe dreißig Zentimeter Schnee gefallen, und selbst die Französische Riviera hatte ein paar Flocken abbekommen. Kälte und Feuchtigkeit krochen überall hinein, und auch vor dem holzgetäfelten Büro/Konferenzzimmer der Wudu, Ltd. – wo Durant ein elektrisches Heizgerät mit drei Heizstäben aus dem Wandschrank geholt und in den falschen Kamin gestellt hatte, um die unzureichende Zentralheizung zu unterstützen – machten sie nicht halt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!