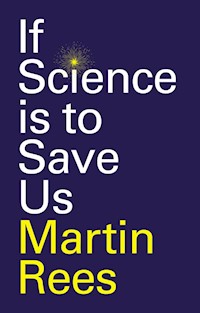14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Gibt es neben unserem noch andere Universen? Wie und wann sind sie entstanden? Welche physikalischen Gesetze herrschen dort? – Die Grundfragen der Kosmologie, beantwortet von Martin Rees, einem der renommiertesten Astronomen der Welt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Martin Rees
Vor dem Anfang
Eine Geschichte des Universums
Aus dem Englischen von Anita Ehlers
FISCHER E-Books
Mit einem Geleitwort von Stephen Hawking
Inhalt
Geleitwort
Martin Rees und ich waren zur gleichen Zeit Doktoranden am Department für Angewandte Mathematik und Physik in Cambridge. Martin hatte Mathematik studiert und begann sich für Physik und Astrophysik zu interessieren, während ich in Oxford wohl etwas Physik gelernt hatte und nun versuchte, mir die zum Verständnis von Einsteins Relativitätstheorie nötige Mathematik anzueignen. Unser beider Doktorvater war Dennis Sciama. Er war für uns sehr anregend, obwohl weder Martin noch ich ihm in allem zustimmten. Damals wurden heftige Auseinandersetzungen um die Frage geführt, ob die Welt mit einem Urknall begonnen habe oder von jeher im gleichen Zustand war. Sciama vertrat diese Steady-State-Theorie. Martin und ich aber waren beeindruckt von den zahllosen Beobachtungen von Radioquellen und Quasaren, die für die Urknalltheorie sprachen. Die Frage wurde später durch die Entdeckung der schwachen Hintergrundstrahlung entschieden, die nur als Überbleibsel des Urknalls erklärt werden kann.
Diese Zeit um 1960 war für uns Physikstudenten sehr aufregend, denn sowohl Theorie als auch Beobachtung brachten überraschende Entdeckungen. Alles war neu, deshalb konnte auch ein fortgeschrittener Student Wege finden, die zu gehen etablierten Forschern zu schwerfällig erschien. Erstaunlicherweise ist das mit gelegentlichem Auf und Ab auch heute noch so, weil das Gebiet sich jetzt ebenso rasch verändert wie damals.
Martin und ich sind später sehr unterschiedliche Wege gegangen. Während ich mich vor allem für die Weiterentwicklung der Theorie interessiert habe und meine Arbeit größtenteils noch nicht durch Beobachtungen bestätigt wurde, hat Martin immer in engem Kontakt mit der Beobachtung gearbeitet und auf das geachtet, was sie uns über das Universum mitteilt. Dieser andere Ansatz spiegelt sich in den Büchern, die wir geschrieben haben, wider. Das vorliegende Buch vermittelt dem Leser Bekanntschaft mit den Tatsachen, um die es in der Astronomie geht – ohne das Wort Gott zu erwähnen, bei dem Martin offenbar Unbehagen verspürt. Aber »Gott« ist ja auch ein theoretischer Begriff.
Stephen Hawking Mai 1997
Einleitung
Die Philosophie beginnt mit dem Staunen. Und am Ende, wenn das philosophische Denken alles ihm Mögliche getan hat, bleibt das Staunen.
A.N. Whitehead
Die kosmische Perspektive
Unser Universum hatte seinen Anfang im »Urknall« oder »Feuerball«. Es dehnte sich aus und kühlte sich ab; einige Milliarden Jahre später entstand das komplizierte System von Sternen und Galaxien, das wir um uns herum sehen. Um mindestens einen Stern kreist mindestens ein Planet, auf dem sich Atome zu Gebilden zusammengefunden haben, die so komplex sind, daß sie darüber nachdenken können, wie sie geworden sind.
Spötter haben gern und nicht ganz zu Unrecht gesagt, es gäbe in der Kosmologie nur zwei Tatsachen, nämlich daß unser Universum sich ausdehnt und daß der Nachthimmel dunkel ist. Aber das stimmt so nicht mehr. Von der Erde und vom Weltraum aus beobachten wir mittlerweile Galaxien, die das Licht, wie wir es heute sehen, auf den Weg schickten, als unser Weltall erst ein Zehntel so alt war wie heute. Heute simulieren Computer, wie sich aus amorphen Anfängen Galaxien herausbilden, andere Verfahren haben »Überbleibsel« aus noch früheren Zeiten der kosmischen Geschichte enthüllt.
Wir können die Evolution unseres Universums bis in die Zeit zurückverfolgen, als es nur 1 Sekunde alt war. Diese Behauptung hätte frühere Generationen von Kosmologen erstaunt, die ihr Gebiet als einen Teil der Mathematik sahen, der nichts mit empirischer Überprüfung zu tun hat. Ich würde mindestens 10:1 wetten, daß es wirklich einen Urknall gab und alles in unserem beobachtbaren Universum als komprimierter Feuerball begann, viel heißer als die Mitte der Sonne. Die meisten Kosmologen würden ähnlich hohe Einsätze bieten. (Eine Minderheit jedoch würde lautstark Widerspruch einlegen.)
Kosmos und Mikrowelt
So gewaltig Sterne und Galaxien auch sein mögen, sie stehen auf der Komplexitätsskala weit unten. Deshalb ist es nicht allzu anmaßend, wenn wir sie verstehen möchten. Ein Frosch stellt für die Naturwissenschaft eine viel größere Herausforderung dar als ein Stern. Planetensysteme um ein Zentralgestirn sind nicht selten. Aber wie groß sind die Chancen, daß unter günstigen Umständen Leben entsteht und sich bis zu einem »interessanten« Stadium entwickelt? Diese biologische Frage ist noch unbeantwortet. Vielleicht wimmelt der Kosmos von Leben. Andererseits könnte die Entwicklung von Lebewesen auch eine derart seltene Kombination »glücklicher Zufälle« voraussetzen, daß nur auf unserer Erde bewußte intelligente Wesen leben.
Unser »kosmischer Zyklus« könnte endlich sein und in einem »Big Crunch«, einer »Endkatastrophe« kollabieren. Aber das wird erst geschehen, wenn die Sterne verblaßt sind und alle Atome und sogar die Schwarzen Löcher wieder zu Strahlung geworden sind. Bis dahin hätten Leben und Intelligenz, selbst falls es sie jetzt nur auf der Erde gibt, genug Zeit, sich durch unsere ganze Galaxis und darüber hinaus zu verbreiten. Wenn das Leben auf der Erde jetzt erlöschen würde, wären die Entwicklungsmöglichkeiten des ganzen Weltalls beschnitten. Unsere Biosphäre hat möglicherweise für die ganze Welt Bedeutung, nicht »nur« für die Erde. Wir können die Geschichte des Kosmos zuverlässig bis zur ersten Sekunde zurückverfolgen. Der Boden wird schwankender, wenn wir noch weiter zurück extrapolieren, bis zur ersten Mikrosekunde. Aber neue Fortschritte machen Fragen, deren Antworten man zuvor höchstens vermuten konnte, ernsthafter Forschung zugänglich: Warum ist unser Universum so groß? Warum dehnt es sich eigentlich aus?
Einem neuen Einstein oder Newton stellt sich die Herausforderung, die Naturkräfte zu »vereinheitlichen«, also elektrische Kräfte, Kernkräfte und Gravitationskräfte als unterschiedliche Manifestationen einer einzigen Urkraft zu beschreiben. Vielleicht finden wir diese Urkraft nur dann, wenn die Energien ungeheuer hoch sind – was möglicherweise nur in den ersten Augenblicken des Urknalls der Fall war, in dem alles Existierende bis auf die Größe eines Golfballs und kleiner zusammengepreßt war und Quantenwellen den ganzen Raum erschüttern konnten. Die »Keime« von Galaxien und anderer kosmischer Strukturen und die unser Weltall durchdringende »dunkle Materie« sind Reste aus dieser Zeit.
Das Multiversum
Als sich unser Universum abkühlte, ergab sich die ihm eigene Mischung aus Energie und Strahlung und möglicherweise sogar die Anzahl der Raumdimensionen genauso »zufällig« wie die Muster im Eis eines gefrierenden Sees. Die Naturgesetze jedoch wurden schon beim Urknall »festgelegt«. Unser Universum und die Gesetze, die es bestimmen, mußten (in einem wohldefinierten Sinn) ganz besondere sein, damit wir entstehen konnten. Es mußten sich Sterne bilden, und die nuklearen Brennöfen, die sie leuchten lassen, mußten den im Urknall entstandenen Wasserstoff zu Kohlenstoff, Sauerstoff und Eisenatomen verbrennen. Vorbedingungen für die Komplexität des irdischen Lebens waren eine stabile Umwelt und ungeheuer viel Raum und Zeit.
Die »Feinabstimmung« des Universums, von der unsere Existenz abhängt, könnte Zufall sein: So habe ich früher gedacht. Aber diese Sichtweise erscheint mir jetzt als zu eng. Was man gewöhnlich »Universum« nennt, könnte nämlich ein Teil einer größeren Gesamtheit sein. Es könnte zahllose Universen geben, in denen andere Gesetze gelten. Das Universum, in dem wir uns entwickelt haben, gehört zu der ungewöhnlichen Teilmenge, welche die Entwicklung von Komplexität und Bewußtsein zuläßt. Wenn wir so denken, brauchen wir uns nicht mehr zu wundern, daß unser Universum Eigenschaften hat, die »besonders« zu sein scheinen – und von Theologen einmal als Hinweise auf die Vorsehung oder einen göttlichen Plan angeführt wurden. Die größere Perspektive des »Multiversums« war ein Beweggrund, dieses Buch zu schreiben. Sie bedeutet womöglich eine so drastische Veränderung unserer Vorstellungen vom Kosmos, wie es der Übergang vom vorkopernikanischen Weltbild zu der Erkenntnis war, daß die Erde einen ganz gewöhnlichen Stern am Rand des Milchstraßensystems umläuft, das selbst nur eine unter vielen Galaxien ist. Ganz im Geist der Wissenschaft können Kosmologen heute ernsthafte Fragen zu einem neuen Bereich grundlegender Themen stellen, über den sie zuvor höchstens nach Feierabend spekulierten.
Vielleicht ist unser ganzes Universum nur ein Element – ein »Atom« sozusagen – einer unendlichen Menge von Universen, eine Insel im kosmischen Archipel. Jedes dieser Universen beginnt mit seinem eigenen Urknall, erhält, während es sich abkühlt, seine eigene Prägung (und seine eigenen Naturgesetze) und durchläuft seinen eigenen kosmischen Kreislauf. Der Urknall, der unser Universum auslöste, ist so gesehen der winzige Teil eines höchst raffinierten Prozesses, der weit über die Reichweite aller Teleskope hinausgeht.
Nach Meinung einiger Kosmologen können sich in den vorhandenen Universen neue »Embryo-Welten« bilden. So könnte Materie, die (beispielsweise in der Umgebung eines kleinen Schwarzen Lochs) zu ungeheurer Dichte zusammenfällt, die Ausdehnung eines uns unzugänglichen neuen Bereichs auslösen. Vielleicht lassen sich Universen sogar »herstellen« – das geht zwar heute über alles in der Experimentalphysik Menschenmögliche hinaus, könnte aber einmal Wirklichkeit werden. Bedenken wir, daß unser Weltall den größten Teil seines Lebens noch vor sich hat! Mit einer Tochterwelt könnten wir zwar unmöglich Information austauschen, aber sie könnte durch ihre Herkunft geprägt sein. Möglicherweise ist unser eigenes Universum das (geplante oder ungeplante) Ergebnis eines solchen Vorgangs, der sich in einem früheren Kosmos abspielte. In diesem Fall würde der alte Gottesbeweis, der sich auf die Zweckmäßigkeit der Welt beruft, in neuer Form wieder auftauchen.
Die meisten natürlich entstandenen Universen wären »Totgeburten« in dem Sinn, daß sie keine Umwelt bieten, in der eine komplexe Evolution ablaufen könnte: Ihre Lebenszeit wäre zu kurz, sie hätten die falsche Anzahl von Dimensionen, sie ließen keine Chemie zu, oder sie wären sonst irgendwie ungeeignet. Aber vielleicht ist unser Universum nicht einmal besonders kompliziert: Andere Universen könnten eine reichere Struktur haben, reicher als alles, was wir uns vorstellen können.
Wir können das Wesen unserer kosmischen Umwelt nicht allein durch Denken erfassen. Die modernen Teleskope und Raumschiffe haben die Kosmologie zu einer Wissenschaft gemacht – sie dringen tief in den Raum und weit zurück in die Zeit und suchen nach solch bizarren Objekten wie Schwarzen Löchern und kosmischen Strings. Dieses Buch beschreibt einige der Höhepunkte dieser Suche und berichtet von Entdeckungen und Gedanken, die erst jetzt ins Blickfeld rücken. Ich habe mich dabei immer bemüht, den historischen Zusammenhang im Auge zu behalten und einige der »alten« Fragen zu klären, die immer wieder angesprochen werden – Themen wie Rotverschiebung, dunkle Materie, Schwerkraft und dergleichen.
Ich habe in den Text auch manche Erinnerung eingeflochten und versucht, den Eindruck zu schildern, den einige der außergewöhnlichen Menschen auf mich gemacht haben, denen ich begegnet bin oder mit denen ich zusammengearbeitet habe. Dabei habe ich mich bemüht zu zeigen, wie ihr Ansatz durch ihre Persönlichkeit, ihre außerwissenschaftlichen Interessen und gelegentlich auch durch fixe Ideen geformt wurde.
»Federn« werden im Großen Brockhaus als »Ausstülpungen der Haut« definiert und so beschrieben:
Die in der Haut wurzelnde Achse (Schaft) der Konturfeder ist beiderseits dicht mit Ästen (rami) besetzt, die ihrerseits nach oben und unten die Äste zweiter Ordnung oder Strahlen (radii) entsenden.
Diese Definition könnte für jemanden, der ungeheuer gelehrt ist und noch nie einen Vogel gesehen hat, nützlich sein. Viele naturwissenschaftliche Bücher sprechen eine (fast nicht existente) Klasse von Lesern an, die zwar über einen umfangreichen Wortschatz verfügen, sich aber von Zahlen oder Formeln verwirren lassen – dabei kann Fachjargon oft unverständlicher sein als einfache Gleichungen.
Ich habe versucht, Fachsprache und Formeln zu vermeiden. Aber Zahlen lassen sich nicht vermeiden. Und wenn man den Kosmos beschreibt, sind einige der Zahlen sehr groß. Wichtig ist ihre Größenordnung, nicht ihr genauer Wert, deshalb werden sie hier oft als Zehnerpotenzen angegeben (10x, wobei × die Anzahl der Nullen ist, die in der ausgeschriebenen Zahl vorkommen). Der Däne Niels Bohr, ein Bahnbrecher der modernen Physik, gab seinen Kollegen den Rat, so »klar zu sprechen, wie sie denken, aber nicht klarer«. Er befolgte seinen eigenen Rat – er war geradezu berühmt für sein unhörbares und unverständliches Gemurmel. Die Mathematik der Theoretiker und die Instrumente der Beobachter mögen in der Tat schwer verständlich erscheinen, aber diese technischen Einzelheiten gehen eigentlich nur Spezialisten etwas an. Sie sind lediglich das Werkzeug, mit dem sich die großen Fragen der Kosmologie anpacken lassen: Wie entstanden Sterne, Planeten und das Leben? Warum ist unser Universum gerade so, wie es ist? Was prägte die Gesetze, die es bestimmen? Könnte es andere Universen geben? Diese Fragen kann jeder erfassen – und wenn wir alle nach einer Lösung suchen, hat der Spezialist sicher kaum einen Vorsprung vor dem allgemein gebildeten Laien.
Für einige Behauptungen über unser Universum gibt es inzwischen gute Bestätigungen, die unter Kosmologen weite Zustimmung finden, andere sind eher Vermutungen oder Spekulationen. Dieses Buch beschreibt einige dieser Gedanken, über die heute Übereinstimmung besteht, aber auch einige Vermutungen, die meine Kollegen nicht teilen würden. Ich habe immer versucht, den Unterschied zwischen dem, was gesichert ist, und dem, was nicht – oder jedenfalls noch nicht – bestätigt wurde, nicht zu verwischen.
Stephen Hawking, mein Kollege in Cambridge, behauptet in Eine kurze Geschichte der Zeit, jede in einem Buch vorkommende Gleichung halbiere die Verkaufszahlen. Er verzichtete deshalb auf Gleichungen, und das tue ich auch. Aber er (oder vielleicht auch der Verlag), meinte, jede Erwähnung von Gott werde die Verkaufszahlen verdoppeln. In Befolgung dieses Gedankens kommt Gott in den Titeln mehrerer Astronomiebücher vor – Gott und die moderne Physik, Der Plan Gottes und ähnliches. Ausflüge von Naturwissenschaftlern in die Theologie oder Philosophie können peinlich naiv oder dogmatisch sein. Die Folgerungen, die sich für diese Bereiche des Denkens aus der Kosmologie ziehen lassen, mögen tief gehen und weit reichen, aber mir fehlt das Selbstvertrauen, mich auf dieses Gebiet zu wagen. Ich halte es vielmehr mit einem anderen Kollegen, dem Kosmologen Joseph Silk: »Eingedenk des unverändert großen Unbekannten ist die wahre, der modernen Physik angemessene Haltung schlichte Demut.«
Martin Rees Cambridge, 1996
1 Von den Atomen zum Leben: Galaktische Ökologie
Ich bin Teil der Sonne, wie mein Auge Teil von mir ist. Daß ich Teil der Erde bin, wissen meine Füße sehr wohl, und mein Blut ist Teil des Meeres.
D.H. Lawrence
»Es ist wahrlich eine großartige Auffassung, dass …, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreis geschwungen, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und immer noch entwickelt.« Mit diesen Worten schließt Charles Darwins Über die Entstehung der Arten.
Kosmologen gehen vor Darwins »einfachen Anfang« zurück und versuchen, unser Sonnensystem als Teil der Entwicklung eines großen Systems zu sehen, dessen Anfang bis zur Entstehung des Milchstraßensystems zurückreicht – zurück sogar bis zum Urknall, mit dem die Expansion unseres Universums begann. Wir werden dadurch zu Spekulationen ermutigt: Welche Möglichkeiten bieten sich unserer kosmischen Entwicklung in ferner Zukunft? Könnte es andere Universen geben, in denen vielleicht andere Gesetze gelten? Würden sie für die »schönsten und wundervollsten Formen« ähnlich günstige Umwelten bieten? Mit diesen Themen werden wir uns in späteren Kapiteln beschäftigen.
Das Licht der Sonne braucht 8 Minuten, um die Erde zu erreichen, und nur wenige Stunden, um Neptun und Pluto zu passieren, die äußersten Planeten des Sonnensystems. Das Licht der hellen Sterne im Milchstraßensystem – Sonnen wie die unsere – war Jahrhunderte unterwegs, bis wir es sehen. Aber auch die gesamte Milchstraße, das System der Sterne, zu der die Sonne gehört, ist nur ein kleiner Farbtupfer im Vordergrund des kosmischen Bildes. Am Horizont sehen wir jetzt das Licht von Himmelskörpern, das sich vor mehreren Milliarden Jahren auf den Weg gemacht hat.
Die modernen Teleskope offenbaren uns die gewaltigen räumlichen Entfernungen. Das Sonnensystem zwingt uns aber auch, unseren Begriff von Zeiträumen in einem Maß zu dehnen, das sich nur schwerlich mit menschlichen (oder auch geschichtlichen) Maßstäben in Einklang bringen läßt. Nehmen wir an, es hätte Amerika schon immer gegeben und wir wollten es durchwandern. Wir beginnen an der Ostküste zu der Zeit, zu der die Erde entsteht und wollen in Kalifornien ankommen, wenn die Sonne im Sterben liegt. Wir müssen dann nur alle 2000 Jahre einen Schritt weitergehen. Drei oder vier Schritte umfassen bereits die gesamte Menschheitsgeschichte. Diese wenigen Schritte würden wir kurz vor der Hälfte des Weges machen, irgendwo in Kansas vielleicht – sie sind also keineswegs der Höhepunkt der Reise. Unsere Sonne hat erst weniger als die Hälfte ihres Lebens hinter sich. Wir sind dem Anfang ihrer Entwicklungsgeschichte noch nahe.
Die Sonne und ihr Stoffwechsel
Die Sonne ist wie andere Sterne eine riesige Kugel aus leuchtendem Gas, in der zwei Kräfte gegeneinander kämpfen: Schwerkraft und Druck. Die Schwerkraft versucht, alles zur Mitte zu ziehen, aber wenn Gas zusammengepreßt wird, erhöht sich der Druck. Dieser Druck stellt eine Gegenkraft zur Schwerkraft dar. Die weißglühende Sonnenoberfläche hat eine Temperatur von 6000 Kelvin. In der Mitte aber muß die Sonne noch viel heißer sein, damit der Druck hoch genug ist – die Temperatur dort beträgt etwa 15 Millionen Kelvin.
Die Sonne wird durch denselben Vorgang mit Energie versorgt, der Wasserstoffbomben explodieren läßt. Wasserstoffatome sind die einfachsten aller Atome: Ihr Kern enthält nur ein Proton. Je heißer ein Gas wird, um so schneller bewegen sich die Atome, aus denen es besteht. Im Kern der Sonne stoßen Protonen so heftig gegeneinander, daß sie aneinander haftenbleiben. Eine Reihe von Reaktionen kann 4 Wasserstoffkerne (Protonen) in einen Heliumkern verwandeln. Der Heliumkern wiegt jedoch 0,7 % weniger als die 4 Wasserstoffatome, aus denen er gebildet wurde. Wenn beispielsweise 1 g Wasserstoff zu Helium verschmilzt, werden 175000 kWh frei. Der Prozeß liefert genug Energie, um die Sonne mehrere Milliarden Jahre leuchten zu lassen. Die Energiefreisetzung erfolgt in einem Stern gleichmäßig und »kontrolliert«, nicht explosiv wie in einer Bombe, weil die Schwerkraft die oberen Schichten stark nach unten zieht und dadurch immer »den Daumen draufhält«, obwohl der Druck in der Mitte gewaltig ist. Auf der Sonne hat sich ein Gleichgewicht eingestellt, so daß die Kernfusion gerade so viel Nachschub liefert, um die von der Sonnenoberfläche abstrahlende Energie zu ersetzen.
Über die Sonne wissen wir inzwischen, jedenfalls im Umriß, gut Bescheid. Die Diskussion geht heute um Einzelheiten: Was verursacht die dunklen Flecken und heftigen Ausbrüche auf ihrer Oberfläche? Wie können wir etwas über ihr Innerstes erfahren? Scheint die Sonne gleichmäßig, oder reichen ihre Helligkeitsschwankungen aus, um das Klima auf der Erde zu beeinflussen?
Die Sonne wurde in einer interstellaren Wolke geboren. Diese Wolke rotierte zunächst nur sehr langsam, dann immer rascher, da sie sich zusammenzog (wie Eiskunstläufer, wenn sie die Arme anziehen). Die Zentrifugalkräfte verstärkten sich, bis sie an die Schwerkraft heranreichten. Um eine Proto-Sonne herum entwickelte sich eine wirbelnde Scheibe, die allmählich (mehr oder weniger wie von Kelvin vorhergesagt) schrumpfte, bis die Mitte heiß genug war, um die Kernfusion auszulösen. Mittlerweile kühlte sich die umgebende Scheibe ab, und ein Teil des Gases kondensierte zu Staub und Gesteinsbrocken, die sich zu Planeten zusammenfanden.
Die Sonne, jetzt also Mittelpunkt eines Planetensystems, kam in einen Gleichgewichtszustand und verbrannte langsam, aber stetig Wasserstoff zu Helium. Dieser Vorgang setzt so viel Wärme frei, daß die Sonne bis heute erst weniger als die Hälfte des Wasserstoffvorrats in der Sonnenmitte aufgebraucht hat, obwohl sie schon 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Sie kann also noch weitere 5 Milliarden Jahre leuchten. Dann wird sie zu einem roten Riesenstern anschwellen und so groß und hell werden, daß sie die inneren Planeten verschlingt und alles irdische Leben verdampft. Im nächsten Stadium werden einige der äußeren Schichten in den Raum geblasen, während sich der Sonnenkern zu einem Weißen Zwerg zusammenzieht – zu einem dichten Stern, der nicht größer ist als die Erde, aber mehrere hunderttausendmal schwerer; er wird nicht heller sein als der Mond heute und mit seinem bläulichen Schimmer all das bescheinen, was von unserem Sonnensystem übriggeblieben ist.
Andere Sterne
Wie hängen die Leuchtkraft und die Farbe eines Sterns von seiner Masse, seinem Alter oder seiner Zusammensetzung ab? Astrophysiker kennen jetzt die Antwort auf diese Fragen. Sie können nicht nur die Entwicklung der Sonne berechnen, sondern auch die Lebenszyklen von Sternen, die zu Beginn ihres Lebens leichter oder schwerer sind als die Sonne, also weniger oder mehr Masse haben. Schwerere Sterne sind heller und durchlaufen ihren Lebenszyklus rascher. Die Berechnungen beruhen auf den Daten, die Physiker in Laborversuchen über Atome und Atomkerne gewonnen haben.
Aber wie lassen sich solche Behauptungen beweisen? Die Lebensdauer eines Sterns ist im Vergleich zu der eines Astronomen so ungeheuer lang, daß wir von jedem Stern nur einen einzigen »Schnappschuß« erhalten. Wir können unsere Theorien trotzdem überprüfen, indem wir die Gesamtheit der Sternpopulationen überblicken. Bäume können jahrhundertelang leben, aber selbst wer noch nie einen Baum gesehen hätte, könnte auf einer einzigen nachmittäglichen Waldwanderung den Lebenslauf der Bäume erschließen: Man findet nebeneinander Schößlinge, voll ausgewachsene Bäume und auch abgestorbene Stämme. Wilhelm Herschel, der große Astronom des 18. Jahrhunderts, der den Uranus entdeckte und die Milchstraße durchmusterte, beschrieb das in einem anschaulichen Bild:
Ist es nicht beinahe einerley, ob wir fortleben, um nach und nach das Aussprossen, Blühen, Belauben, Fruchttragen, Verwelken, Verdorren und Verwesen einer Pflanze einzusehen, oder ob eine große Anzahl von Exemplaren, die aus jedem Zustande, den die Pflanze durchgeht, erlesen, auf einmal uns vor Augen gebracht werden?
Sterne lassen sich am leichtesten beobachten, wenn sie in den hellsten Phasen ihrer Entwicklung sind: Wohlbekannte Sterne wie Beteigeuze und Arkturus sind im »Riesenstadium«. Die besten »Prüfstände« für unsere Theorien über die Sternentwicklung sind die sogenannten Kugelhaufen – Schwärme von bis zu einer Million gleichzeitig entstandener Sterne unterschiedlicher Größe, die sich wechselseitig durch ihre Schwerkraft halten.
Weiße Zwerge, die »Asche«, die zurückbleibt, wenn Sterne wie die Sonne ihren Lebenslauf beendet haben, sind in unserer Galaxis sehr häufig, aber wegen ihrer Lichtschwäche nicht leicht zu untersuchen. Neugebildete Weiße Zwerge haben sehr heiße Oberflächen (sie sind eigentlich eher blau als weiß). Weil ihnen keine Kernenergie mehr zur Verfügung steht, mit der sie die Abstrahlung kompensieren können, kühlen sie sich allmählich ab. Wir können die Temperatur Weißer Zwerge aufgrund ihrer Farbe bestimmen (sie werden roter, wenn sie abkühlen) und daraus ihr Alter berechnen (also die Zeit, zu der ihre Hauptenergiequelle verbraucht war). Die kältesten Sterne sind mehrere Milliarden Jahre alt, und schon daraus können wir schließen, daß einige Sterne ihren Lebenslauf beendet hatten, bevor das Sonnensystem entstand.
Plötzliche Todesfälle
Nicht alles im Kosmos geschieht langsam. Gelegentlich explodieren Sterne in einer Katastrophe, die wir Supernova nennen. Eine nahe Supernova überstrahlt einige Wochen lang alles andere am Nachthimmel. Das berühmteste derartige Ereignis wurde in China beobachtet. »An einem chi-chhou Tag im fünften Monat des ersten Jahres der Regierung von Chih-Ho« (4. Juli 1054) schrieb Yang Wei-Te, der »Hauptberechner des Kalenders« – wohl die chinesische Entsprechung zum »Königlich-britischen Astronom« –, seinem Kaiser diese ehrerbietigen Worte: »Vor Eurer Majestät verneige ich mich in tiefster Verehrung, um von dem Erscheinen eines Gast-Sterns zu berichten. Auf dem Stern war eine leicht schillernde gelbe Farbe zu beobachten.«
Jetzt, etwa 1000 Jahre später, sehen wir die Trümmer der von Yang Wei-Te beobachteten Explosion – ein bläuliches Oval, Krebsnebel genannt, von dessen Mitte fadenförmige Gasströme ausgehen. Er wird noch einige Jahrtausende zu beobachten sein, obwohl er sich allmählich ausbreitet und schwächer wird, bis er schließlich so dünn sein wird, daß er sich mit dem sehr dünnen Gas und Staub des interstellaren Raums vereint.
Die uns nächste Supernova des 20. Jahrhunderts – nicht so nah wie der Krebsnebel, aber gut zu erforschen, weil sie hell genug war – wurde 1987 beobachtet. In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar bemerkte Ian Shelton, ein kanadischer Astronom, der in den chilenischen Anden beobachtete, am Südhimmel in der sogenannten Großen Magellanschen Wolke ein »neues« Phänomen. Das Aufleuchten und allmähliche Verblassen wurde nicht nur mit optischen Geräten verfolgt, sondern auch von Radio-, Röntgen- und Gammastrahlenteleskopen, die mit modernen Verfahren neue »Fenster« zum Weltall geöffnet haben. Das gab den Theoretikern die seltene und glückliche Gelegenheit, ihre komplizierten, viele Einzelheiten berücksichtigenden Berechnungen zu überprüfen.
Kosmische Alchemie
Ereignisse wie Supernovae faszinieren Astronomen. Aber warum sollte sich irgend jemand sonst um Sterne kümmern, die Tausende von Lichtjahren von uns entfernt explodieren? Warum sollten sich die99 % der Menschen dafür interessieren, deren berufliche Belange irdisch und nicht kosmisch sind? Weil die Komplexität des Lebens auf der Erde niemals entstanden wäre, wenn es keine Supernovae gebe – und weil es uns dann sicherlich auch nicht gäbe!
Auf der Erde kommen 92 Atomarten vor, aber einige sind ungeheuer viel häufiger als andere. So kommen auf je 10 Kohlenstoffatome im Mittel 20 Sauerstoffatome und etwa 5 Stickstoff- und Eisenatome. Gold aber ist hundertmillionenmal seltener als Sauerstoff, und andere Elemente – beispielsweise Uran – sind noch seltener.
Alles, was je in unserer Sprache geschrieben wurde, setzt sich aus den 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets zusammen. Ähnlich lassen sich Atome auf unzählige unterschiedliche Weisen zu Molekülen kombinieren, von denen einige so einfach sind wie Wasser (H2O) oder Kohlendioxid (CO2), während andere Tausende von Atomen enthalten. Die wichtigsten Bestandteile von Lebewesen (uns selbst eingeschlossen) sind Kohlenstoff- und Sauerstoffatome, die (mit anderen Elementen) zu ungeheuer komplizierten kettenartigen Molekülen verknüpft sind. Wir würden nicht existieren, wenn diese Atome auf der Erde nicht so häufig vorkämen.
Atome bestehen wiederum aus einfacheren Teilchen. Jedes Element hat in seinem Kern eine bestimmte Anzahl von (positiv geladenen) Protonen und (neutralen) Neutronen. Den Kern umlaufen (negativ geladene) Elektronen, deren Zahl der Anzahl der Protonen entspricht. Diese Kernladungszahl ist die sogenannte Ordnungszahl. Die Ordnungszahl von Wasserstoff ist 1, die von Uran 92.
Da die Kerne der Atome alle aus denselben Elementarteilchen – Protonen und Neutronen – bestehen, ist es nicht erstaunlich, daß sie ineinander umgewandelt werden können. Das passiert beispielsweise bei einer Kernreaktion. Kerne sind allerdings sehr »robust« und lassen sich durch chemische Vorgänge, wie sie sich in Lebewesen oder im Chemielabor abspielen, nicht zerstören.
Die relativen Häufigkeiten der Atomarten auf der Erde sind heute dieselben wie bei der Bildung des Sonnensystems vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, denn kein natürlicher irdischer Vorgang kann Atome erschaffen oder zerstören.[1] Wir würden gern verstehen, warum uns die Atome gerade in diesen Häufigkeiten »zugeteilt« wurden. Natürlich können wir das als Tatsache einfach hinnehmen – vielleicht hat ein Schöpfer 92 verschiedene Knöpfe gedrückt. Aber wir suchen auch nach einer umfassenderen Erklärung, die komplexe Strukturen auf einfache Anfänge zurückführt. In diesem Fall verdanken wir die entscheidenden Einsichten den Astronomen: Anscheinend begann das Weltall tatsächlich mit einfachen Atomen, die im Inneren von Sternen verschmolzen und in schwerere umgewandelt wurden.
Nicht einmal in der Mitte der Sonne ist es heiß genug für diese Umwandlungen. Aber die Kräfte im Inneren heller blauer Sterne, wie wir sie im Orionnebel finden, und die starken Schockwellen, die bei ihrer Explosion entstehen, können unedle Metalle in Gold verwandeln.
Sterne, die über zehnmal schwerer sind als die Sonne, leuchten heller; ihre Entwicklung verläuft komplizierter und aufregender. Der in ihnen enthaltene Wasserstoff wird in 100 Millionen Jahren verbraucht (und in Helium umgewandelt) – also in weniger als 1 % der Lebenszeit der Sonne. Die Schwerkraft preßt diese schweren Sterne dann noch weiter zusammen, und die Temperatur in ihrem Inneren steigt weiter, bis sogar Heliumatome aneinanderhaften und zu Kernen schwererer Atome werden – zu Kohlenstoff (6 Protonen), Sauerstoff (8 Protonen), Silizium (14 Protonen) und Eisen (26 Protonen). So entwickelt sich eine Art »Zwiebel«: Eine Schicht Kohlenstoff umgibt eine Schicht Sauerstoff, die wiederum eine aus Silizium umgibt. Die heißeren inneren Schichten werden in Elemente mit noch höherer Atomzahl umgewandelt und umgeben eine Sternmitte, die im wesentlichen aus Eisen besteht.
Wenn ein großer Stern seinen Brennstoff restlos verbraucht hat (wenn also, anders gesagt, seine heiße Mitte in Eisen verwandelt wurde), steht eine Krise bevor. In einer verheerenden Katastrophe wird der Eisenkern auf die Dichte eines Atomkerns zusammengepreßt. Das löst eine enorm heftige Explosion aus, welche die äußeren Schichten mit einer Geschwindigkeit von 10000 km/s wegschleudert. Diese Explosion macht sich als eine Supernova von der Art bemerkbar, die den Krebsnebel entstehen ließ. Die Trümmer enthalten die Ergebnisse all der nuklearen Alchemie, die den Stern zu seinen Lebzeiten leuchten ließ. Diese Mischung enthält viel Sauerstoff und Kohlenstoff und Spuren von vielen anderen Elementen. Die berechnete »Mischung« kommt den Anteilen, die wir jetzt in unserem Sonnensystem beobachten, erfreulich nahe.
Ein wenig Geschichte
Als erste erkannten unabhängig voneinander der in Straßburg geborene und in die USA emigrierte Hans Bethe, einer der Pioniere der Kernphysik der dreißiger Jahre, und Carl Friedrich von Weizsäcker, wie die Sonne Energie freisetzt.[2] Genaue Berechnungen der Vorgänge im Sterninneren, insbesondere während der sehr heißen Phasen, die dem Supernova-Ausbruch unmittelbar vorangehen, müssen sehr komplizierte Reaktionsketten berücksichtigen und wurden erst durch leistungsfähige Computer möglich. Das Ergebnis hängt wesentlich von den Einzelheiten der Kernphysik ab. (Einige der für diese komplizierten Berechnungen nötigen Verfahren wurden im Rahmen der Entwicklung von Kernwaffen erarbeitet. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die ersten detaillierten Berechnungen zu Supernovae aus dem U.S.Livermore Laboratory und ähnlichen militärischen Forschungsinstituten in den USA und in der Sowjetunion kamen.)[3]
Der erste, der die Beziehung zwischen den Sternen und den uns umgebenden Elementen durchschaute – also sah, warum Kohlenstoff und Eisenatome häufig sind, Goldatome aber selten –, war Fred Hoyle. Er tat das in der knappen Zeit, die ihm blieb, als er während des Zweiten Weltkriegs an der Entwicklung des Radarsystems arbeitete.
Wäre Fred Hoyle 10 Jahre früher geboren worden, hätte er wohl an den triumphalen Leistungen des »goldenen Zeitalters« der theoretischen Physik zwischen 1925 und 1930 Anteil gehabt. In diesen wenigen Jahren wurde die Quantentheorie formuliert, die Ordnung in die anscheinend widersprüchlichen Eigenschaften von Atomen, Elektronen und Strahlung brachte. Alle Naturwissenschaftler, Kosmologen wie Biologen, werden zugeben, daß die Quantenmechanik einen entscheidenderen begrifflichen Durchbruch darstellt als alle anderen Theorien, denn die Breite ihrer wissenschaftlichen Auswirkungen ist groß und der Schlag, den ihre der Anschauung widersprechenden Folgerungen unserer Sicht der Welt versetzten, war gewaltig. Für diese Sichtweise war kein einzelner »Einstein« verantwortlich, ihre Grundlagen wurden vielmehr von einer ganzen Schar brillanter junger Physiker gelegt – Werner Heisenberg, Max Born und Pascual Jordan in Göttingen, Paul Dirac in Cambridge und Erwin Schrödinger in Zürich.
Nach den revolutionären neuen Gedanken der zwanziger Jahre waren die späten dreißiger Jahre eine Zeit der Konsolidierung. Dirac, zu der Zeit Professor in Cambridge, sagte damals zu Hoyle, der gerade sein Studium abgeschlossen hatte: »Leute, die nicht besonders gut waren, konnten 1926 wichtige Fragen der Grundlagenphysik bearbeiten. Heute [1938] finden selbst sehr gute Leute keine wichtigen Probleme mehr, die sie lösen können.« Deshalb wandte sich Hoyle den Sternen zu. Mit Hilfe seines Wissens über Atomkerne wollte er ihr Verhalten bei extrem hohen Temperaturen erforschen.
Hoyle wußte, daß die schwereren Atome, die im Periodensystem der Elemente höhere Ordnungszahlen haben, auf der Erde gewöhnlich seltener sind als die leichteren. Magnesium und Silizium sind weniger häufig als Sauerstoff, und die Edelmetalle sind millionenmal seltener. Aber es gibt Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel: Das 26. Element, Eisen, und seine Nachbarn im Periodensystem, etwa Kobalt und Nickel, sind relativ häufig. Hoyle wußte aus seinem Physikstudium, daß Eisen und seine Nachbarn die Kerne mit der höchsten »Bindungsenergie« haben, also sehr stabile Elemente sind und sich nur unter großer Energiezufuhr spalten oder in noch schwerere Kerne verwandeln lassen. Sind also die chemischen Elemente möglicherweise das Ergebnis von Kernumwandlungen? Auch ohne die Reaktionsabläufe im einzelnen zu kennen, kann man mit Sicherheit folgern, daß Eisenkerne, wenn sie einmal gebildet sind, besonders schwer zu zerstören sind. Deshalb sollte die relative Häufigkeit von Eisen besonders groß sein.
Aber ein solcher Prozeß braucht ein Umfeld, in dem die Kerne auch wirklich ineinander umgewandelt werden können. Diese Forderung ist für die massereicheren Kerne besonders schwer zu erfüllen, denn diese stoßen einander stärker ab, weil ihre elektrischen Ladungen größer sind (Eisenkerne enthalten 26 Protonen). Um sie zu verschmelzen oder zu spalten, braucht man deshalb viel energiereichere Stöße als beispielsweise bei der Umwandlung von Wasserstoff in Helium. Die Geschwindigkeit der Atome in einem Gas hängt von der Gastemperatur ab, deshalb setzt eine Kernumwandlung extrem hohe Temperaturen voraus – so verschmelzen in der Sonne Wasserstoffatome bei Temperaturen von 15 Millionen Kelvin. Nach Hoyles Schätzung muß die Umgebung, in der die »eisenähnlichen« Elemente geschmiedet wurden, noch einmal hundertmal heißer gewesen sein – die Temperatur muß also über 1 Milliarde Kelvin betragen haben.
Hoyle veröffentlichte seine Vermutungen 1946. Alle »schweren« Elemente der Erde würden, so behauptete er, aus einfacheren Kernen im Inneren von Sternen aufgebaut, die in ihrer späteren Entwicklung Temperaturen von Milliarden Kelvin erreichten. Sterne wie die Sonne werden niemals so heiß, aber vielleicht gilt die Theorie tatsächlich für massereichere Sterne?
Hoyle fand seine Gedanken durch die auf der Erde gefundenen Häufigkeiten der Elemente bestätigt. Aber sind diese in irgendeiner Weise für den Kosmos »typisch«? In einer Hinsicht sind sie es nicht. Wasserstoff und Helium sind zu flüchtig, als daß eine Proto-Erde sie hätte festhalten können; deshalb sind diese beiden leichtesten Elemente (von denen wir jetzt wissen, daß sie in der Sonne die weitaus häufigsten sind) auf der Erde unterrepräsentiert. Vielleicht sind aber wenigstens die Häufigkeiten der anderen Elemente für das Sonnensystem typisch.
Wie ist es mit den anderen Sternen in unserem Universum? Woraus bestehen sie? Der französische Philosoph Auguste Comte behauptete vor 150 Jahren, diese Frage werde sich niemals beantworten lassen, und schrieb in seiner Abhandlung über die Philosophie des Positivismus:
Wir werden niemals … die chemische Zusammensetzung oder die mineralogische Struktur der Sterne erforschen können … Unser Wissen über die Sterne ist notwendigerweise auf ihre geometrischen und mechanischen Phänomene beschränkt.
Aber noch vor Ende des 19. Jahrhunderts hatten Astronomen die reiche Information zu nutzen gewußt, die ihnen das Sternenlicht vermittelt. Wenn das Licht durch ein Prisma fällt und sich in ein Spektrum auffächert, verraten sich die verschiedenen Stoffe – Sauerstoff, Natrium, Kohlenstoff und alle anderen – durch ihre Farben. Das Element Helium, das zweite im Periodensystem, wurde auf der Erde erst nachgewiesen, als man seine Spektraleigenschaften im Sonnenspektrum bemerkt hatte. Sterne bestehen aus den gleichen Elementen, wie wir sie auf der Erde finden. Aber es hat sich als schwierig erwiesen – diese Aufgabe beschäftigt immer noch viele Astrophysiker –, mit Hilfe der Spektren herzuleiten, wie häufig die Elemente in den Sternen und Nebeln vorkommen.
Wenn man Hoyles Überlegungen begründen wollte, mußte man die entscheidenden Kernreaktionen besser verstehen. Es gelang Hoyle, William A. Fowler für seine Gedanken zu begeistern, der als Physiker am Caltech (dem Kalifornischen Institut für Technologie) vor allem Messungen vornahm, die von astronomischem Interesse waren. Gemeinsam mit ihren Kollegen Geoffrey und Margaret Burbidge faßten Hoyle und Fowler das Wissen über die kosmische Sternentstehung 1957 in einem Aufsatz von Buchumfang zusammen. Dieses klassische Werk – allen Astronomen als »B2FH«, also unter den Anfangsbuchstaben der vier Verfasser bekannt – ist auch heute noch nicht überholt.
Der wichtigste Fortschritt seit »B2FH« betrifft die Elemente, die im Periodensystem nach dem Eisen kommen. Weil Eisen den am stabilsten gebundenen Kern hat, wird bei der Bildung noch schwererer Kerne wie Blei und Uran keine Energie freigesetzt, sondern es muß Energie zugeführt werden. Die dafür entscheidenden Beiträge stammen unabhängig voneinander von Kippenhahn, damals in Göttingen, und von Hoyles jüngeren amerikanischen Mitarbeitern, die alljährlich im Sommer an seinem Institut in Cambridge mit ihm zusammenarbeiteten. Wenn die Materie während eines Supernova-Ausbruchs plötzlich durch eine Stoßwelle erhitzt wird, die sich ihren Weg durch den Stern hindurch nach außen bahnt, läuft eine sogenannte »explosive Nukleosynthese« ab.
Warum sind Kohlenstoff- und Sauerstoffatome hier auf der Erde so häufig, Gold und Uran aber so selten? Wir können diese alltägliche Frage beantworten – und dabei spielen Vorgänge eine Rolle, die in Sternen abliefen, die vor über 5 Milliarden Jahren in unserem Milchstraßensystem explodierten, noch bevor sich unser Sonnensystem bildete. Der Kosmos ist eine Einheit. Wenn wir uns selbst verstehen wollen, müssen wir die Sterne verstehen. Wir sind Sternenstaub – die Asche von Sternen, die seit langem tot sind.
Die Ökologie des Milchstraßensystems
Primo Levi schildert in seinem Buch Das periodische System die ereignisreiche Geschichte eines typischen irdischen Kohlenstoffatoms:
Unser Held ist also seit Hunderten von Millionen Jahren an drei Sauerstoffatome und ein Kalziumatom gebunden – in einem Kalkfelsen. Er hat bereits eine lange kosmische Geschichte hinter sich, die wir aber unberücksichtigt lassen wollen. … Irgendwann … wurde das Atom von einem Schlag mit der Spitzhacke herausgebrochen, … es wanderte in den Kalkofen … und erhob sich in die Lüfte. … Der Wind erfaßte das Atom, warf es zu Boden und hob es zehn Kilometer in die Höhe. Ein Falke atmete es ein. … Dreimal löste es sich im Meereswasser auf … und wurde wieder ausgestoßen. … Dann geriet es in Gefangenschaft und in ein organisches Abenteuer. … Es hatte das Glück, ein Blatt zu streifen, in dieses einzudringen und von einem Sonnenstrahl darin festgenagelt zu werden. … Es schließt sich einem großen, komplizierten Molekül an, wird von ihm aktiviert und empfängt gleichzeitig … die entscheidende Botschaft: im Nu, wie ein im Spinnennetz gefangenes Insekt, wird es von seinem Sauerstoff getrennt, verbindet sich mit Wasserstoff … wird schließlich in eine Kette aufgenommen … die Kette des Lebens. … Es dringt in den Blutstrom ein: es wandert, klopft an die Pforte einer Nervenzelle, tritt ein und ersetzt ein anderes Kohlenstoffatom. Diese Zelle gehört zu einem Gehirn, dem meinigen, dessen, der hier sitzt und schreibt, die fragliche Zelle und das in ihr enthaltene Atom sind für mein Schreiben zuständig – ein gigantisches und zugleich mikroskopisch feines Spiel, das noch niemand beschrieben hat. Es führt meine Hand, und sie drückt diesen Punkt aufs Papier: diesen.
Die Theorie der Sternentwicklung und Elemententstehung, zweifellos ein Triumph der Astrophysik des 20. Jahrhunderts, verfolgt die Geschichte aller Atome zurück in die Zeit vor der Entstehung der Erde. Eine Galaxie gleicht einem ungeheuer großen Ökosystem. Wasserstoff aus dem Urknall wird im Inneren von Sternen in die Grundbausteine des Lebens umgewandelt – in Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen und alle anderen. Ein Teil dieser Materie gelangt in den interstellaren Raum, wo sie zu neuen Sternen wird.
Unsere Galaxis, das Milchstraßensystem, ist eine gewaltige Scheibe mit einem Durchmesser von 100000 Lichtjahren, die 100 Milliarden Sterne enthält. Ihre ältesten Sterne bildeten sich vor über 10 Milliarden Jahren. Die ursprüngliche Materie enthielt nur die einfachsten Atome – weder Kohlenstoff noch Sauerstoff oder Eisen. Unsere Sonne ist ein mittelalter Stern – manche Sterne sind mehr als doppelt so alt. Bevor sie vor 4,5 Milliarden Jahren entstand, hatten womöglich schon mehrere Generationen schwerer Sterne ihren ganzen Lebenszyklus durchlaufen. In diesen Sternen wurden die chemisch interessanten Atome – solche, die Komplexität und Leben ermöglichen – geschmiedet. Die Todeskämpfe dieser Sterne, die Supernovae, haben diese Atome in den interstellaren Raum zurückgeschleudert.
Kohlenstoffatome – jene in unseren Blut- und Gehirnzellen oder in der Druckerschwärze dieser Seite – haben eine Ahnentafel, die viel weiter zurückreicht als bis zur Geburt unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren. Das Sonnensystem selbst kondensierte aus den Trümmern vieler früherer Sterne. Wenn wir die Geschichte der Atome, die jetzt auf einem einzelnen Strang DNA vereint sind, weiter zurückverfolgen – bis vor, sagen wir, 7 Milliarden Jahren –, finden wir Atome im Inneren von Sternen oder in interstellarer Materie durch die gesamte Galaxis verstreut wieder.
Ein Kohlenstoffatom, das in einer frühen Supernova aus Helium entstanden war, könnte mehrere 100 Millionen Jahre zwischen den Sternen herumgewandert sein und sich dann in einer interstellaren Wolke wiedergefunden haben, die unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenfiel und Sterne bildete. Das Atom könnte in den Kern eines neuen hellen Sterns gelangt, im periodischen System (umgewandelt in Silizium oder Eisen) höher gestiegen und in einem weiteren Supernova-Ausbruch in den interstellaren Raum zurückgeschleudert worden sein. Es könnte auch in einen weniger massereichen Stern gelangt sein, der von einer kreisenden Gasscheibe umgeben war, die zu einen Schwarm von Planeten kondensierte. Ein solcher Stern könnte unsere Sonne gewesen sein. Dieses Kohlenstoffatom könnte sich in der neugebildeten Erde wiedergefunden haben, um dort seine Rolle bei den geologischen Vorgängen zu spielen, welche die Erdkruste formten und gestalteten, und in der Chemie, die sich bei der Entstehung und Entwicklung biologischer Arten abspielte, und so schließlich in Primo Levis Gehirnzelle gelangt sein.
In der fernen Zukunft, nach dem Tod unseres Sonnensystems, könnte dieses Atom wieder irgendwo in der Galaxis in einen neuen Stern eingebaut werden. Es hat nur vorübergehend biochemische Gestalt, wenn es in einem DNA-Molekül gefangen ist; astrophysikalisch gesehen ist auch die Gefangenschaft in demselben Sonnensystem eine vorübergehende Epoche in seiner Geschichte, die zurückgeht in die Zeit vor der Bildung der Galaxis und die weit in die Zukunft reichen kann.
Während die Häufigkeiten von Kohlenstoff, Sauerstoff, Natrium und der anderen »schweren Elemente« relativ zueinander überall gleich sind, ist ihr Mengenverhältnis relativ zum Wasserstoff nicht immer dasselbe. Sie sind in den ältesten Sternen weniger häufig. Das ist natürlich auch zu erwarten, wenn sie sich wirklich in aufeinanderfolgenden Sterngenerationen allmählich gebildet haben. Die ältesten Sterne, die früh in der galaktischen Geschichte entstanden, hätten sich demnach aus Materie kondensiert, die noch nicht so »verschmutzt« war wie heute und wie zu den Zeiten, als sich die jüngeren Sterne bildeten. Außerdem sind die Häufigkeiten oft dort höher, wo die Sternbildung am raschesten erfolgt und die »Recyclingrate« besonders hoch ist.
In ihrer Jugend enthielt unsere Galaxis weder Kohlenstoff noch Sauerstoff oder Eisen. Chemie wäre damals ein langweiliges Fach gewesen. Bevor sich komplexe chemische Verbindungen bilden konnten und bevor ein Sonnensystem entstand, mußten alte Sterne die grundlegende Arbeit der Bildung, Umwandlung und Wiederverwertung der chemischen Elemente verrichten.
Gibt es andere Planeten?
Sterne bilden sich auch heute noch. Etwa 1500 Lichtjahre von uns entfernt liegt der Orionnebel, der genug Gas und Staub für Millionen Sterne enthält. Er enthält helle junge Sterne, sogar Proto-Sterne, die noch kondensieren und nicht heiß genug sind, um ihren Kernbrennstoff zu entzünden. Einige Proto-Sterne sind von kreiselnden Scheiben aus Staub und Gas umgeben. Dies sind Proto-Sonnensysteme: Staubteilchen haften zusammen und werden zu felsigen »Planetesimalen«, die wiederum zu Planeten verschmelzen.
Planetensysteme wurden früher unwahrscheinlichen und ungewöhnlichen Ereignissen zugeschrieben – man vermutete beispielsweise, ein Stern sei so nahe an der Sonne vorbeigezogen, daß seine Schwerkraft aus ihr einen Gasstrom herausriß, der sich zu Planeten abkühlte. Aber es ist inzwischen deutlich geworden, daß die Entstehung von Planeten keinen seltenen »Zufall« voraussetzt. Planeten sind eine natürliche Begleiterscheinung der Sternbildung. Sie sind sogar unvermeidlich, wenn der Drehimpuls der Materie, die einen Stern bildet, nicht gerade Null ist: Das wäre eher ein seltener Zufall!
Planetensysteme sollten also weit verbreitet sein. Voll ausgebildete Planeten, die andere Sterne umlaufen, sind wegen ihrer Lichtschwäche nur sehr schlecht zu sehen, wohl aber läßt sich ihre Wirkung indirekt ausmachen. Ein Stern und die ihn begleitenden Planeten umlaufen einen gemeinsamen Massenmittelpunkt, den sogenannten Schwerpunkt. Dieser Schwerpunkt liegt natürlich sehr nahe am Stern, weil dieser viel schwerer ist als die Planeten. Der Stern bewegt sich kaum, aber hinreichend genaue Messungen können die von umlaufenden Planeten bewirkten kleinen Veränderungen messen.
Die ersten wirklich überzeugenden Hinweise auf einen Planeten um einen gewöhnlichen Stern wurden erst 1995 gefunden, als Michel Mayor und David Queloz an der Genfer Sternwarte nachwiesen, daß die Dopplerverschiebung von 51 Pegasus, einem sonnenähnlichen Stern in 40 Lichtjahren Entfernung, in einem Rhythmus von 4 Tagen sehr leicht schwankt.[4] Anscheinend wird er eng von einem Planeten umkreist, der fast so schwer ist wie Jupiter. Dieser Planet dürfte seinem Zentralstern zehnmal näher sein als Merkur der Sonne, und seine Oberflächentemperatur dürfte über 1450 Kelvin betragen; vielleicht ist er nur der größte Planet eines ganzen Planetensystems. Innerhalb weniger Monate haben Geoffrey Marcy und Paul Butler in Kalifornien auch bei anderen Sternen Planeten entdeckt, die längere Umlaufzeiten haben und deren Temperaturen die Existenz von Wasser zulassen könnten. Aber diese Planeten sind alle sehr groß – schwerer als Jupiter. Planeten, die nicht mehr wiegen als die Erde, wären weitaus schwerer zu entdecken.
Planeten, auf denen sich wie hier auf der Erde Leben entwickeln kann, müssen ganz besondere Eigenschaften haben. Ihre Schwerkraft muß stark genug sein, um die Atmosphäre daran zu hindern, in den Raum zu verdampfen. Sie dürfen weder zu heiß noch zu kalt sein, müssen also die richtige Entfernung von einem langlebigen und stabilen Stern haben. Nur ein kleiner Bruchteil der Planeten erfüllt diese Bedingungen, aber meiner Meinung nach sind Planetensysteme in unserem Milchstraßensystem so häufig, daß es Millionen erdähnlicher Planeten geben sollte. Die für das Forschungsprogramm der NASA verantwortlichen Wissenschaftler haben die USA gedrängt, die Suche nach Planeten zu einem vorrangigen Ziel des Raumfahrtprogramms der USA zu machen. Das Ziel ist von ungeheurem wissenschaftlichen Interesse und könnte mehr als die meisten anderen wissenschaftlichen Programme auch die Begeisterung der Öffentlichkeit wecken.
Die Aufgabe ist nicht nur deshalb schwierig, weil erdähnliche Planeten sehr lichtschwach sind, sondern auch, weil Planet und Stern am Himmel eng benachbart sind. Kein existierendes optisches Teleskop, nicht einmal das Hubble-Raumteleskop, könnte Bilder liefern, die scharf genug sind, um die beiden zu unterscheiden. Das ist nur mit Hilfe der »Interferometrie« möglich, die zwei getrennte Teleskope miteinander verbindet. Die jupiterähnlichen Planeten dagegen können auf recht einfache Weise von der Erde aus mit mäßig großen Teleskopen entdeckt werden, die das Sternenlicht analysieren und so die winzigen Bewegungsschwankungen des Sterns nachweisen, die der umlaufende Planet bewirkt.
Die technischen Probleme, welche die Entdeckung erdähnlicher Planeten stellt, sind nicht unüberwindlich, und wir könnten, wenn einmal ein solcher Planet gefunden wird, einiges über ihn in Erfahrung bringen. Nehmen wir an, ein Astronom, der 40 Lichtjahre von uns entfernt lebt, hätte unsere Erde entdeckt – sie wäre, wie Carl Sagan sagte, ein »blaßblauer Punkt«, sehr nahe an einem Stern (unserer Sonne), der viele millionenmal heller ist. Wenn die Erde überhaupt gesehen werden könnte, würde die Analyse ihres Lichts zeigen, daß es eine Biosphäre mit angereichertem Sauerstoff durchlaufen hat. Die Blauschattierungen wären etwas unterschiedlich, je nachdem, ob der Pazifische Ozean oder Eurasien im Blickfeld wäre. Der ferne Astronom könnte deshalb aus wiederholten Beobachtungen schließen, daß die Erde sich dreht. Er könnte die Länge eines Erdentages herausfinden und sogar die Topographie und das Klima erschließen.
Gibt es Leben auf anderen Planeten?
Die Frage, wie Leben auf einem Planeten entstehen kann, ist auch dann, wenn die richtige physikalische Umwelt gegeben ist, schwieriger zu beantworten. »Leben« kann Formen annehmen, die wir nicht erkennen würden und uns nicht vorstellen können. Mit welcher Wahrscheinlichkeit Leben, wie wir es von der Erde kennen, anderswo entsteht, hängt von der Antwort auf zwei Fragen ab. Erstens: Wie häufig sind erdähnliche Umwelten? Zweitens: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß Leben sich entwickelt, selbst wenn die physikalischen Bedingungen optimal sind?
Die erste dieser Fragen haben wir bereits beantwortet: Es sollte viele »geeignete« Planeten geben. Aber wie wahrscheinlich ist es, daß Leben beginnt, wenn Chemie, Temperatur und Schwerkraft »stimmen«? Darüber herrscht bei Biologen immer noch keine Übereinstimmung, aber man fand 1996 einen faszinierenden Hinweis, als in einem Meteoriten, der vermutlich vom Mars stammt, winzige Spuren organischer »Fossilien« gefunden wurden. Wenn das Leben auf unserem Nachbarplaneten von selbst entstand, würden die Chancen, daß »Grünzeug« in jeder ähnlichen Umwelt entstehen würde, deutlich steigen. Aber das Leben auf dem Mars ist, wenn es überhaupt einmal existierte, offenbar in einem primitiven Stadium steckengeblieben. Die komplexe Biosphäre der Erde könnte sich gegen alle Wahrscheinlichkeit entwickelt haben, und die Entwicklung intelligenter Wesen könnte ein noch größerer Glücksfall sein. Der Verlauf der Evolution wurde vielleicht durch »Zufälle« gesteuert – Kometeneinfälle, Eiszeiten, Vulkanausbrüche und dergleichen.
Wenn die Evolution auf der Erde noch einmal ablaufen könnte, käme vielleicht ein ganz anderes Ergebnis heraus. Biologen behaupten, es würde immer Tiere mit Augen geben, weil sich im Lauf der Evolution Augen in der einen oder anderen Form unabhängig voneinander entwickelt haben. Aber würde auch notwendigerweise Intelligenz entstehen? Der Evolutionstheoretiker Ernst Mayr behauptet, Intelligenz sei nicht (wie Augen) ein sehr wahrscheinliches Ergebnis der Evolution, denn sie hat sich anscheinend nur einmal entwickelt. Aber es gibt einen anderen Grund, warum sich Intelligenz vielleicht nicht mehrmals unabhängig voneinander entwickelt hat. Wenn es einmal intelligente Wesen gibt, die sich über ein gewisses Niveau hinaus entwickelt haben, beherrschen sie die Biosphäre und lassen der natürlichen Auslese nicht länger freien Lauf. Solange sich die vorherrschende Art nicht selbst ausrottet, hat eine andere Form von Intelligenz keine Chance, sich zu entwickeln.
Warum intelligentes Leben selten sein könnte
Selbst wenn es einfache Lebensformen gibt, wissen wir nicht, wie wahrscheinlich es ist, daß sie sich zu intelligenten Formen entwickeln, und auch nicht, wie lange sie Bestand haben, falls sie sich entwickeln. Intelligentes Leben könnte »natürlich« sein, oder es könnte eine Kette von Zufällen voraussetzen, die so überaus selten sind, daß nirgendwo sonst in unserer Galaxis je etwas Ähnliches passiert ist.
Es gibt sogar überzeugende Gründe für die Vermutung, daß intelligentes Leben selten ist. Ein alter Beweis steckt, wie der große Physiker Enrico Fermi einmal sagte, in der Frage »Wo sind sie?«. Viele Sterne sind Milliarden Jahre älter als unsere Sonne, deshalb sollte die Evolution an anderen Orten der unsrigen weit voraus sein. Warum haben uns dann Außerirdische nicht besucht oder zumindest Signale oder Gegenstände geschickt, die ihre Existenz deutlich verraten?
Ein ganz anderer Hinweis darauf, daß fortgeschrittene Lebensformen selten sind, stammt von Brandon Carter, einem Experten für Schwarze Löcher, von dem wir in späteren Kapiteln mehr hören werden. Sein Ausgangspunkt ist die schon erwähnte und wohlbekannte Tatsache, daß unsere Sonne etwa die Hälfte ihres Lebens hinter sich hat. Mit anderen Worten: Die Zeit, die wir zu unserer Entwicklung gebraucht haben, ist (bis auf einen Faktor 2) gleich dem Alter der Sonne. Carter wunderte sich darüber, daß diese beiden Zeiten näherungsweise gleich sind. Menschen sind das Ergebnis der Evolution einer Folge von ungeheuer vielen vorangegangenen Arten, während das Alter der Sonne durch ganz andere (und viel besser verstandene) physikalische Zwänge bedingt ist. Die beiden Zeitskalen könnten sich a priori um viele Zehnerpotenzen unterscheiden.
Carter sah diese Zeitskalen auf eine neue Weise und stellte die folgenden Überlegungen an: Es wäre ein unwahrscheinlicher Zufall, wenn die Zeit, die nötig ist, damit intelligente Wesen entstehen, gerade mit der Lebenszeit eines Sterns übereinstimmen sollte, denn die Vorgänge, die diese beiden Zeitskalen bestimmen, haben nichts miteinander zu tun. Die Zeitskala der Evolution würde (so wäre zu vermuten) entweder viel kürzer oder viel länger sein als die Lebensdauer der Sonne. Wenn sie viel kürzer wäre, wären wir Nachzügler – und Fermis Frage müßte direkt angegangen werden. Andererseits könnte man auch annehmen, daß die biologische Zeitskala in der Regel viel größer ist als das Alter von Sternen. Die Evolution würde dann auf den meisten Planeten nicht sehr weit kommen, bevor ihre Sonnen sterben. Es gäbe uns überhaupt nicht, wenn die entscheidenden Schritte der Evolution hier auf der Erde nicht alle besonders rasch abgelaufen wären. Intelligentes Leben der Art, wie es sich auf Planeten entwickelt, die eine Sonne umkreisen, sollte deshalb selten sein.[5]
Die Überwindung kultureller Schranken im Kosmos
Sicher ist nur, daß sich mindestens einmal intelligentes Leben entwickelt hat. Selbst wenn es woanders existierte, würden wir es vielleicht gar nicht erkennen. Intelligente Außerirdische leben möglicherweise eher zurückgezogen und kontemplativ und sehen keinen Grund, uns ihre Gegenwart anzuzeigen: Ein Nichts an Beweisen beweist nicht, daß es nichts gibt!
Die systematische Suche nach künstlichen Signalen ist ein lohnendes Glücksspiel – obwohl die Erfolgschancen so schlecht stehen –, weil jede solche Entdeckung große philosophische Bedeutung hätte. Außerirdische Intelligenz könnte »organisches« Leben sein, es könnten aber auch Maschinen sein, die von Lebewesen konstruiert wurden (oder sich aus ihnen entwickelt haben). Jedenfalls besagt die »herkömmliche Weisheit«, daß sie sich höchstwahrscheinlich durch Signale im Bereich der Radiofrequenzen verraten würden – Radioteleskope sind außerordentlich empfindlich. Deshalb lassen sich im Bereich der Radiowellenlängen weniger energiereiche Signale aufspüren als (beispielsweise) im optischen oder im Röntgenbereich. Die Suche hat sich auf das Fenster im elektromagnetischen Spektrum konzentriert, das zwischen der 21-cm-Linie liegt, die von atomarem Wasserstoff (H) stammt, und der 18-cm-Linie, die von ionisiertem Wasser (OH) ausgeschickt wird.
Es lassen sich leicht Signale ausdenken, die unbestreitbar künstlich erzeugt sind: Beispielsweise könnte eine Zahlenfolge 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 Aufmerksamkeit erregen. Diese ersten 10 Primzahlen lassen sich durch keinen natürlichen Vorgang erzeugen, würden aber von jeder Kultur erkannt werden, die an kosmischen Radiowellen interessiert ist (und in der Lage ist, sie aufzufangen).
Eine Reihe sorgfältig zusammengestellter Botschaften könnte dann einen Wortschatz aufbauen, um Dinge zu beschreiben, die beiden, Absendern und möglichen Empfängern, vertraut sind: die Grundlagen der Mathematik, Physik und Astronomie. Der Logiker Hans Freudenthal führt in seinem Buch Lincos. Design of a language for cosmic discourse die Einzelheiten dieses Vorhabens auf. Die Signale könnten auch Bilder übermitteln und (ein in der Science-fiction häufiges Thema) Kopien dreidimensionaler Gebilde zu uns »herunterbeamen«. Die nächsten möglichen Adressaten unserer Botschaften sind so weit entfernt, daß Signale viele Jahre brauchen würden, um sie zu erreichen. Ganz abgesehen von den Unterschieden in der kulturellen Entwicklung wäre die Übermittlung schon aus diesem Grund weitgehend eine Einbahnstraße – man hätte Zeit, eine wohlüberlegte Antwort zu senden, aber keine Möglichkeit zu einer schlagfertigen Unterhaltung.
Nach Meinung von Optimisten könnten uns die »Außerirdischen« Botschaften von solcher Wichtigkeit vermitteln, daß wir mit ihrer Hilfe Jahrhunderte wissenschaftlicher Forschung und Entdeckung überspringen könnten oder auch vor einer eventuellen Katastrophe gewarnt wären (die dann verhindert werden könnte). Aber selbst im Rahmen der menschlichen