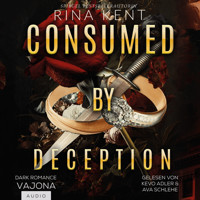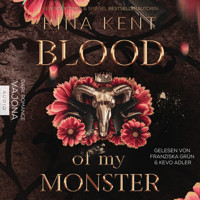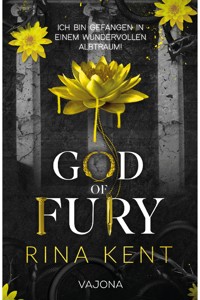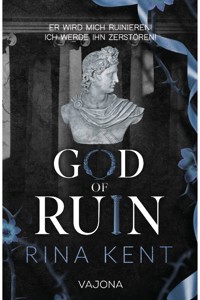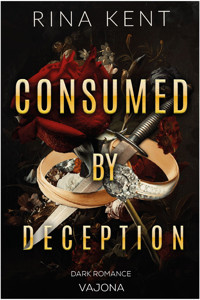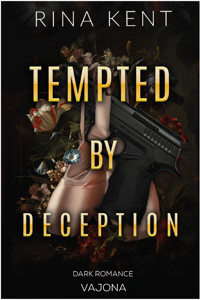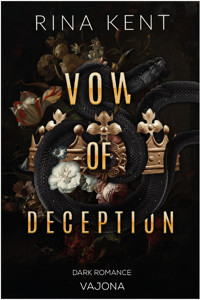
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: VAJONA Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mein Ehemann. Mein Peiniger. Der berüchtigtste Mann der Stadt bietet mir einen Job an: Ich soll so tun, als wäre ich seine tote Frau. Adrian Volkov gehört nicht zu den Leuten, die ein Nein akzeptieren. Er herrscht mit eiserner Faust und all seine Befehle müssen befolgt werden. Als er mit dem Angebot an mich herantritt, habe ich genau zwei Optionen: Ins Gefängnis gehen oder mich seinem Zorn ergeben. Ich entscheide mich dafür, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das bisschen Schauspielern kann ja nicht so schwer sein, richtig? Falsch In der Sekunde, in der ich in die Fußstapfen seiner Frau trete, läuft alles aus dem Ruder. Meine einzige Chance, zu überleben, ist Adrian. Oder auch nicht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rina Kent
Vow of Deception
Vow of Deception
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel
»VOW OF DECEPTION«.
Copyright © 2021. VOW OF DECEPTION by Rina Kent
the moral rights of the author have been asserted.
Deutschsprachige Ausgabe © 2025. Vow of Deception
by VAJONA Verlag GmbH
Übersetzung: Anne Masur
Lektorat: Alexandra Gentara
Umschlaggestaltung: Haya in Designs
Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Für alle, die sich der Logik widersetzen und den Bösewichten verfallen.
Anmerkung der Autorin
Liebe Leserin, lieber Leser,
falls du bisher noch keines meiner Bücher gelesen hast, könnte das neu für dich sein, aber ich schreibe düstere Geschichten, die aufregend und verstörend sein können. Meine Bücher und Charaktere sind nichts für schwache Nerven.
Vow of Deception ist das erste Buch einer Trilogie und sollte zusammenhängend gelesen werden.
Deception Trilogie:
#1 Vow of Deception
#2 Tempted by Deception
#3 Consumed by Deception
Melde dich für Rina Kents Newsletter an, um über neue Veröffentlichungen auf dem Laufenden gehalten zu werden und eine exklusive Überraschung zu erhalten.
Playlist
Snuff – Slipknot
Demons and Angels – LOWBORN
Darkness in Me – Fight The Fade
I Don’t Know What to Say – Bring Me The Horizon Designer Drugs – FNKHOUSER
Virgin – Manchester Orchestra
Simple Math – Manchester Orchestra
Pale Black Eye – Manchester Orchestra
Warning Sign – Coldplay Hemorrhage – Red
Crawling – Dream State
Ashes – Claire Guerreso
Survivin’ – Bastille
Heavy Rain – Solence
Apprehension – Manchester Orchestra
Mighty – Manchester Orchestra
Flares – The Script
Haunted – Acacia Ridge
In The Shadows – Amy Stroup
Under Your Scars – Godsmack
Die ganze Playlist findet ihr auf Spotify.
Der Tod kann sich in Form eines Doppelgängers zeigen.
Es gibt eine Sage, so alt wie die Zeit selbst, die besagt: Wenn man jemanden trifft, der genauso aussieht wie man selbst, wird einer der beiden sterben.
Die Frage ist nur … wer?
Wer wird als Erstes sterben? Ich … oder sie?
Laut der Sage wird derjenige, der den anderen als Erstes entdeckt, schon bald sein Ende finden. Im selben Jahrzehnt. Im selben Jahr. Vielleicht sogar noch am selben Tag.
Ich hebe meine zittrigen Hände und starre auf das Blut, das sie überzieht, zwischen meine Finger läuft und unter meine Nägel kriecht.
Oh.
Ich schätze, das bedeutet, dass ich sie zuerst gesehen habe. Ich hatte zuerst Augenkontakt.
Was für ein Pech.
Aber ich schätze, besonders viel Glück hatte ich noch nie. Nicht, als ich geboren wurde, und ganz bestimmt auch nicht, als ich in dieses Leben gestoßen wurde.
Meine Aufmerksamkeit liegt auf dem satten Purpur, das meine Hände wie eine zweite Haut überzieht. Es ist dick, klebrig, und die dunkle Farbe brennt sich in meinen Kopf ein. Ich reibe die Handflächen aneinander, um es abzuwischen, aber besser macht es das nicht. Wenn überhaupt, dann verschmiere ich das warme, frische Blut nur noch weiter, als hätte es meine Hände als dauerhaften Wohnsitz auserkoren.
Ich kneife die Augen zusammen und atme scharf ein. Es klingt rau, kehlig, kratzt wie lange, rostige Nägel über meine Lunge.
Schon okay. Wenn ich die Augen öffne, werde ich aufwachen. Das ist nicht real. Es sind nur meine verrückte Vorstellungskraft und der Aberglaube, die sich zusammengeschlossen haben, um mich zu foltern.
Das. Ist. Nicht. Real.
Als ich die Augen wieder öffne, fühlen sich meine Lider an, als hätte man sie zusammengeklebt.
Das Blut ist immer noch da – warm, klebrig, und durch das fehlende Licht nahezu schwarz. Ich balle die Fäuste, und mein Körper wird hart wie eine gespannte Peitsche.
Wach auf. Wach verdammt noch mal auf.
Meine Nägel graben sich in meine Handflächen, aber nichts holt mich hier raus. Nichts stoppt diesen widerlichen Kreislauf.
Ich hebe meinen Kopf und studiere meine Umgebung. Wilde Bäume schließen sich wie ein Kokon um mich. Sie sind so groß, dass der dunkle Himmel nur durch die kleinen Lücken über meinem Kopf sichtbar wird. Wolken legen sich über den silbrigen Schimmer des Mondes und ich erschauere. Die dünne Strickjacke über meinem Baumwollkleid schützt mich kaum vor den Temperaturen. Die Kälte zu spüren, sollte ein gutes Zeichen sein, aber das ist es nicht. Es ist kein klarer Indikator dafür, ob das hier echt ist oder nicht.
Das Blut an meinen Händen will nicht verschwinden, genauso wenig wie das Zittern, das durch meinen Körper fährt.
Er ist hinter mir her.
Wenn er mich findet, wird er mich töten.
Ich schließe meine Augen und fange an zu zählen. »Drei, zwei, eins.«
Als ich sie wieder öffne, stehen die Bäume unverändert dort, und auch die Kälte ist geblieben. Jetzt ist auch das Blut kühler. Zähflüssiger. Klebriger. Wie ein Dämon, der Besitz von mir ergreift und bei meinen Händen anfängt.
Nein.
Ich vergrabe meine Fingernägel in der langen Narbe an meinem Handgelenk und reiße so fest ich kann an der Haut, will sie entfernen und darunter lugen. Ich muss sehen, ob tatsächlich Blut fließt, um diesen Albtraum von der Realität zu unterscheiden.
Wenn ich keinen Schmerz spüre, ist es nicht real. Dann ist es nur eine weitere grausame Manifestation meines Unterbewusstseins und eine weitere Bestrafung für mich selbst. Bald ist das alles vorbei und ich werde aufwachen, gesund und munter.
Meine Haut gibt unter dem Angriff meiner Nägel nach und ein scharfer Schmerz explodiert in der Verletzung.
Mein Mund öffnet sich, Tränen stehen in meinen Augen.
Es ist real.
Das ist kein Albtraum. Ich bin nicht eingeschlafen und in dieser Hölle aufgewacht. Ich habe sie selbst mit meinen eigenen zwei Füßen betreten.
Nein.
Nein …
Meine ausgetrockneten Lippen zittern, als ein paar Tropfen meines Blutes aus der Wunde laufen und sich dem Massaker auf meinen Händen anschließen.
So viel Blut kann nur eins bedeuten.
Ich habe ein Leben genommen.
Meine Dämonen haben schließlich doch gewonnen.
Jetzt schweigen sie, wagen es nicht mal, diese boshaften Dinge zu flüstern, diese Gedanken, mit denen sie mich Tag und Nacht quälen. Sie werden immer lauter, krächzen und kratzen am Rande meines Verstands, bis ich sie verstehe.
Bis ich ihre Wünsche erfülle.
»Ich bin keine Mörderin. Keine Mörderin …«, murmle ich mir selbst zu. Vielleicht kann ich ungeschehen machen, was auch immer passiert ist, wenn ich es nur oft genug wiederhole.
Vielleicht kann ich zurückgehen und das Schicksal verändern.
Ich starre in den düsteren, trostlosen Himmel, während Tränen in meinen Augen brennen. »Wenn da draußen irgendjemand ist, bitte lass mich zurückgehen und es rückgängig machen. Das bin nicht ich. Bitte lass mich nicht diese Person sein. Bitte …«
Nur der heulende Wind antwortet mir, er hallt durch den verlassenen Wald wie rachsüchtige Geister mit gelben Augen und klaffenden Mäulern.
»B-bitte …«, flehe ich. »Bitte hör auf, mich durch mich selbst zu foltern. Bitte.«
Mir ist bewusst, dass mein Flehen nichts bringt, aber es ist meine letzte Hoffnung, also muss ich mich daran klammern. Der letzte Strohhalm, der mich noch retten kann. Denn ich brauche dringend Hilfe.
Und ich vertraue mir selbst nicht mehr. Wenn ich es versuche, werde ich es nur noch schlimmer machen. Ich gerate außer Kontrolle und schlittere diesen Weg hinunter, ohne eine Möglichkeit der Rückkehr.
Bald werde ich bei meinen Dämonen sein.
Ich werde mein eigener Untergang sein.
Ich werde zu dem Ding werden, vor dem ich mein ganzes Leben lang weggelaufen bin.
»Bitte mach, dass es aufhört.« Meine Stimme bricht und ich schniefe. »Bitte. Ich tue alles.«
Diesmal antwortet mir nicht der Wind. Das Rascheln von Schritten dringt durch die Bäume.
Meine Beine versagen und mir stockt der Atem. So schnell können meine Dämonen mich nicht gefunden haben.
Obwohl … Moment. Das hier ist die Realität. In der Realität tauchen meine Dämonen nicht auf. Was bedeutet, dass die Schritte zu jemandem gehören, der noch gefährlicher ist als sie.
Ich wirble herum und sprinte los, stoße die niedrigen Äste mit den Ellbogen aus dem Weg. Das Laub raschelt unter meinen flachen Schuhen, aber ich denke nicht über den Lärm nach, den ich mache – obwohl er genau verrät, wo ich mich befinde. Das ist jetzt nicht wichtig. Wenn ich erwischt werde, werde ich umgebracht.
Tatsächlich wird mein Schicksal noch viel schlimmer sein als der Tod.
Lebe. Du bist eine Kämpferin. Du wurdest geboren, um zu überleben.
Moms Worte hallen in meinem Kopf wider, versorgen mich mit einem Schub Adrenalin. Ich muss lebendig sein und es auch bleiben, für uns beide.
Ich muss weiterleben.
Mit jeder Sekunde kommen die Schritte näher, bis das Stampfen direkt hinter mir ertönt. Ich sehe mich nicht um, versuche es nicht einmal. Stattdessen nutze ich die Bäume als Deckung, rase so schnell zwischen ihnen hindurch, dass meine Sehnen vor Schmerz aufschreien.
Wenn mein Laufmuster unregelmäßig ist, wird er mich nicht finden. Wenn ich unvorhersehbar bin, kann ich den Fängen des Todes entkommen.
Mir wurde beigebracht, nie den Kürzeren zu ziehen oder mich mit weniger, als ich verdiene, zufriedenzugeben. Es ist ironisch, dass er mir das beigebracht hat und nun hinter mir her ist.
So ironisch.
Die Bäume lichten sich und ich komme abrupt vor einer Klippe zum Stehen. Kiesel lösen sich unter meinen Füßen und hüpfen über die riesigen Felsbrocken, ehe sie schließlich in dem dunklen, trüben Wasser landen, das gegen die Felsen schlägt. Der Klang der dröhnenden Wellen hallt wie eine Symphonie des Todes durch die Luft.
Der Himmel ist jetzt vollständig bewölkt und wirft einen finsteren Schatten auf die wütende See. Als ich nach unten schaue, spielt sich ein fremder und doch vertrauter Gedanke ganz hinten in meinem Kopf ab. Es wäre so leicht, es zu beenden. So einfach.
Es braucht nur einen Schritt. Ein Schritt, und ich würde meine Dämonen eigenhändig ertränken.
Ein Schritt, und ich würde sie ein für alle Mal töten, sodass sie nie wieder herauskommen könnten.
»Tu es.«
Ein Schauer läuft mir über den Rücken, als ich die bösartige Stimme hinter mir höre.
Er hat mich gefunden.
Ich wirble so schnell herum, dass ich das Gleichgewicht verliere und nach hinten schwanke. Ich strecke meine Arme nach ihm aus, greife mit beiden Händen nach ihm und vergrabe meine Nägel in seinem Hemd. Die Blutflecken auf dem hellgrauen Stoff sind der Beweis für meinen verzweifelten Willen, zu leben.
Er ist regungslos, wie eine kalte Statue, während ich halb im Sturz gefangen bin. Sein Gesicht liegt im Schatten, abgesehen von den Konturen seines Kiefers und den Haaren kann ich nichts erkennen.
Da ich weiß, dass er mir nicht helfen wird, versuche ich, mich selbst an seinem Ärmel hochzuziehen.
»Du hast ein Leben beendet.« Seine ruhige und doch bedrohliche Stimme lässt mich mitten in der Bewegung innehalten.
Ich schüttle vehement den Kopf. »Ich w-wollte das nicht.«
»Passiert ist es trotzdem.«
»Nein, bitte … nicht …«
»Stirb für deine Sünden.« Er reißt den Stoff aus meiner Hand, ich stolpere zurück und die Klippe hinunter.
Ich öffne den Mund, um zu schreien, bringe aber keinen Laut hervor. Der Sturz ist nicht so schmerzhaft wie erwartet. Wenn überhaupt, dann ist er … friedlich.
Nachdem ich einen letzten Blick auf die Silhouette geworfen habe, die auf mich herabschaut, schließe ich die Augen und lasse den Tränen freien Lauf.
Endlich ist es vorbei.
Der Duft von Rosen hat sich unter den Gestank des Todes gemischt.
Ich starre auf das Blut hinunter, das aus ihren Wunden strömt, während das Leben stur ohne Pause oder Zögern ihren Körper verlässt. Das tiefe Rot steht im Kontrast zu ihrer hellen Haut, zeichnet Bächlein über ihre Arme und Beine und umrahmt ihr sanftes Gesicht.
Ihre Augen sind geöffnet, aber sie sieht mich nicht an. Das Blau darin ist leer, matt, existiert bereits an einem anderen Ort, zu dem ich keinen Zugang habe.
Ich wiege ihren Kopf in meinen Armen, streichle sanft über das dunkelbraune Haar. Hebe eine feuchte Strähne an und atme meinen womöglich letzten Schuss von Rosen ein. Es spielt keine Rolle, ob sie Stacheln haben und mich dabei stechen. Die Methode ist mir unwichtig, solange ich das Ziel erreiche.
Was mich erwartet, ist weit entfernt von Rosen. Es ist nicht einmal der Tod. Es ist schlimmer.
Das Nichts.
Leere.
Ein Ort, an dem sie mich nicht fühlen kann. Wo sie alles beendet, nur damit sie ihr Herz und ihre Seele versiegeln kann.
Damit sie einfach … verschwindet.
Ich streiche ihr die Haare aus dem Gesicht und lasse meine Lippen über ihre Stirn gleiten. »Ich werde dich wiederfinden.«
Die Leute sagen, der Tod sei das Ende.
Aber für mich ist er erst der Anfang.
Ich glaube, ich habe aufgehört, zu fühlen.
Es ist nicht so, als hätte ich meine Emotionen abgeschaltet, aber ich bin mir ziemlich sicher, das Gefühl in meinen Händen und Füßen verloren zu haben.
Ich kann die Erfrierungen an den Fingern in meinen zerrissenen Handschuhen beinahe vor mir sehen, und auch zwischen den Zehen. Meine Füße stecken in alten Socken und Männerschuhen, die eine Nummer zu groß sind und sie bei jedem Schritt herumrutschen lassen. Die eisige Kälte dringt sogar durch die vier Schichten meiner Sweatshirts und des viel zu großen Mantels.
Die Wintersaison hat New York City in diesem Jahr hart getroffen. Mit dem Gewicht der ganzen Kleidung, die ich trage, fühle ich mich wie ein wandelnder Schneemann. Nichts davon ist warm oder schützend genug, aber immer noch besser, als zu erfrieren.
Wie ironisch es wäre, wenn ich durch die Kälte sterbe, obwohl mein Name Winter lautet. Das wäre ein bisschen zu zynisch vom Schicksal, oder nicht? Es muss an diesen Moment gedacht haben, als es meiner Mutter zugeflüstert hat, dass sie mich nach der kältesten und härtesten Jahreszeit benennen soll.
Das Schicksal hat auch entschieden, mich in den schlimmsten Staat von allen zu werfen. Hier sind nicht nur die Winter kalt, windig und verdammt nass, auch der Sommer ist mit all der Luftfeuchtigkeit unerträglich.
Aber wieso beschwere ich mich? Hier kann ich wenigstens unbemerkt in der Menge untertauchen.
Als würde ich gar nicht existieren.
Unsichtbarkeit ist eine mächtige Waffe. In einer Stadt, die über acht Millionen Einwohner beherbergt, ist es für jemanden wie mich tatsächlich leicht, unbemerkt zu bleiben.
Jedoch zwingt die Kälte mich, mehr herauszustechen. Als ich die nassen Straßen zwischen Hunderten und Tausenden von Menschen entlanggehe, ernte ich viele Blicke. Sie zeugen nicht immer von Mitleid – oft sind sie urteilend. Ich kann sie sagen hören: Du hättest mehr aus dir machen können, junge Dame.
Aber die meisten New Yorker sind so abgestumpft, dass sie sich nicht weniger für jemanden wie mich interessieren könnten.
Ich bemühe mich, nicht auf die Menschen zu achten, die die Bäckereien mit Tüten in den Händen verlassen, aber ich kann die verlockenden Düfte nicht ignorieren, die mir entgegenwehen. Ich öffne meinen Mund und schließe ihn wieder, als könnte ich so von den leckeren Waren kosten.
Wenn ich doch nur etwas heiße Suppe oder ein Stück warmes Brot hätte.
Ich schlucke den Speichel herunter, der sich bei diesem Gedanken in meinem Mund sammelt. Immer wenn ich ausgehungert bin und kein Essen in Sicht habe, stelle ich mir einen Tisch voller köstlicher Gerichte vor und tue so, als würde ich schlemmen. Aber mein Bauch glaubt das nur für eine halbe Minute, bevor er wieder anfängt zu knurren.
Es ist schwer, ihn zu überlisten.
Doch so hungrig ich auch bin, was ich mir wirklich wünsche, ist, mehr zu trinken.
Ich hebe die in eine braune Papiertüte gewickelte Bierdose an meine Lippen und kippe den Rest hinunter. Da fließt der letzte Tropfen, der mich eigentlich durch den ganzen Tag bringen sollte.
Es ist erst Nachmittag und ich habe nichts mehr gegessen seit … Wie lange ist das jetzt her? Zwei Tage?
Vielleicht sollte ich zu dem Obdachlosenasyl zurückgehen und mir eine Mahlzeit und ein Stück Brot abholen …
Doch den Gedanken verdränge ich gleich wieder. An diesen Ort werde ich nie wieder zurückkehren, nicht mal, wenn ich auf der Straße schlafen muss. Vermutlich sollte ich mir einen anderen Zufluchtsort suchen, an dem ich den Winter verbringen kann, sonst friere ich mich noch zu Tode.
Vor einem gerahmten Poster, das an der Seite eines Gebäudes hängt, kommen meine Füße zum Stehen. Ich weiß nicht, warum ich anhalte.
Das sollte ich nicht.
Normalerweise mache ich es auch nicht.
Ich bleibe nicht stehen und starre etwas an, denn das würde Aufmerksamkeit auf mich ziehen und meine Chancen auf meine Superkraft der Unsichtbarkeit schmälern.
Aber aus einem mir unbekannten Grund bleibe ich diesmal stehen. Die leere Dose liegt zwischen meinen behandschuhten Fingern, mitten in der Luft, während ich die Anzeige studiere.
Es ist ein Poster des New York City Ballets, das eine ihrer Vorstellungen bewirbt. Das gesamte Bild wird von einer Frau, die en pointe in einem Hochzeitskleid posiert, dominiert. Ein Schleier bedeckt ihr Gesicht, aber er ist durchsichtig genug, um ihre Traurigkeit zu erkennen, die Härte, die … Hoffnungslosigkeit.
»Giselle« steht über ihrem Kopf. Am unteren Rand stehen die Namen des Direktors und der Prima-Ballerina, Hannah Max, und auch die der anderen Ballerinas, die bei der Show mitwirken.
Ich blinzle einmal, und für einen kurzen Moment sehe ich mein Spiegelbild in dem Glas. Der Mantel verschlingt meine schmächtige Gestalt und meine Sneaker sehen an mir aus wie die übergroßen Schuhe eines Clowns. Meine Kunstfell-Mütze bedeckt meine Ohren, und meine blonden Haare, deren Spitzen im Mantel stecken, sind zerzaust und fettig. Die Mütze ist etwas nach hinten gerutscht und offenbart den dunklen Haaransatz. Ich fühle mich leicht benommen und ziehe mir die Kapuze über den Kopf, die einen Schatten über mein Gesicht wirft.
Jetzt sehe ich aus wie ein Serienkiller.
Ha. Wenn ich könnte, würde ich darüber lachen. Ein Serienkiller wäre clever genug, um nicht auf der Straße zu landen. Sie wären clever genug, nicht so viel Alkohol zu trinken, dass es unmöglich wird, einen Job zu behalten.
Ich blinzle erneut und sehe wieder das Poster vor mir. Giselle. Ballett. Prima-Ballerina.
Der plötzliche Drang, dieser Frau die Augen auszukratzen, überkommt mich. Ich atme ein und wieder aus. Ich sollte keine so starken Reaktionen gegenüber einer Fremden haben.
Aber ich hasse sie. Ich hasse Hannah Max und Giselle und Ballett.
Ich wirble herum und haue ab, bevor ich der Versuchung nachgeben kann, das Poster von der Wand zu reißen.
Die leere Dose drücke ich zusammen und werfe sie in den nächsten Mülleimer. Diese Stimmungsschwankungen sind nicht gut – ganz und gar nicht.
Es liegt an dem Mangel an Alkohol in meinem Blut. Ich hatte nicht genug Bier, um mich am helllichten Tag zu betrinken. Wenn mein Verstand betäubt wurde, ist die Kälte leichter zu ertragen. Dann sind meine Gedanken nicht so laut und ich bekomme keine Mordlust beim bloßen Anblick eines Ballett-Posters.
Geistesabwesend überquere ich die Straße, wie eigentlich jeden Tag. Das ist zu meiner Routine geworden, der ich keine besondere Aufmerksamkeit mehr schenke.
Den Fehler mache ich immer wieder – Dinge als selbstverständlich anzusehen.
Die dröhnende Hupe höre ich erst, als ich schon mitten auf der Straße stehe.
Meine Füße erstarren, als hätte man sie mit Steinen beschwert. Während ich in die grellen Scheinwerfer des Transporters schaue und die Hupe weiter dröhnt, denke ich an mein siebenundzwanzigjähriges Leben zurück. Vom Moment meiner Geburt an rauscht alles vor meinem inneren Auge vorbei. Das passiert doch, wenn man stirbt, oder? Ich sollte mich an alles erinnern.
Von dem Moment an, als Mom mit mir in eine andere Stadt gezogen ist, bis das Leben mich nach New York gebracht hat.
Von dem Moment an, als ich erblühte, bis zu dem Unfall, der mich in eine unheilbare Alkoholikerin verwandelte.
Allerdings kommt keine dieser Erinnerungen. Nicht mal kurze Auszüge davon. Das Einzige, was seinen Weg in meinen Kopf findet, sind kleine Zehen und Finger. Das winzige Gesicht einer kleinen Gestalt, die die Krankenschwester in meine Arme legt, bevor sie mir für immer genommen wurde.
Ein Kloß bildet sich in meinem Hals und ich zittere wie Espenlaub in den kühlen, winterlichen Straßen von New York.
Ich habe versprochen, für sie weiterzuleben. Warum zum Teufel sterbe ich dann jetzt?
Ich schließe die Augen. Es tut mir so leid, Baby Girl. So verdammt leid.
Eine große Hand legt sich um meinen Ellbogen und reißt mich so ruckartig zurück, dass ich über meine eigenen Füße stolpere. Dann hält dieselbe Hand mich sanft am Arm, damit ich nicht stürze.
Langsam öffne ich die Augen, in der Erwartung, meinen Kopf unter dem Transporter wiederzufinden. Doch stattdessen rast er laut hupend an mir vorbei, während der Fahrer aus dem offenen Fenster schreit: »Pass auf, wo du hinläufst, du dämliche Schlampe!«
Ich begegne seinem Blick, zeige ihm mit meiner freien Hand den Mittelfinger und halte ihn weiter hoch, damit er die Geste auch noch im Rückspiegel sehen kann.
Sobald der Transporter um die Ecke gebogen ist, fange ich wieder an zu zittern. Der kurze Adrenalinschub, der mich nach seiner Beleidigung getroffen hat, verfliegt, und jetzt kann ich nur noch daran denken, dass ich hätte sterben können.
Dass ich mein kleines Mädchen wirklich im Stich gelassen hätte.
»Geht es dir gut?«
Beim Klang der mit Akzent sprechenden Stimme wirble ich herum. Für eine Sekunde habe ich vergessen, dass mich jemand aus der Fahrbahn des Transporters gezogen hat. Und ich jetzt tot wäre, wenn diese Person das nicht getan hätte.
Der Mann – der seinem leichten Akzent nach zu urteilen Russe ist – steht direkt vor mir, seine Hand liegt noch immer auf meinem Ellbogen. Im Vergleich zu der rauen Kraft, mit der er mich zurückgezogen hat, ist die Berührung sanft.
Er ist groß, und auch wenn die meisten Leute größer sind als ich mit meinen ein Meter sechzig, geht er weit darüber hinaus. Wahrscheinlich eher Richtung eins neunzig oder mehr. Er trägt ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose unter einem dunkelgrauen Kaschmirmantel. Es könnte an den Farben liegen oder an der Länge des Mantels, der bis zu seinen Knien reicht, aber er sieht elegant aus. Klug, wie eine Art Anwalt, der während seines Studiums vermutlich als Model gearbeitet hat, um seine Studiengebühren zu bezahlen.
Doch sein Gesicht erzählt eine andere Geschichte. Nicht, dass er nicht attraktiv wäre, denn das ist er mit seinen markanten, kantigen Zügen, die zu seinem Modelkörper passen. Er hat hohe Wangenknochen, die einen Schatten auf seinen dichten Drei-Tage-Bart werfen.
Seine Augen sind von einem intensiven Grau, das beinahe schwarz wirkt. Obwohl die Farbe seiner Kleidung diesen Effekt verstärken könnte. Die Tatsache bleibt, dass sie mir … Unbehagen bereiten. Kennst du das Gefühl, wenn etwas oder jemand so schön ist, dass es tatsächlich wehtut, hinzusehen? Genau so ist es bei diesem Fremden. Wenn ich ihm in die Augen sehe, überkommt mich ein Gefühl der Minderwertigkeit, das ich nicht abschütteln kann, so seltsam sich das auch anhört.
Obwohl seine Worte Besorgnis ausdrücken, sehe ich nichts davon auf seinem Gesicht. Keine Empathie, zu der die meisten Menschen fähig sind.
Aber gleichzeitig scheint er nicht der Typ zu sein, der Sorge vorgaukelt. Wenn überhaupt, wirkt er eher wie die anderen Passanten, die dem Beinahe-Unfall kaum Beachtung geschenkt haben.
Ich sollte dankbar sein, aber das Einzige, woran ich denken kann, ist, seinem Griff und diesen beunruhigenden Augen zu entkommen. Diesen tiefen, eindringlichen Augen, die mein Gesicht nach und nach zu entschlüsseln scheinen.
Ein winziges Stück nach dem anderen.
»Es geht mir gut«, bringe ich hervor und befreie meinen Ellbogen mit einer drehenden Bewegung.
Er runzelt die Stirn, nur kurz, kaum merkbar, bevor er seine vorherige Miene wieder aufsetzt und genauso sanft von mir ablässt, wie er mich festgehalten hat. Ich erwarte, dass er sich umdreht und weggeht, damit ich das Ganze als einen weiteren vom Pech verfolgten Winternachmittag abstempeln kann.
Aber er steht einfach da, regungslos, ohne zu blinzeln oder sich in irgendeine Richtung zu entfernen. Stattdessen betrachtet er mich. Die buschigen Brauen ziehen sich über diese Augen, in die ich wirklich nicht starren möchte, aber ihr wildes Grau zieht mich trotzdem in ihren Bann.
In ihnen spiegeln sich die Härte der Wolken über uns und die Unbarmherzigkeit des Windes. Ich könnte so tun, als würden sie nicht existieren, aber sie saugen dennoch das Gefühl aus meinen Gliedern. Sie verursachen Frostbeulen und Schmerz.
»Bist du sicher, dass es dir gut geht?«, fragt er erneut, und aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass er ein Nein hören will.
Aber warum? Zu welchem Zweck?
Ich bin nur eine von Tausenden Obdachlosen in dieser Stadt. Ein Mann wie er, umgeben von einer undurchdringlichen Wolke aus Selbstbewusstsein, die andeutet, wie einflussreich er ist, sollte mich nicht einmal ansehen.
Doch das tut er.
Und jetzt fragt er, ob es mir gut geht. Da ich es gewohnt bin, unsichtbar zu sein, macht mich die plötzliche Aufmerksamkeit nervös.
Seit dieser russische Fremde nach meinem Arm gegriffen hat, spüre ich ein Jucken unter meiner Haut, das mich dazu drängt, wieder in den Schatten zu verschwinden.
Sofort.
»Ja«, platze ich heraus. »Danke.«
Ich will mich umdrehen und weglaufen, als die Autorität in seiner Stimme mich innehalten lässt. »Warte.«
Meine zu großen Schuhe quietschen auf dem Asphalt, als ich seinem Befehl nachkomme. Normalerweise würde ich das nicht tun. Ich bin nicht gut darin, Anweisungen zu befolgen, weshalb ich mich auch in dieser Lage befinde.
Aber irgendetwas an seinem Ton erregt meine Aufmerksamkeit. Als er in seinen Mantel greift, gehen mir zwei Szenarien durch den Kopf. Das erste ist, dass er eine Waffe zieht und mich erschießt, weil ich respektlos war. Das zweite ist, dass er mich so behandelt wie die meisten anderen und mir etwas Geld zusteckt.
Wieder überkommt mich dieses Gefühl der Minderwertigkeit. Obwohl ich Kleingeld für gewöhnlich annehme, um mir Bier zu kaufen, gehe ich nicht betteln. Bei dem Gedanken, das Geld dieses Fremden anzunehmen, fühle ich mich schmutzig. Nicht mehr unsichtbar, sondern eher wie ein Staubkörnchen auf seinen makellosen schwarzen Lederschuhen.
Ich nehme mir vor, sein Geld abzulehnen, doch er zieht nur ein Taschentuch hervor und legt es in meine Hand. »Du hast da etwas im Gesicht.«
Für den Bruchteil einer Sekunde streicht seine Hand über meinen Handschuh, und obwohl der Moment sehr kurz ist, sehe ich es.
Er trägt einen Ehering.
Ich drücke das Stück Stoff in meiner Hand zusammen und nicke dankend. Keine Ahnung, warum ich von ihm ein Lächeln oder ebenfalls ein Nicken erwartet habe.
Das tut er nicht.
Seine Augen durchbohren die meinen noch eine Weile, dann dreht er sich um und verschwindet.
Einfach so.
Er lässt seinen unglückseligen Nachmittag hinter sich und kehrt zu seiner Frau zurück.
In Anbetracht des extremen Unbehagens, das ich in seiner Nähe gespürt habe, sollte ich erleichtert sein.
Doch das Gegenteil tritt ein. Es fühlt sich an, als würde sich ein Knochen direkt durch den sensiblen Muskel meines Herzens bohren.
Was zum Teufel?
Ich starre auf das Taschentuch, das er mir in die Hand gedrückt hat. Die Buchstaben A.V. sind darauf gestickt, es sieht handgefertigt aus. Hochwertig.
Warum sollte er mir so was geben?
Etwas im Gesicht.
Ich habe verdammt viel Mist im Gesicht. Eine ganze Schicht Dreck, da ich mich schon länger nicht mehr in einer öffentlichen Toilette gewaschen habe. Glaubt er wirklich, ein verdammtes Taschentuch wäre die Lösung dafür?
Wütend auf ihn und meine eigene Reaktion werfe ich das Taschentuch in einen Mülleimer und stürme in die entgegengesetzte Richtung davon.
Heute Nacht brauche ich eine heiße Mahlzeit und ein Bett, und wenn das bedeutet, mich wieder dem Teufel stellen zu müssen, dann soll es so sein.
Bevor ich um die Kurve gehe, die zu dem Obdachlosenasyl führt, bleibe ich stehen. Zu sagen, dass ich mich dem Teufel stellen werde, und es tatsächlich zu tun, sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Immerhin habe ich ihm beim letzten Mal das Gesicht zerkratzt, ihm in die Eier getreten und ihn dann gegen seinen Schreibtisch gestoßen.
Er könnte mich schnappen und dazu zwingen, einen Tag in der Polizeiwache zu verbringen.
Ein leises Knurren entweicht meinem Bauch, und ich zucke zusammen, als er sich schmerzhaft verzieht. Ich kann beinahe spüren, wie er sein Maul öffnet und diesen gottlosen Laut ausstößt, als er nichts findet.
Ich schlinge meine Arme um meine Mitte, als würde das den Schmerz auf magische Weise verschwinden lassen.
Okay, ich versuche einfach, ein bisschen Suppe zu erhaschen, und verschwinde wieder. Viele Obdachlose, die ihre Nächte woanders verbringen, kommen nur für die Mahlzeiten her, also ist der Plan nicht zu abwegig.
Ich ziehe mir die Kapuze über den Kopf und reibe meine Hände in einem halbherzigen Versuch, sie aufzuwärmen, aneinander, während ich um die nächste Ecke biege.
Vor dem Asyl stehen zwei Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Ein paar neue Vans stehen um das heruntergekommene Gebäude verteilt. Überall laufen Reporter und Kameraleute herum, wie Ungeziefer, das den Müll nach einem saftigen Happen durchsucht.
Erzähl mir nicht, dass dieses schleimige Arschloch mir die Polizei und die Medien auf den Hals hetzen will! Ich habe ihn doch nur getreten. Okay, vielleicht habe ich ihm auch das Gesicht zerkratzt und ihn geschlagen, aber das war Notwehr. Er war derjenige, der mich in sein Büro gerufen und an Stellen angefasst hat, wo seine Hände nichts zu suchen hatten.
Vielleicht besitze ich nur wenig – okay, nicht so wichtig –, aber gegen Arschlöcher wie ihn kann ich mich verteidigen.
Doch wenn ich das der Polizei oder den Medien sage, werden sie mir nicht glauben. Warum sollte der ehrenwerte Leiter eines Obdachlosenasyls, der darüber hinaus als Bürgermeister kandidiert, eine so unbedeutende, schmutzige Person wie mich anfassen wollen?
Ich sollte mir wirklich eine andere Unterkunft suchen. Aber werde ich dort noch hereingelassen, falls Richard mich bereits auf die schwarze Liste gesetzt hat?
War es das Kratzen, die Schläge oder die Tritte, die mein Schicksal besiegelt haben? Falls es um Letzteres geht, dann soll es eben so sein. Denn ihm in die Eier getreten zu haben, bereue ich nicht im Geringsten.
Ein Steinchen trifft mich am Kopf, ich zucke zusammen und drehe mich um. Als ich dem Blick der einzigen Person begegne, die ich in diesem Drecksloch meinen Freund nennen kann, huscht mir ein Lächeln über die Lippen.
»Larry!«, rufe ich mit Flüsterstimme.
»Komm her.« Er bedeutet mir, ihm in eine schmale Gasse zu folgen, die nur zur Müllentsorgung genutzt wird.
Ich husche an seine Seite und rümpfe die Nase, als der Gestank des Abfalls mich trifft. Nicht, dass Larry und ich nach Blumen duften würden, unsere Duschmöglichkeiten sind sehr begrenzt.
In den Schatten wirkt Larrys gebräunte Haut noch dunkler. Er ist ein Mann mittleren Alters – etwa Mitte fünfzig, wie er mir verraten hat – und die Falten um seine Augen zeugen von der Zeit, die er schon auf dieser Erde verbracht hat. Seine Züge sind hart, kantig, und seiner Nase ist anzusehen, dass sie schon einmal gebrochen war.
Er trägt einen Secondhandmantel in einem satten Orangeton, den er von einem Wohltätigkeitsverein bekommen hat. Seine Stiefel und Handschuhe sind marineblau. Offensichtlich hat er einen besseren Modegeschmack als ich.
Wir haben uns vor ein paar Wochen in einer U-Bahn-Station kennengelernt, wo er sein Abendessen mit mir geteilt hat. Ich habe ihm die Hälfte meines wertvollen Bieres überlassen, und irgendwie wurden wir Freunde. Was ich an Larrys Gesellschaft am meisten schätze, ist die Tatsache, dass er nicht sehr redselig ist. Wir können beide unseren Tagträumen nachgehen, wenn der andere dabei ist, ohne einander zu nerven oder zu viele Fragen zu stellen. Wir haben eine stumme Kameradschaft gefunden, indem wir die Tür zum Rest der Welt schließen können. Doch er weiß von meinem Alkoholproblem, und er hat mir erzählt, dass er Veteran ist.
Larry ist auch derjenige, der mich in dieses Drecksloch geschleppt hat. Er meinte, dort bekämen wir etwas zu essen und ein warmes Bett. Wir sind zusammen geblieben, damit der eine Wache halten kann, während der andere schläft. Wenn keine Betten frei sind, sitzen wir nebeneinander, ich lege meinen Kopf an seine Schulter und wir schlafen so ein.
»Ich hab dich schon überall gesucht«, keucht er. »Wo warst du?«
»Hier und da.«
»Hast du wieder Bier geklaut?«
»Nein!«
»Winter …« Er kneift sich in den Nasenrücken, als wäre ich ein ungehorsames Kind.
»Okay. Aber nur eins. Ich hatte kein Kleingeld mehr.«
»Wir waren uns einig, niemals zu stehlen.«
»Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen, Larry. Außerdem weißt du, dass ich mein nüchternes Ich nicht mag. Sie hat ernsthafte Probleme.« Vielleicht habe ich mich deshalb den ganzen Nachmittag so durcheinander gefühlt. Obwohl ich nicht viel Alkohol vertrage, brauche sogar ich mehr als ein Bier, um betrunken zu werden.
»Winter …«
»Genug von mir.« Ich deute herablassend in Richtung des Asyls. »Was ist hier passiert?«
Seine Lippen verziehen sich zu einer schmalen Linie, bevor sie sich wieder entspannen. »Das wollte ich dich gerade fragen.«
»Mich?«
»Ja, dich. Was glaubst du, warum die Polizei und der ganze Medienrummel hier sind?«
»Weil Richard sie gerufen hat, um mich fertigzumachen?«
»Nicht direkt.«
»Warum dann?«
»Richard wurde heute Morgen tot in seinem Büro aufgefunden.«
Ich erstarre, als ein seltsames Gefühl Besitz von mir ergreift, sich um meine Kehle legt und mir die Luft abschnürt. Als ich spreche, ist es nicht mehr als ein heiseres Flüstern. »Was?«
»Das Reinigungspersonal hat ihn in einer Lache seines eigenen Blutes gefunden, und die Polizei verdächtigt dich, es getan zu haben.«
»Mich?«
»Ja. Ich weiß nicht, ob Richard mit ihnen gesprochen hat, bevor er starb, oder ob die Angestellten und die anderen bezeugt haben, dass du die letzte Person warst, die ihn lebend gesehen hat.«
Ich balle die Hände an meinen Seiten zu Fäusten. »Ich habe ihn nicht umgebracht, Larry. Das war ich nicht.«
Die Augenbrauen über seinen faltigen Augen zucken, bevor er seufzt. Seine dicke Haut ist mit einigen Flecken übersät, wahrscheinlich, weil er zu viele Jahre in der Sonne verbracht hat. »Ich weiß.«
»Wirklich?«
»Wirklich, Winter. Du bist ein verrücktes kleines Ding, aber du bist keine Mörderin.«
Das bringt mich zum Lächeln. »Wen nennst du hier verrückt, alter Mann?«
»Ich bin kein alter Mann, du kleine Göre.«
»Aber du benimmst dich wie einer, Larry.«
Kurz nimmt er mich in den Schwitzkasten, stößt mich jedoch schnell wieder von sich. Larry hat immer eine gewisse Distanz zwischen uns gewahrt, als hätte er Angst, mich zu berühren, wofür ich sehr dankbar bin. Nicht, weil seine Berührungen unangenehm wären, aber ich mag es generell nicht, angefasst zu werden. Deshalb ziehe ich es vor, unsichtbar zu bleiben.
»Wie auch immer, du musst verschwinden, bevor sie dich finden.«
»Nein. Ich habe nichts Falsches getan, und wenn ich mich verstecke, würde ich ein Verbrechen gestehen, das ich nicht begangen habe.«
»Wie sieht dann dein Plan aus, Lady? Willst du einfach in dieses Polizeiaufgebot platzen? Was willst du denen sagen? ›Ähm, hey, Officers. Ich bin diejenige, von der ihr denkt, dass sie Richard umgebracht hat, aber das habe ich gar nicht getan. Also alles gut, oder?‹«
»Ich werde ihnen einfach erzählen, was passiert ist.«
»Niemand wird dir glauben, Winter. Deine Fingerabdrücke sind überall in seinem Büro, und du warst die Letzte, die ihn lebend gesehen hat, bevor du verschwunden bist. In ihren Augen bist du schuldig. Wenn du da reingehst, werden sie dich für zwanzig Jahre hinter Gitter bringen. Und du wirst keinen guten Anwalt bekommen. Die Pflichtverteidiger vom Staat sind alle scheiße.«
Seine Worte dringen in meinen Verstand vor und ergeben Sinn, dennoch will ich sie so schnell wie möglich verdrängen. Ich will, dass sie unwahr sind. Denn diese Option kann ich nicht akzeptieren.
»Was schlägst du dann vor, Larry? Soll ich weglaufen?«
Er schnipst mit den Fingern. »Ganz genau. Tauch für eine Weile unter und dann finden wir einen Weg, wie wir dich aus der Stadt herausschaffen können.«
Unter den gegebenen Umständen wäre das die logischste Handlung. Wirklich. Aber ich war mit dieser gnadenlosen Stadt schon immer wie mit Superkleber verbunden. Außerdem erinnert mich hier alles an mein Baby Girl, und wenn ich fortgehe, wäre es, als ließe ich einen Teil von mir zurück.
»Aber … Larry …«
Er seufzt und hakt seine Hände in seinem orangefarbenen Mantel unter. »Du willst nicht gehen?«
Ich schüttle den Kopf.
»Aber du könntest verhaftet werden. Du musst gehen.«
»Ich weiß. Kommst du … Kommst du mit mir?«
»Auf jeden Fall, Lady. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin.«
»Das klingt wie ein Zitat aus einer kitschigen Romanze.«
»Ich habe es irgendwo geklaut.« Er linst um die Ecke und seine braunen Augen funkeln konzentriert, bevor er sich wieder mir zuwendet. »Und jetzt geh. Halte dich von öffentlichen Orten und Kameras fern. Ich halte dir den Rücken frei.«
Ich schlinge kurz meine Arme um ihn. »Wie finden wir uns wieder?«
»Ich habe meine Augen und Ohren überall. Ich werde dich finden. Halt dich einfach bedeckt.«
Nachdem ich widerwillig von ihm abgelassen habe, bahne ich mir meinen Weg durch die Gasse.
Ich schaue über die Schulter zurück, um einen letzten Blick auf Larry zu werfen, aber er ist bereits verschwunden.
Wenn wir nicht in einem Obdachlosenasyl sind, verbringen Larry und ich die Nächte für gewöhnlich in der U-Bahn-Station. Die Bänke sind unsere Freunde, und die abgeschirmte Stille ist besser als der Lärm der Stadt draußen.
Also ist das mein erster Anlaufpunkt, bevor ich meinen Fehler erkenne: Auf den Fernsehbildschirmen am Bahnhof sehe ich einen Bericht über Richards Tod.
Zwei Männer mittleren Alters, die ihren blauen Giants-Caps nach zu urteilen Football-Fans sind, bleiben vor mir stehen, um die Nachrichten zu verfolgen. Ich weiche zurück und verschmelze mit der Wand, für den Fall, dass mich hier jemand erkennt.
»Was für eine Sauerei«, sagt einer von ihnen und zündet sich trotz der »Rauchen verboten«-Schilder eine Zigarette an.
»Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht dafür bestimmt war, Bürgermeister zu werden«, erwidert der andere und zuckt mit den Schultern.
»Nicht dafür bestimmt? Mann, wie lange wohnst du jetzt schon in dieser Stadt?«
»Was? Wieso?«
»Richard Green war der Spitzenkandidat für das Amt des Bürgermeisters.« Der Zigarettenkerl beugt sich zu seinem Freund und senkt die Stimme, als würde er CIA-interne Informationen mit ihm teilen. »Es geht das Gerücht um, dass er von der Mafia unterstützt wurde.«
»Von der Mafia?«, keucht der andere Mann.
»Leise, du Idiot. Oder willst du, dass sie uns umlegen?«
Die Art und Weise, wie er die berühmten Gangster-Filme nachahmt, lässt mich schnauben. Dennoch ertappe ich mich dabei, wie ich mich vorsichtig nähere, um ihre Unterhaltung verfolgen zu können. Wenn Richard von der Mafia unterstützt wurde, dann ergeben die gruseligen Männer in den dunklen Anzügen, die gelegentlich vorbeikamen und direkt in seinem Büro verschwanden, plötzlich Sinn.
»Etwa die Italiener?«, fragt der Nicht-Raucher.
Zigarettenkerl bläst eine Rauchwolke aus und ich muss mir eine Hand über Mund und Nase legen, um nicht husten zu müssen. »Nein. Die Bratva.«
»Die Russen?«
»Das habe ich zumindest gehört.«
»Mischen sich die dreckigen Russen wieder in unsere Politik ein?«
»Ja, Mann. Und mit ihrer Mafia sollte man es sich nicht verscherzen. Die töten die Leute wie Fliegen.«
»Das hier ist ein Rechtsstaat.«
Zigarettenkerl bricht in Gelächter aus und wedelt mit der Hand, als müsste er sich Luft zufächeln. »Welches Recht, Mann? Diese Monster machen ihre eigenen Gesetze, ganz egal, wo sie sich aufhalten.«
»Soll das heißen, Richards Tod ist nicht so simpel, wie es die Medien darstellen?«
»Genau so ist es. Das ist nur Ablenkung.« Zigarettenkerl deutet auf die Zeile am unteren Bildschirmrand, auf der steht: »Richard Green, Spitzenkandidat für das New Yorker Bürgermeisteramt, wurde von einer der obdachlosen Personen aus dem Asyl, das er geleitet hat, getötet.«
Ich linse mit verengten Augen auf den Bildschirm und runzle die Stirn. Mein Bild sollte überall in den Nachrichten zu sehen sein, mit der Überschrift: »Gesucht«. Wieso haben sie meinen Namen nicht erwähnt? Hat die Polizei den Medien noch keine konkreten Informationen gegeben?
Aber das ergibt keinen Sinn. Meine Fingerabdrücke sind überall in Richards Büro, und ich bin zweifelsohne die Hauptverdächtige. Wie kann es sein, dass ich nur eine obdachlose Person aus seinem Asyl bin? Sogar das Geschlecht wurde neutral gehalten.
»Die Russen sind gruselig, Alter«, sagt Zigarettenkerl.
»Also schlimmer als die Italiener?«
»Im Moment? Tausendmal schlimmer. Ihre Macht und ihr Einfluss gehen tiefer als bei jeder anderen kriminellen Organisation.« Er wirft seine Zigarette auf den Betonboden, ohne sie auszutreten, und scheucht seinen Freund los, um die nächste Bahn zu erwischen.
Ich gehe dorthin, wo sie gerade noch standen, und ersticke die Zigarette mit der Schuhsohle. Das Thema im Fernsehen wechselt zu den internationalen Nachrichten und ich starre den verbrannten Stummel an. Wie das Feuer eine schwarze Spur auf dem hellen Boden hinterlassen hat. Auch wenn es fort ist, bleiben die Spuren erhalten.
Genau wie in meinem Leben.
Ich berühre meinen unteren Bauch, wo sich unter den zahlreichen Kleidungsschichten die Narbe befindet. Sie brennt immer noch, als stünden meine Fingerspitzen in Flammen, als würden sie sich durch die Kleidung brennen und meine Haut versengen.
Ein weiterer Hungerprotest dringt aus meinem Magen, woraufhin ich seufzend den Bahnhof verlasse. Ich muss mir einen weniger belebten Ort suchen, denn auch, wenn sie meine Identität noch nicht preisgegeben haben, werden sie es irgendwann tun.
Die Unterhaltung der Giants-Fans hallt in meinem Kopf wider, als ich von einer Gasse in die nächste husche, meine Schritte sind leichtfüßig und schnell.
Als Zigarettenkerl die Russen erwähnte, musste ich zwangsläufig an den Fremden von vorhin denken. Sein Akzent klang sehr russisch, aber nicht so harsch, wie ich ihn sonst kenne. Es klang geschmeidig, mühelos, beinahe so, wie ich mir russische Adelige vorstelle, falls sie jemals Englisch lernen würden.
Könnte er zu der Mafia gehören, die Zigarettenkerl erwähnt hat?
Ich schüttle innerlich den Kopf. Warum denke ich, er könnte zur Mafia gehören, nur weil er einen russischen Akzent hat? Er könnte ein russischer Geschäftsmann sein, so wie Tausende andere, die immer in New York herumschwirren.
Oder ein Spion.
Bei diesem Gedanken erschüttert ein Schauder mein Inneres. Ich muss meine wilde Vorstellungskraft wirklich zügeln. Außerdem: In welcher Welt ist ein Spion so attraktiv? Abgesehen von James Bond, aber der ist nicht echt. Der russische Fremde hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und das Seltsamste daran ist, dass er sich dessen völlig unbewusst zu sein schien. Oder vielleicht störte es ihn, als wollte er nicht im Mittelpunkt stehen, wurde aber in diese Position gezwungen.
Ich greife in meine Tasche und ziehe das Taschentuch heraus, das er mir gegeben hat. Okay, ich habe es weggeworfen, aber es dann wieder aus dem Mülleimer herausgeholt. Keine Ahnung, wieso. Vermutlich fühlte es sich wie Verschwendung an.
Ich fahre mit den behandschuhten Fingern über die Initialen und frage mich, ob seine Frau das für ihn gemacht hat und ihn fragen wird, was damit passiert ist. Obwohl eher er der Typ zu sein schien, der die Fragen stellt, nicht umgekehrt.
Ich schiebe das Tuch zurück in meine Tasche, verdränge den Fremden aus meinen Gedanken und biege um ein paar weitere Ecken, bis ich eine Tiefgarage erreiche, in der Larry und ich uns regelmäßig aufhalten.
Der Wachmann am Eingang schnarcht und murmelt etwas darüber, was für Idioten manche Baseball-Spieler sind. Es ist nicht schwer, sich an ihm vorbeizuschleichen. Jetzt muss ich nur noch früh genug am nächsten Morgen verschwinden, bevor er aufwacht.
Die Tiefgarage ist nicht groß oder schick, es passen nur etwa hundert Autos hinein und die Hälfte der Plätze ist noch frei. Nur ein Drittel der Neonbeleuchtung funktioniert, aber selbst wenn sie mich alle blenden würden, würde es keinen Unterschied machen. Ich habe schon an schlimmeren Orten mit stärkerem Licht und mehr Lärm geschlafen.
Der Trick für die eigene Sicherheit ist, mit einem offenen Auge zu schlafen. Nicht wortwörtlich. Aber es hilft, einen leichten Schlaf zu haben, damit man auch bei dem kleinsten Laut aufwacht.
Als ich mich auf den Betonboden zwischen zwei Autos setze und meine Augen schließe, bin ich mir des Summens der teilweise defekten Lampen und des Rauschens der Wagen, die oben auf der Straße vorbeifahren, bewusst. Ich kann sogar das Murmeln des Wachmanns hören, auch wenn ich die Worte nicht verstehe.
Wenn es aufhört, weiß ich, dass er aufgewacht ist, und ich wachsam sein muss. Er könnte mir die Polizei auf den Hals hetzen, und das ist das Letzte, was ich in meiner aktuellen Situation – oder eigentlich in jeder Situation – gebrauchen kann.
Ich versuche, es mir so gemütlich wie möglich zu machen, obwohl die Kälte aus dem Boden und der Wand hinter mir sich bis in meine Knochen frisst.
Ich versuche, nicht auf meinen knurrenden Magen oder das pochende Verlangen nach Alkohol zu hören.
Stattdessen versuche ich, mir zu überlegen, wo ich hingehen sollte, wenn offiziell nach mir gefahndet wird.
Schon bald zeigt sich meine Erschöpfung und zieht mich in einen traumlosen Schlaf.
Ich träume nicht. Niemals. Als wäre mein Verstand seit dem Unfall zu einer leeren Leinwand geworden.
Das Murmeln hört auf und der Wachmann sagt etwas. Meine Augen zucken auf und ich starre in die kleine Öffnung an der gegenüberliegenden Wand, die ihm als Fenster dient. Es ist immer noch Nacht, und dem fehlenden Rauschen der Autos nach zu urteilen, ist es spät genug, dass kein Fahrzeug mehr herkommen sollte.
Dennoch fährt gerade ein schwarzer Wagen langsam in die Tiefgarage. Er ist so leise, dass ich ihn gar nicht wahrgenommen hätte, wenn ich mich nicht so auf die Geräusche in meiner Umgebung konzentriert hätte.
Ich ziehe die Knie an meine Brust und schlinge meine Arme um sie, dann schiebe ich die Kapuze meines Mantels weiter über den Kopf, um mein Gesicht ganz zu bedecken. Nur noch ein Auge linst durch einen kleinen Schlitz.
Solange der Wagen nicht auf dem Parkplatz mir gegenüber parkt, sollte ich keine Probleme bekommen. Und es ist wahrscheinlicher, dass er einen der Plätze nahe am Eingang wählt.
Der Lärm kommt näher und ich erhasche einen Blick auf das schwarze Auto. Ich drücke mich in die enge Spalte zwischen einem Hyundai und der Wand und danke allem, was heilig ist, für meine kleine Gestalt. Sie hilft mir bei meinem Vorhaben, unsichtbar zu bleiben.
Aber indem ich das tue, verliere ich die Sicht auf das Auto. Für ein paar lange Sekunden höre ich nichts mehr. Weder das Öffnen einer Tür noch das Piepen des Schlosses.
Ich hocke mich hin, schaue unter dem Wagen hindurch und sehe ein Paar dunkler Männerfüße direkt vor dem Hyundai stehen. Um nicht aus Versehen einen Laut auszustoßen, lege ich mir eine Hand über den Mund.
Der faule Gestank von etwas, in das ich irgendwann reingepackt habe, löst Übelkeit in mir aus und ich muss ein Würgen unterdrücken.
Ich atme durch den Mund, während ich weiter diese Füße im Auge behalte. Die braunen Schuhe bewegen sich nicht, als würde er auf etwas warten.
Verschwinde! Na los!
Dieses Mantra wiederhole ich in Gedanken immer und immer wieder, als könnte es irgendwas bewirken.
Mom hat oft gesagt, wenn man nur stark genug an etwas glaubt, dann wird es wahr werden.
Und als würde die Magie wirken, verschwinden die braunen Schuhe. Erleichtert atme ich auf, doch dann reißt plötzlich eine starke Hand an meiner Kapuze.
Die Kraft ist so stark, dass ich für einen Moment in der Luft hänge, ehe ich einen bulligen Mann mit gruseligem Gesicht und starkem russischem Akzent sagen höre: »Hab sie, Boss.«
Hab sie, Boss.
Ich halte nicht inne, um darüber nachzudenken, was diese Worte bedeuten könnten. Meine erste und wichtigste Aufgabe im Leben ist das Überleben. Ich lebe nicht für mich selbst. Ich lebe für mein Baby Girl. Für das Leben, das sie nicht haben konnte.
Der Mann, der mich gefangen hat, ist bullig und massiv wie ein Berg. Seine Miene ist ernst, hart, als wäre er schon mit diesem bösen Blick geboren worden. Seine Haare sind kurz, weißblond, und das Licht in seinen Augen ist gnadenlos und kühl wie Eis.
Sobald er mich auf dem Boden absetzt, winde ich mich, um mich aus dem Griff um meine Kapuze zu befreien. Ich drehe mich und zapple, greife nach seiner Hand und versuche, sie wegzureißen, aber ich könnte genauso gut eine Maus sein, die es mit einer Katze aufnehmen muss.
Er scheint vollkommen desinteressiert zu sein, als er mich mit sich zerrt, meine Bemühungen halten ihn kein bisschen auf.