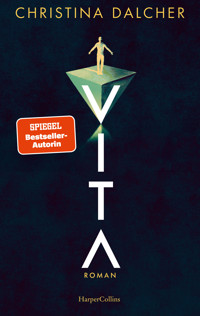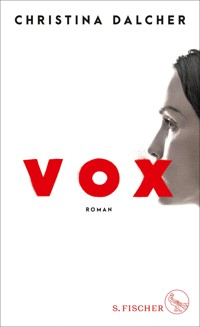
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Welt, in der Frauen nur hundert Wörter am Tag sprechen dürfen, bricht eine das Gesetz. Das provozierende Überraschungsdebüt aus den USA, über das niemand schweigen wird! Als die neue Regierung anordnet, dass Frauen ab sofort nicht mehr als hundert Worte am Tag sprechen dürfen, will Jean McClellan diese wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben – das kann nicht passieren. Nicht im 21. Jahrhundert. Nicht in Amerika. Nicht ihr. Das ist der Anfang. Schon bald kann Jean ihren Beruf als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben. Schon bald wird ihrer Tochter Sonia in der Schule nicht länger Lesen und Schreiben beigebracht. Sie und alle Mädchen und Frauen werden ihres Stimmrechts, ihres Lebensmuts, ihrer Träume beraubt. Aber das ist nicht das Ende. Für Sonia und alle entmündigten Frauen will Jean sich ihre Stimme zurückerkämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christina Dalcher
Vox
Roman
Über dieses Buch
Ihr könnt uns die Worte nehmen, aber zum Schweigen bringen könnt ihr uns nicht!
Als die neue Regierung anordnet, dass Frauen ab sofort nicht mehr als hundert Worte am Tag sprechen dürfen, will Jean McClellan diese wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben – das kann nicht passieren. Nicht im 21. Jahrhundert. Nicht in Amerika. Nicht ihr.
Das ist der Anfang.
Schon bald kann Jean ihren Beruf als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben. Schon bald wird ihrer Tochter Sonia in der Schule nicht länger Lesen und Schreiben beigebracht. Sie und alle Mädchen und Frauen werden ihres Stimmrechts, ihres Lebensmutes, ihrer Träume beraubt.
Aber es ist nicht das Ende.
Für Sonia und alle entmündigten Frauen will Jean sich ihre Stimme zurückerkämpfen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Christina Dalcher promovierte in Theoretischer Linguistik an der Georgetown University. Die gebürtige Amerikanerin beschäftigte sich mit Sprache und Sprachwandel und untersuchte den Lautwandel in italienischen und britischen Dialekten. Ihre Kurzgeschichten und Flash Fiction erschienen weltweit in Magazinen und Zeitschriften, u.a. wurde sie für den Pushcart Prize nominiert. Sie lebt in den Südstaaten der USA und in Neapel, Italien. »Vox« ist ihr Debütroman.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
Danksagung
Im Gedenken an Charlie Jones
Linguist, Professor, Freund
1
Wenn mir jemand erzählt hätte, ich könnte den Präsidenten, die Bewegung der Reinen und diesen unfähigen kleinen Scheißkerl Morgan LeBron innerhalb einer Woche zu Fall bringen, hätte ich ihm nicht geglaubt. Aber ich hätte auch keinen Einwand erhoben. Ich hätte überhaupt nichts gesagt.
Ich bin eine Frau weniger Worte geworden.
Heute Abend beim Essen, bevor ich meine letzten Silben des Tages äußere, tippt Patrick auf das silbrige Gerät an meinem linken Handgelenk, als wolle er meinen Schmerz teilen oder mich vielleicht daran erinnern, stumm zu bleiben, bis das Zählwerk um Mitternacht zurückgesetzt wird. Dieses magische Ereignis wird geschehen, während ich schlafe, und ich werde den Dienstag mit einem leeren Display beginnen. Das Zählwerk meiner Tochter Sonia wird dasselbe tun.
Meine Söhne tragen keine Wortzähler.
Während des Abendessens quatschen sie wie üblich über die Schule.
Sonia geht auch zur Schule, verschwendet jedoch keine Wörter für ihren Tagesbericht. Beim Essen des einfachen Eintopfs, den ich aus dem Gedächtnis zusammengeschustert habe, fragt Patrick sie nach ihren Fortschritten in Hauswirtschaftslehre, Körperlicher Fitness und einem neuen Unterrichtsfach namens Einfache Haushaltsbuchführung ab. Gehorcht sie ihren Lehrern? Wird sie in diesem Halbjahr gute Noten bekommen? Er weiß genau, welche Art von Fragen er stellen muss: geschlossene Fragen, die man nur mit Nicken oder Kopfschütteln beantworten kann.
Ich höre stumm zu. Meine Fingernägel drücken Halbmonde in meine Handflächen. Sonia nickt, wenn es angebracht ist, und verzieht die Nase, wenn meine elfjährigen Zwillinge Sam und Leo, denen die Wichtigkeit von Ja-/Nein-Fragen und finalen Antwortmustern nicht klar ist, ihre Schwester bitten, ihnen zu erzählen, wie die Lehrer sind, wie es im Unterricht ist, welche Fächer sie am liebsten mag. So viele offene Fragen. Ich will nicht glauben, dass sie es begreifen, sie schikanieren wollen, um ihr Wörter zu entlocken. Doch mit elf Jahren sind sie alt genug, Bescheid zu wissen. Und sie haben erlebt, was passiert, wenn wir zu viele Wörter verwenden.
Sonias Lippen beben, während sie von einem Bruder zum anderen schaut, ihre rosa Zunge, ein Körperteil mit eigenem Willen, zittert am Rand der Zähne. Steven, mit siebzehn mein Ältester, legt ihr den Zeigefinger auf den Mund.
Ich könnte ihnen erzählen, was sie wissen wollen: Vor den Klassen stehen nur noch männliche Lehrkräfte. Frontalunterricht. Lehrer reden. Schüler hören zu. Das würde mich vierzehn Wörter kosten.
Ich habe noch fünf übrig.
»Wie steht es um ihren Wortschatz?«, fragt Patrick und wendet mir sein Kinn zu. Er formuliert die Frage um. »Lernt sie?«
Ich zucke mit den Schultern. Mit sechs müsste Sonia über eine Armee von zehntausend Lexemen verfügen, individuellen Soldaten, die sich versammeln, strammstehen und den Befehlen ihres kleinen, noch formbaren Gehirns gehorchen. Müsste, wenn Lesen, Schreiben und Rechnen nicht auf ein einziges Fach reduziert worden wären: simple Arithmetik. Schließlich wird von meiner Tochter erwartet, eines Tages einzukaufen und einen Haushalt zu führen, eine ergebene und pflichtbewusste Ehefrau zu sein. Dafür braucht man Mathematik, keine Rechtschreibung. Keine Literatur, keine Stimme.
»Du bist die kognitive Linguistin«, sagt Patrick, sammelt die leeren Teller ein und bedeutet Steven, dasselbe zu tun.
»War.«
»Bist.«
Obwohl ich es nach einem Jahr Erfahrung besser wissen sollte, platzen die zusätzlichen Wörter aus mir heraus: »Nein. Ich. War.«
Patrick sieht zu, wie das Zählwerk drei Einheiten weiterklickt. Ich spüre jeden einzelnen Klick am Puls wie einen unheilvollen Trommelschlag. »Das reicht, Jean.«
Die Jungs wechseln besorgte Blicke, weil sie genau wissen, was passiert, wenn das Zählwerk eine bestimmte Einheit übersteigt. Eins, null, null. Daher spreche ich jetzt mein letztes Wort für den Montag. An meine Tochter gewandt. Das geflüsterte »Gutnacht« ist kaum heraus, als mich Patricks flehender Blick erreicht.
Ich hebe sie hoch und trage sie ins Bett. Sie ist schwerer geworden, fast zu groß, um noch getragen zu werden, und ich brauche beide Arme.
Sonia lächelt, als ich sie zudecke. Wie immer gibt es keine Gutenachtgeschichte, keine Dora, keinen Pu und Ferkel, keinen Peter Hase und sein Missgeschick im Gemüsegarten von Mr McGregor. Beängstigend, was sie bereits als normal hinnimmt.
Ich summe sie mit einem Lied über Spottdrosseln und Ziegenböcke in den Schlaf, der Text nur wortlose Bilder in meinem Kopf.
Patrick sieht mir von der Tür aus zu. Seine Schultern, einst breit und stark, hängen in einem abwärts gerichteten V herab; seine Stirn ist voller Falten. Alles an ihm scheint nach unten zu deuten.
2
In meinem Schlafzimmer hülle ich mich, wie jeden Abend, in eine Decke aus unsichtbaren Wörtern, gebe vor zu lesen, erlaube meinen Augen, über imaginäre Seiten von Shakespeare zu tanzen. Wenn ich übermütig bin, entscheide ich mich vielleicht für Dante im Original. Dantes Sprache hat sich über die Jahrhunderte nur wenig verändert, doch heute Abend rackere ich mich durch einen vergessenen Wortschatz. Ich überlege, wie es den Italienerinnen wohl ergehen wird, sollten unsere heimischen Bestrebungen jemals auf das Ausland übergreifen.
Vielleicht werden sie mehr mit den Händen reden.
Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich unsere Krankheit ins Ausland ausbreitet, ist gering. Bevor das Fernsehen unter Staatshoheit fiel, bevor sich die Wortzähler um unsere Handgelenke schlossen, verfolgte ich Nachrichtensendungen. Al Jazeera, BBC, die drei italienischen Sender von RAI und andere brachten gelegentlich Talkshows. Patrick, Steven und ich schauten sie uns immer an, wenn die Kleinen im Bett waren.
»Müssen wir das sehen?«, stöhnte Steven. Er lümmelte auf seinem gewohnten Sessel herum, eine Hand in einer Schüssel Popcorn, die andere beim Texten auf dem Handy.
Ich stellte den Ton lauter. »Nein. Müssen wir nicht. Aber wir können.« Wer wusste, wie lange das noch so blieb? Patrick sprach bereits von Kabel-Privilegien und davon, dass diese an einem seidenen Faden hingen. »Nicht alle kapieren das, Steven.« Den Zusatz Genieße es, solange du noch kannst ließ ich unausgesprochen.
Nur war da wenig zu genießen.
In jeder Sendung passierte dasselbe. Alle lachten über uns. Al Jazeera bezeichnete uns als »Die Neuen Extremisten«. Darüber hätte ich fast lächeln können, wenn ich nicht die Wahrheit darin erkannt hätte. Die britischen Politikexperten schüttelten den Kopf, als wollten sie sagen: Oh, diese blöden Yankees. Was treiben sie denn jetzt schon wieder? Die italienischen Fachleute, moderiert von knapp bekleideten und übermäßig geschminkten Sexbomben, brüllten und fuchtelten und lachten.
Sie lachten uns aus. Sie meinten, wir sollten uns entspannen, bevor wir es dazu kommen ließen, Kopftücher und bodenlange, formlose Röcke tragen zu müssen. Einer der italienischen Sender zeigte eine unzüchtige Parodie, bei der zwei als Puritaner verkleidete Männer Analverkehr betrieben. Sahen sie Amerika wirklich so?
Ich weiß es nicht. Seit Sonias Geburt war ich nicht mehr in Italien, und jetzt besteht keine Möglichkeit mehr dazu.
Noch vor unseren Wörtern wurden uns die Pässe genommen.
Ich sollte mich deutlicher ausdrücken: Einige unserer Pässe wurden eingezogen.
Das fand ich auf banalste Weise heraus. Im Dezember bemerkte ich, dass die Pässe von Steven und den Zwillingen abgelaufen waren, und wollte aus dem Internet drei Verlängerungsanträge herunterladen. Für Sonia, die bisher nur eine Geburtsurkunde und den Impfpass hatte, benötigte ich ein anderes Formular.
Die Verlängerung für die Jungs war einfach, genau wie es stets bei Patricks und meinem Pass gewesen war. Doch als ich auf den Link für den Antrag eines neuen Passes klickte, kam ich auf eine Seite, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, mit einem einzeiligen Fragebogen:
Ist der Antragsteller männlich oder weiblich?
Ich blickte zu Sonia, die auf dem Boden meines improvisierten Heimbüros mit farbigen Bauklötzchen spielte, und klickte den Kasten für weiblich an.
»Rot!«, schrie sie und schaute zum Bildschirm.
»Ja, Schätzchen«, erwiderte ich. »Rot. Sehr gut. Wie noch?«
»Scharlachrot!«
»Noch besser.«
Ohne Aufforderung fuhr sie fort. »Feuerrot! Kirschrot!«
»Du hast es kapiert, Schatz. Weiter so.« Ich tätschelte ihren Kopf und warf noch mehr Bauklötze auf den Teppich. »Probier’s jetzt mal mit den blauen.«
Als ich mich wieder dem Computer zuwandte, begriff ich, dass Sonias Aufmerksamkeit nicht ihren Bauklötzen gegolten hatte. Der Bildschirm war rot. Rot wie verdammtes Blut.
Bitte wenden Sie sich an die unten angegebene Telefonnummer. Oder senden Sie eine E-Mail an antraege.state.gov. Vielen Dank!
Ich rief mehrfach bei der angegebenen Nummer an, bevor ich eine E-Mail schickte, und wartete dann mehrere Tage auf eine Antwort. Zumindest so etwas wie eine Antwort. Anderthalb Wochen später landete eine Nachricht in meinem Posteingang mit der Aufforderung, mein zuständiges Passamt aufzusuchen.
»Kann ich Ihnen helfen, Ma’am?«, fragte der Beamte, als ich ihm Sonias Geburtsurkunde zeigte.
»Das können Sie, falls Sie für Passanträge zuständig sind.« Ich schob die Papiere durch den Schlitz in der Plexiglasscheibe.
Der Beamte, der nicht älter als neunzehn sein konnte, griff danach und bat mich zu warten. »Oh«, sagte er und hastete an die Scheibe zurück, »ich brauche auch kurz Ihren Pass. Nur um eine Kopie zu machen.«
Sonias Pass würde ein paar Wochen dauern, wurde mir mitgeteilt. Wobei mir allerdings nicht mitgeteilt wurde, dass mein Pass gerade seine Gültigkeit verloren hatte.
Das fand ich erst sehr viel später heraus. Und Sonia bekam ihren Pass nie.
Am Anfang gelang es einigen Menschen, das Land zu verlassen. Manche überquerten die Grenze nach Kanada; andere bestiegen Boote nach Kuba, Mexiko oder zu den Inseln. Die Behörden brauchten nicht lange, um Grenzposten zu errichten, und die Mauer, die Südkalifornien, Arizona, New Mexico und Texas von Mexiko trennte, war bereits gebaut worden, daher hörten die Ausreisen bald auf.
»Wir können nicht zulassen, dass unsere Bürger, unsere Familien, unsere Mütter und Väter fliehen«, erklärte der Präsident in einer seiner frühen Reden.
Ich glaube immer noch, dass wir es geschafft hätten, wenn es nur um Patrick und mich gegangen wäre. Aber mit vier Kindern, von denen eines noch nicht genug verstand, um nicht auf dem Sitz herumzuhüpfen und den Grenzposten »Kanada!« ins Ohr zu zwitschern – ausgeschlossen.
Daher bin ich heute nicht gerade übermütig, nachdem ich daran gedacht habe, wie leicht es ihnen fiel, uns im eigenen Land gefangen zu halten, und nachdem Patrick mich in die Arme nahm und mir riet, nicht darüber nachzudenken, was mal war.
Was mal war.
Das war mal: Wir unterhielten uns bis spät in die Nacht. Wir lagen am Wochenende lange im Bett, verschoben die häuslichen Pflichten und lasen die Sonntagszeitung. Wir gaben Cocktail- und Dinnerpartys und veranstalteten Grillfeste, wenn das Wetter es zuließ. Wir spielten gerne Kartenspiele – zuerst Spades und Bridge; später, als die Jungs alt genug waren, eine Sechs von einer Fünf zu unterscheiden, Krieg und Quartett.
Was mich betraf, ich hatte Freundinnen. Patrick nannte meine Abende mit ihnen immer »Weiberabend«, ich wusste, er meinte es nicht abfällig. So drückten sich Männer halt aus. Wenigstens redete ich mir das ein.
Es gab Literaturkreise, wir redeten über Politik in Cafés oder Weinlokalen, später in Kellern – unsere amerikanische Version von Lolita lesen in Teheran. Patrick schienen meine wöchentlichen Ausflüge nichts auszumachen, obwohl er sich manchmal über uns lustig machte, bevor es nichts mehr gab, über das man sich lustig machen konnte. Wir waren, wie er es nannte, die Stimmen, die man nicht zum Schweigen bringen konnte.
Tja. Das nur zu Patricks Unfehlbarkeit.
3
Als es begann, noch bevor wir anderen erkannten, was die Zukunft für uns bereithielt, gab es insbesondere eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nahm. Ihr Name war Jackie Juarez.
Ich will nicht an Jackie denken, doch plötzlich werde ich anderthalb Jahre zurückversetzt, kurz nach der Amtseinführung. Ich sitze mit den Jungs nach dem Abendessen im Wohnzimmer und ermahne sie, leiser zu sein, damit Sonia nicht aufwacht.
»Die Frau im Fernsehen ist hysterisch«, behauptet Steven, als er mit drei Portionen Eis zurückkommt.
Hysterisch. Ich kann dieses Wort nicht leiden. »Wie bitte?«
»Frauen sind gaga«, fährt er fort. »Das ist doch nichts Neues, Mom. Du weißt ja, was man über hysterische Frauen und ausflippende Mütter sagt.«
»Wie bitte?«, wiederhole ich. »Wo hast du das denn her?«
»Hab ich heute in der Schule gelernt. Stammt von irgendeinem Typ namens Cooke oder so.« Steven verteilt den Nachtisch. »Mist, eine Portion ist kleiner. Mom, willst du die kleinere oder die größere?«
»Die kleinere.« Seit der letzten Schwangerschaft kämpfe ich mit meinem Gewicht.
Er verdreht die Augen.
»Ja doch. Warte nur, bis dein Stoffwechsel die Vierzig erreicht. Und seit wann liest du Crooke? Hätte nicht gedacht, dass sein Werk über die Anatomie des Menschen es mal zur Schullektüre bringt.« Ich nehme den ersten Löffel von meiner winzigen Eisportion. »Selbst in englischer Literatur.«
»Nee, in Religion, Mom«, erwidert Steven. »Und ob Cooke oder Crooke, wo liegt da der Unterschied?«
»Im r, mein Lieber.« Ich wende mich wieder der zornigen Frau im Fernsehen zu.
Sie ist schon früher aufgetreten, hat über Lohnungleichheit und »Gläserne Decken« geschimpft, verbunden mit Schleichwerbung für ihr neuestes Buch. Das allerneueste trägt den erbaulichen Weltuntergangstitel Sie werden uns zum Schweigen bringen, Untertitel Was Sie über das Patriarchat und Ihre Stimme wissen müssen. Auf dem Umschlag eine Reihe knallbunter Puppen, denen per Fotoshop Ballknebel in den Mund gestopft worden sind.
»Gruselig«, sage ich zu Patrick.
»Ziemlich übertrieben, findest du nicht?« Er blickt ein bisschen zu sehnsüchtig auf mein schmelzendes Eis. »Isst du das noch?«
Ich reiche ihm die Schale, ohne mich vom Fernseher abzuwenden. Irgendwas an den Ballknebeln beunruhigt mich – mehr als mich eine Puppe mit einem roten Ballknebel vor dem Gesicht beunruhigen sollte. Liegt an den Bändern, denke ich. Das schwarze X mit dem blutroten Mittelpunkt wirkt wie ein halbherziger Schleier. Er löscht alles bis auf die Augen aus. Vielleicht ist das der Zweck.
Jackie Juarez ist die Autorin dieses und sechs anderer Bücher, alle mit ähnlich haarsträubenden Titeln wie Klappe halten und setzen, Barfuß und schwanger: Wie die religiöse Rechte uns haben will, sowie Patricks und Stevens Lieblingstitel Der wandelnde Uterus. Die dafür verwendete Graphik war grausig.
Jetzt schreit sie den Interviewer an, der vermutlich nicht »Feminazi« hätte sagen sollen. »Wissen Sie, was übrig bleibt, wenn man die Feministin aus Feminazi nimmt?« Jackie wartet nicht auf die Antwort. »Nazi. Das bleibt übrig. Gefällt Ihnen das besser?«
Der Interviewer ist perplex.
Jackie ignoriert ihn und bohrt den wirren Blick ihrer geschminkten Augen in die Kamera, und es kommt mir vor, als schaute sie mich direkt an. »Ihr alle habt ja keine Ahnung. Keine gottverdammte Ahnung. Wir befinden uns auf einer Rutschbahn in die Steinzeit, Mädels. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach, wo ihr sein werdet – wo eure Töchter sein werden –, wenn die Gerichte die Uhr zurückdrehen. Denkt an Ausdrücke wie ›Zustimmung des Ehegatten‹ und ›Väterliche Einwilligung‹. Denkt darüber nach, eines Morgens aufzuwachen und zu entdecken, dass ihr kein Mitspracherecht mehr habt.« Sie macht nach jedem dieser letzten Wörter eine Pause und beißt die Zähne zusammen.
Patrick gibt mir einen Gutenachtkuss. »Muss morgen in aller Herrgottsfrühe raus, Schatz. Frühstückstermin mit dem Oberboss, du weißt schon, wo. Schlaf gut.«
»Du auch, Schatz.«
»Die sollte sich mal abregen.« Steven hat den Blick immer noch auf den Bildschirm gerichtet. Inzwischen hat er eine Tüte Tortilla-Chips auf dem Schoß und mampft sie geräuschvoll, fünf auf einmal, eine Erinnerung daran, dass die Pubertät nicht nur schlecht ist.
»Eis und Chips, Großer?«, frage ich. »Du machst dir deine Haut kaputt.«
»Nachtisch der Champions, Mom. Hey, können wir nicht was anderes sehen? Die Tussi ist das reinste Brechmittel.«
»Klar.« Ich gebe ihm die Fernbedienung. Jackie Juarez verstummt, nur um durch eine Wiederholung der Reality-Sendung Duck Dynasty ersetzt zu werden.
»Muss das wirklich sein, Steven?«, stöhne ich, während ein bärtiger Hinterwäldler in Tarnkleidung nach dem anderen Philosophisches über Politik von sich gibt.
»Ja. Die sind eine megageile Truppe.«
»Die sind geisteskrank. Und sprich nicht so.«
»War doch nur ein Witz, Mom. Himmel, solche Leute gibt’s in echt gar nicht.«
»Warst du je in Louisiana?« Ich nehme ihm die Chipstüte weg. »Dein Dad hat mein ganzes Eis gegessen.«
»Mardi Gras, vor zwei Jahren. Mom, ich mach mir langsam Sorgen um dein Gedächtnis.«
»New Orleans ist nicht Louisiana.«
Oder vielleicht doch, denke ich. Wenn man es genau betrachtet, was ist dann der Unterschied zwischen ein paar hirnlosen Hinterwäldlern, die Männern raten, Mädchen im Teenageralter zu heiraten, und einem Haufen kostümierter Betrunkener, die jeder Frau Perlenschnüre zuwerfen, wenn sie ihre Brüste auf der St. Charles Avenue zeigt?
Vermutlich kein großer.
Und hier haben wir das Land in fünfminütigen Clips: Jackie Juarez, die in Hosenanzug und mit Bobbi-Brown-Make-up Furcht und Schrecken verbreitet, und die Hass predigenden Hinterwäldler. Oder vielleicht ist es andersherum. Wenigstens starren mich die Hinterwäldler nicht vom Bildschirm an und machen mir Vorwürfe.
Steven, jetzt bei seiner zweiten Cola und der zweiten Schale Eis – genauer gesagt, hat er die Schale weggelassen und löffelt das letzte Eis direkt aus der Verpackung –, verkündet, er wolle ins Bett. »Schreiben morgen eine Arbeit im College-Kurs Religionswissenschaften.«
Seit wann bieten sie im zweiten Jahr der Highschool schon College-Kurse an? Und warum hat er dann nicht etwas Sinnvolles gewählt, wie Biologie oder Geschichte? Ich frage ihn nach beidem.
»Der Kurs in Religion ist neu. Er wird allen angeboten, selbst den unteren Klassen. Ich glaube, sie wollen ihn im nächsten Jahr in den regulären Lehrplan aufnehmen. Was soll’s«, ruft er aus der Küche. »Das heißt, dieses Jahr keine Zeit für Bio oder Geschichte.«
»Und worum geht es? Vergleichende Theologie?« Schätze, damit könnte ich leben – selbst in einer öffentlichen Schule.
Er kommt mit einem Brownie zurück ins Wohnzimmer. Sein Schlummerkuchen. »Nee. Eher so was wie, keine Ahnung, Philosophie des Christentums. Egal, Mom. Schlaf gut. Hab dich lieb.« Er gibt mir einen Kuss auf die Wange und verschwindet im Flur.
Ich schalte Jackie Juarez wieder ein.
In persona ist sie viel hübscher, und es ist unmöglich, zu erkennen, ob sie seit der Uni zugenommen oder die Kamera ihr die sprichwörtlichen sieben Kilo draufgepackt hat. Mit dem professionellen Make-up und der gestylten Frisur wirkt Jackie müde, als hätten sich zwanzig Jahre Wut in ihr Gesicht gegraben, eine Falte nach der anderen.
Ich genehmige mir noch einen weiteren Chip und lecke mir die salzigen Chemikalien von den Fingern, bevor ich die Tüte zusammenrolle und außer Reichweite schiebe.
Jackie starrt mich mit diesen kalten, unveränderten Augen vorwurfsvoll an.
Ich brauche ihre Vorwürfe nicht. Ich brauchte sie vor zwanzig Jahren nicht und brauche sie auch jetzt nicht, doch ich erinnere mich an den Tag, an dem sie begannen. Der Tag, an dem meine Freundschaft mit Jackie den Bach runterging.
»Du kommst doch mit zur Demo, ja, Jean?« Jackie stand, ohne BH und ungeschminkt, an der Tür zu meinem Zimmer, in dem ich zwischen dem halben Bibliotheksbestand neurolinguistischer Fachliteratur lag.
»Kann nicht. Hab zu tun.«
»Verdammt nochmal, Jean, das hier ist viel wichtiger als irgendwelche blöden Studien über Aphasie. Wie wär’s, wenn du dich auf die Menschen konzentrierst, die noch da sind?«
Ich sah sie an, den Kopf zu einer stummen Frage nach rechts geneigt.
»Okay, okay.« Sie warf die Hände hoch. »Sie sind immer noch da. Tut mir leid. Ich will damit bloß sagen, dass das, was da bei diesem Obersten-Bundesgerichtsding vorgeht, na ja, jetzt passiert.« Jackie bezeichnete politische Vorgänge – Wahlen, Nominierungen, Bestätigungen, Reden, was auch immer – als Ding. Dieses Gerichtsding. Dieses Redending. Dieses Wahlding. Das machte mich verrückt. Man sollte doch meinen, eine Soziolinguistin würde sich die Zeit nehmen, hin und wieder an ihrem Vokabular zu arbeiten.
»Also, ich gehe da jedenfalls hin. Du kannst mir später danken, wenn der Senat Grace Murray als Bundesrichterin bestätigt. Inzwischen die einzige Frau, falls dich das interessiert.« Sie ereiferte sich erneut über »diese frauenfeindlichen Flachwichser im Anhörungsausschuss vor zwei Jahren«.
»Danke, Jackie.« Ich konnte das Lächeln in meiner Stimme nicht verbergen.
Sie lächelte jedoch nicht.
»Na gut.« Ich schob mein Notizheft beiseite und steckte den Bleistift durch meinen Pferdeschwanz. »Könntest du bitte aufhören, mich zusammenzuscheißen? Ich meine, diese Neurowissenschaften bringen mich um. In diesem Semester haben wir Professor Wu, und die nimmt keine Gefangenen. Joe hat hingeschmissen. Mark hat hingeschmissen. Hannah hat hingeschmissen. Diese beiden Tussis aus Neu-Delhi, die ständig Arm in Arm rumlaufen und ihre Arschabdrücke in den Lesekabinen der Bibliothek hinterlassen, haben hingeschmissen. Wir sitzen schließlich nicht jeden Dienstag rum und tratschen über wütende Ehemänner, traurige Frauen und unsere Vision, dass die SMS-Kommunikation unter Jugendlichen die Zukunft ist.«
Jackie nahm ein Fachbuch von meinem Bett und las den Titel des aufgeschlagenen Kapitels. »›Ätiologie von Schlaganfällen bei Patienten mit Wernicke-Aphasie‹. Fesselnd, Jean.« Sie ließ das Buch fallen, das mit einem dumpfen Aufprall auf meiner Bettdecke landete.
»Allerdings.«
»Na gut. Bleib du hier in deiner kleinen Laborblase, während wir anderen uns auf den Weg machen.« Sie nahm das Buch noch einmal hoch und kritzelte zwei Zeilen auf die Innenseite des Einbands. »Falls du dir mal eine Minute abzwacken kannst, um deinen Senator anzurufen, Blasenmädchen.«
»Ich mag meine Blase«, sagte ich. »Und das ist übrigens ein Bibliotheksbuch.«
Jackie war es anscheinend scheißegal, ob sie gerade den Rosettastein mit einer Dose Sprühfarbe getaggt hatte. »Ja, ja. Klar magst du die, du und der Rest der weißen Feministinnen. Ich kann nur hoffen, dass niemand kommt und die Blase zum Platzen bringt.« Damit war sie aus der Tür hinaus, einen Haufen bunt bemalter Schilder in den Armen.
Als unser Mietvertrag auslief, meinte Jackie, sie wolle ihn nicht verlängern. Zusammen mit ein paar anderen Frauen hatte sie sich für ein Haus in Adams Morgan entschieden.
»Da gefallen mir die Vibes besser«, teilte sie mir mit. »Und übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nächstes Jahr wirst du ein Vierteljahrhundert alt. Wie Marilyn Monroe sagte, das bringt ein Mädchen zum Nachdenken. Immer schön cool bleiben. Und denk drüber nach, was du tun musst, um frei zu bleiben.«
Das Geschenkpaket, das sie mir daließ, war eine thematisch gestaltete Sammlung ähnlicher Belanglosigkeiten. Eine in Blasenfolie eingewickelte Tüte Bubblegum, die mit den idiotischen Cartoons auf der Verpackung der einzelnen Streifen; eine rosa Flasche Duschgel mit einem Plastikstab an der Verschlusskappe; Badreiniger; eine kleine Flasche kalifornischer Sekt und eine Tüte mit fünfundzwanzig Luftballons.
An diesem Abend trank ich den Sekt direkt aus der Flasche und ließ alle Blasen der Folie platzen. Der Rest wanderte in den Müll.
Mit Jackie sprach ich nie wieder. An Abenden wie diesem wünsche ich mir, ich hätte es getan. Viele Dinge – das Wahlding, das Nominierungsding, das Bestätigungsding, das Präsidentenverfügungsding – wären dann sicher anders verlaufen.
4
Manchmal male ich unsichtbare Buchstaben auf meine Handfläche. Während Patrick und die Jungs reden, bis ihnen die Zunge heraushängt, sprechen meine Finger für mich. Ich schreie und jammere und fluche über das, wie Patrick sich ausdrückt, »was früher war.«
So stehen die Dinge jetzt: Wir haben ein Kontingent von hundert Wörtern pro Tag. Meine Bücher, selbst die alten Bände von Julia Child und – wie ironisch ist das denn? – die zerfledderte Ausgabe von Heim und Garten, die ein Freund für ein witziges Hochzeitsgeschenk hielt, sind in Schränken verschlossen, damit Sonia sie nicht in die Finger bekommt. Was bedeutet, dass sie für mich ebenfalls außer Reichweite sind. Patrick trägt die Schlüssel wie ein Gewicht mit sich herum, und manchmal glaube ich, dass es die Schwere dieser Bürde ist, die ihn älter wirken lässt.
Die kleinen Dinge fehlen mir am meisten: Becher mit Kugelschreibern und Bleistiften in jeder Zimmerecke, zwischen Kochbücher gesteckte Notizblöcke, die Trockenlöschtafel mit der Einkaufsliste neben dem Gewürzschränkchen. Selbst meine alten Kühlschrankmagnete mit Gedichtzeilen, die Steven benutzte, um alberne italienisch-englische Sätze zu bilden, und sich dabei totlachte, sind fort. Fort, fort, fort. Genau wie mein E-Mail-Konto.
Wie alles.
Einige kleine Albernheiten des Lebens sind gleich geblieben. Ich fahre nach wie vor Auto, besorge dienstags und freitags Lebensmittel, kaufe neue Kleider und Handtaschen, lasse mir einmal im Monat bei Iannuzzi’s die Haare machen. Wobei ich den Schnitt nie verändert habe – es würde mich zu viele kostbare Wörter kosten, Stefano zu erklären, wie viel er hier abschneiden und dort lassen soll. Meine Freizeitlektüre beschränkt sich auf Reklametafeln für den neuesten Energydrink, Zutatenlisten auf Ketchupflaschen, Waschanweisungen auf Etiketten: Kein Bleichmittel verwenden.
Alles sehr fesselnd.
Sonntags gehen wir mit den Kindern ins Kino und kaufen Popcorn und Limo sowie die kleinen rechteckigen Schachteln Schokolade mit weißen Liebesperlen, die man nur in Kinos findet, nicht in Geschäften. Sonia lacht immer über die Cartoons im Vorprogramm, während die Zuschauer ihre Plätze einnehmen. Die Filme sind eine Ablenkung, denn nur in ihnen höre ich weibliche Stimmen uneingeschränkt und unbegrenzt sprechen. Schauspielerinnen haben einen speziellen Dispens, während sie ihrer Arbeit nachgehen. Ihre Texte werden natürlich von Männern geschrieben.
In den ersten Monaten gelang es mir hin und wieder, einen flüchtigen Blick in ein Buch zu werfen, eine rasche Nachricht auf eine Cornflakespackung oder einen Eierkarton zu kritzeln und Patrick Liebesworte mit Lippenstift auf den Badezimmerspiegel zu schreiben. Ich hatte gute Gründe, sehr gute Gründe dafür – Denk nicht an sie, Jean; denk nicht an die Frauen, die du im Supermarkt gesehen hast –, das Schreiben dieser Notizen aufs Haus zu beschränken. Dann kam Sonia eines Morgens, sah die Lippenstift-Botschaft, die sie nicht lesen konnte, und jaulte: »Buchstaben! Böse!«
Von da an behielt ich die Mitteilungen in mir, schrieb nur abends, wenn die Kinder im Bett waren, ein paar Wörter an Patrick und verbrannte die Papierschnipsel in einer Blechdose. Nach dem, wie sich Steven jetzt aufführt, riskiere ich selbst das nicht mehr.
Patrick und die Jungs unterhalten sich draußen auf der hinteren Veranda vor meinem Fenster über die Schule, über Politik und die Nachrichten, während Zikaden in der Dunkelheit um den Bungalow zirpen. Sie machen so viel Krach, diese Jungs und die Zikaden. Ohrenbetäubend.
All meine Wörter wirbeln in meinem Kopf herum, kommen als schwerer, sinnloser Seufzer aus meiner Kehle heraus. Und ich kann nur an Jackies letzte Worte denken.
Denk darüber nach, was du tun musst, um frei zu bleiben.
Tja, mehr zu tun als rein gar nichts, hätte ein guter Anfang sein können.
5
Patrick trifft keine Schuld. Das rede ich mir heute Abend ein.
Er hat versucht, sich dagegen auszusprechen, als der Entwurf zum ersten Mal innerhalb der ovalen Wände eines blauen Büros in einem weißen Gebäude an der Pennsylvania Avenue erörtert wurde. Ich weiß, dass er es tat. Die Bitte um Verzeihung in seinen Augen ist schwer zu übersehen, aber den Mund aufzumachen, war nie Patricks Stärke.
Und Patrick war es nicht, der Sam Myers vor der letzten Wahl zu einer Unzahl von Stimmen verhalf, derselbe Mann, der noch mehr Stimmen versprach, als Myers erneut kandidierte. Der Mann, den Jackie vor Jahren den heiligen Carl zu nennen pflegte.
Der Präsident musste nur noch zuhören, Anweisungen entgegennehmen und Papiere unterzeichnen – ein kleiner Preis für acht Jahre als mächtigster Mann der Welt. Als er dann gewählt wurde, gab es nicht mehr viel zu unterzeichnen. Für jede teuflische Einzelheit war bereits gesorgt worden.
Irgendwann begann sich das auszuweiten, was als Bible Belt, Bibelgürtel, bekannt war, dieser Streifen der Südstaaten, in dem die Religion regierte. Er verwandelte sich vom Gürtel zu einem Korsett, das alles bis auf die Gliedmaßen des Landes bedeckte – die demokratischen Utopien von Kalifornien, Neuengland, den pazifischen Nordwesten, Washington und die südlichen Anhängsel in Texas und Florida – so stramm auf demokratischer Linie, dass sie unantastbar schienen. Doch dann wurde das Korsett zu einem Ganzkörperanzug, der sich schließlich auch bis nach Hawaii ausweitete.
Und wir haben es nicht kommen sehen.
Frauen wie Jackie schon. Sie führte sogar den Marsch der zehn Mitglieder starken Gruppe »Atheisten für Anarchie« über den Campus an, brüllte so haarsträubende Prophezeiungen wie Heute Alabama, morgen Vermont! und Schluss mit der Vereinnahmung! Es kümmerte sie einen Scheiß, wenn die Leute sie auslachten.
»Du wirst schon sehen, Jeanie«, sagte sie zu mir. »Letztes Jahr gab es einundzwanzig Frauen im Senat. Jetzt haben wir noch fünfzehn der Unseren im verdammten Allerheiligsten.« Sie hielt die Hand hoch und knickte die Finger um, einen nach dem anderen. »West Virginia. Nicht wiedergewählt. Abgehakt. Iowa. Nicht wiedergewählt. Abgehakt. North Dakota. Nicht wiedergewählt. Abgehakt. Missouri, Minnesota und Arkansas sind ›aus unbekannten Gründen‹ zurückgetreten. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Das heißt, von einundzwanzig Prozent der Senatoren in null Komma nichts runter auf fünfzehn Prozent. Und aus Nebraska und Wisconsin heißt es, sie tendierten zu Kandidaten, die – und ich zitiere – ›nur das Beste für das Land im Sinn haben‹.«
Bevor ich sie aufhalten konnte, fuhr sie mit den Zahlen des Repräsentantenhauses fort. »Von neunzehn Prozent runter auf zehn, und die sind nur Kalifornien, New York und Florida zu verdanken.« Jackie hielt inne, um sicherzugehen, dass ich ihr noch zuhörte. »Texas? Weg. Ohio? Weg. Alle Südstaaten? Vom scheiß Winde verweht, genau das. Und du glaubst, das wären nur kurzzeitige Veränderungen? Ich meine, nach den nächsten Zwischenwahlen sind wir zurück in den frühen Neunzigern. Beschneide die Abgeordneten noch mal um die Hälfte, und wir sind auf dem Weg ins finstere Zeitalter der 1970er.«
»Ehrlich, Jacko. Du wirst noch hysterisch darüber.«
Ihre Worte prasselten wie vergiftete Pfeile auf mich. »Tja, irgendjemand muss hier doch hysterisch werden.«
Das Schlimmste war, dass Jackie sich irrte. Wir wurden nicht von zwanzig Prozent weiblicher Abgeordneter im Kongress auf fünf Prozent gedrückt. Innerhalb der nächsten fünfzehn Jahre wurden wir auf fast gar nichts mehr gedrückt.
Bei der letzten Wahl erreichten wir sogar dieses unvorstellbare Ziel, und Jackies Vorhersage, zurück in den frühen Neunzigern zu sein, schien zuzutreffen – wenn man damit die frühen 1890er meinte. Der Kongress hatte die Vielfalt einer Schüssel Vanilleeis, und die beiden Frauen, die noch Regierungsämter innehatten, wurden rasch durch zwei Männer ersetzt, die in Jackies Worten »nur das Beste für das Land im Sinn hatten«.
Der Bibelgürtel hatte sich ausgedehnt und erweitert, bis er zur Eisernen Jungfrau geworden war.
Was diese Jungfrau jedoch brauchte, war eine eiserne Faust, einen Vollstreckungsarm. Wieder schien Jackie hellseherisch zu sein.
»Wart’s nur ab, Jeanie«, sagte sie, während wir billige Nelkenzigaretten am einzigen Fenster unserer Wohnung rauchten. Sie deutete auf die fünf ordentlichen Studentenkolonnen, die im Gleichschritt marschierten. »Siehst du diese Jungs vom Reserveoffizier-Ausbildungskorps?«
»Ja.« Ich blies den Rauch aus dem Fenster, Lysolspray zur Hand, falls unsere Vermieterin auftauchen sollte. »Und?«
»Gehören zu fünfzehn Prozent irgendeiner Baptistenschattierung an. Zwanzig Prozent Katholiken – römisch-katholisch. Fast ein weiteres Fünftel behauptet, nicht konfessionsgebundene Christen zu sein – was auch immer das bedeutet.« Sie versuchte sich an ein paar Rauchringen, sah zu, wie sie aus dem Fenster trieben.
»Und? Wie viel bleibt übrig? Fast die Hälfte macht beim Agnostiktanz mit.«
Jackie lachte. »Ist dein Hirn geschrumpft, Jeanie? Die Mormonen oder die Methodisten oder die Lutheraner oder die Tioga River Christian Conference habe ich noch nicht mal erwähnt.«
»Die Tioga was? Wie viele sind die?«
»Einer. Ich glaube, der ist bei der Air Force.«
Jetzt musste ich lachen. Nelkenrauch geriet mir in die Kehle; ich drückte die Zigarette aus und besprühte mich mit Lysol. »Also keine große Sache.«
»Ist er nicht. Aber die anderen schon. Das ist eine religionsgesättigte Organisation.« Jackie lehnte sich aus dem Fenster, um besser sehen zu können. »Und es sind hauptsächlich Männer. Konservative Männer, die ihren Gott und ihr Land lieben.« Sie seufzte. »Frauen nicht so sehr.«
»Das ist doch lächerlich«, erwiderte ich und überließ es ihr, sich mit einer zweiten Zigarette den anderen Lungenflügel auszubrennen. »Sie hassen Frauen nicht.«
»Du, Liebchen, musst mehr unter die Leute kommen. Rate mal, welche Bundesstaaten die meisten Neuzugänge zum Militär haben? Kleiner Hinweis: nicht die im verdammten Neuengland. Eher die, wo’s noch mit ›rechten Dingen‹ zugeht.«
»Na und?« Mir war klar, dass ich sie auf die Palme brachte, aber ich konnte die Verbindung nicht erkennen, die Jackie herzustellen versuchte.
»Weil sie konservativ sind, darum geht’s. Hauptsächlich weiß. Hauptsächlich hetero.« Jackie drückte die halb gerauchte Nelkenzigarette aus, verstaute sie in einem Plastikbeutel, verschränkte die Arme und sah mich an. »Was glaubst du, wer momentan am wütendsten ist? In unserem Land, meine ich.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Afroamerikaner?«
Sie gab ein Brummen von sich, eins von der Art Sie-haben-zwar-verloren-kriegen-aber-einen-Trostpreis. »Versuch’s noch mal.«
»Schwule?«
»Nein, du Dussel. Der heterosexuelle weiße Mann. Er ist stinkwütend. Er fühlt sich entmannt.«
»Also ehrlich, Jacko.«
»Natürlich tut er das.« Jackie deutete mit ihrem knallroten Fingernagel auf mich. »Wart’s nur ab. In ein paar Jahren ist es eine andere Welt, wenn wir nicht etwas unternehmen, das zu ändern. Ausgeweiteter Bibelgürtel, mieseste Repräsentierung im Kongress und eine Meute machthungriger kleiner Jungs, die es satthaben, dauernd ermahnt zu werden, einfühlsamer zu sein.« Sie lachte, ein boshaftes Lachen, das ihren ganzen Körper durchschüttelte. »Und denk ja nicht, dass es nur die Männer sind. Die Heimchen am Herd werden zu ihnen halten.«
»Die wer?«
Jackie deutete mit dem Kopf auf meine Joggingklamotten und das verstrubbelte Haar, auf den Stapel ungewaschenen Geschirrs im Spülbecken und schließlich auf ihr eigenes Outfit. Eine interessantere Modekreation, als ich sie sonst an ihr sah – Leggings mit Paisleymuster, ein übergroßer Häkelpullover, der einst beige gewesen war, inzwischen jedoch die Farbe verschiedener anderer Kleidungsstücke angenommen hatte, und knallrote hochhackige Stiefel. »Die Hausmütterchen. Die Mädels in farblich abgestimmten Röcken und Pullovern und praktischen Schuhen, die auf ihren Abschluss als Ehefrauen hinarbeiten. Glaubst du, die können uns leiden? Denk mal nach.«
»Ach, komm schon, Jackie.«
»Wart’s nur ab, Jeanie.«
Und das tat ich. Alles entwickelte sich fast genau so, wie Jackie es erwartet hatte. Und schlimmer. Es kam aus so vielen Richtungen auf uns zu, und so lautlos, dass wir keine Möglichkeit hatten, die Reihen zu schließen.
Eines lernte ich von Jackie: Man kann nicht gegen etwas protestieren, das man nicht kommen sieht.
Vor einem Jahr lernte ich auch noch andere Dinge: Ich lernte, wie schwierig es ist, meinem Abgeordneten ohne Stift einen Brief zu schreiben oder einen Brief ohne Briefmarke zu versenden. Ich lernte, wie leicht es für den Mann im Papierwarenladen ist, zu mir zu sagen: »Tut mir leid, Ma’am. Ich kann Ihnen das nicht verkaufen«, oder wie leicht es für den Postbeamten ist, den Kopf zu schütteln, wenn jemand ohne Y-Chromosom nach Briefmarken fragt. Ich lernte, wie schnell ein Handyvertrag annulliert werden kann und wie effizient junge Soldaten beim Anbringen von Kameras sind.
Ich lernte, sobald ein Plan vorhanden ist, kann alles über Nacht passieren.
6
Patrick hat heute Abend offenbar Frühlingsgefühle, im Gegensatz zu mir. Entweder das, oder er braucht Stressabbau vor einem weiteren Tag in einer weiteren Woche in einem Job, der Benzin in den Tank füllt und die Zahnarztrechnungen der Kinder bezahlt. Selbst ein hochdotierter Regierungsposten reicht kaum aus, vor allem seit ich nicht mehr arbeite.
Das Licht auf der Veranda geht aus, die Jungs fallen in ihre Betten und Patrick fällt in unseres.
»Hab dich lieb, Schatz«, sagt er. Seine tastenden Hände verraten mir, dass ihm nicht nach Schlafen ist. Noch nicht. Und es ist schon eine Weile her. Ein paar Monate mindestens. Könnte auch noch länger sein.
Also machen wir uns ans Werk.
Ich habe beim Liebesakt nie gern gesprochen. Worte kamen mir unbeholfen vor; wie abrupte Unterbrechungen eines natürlichen Rhythmus des Geschlechtsverkehrs. Und schon gar nicht die dämlichen Mantras im Pornostil: Gib’s mir. Ich komme. Fick mich härter. O Baby, o Baby, o Baby. Sie gehörten zum scherzhaften Flirten oder zu anzüglichen Witzen unter Freundinnen, aber nicht ins Bett. Nicht mit Patrick.
Trotzdem hatten wir miteinander geredet. Davor und danach. Währenddessen. Und ich liebe dich, sechs Laute, Zwielaute und Gleitlaute und Fließlaute mit nur einem einzigen turbulenten b, einem auf so viele Arten stimmhaften Konsonanten, passend zum Rahmen. Unsere Namen, geflüstert. Patrick. Jean.
Heute Abend, mit den Kindern im Bett und Patrick in mir, sein steter Atem nah und schwer an meinem Ohr, meine Augen geschlossen vor dem schimmernden Mondlicht, aufgefangen vom Spiegel am Frisiertisch, denke ich darüber nach, was ich vorziehen würde. Wäre ich glücklicher, wenn er mein Schweigen teilte? Wäre es leichter? Oder brauche ich die Wörter meines Mannes, um die Lücken im Zimmer und in mir zu füllen?
Er hält inne. »Was ist los, Schatz?« In seiner Stimme liegt Besorgnis, aber ich meine, auch etwas anderes herauszuhören, einen Ton, den ich nie wieder hören möchte. Es klingt wie Mitleid.
Ich lege beide Hände an sein Gesicht und ziehe seinen Mund zu meinem. Mit dem Kuss spreche ich zu ihm, mache Zusicherungen, verdeutliche, dass alles in bester Ordnung ist. Das ist eine Lüge, aber eine passende Lüge für den Augenblick, und er spricht nicht mehr weiter.
Heute Nacht soll Stille herrschen. Vollkommene Stille. Eine Leere.
Ich bin jetzt an zwei Orten gleichzeitig. Ich bin hier, unter Patrick, sein Gewicht über meinen Körper verteilt, ein Teil von ihm und doch getrennt. Ich bin in meinem anderen Selbst, fummele auf dem Rücksitz von Jimmy Reeds Grand National, einem typischen Sexauto, an den Knöpfen meines Abschlussballkleides. Ich keuche und lache, beduselt vom Punsch, während Jimmy mich begrapscht. Dann singe ich im Chor, feure unser erfolgloses Footballteam an, halte eine Abschiedsrede nach dem Examen am College, verfluche Patrick, während er mich antreibt, fester zu drücken, nur noch einmal, Schatz, bevor der Kopf des Babys auftaucht. Ich bin in einer gemieteten Hütte, vor zwei Monaten, liege unter dem Körper eines Mannes, den ich unbedingt wiedersehen möchte, ein Mann, dessen streichelnde Hände ich immer noch auf meiner Haut spüre.
Lorenzo, flüstere ich im Kopf und drücke die drei köstlichen Silben weg, bevor sie mich zu sehr schmerzen.
Mein Selbst spaltet sich immer mehr auf.
In solchen Momenten denke ich an die anderen Frauen. Dr. Claudia, zum Beispiel. Einmal fragte ich sie in ihrem Sprechzimmer, ob Gynäkologinnen Sex mehr genießen als wir anderen oder ob sie sich in der klinischen Natur des Aktes verlieren. Legen sie sich zurück und denken, oh, jetzt dehnt sich meine Vagina aus und verlängert sich, jetzt zieht sich meine Klitoris unter ihre Kapuze zurück, jetzt zieht sich das erste Drittel (aber nur das erste Drittel) meiner Scheidenwand mit der Geschwindigkeit eines Pulsschlags zusammen, alle acht Zehntel einer Sekunde.
Dr. Claudia zog das Spekulum mit einer geschmeidigen Bewegung heraus und erwiderte: »Als ich mit dem Medizinstudium begann, habe ich das tatsächlich gemacht. Ich konnte nicht anders. Zum Glück war mein damaliger Partner ebenfalls Medizinstudent, sonst hätte er wahrscheinlich den Reißverschluss hochgezogen, das Weite gesucht und mich hysterisch lachend unter der Decke zurückgelassen.« Sie tippte an mein Knie und nahm einen Fuß nach dem anderen von den weich gepolsterten Auflagen. »Jetzt genieße ich es einfach. Wie alle anderen.«
Während ich an Dr. Claudia und ihr glänzendes Spekulum denke, kommt Patrick zum Orgasmus und sinkt über mir zusammen, küsst meine Ohren und meinen Hals.
Ich frage mich, was die anderen Frauen machen. Wie sie zurechtkommen. Empfinden sie immer noch Genuss? Lieben sie ihre Männer noch genauso? Hassen sie sie, zumindest ein bisschen?
7
Als sie zum ersten Mal schreit, glaube ich, dass ich träume. Patrick schnarcht neben mir; er hatte schon immer einen tiefen Schlaf, und sein Arbeitspensum im vergangenen Monat hat ihn vollkommen fertiggemacht. Also schnarcht er und schnarcht und schnarcht.
Mein Mitgefühl ist längst vergangen. Sollen sie doch zwölf Stunden am Tag arbeiten, um den unvermeidlichen Stau abzubauen, der durch die Entlassung der halben Arbeitnehmerschaft entstanden ist. Sollen sie sich doch im Papierkram und behördlichen Blödsinn vergraben und dann nach Hause humpeln, nur um wie die Toten zu schlafen, aufzustehen und weiterzurackern. Was hatten sie denn erwartet?
All das ist nicht Patricks Schuld. Mein Herz und mein Verstand wissen das. Bei vier Kindern brauchen wir das Gehalt, das sein Posten einbringt.
Sie schreit wieder, kein wortloser Schrei, sondern ein grauenerregender Wasserfall aus Wörtern.
Mommy, lass nicht zu, dass es mich holt, lass nicht zu, dass es mich holt, lass nicht zu, dass es mich holt –
In einem Gewirr aus Laken und Decken stolpere ich aus dem Bett, das Nachthemd um meine Beine gewickelt. Mein Schienbein knallt gegen die spitze Ecke des Nachttisches, ein Volltreffer. Das wird bluten, wird eine Narbe hinterlassen, doch daran denke ich nicht. Ich denke an die Narbe, die ich bekommen werde, wenn ich es nicht rechtzeitig in Sonias Schlafzimmer schaffe, um sie zum Schweigen zu bringen.
Die Wörter strömen weiter, fliegen durch den Flur auf mich zu wie vergiftete Pfeile aus tausend feindseligen Blasrohren. Jeder trifft; jeder durchstößt meine einst straffe Haut mit der Präzision eines Chirurgenskalpells, dringt mir direkt in den Bauch. Wie viele Wörter? Fünfzig? Sechzig? Mehr?
Mehr.
O Gott.
Jetzt schießt auch Patrick hoch, mit aufgerissenen Augen und bleich, das Bild eines Leinwandhelden, der zu seinem Entsetzen ein Monster in seinem Schrank entdeckt. Ich höre seine raschen Schritte hinter mir, passend zum Trommeln des Blutes in meinen Adern, höre ihn brüllen »Lauf, Jean! Lauf!«, doch ich drehe mich nicht um. Türen öffnen sich, als ich vorbeirenne, zuerst die von Steven, dann die von Sam und Leo. Jemand – vielleicht Patrick, vielleicht ich – haut auf den Schalter des Flurlichts, und drei verschwommene Gesichter, bleich wie Geister, tauchen in meinem peripheren Blickfeld auf. Ausgerechnet Sonias Zimmer muss am weitesten von meinem entfernt sein.
Mommy, lass nicht zu, dass es mich holt, lass nicht zu, dass es mich holt, lass –
Sam und Leo beginnen zu weinen. Für einen winzigen Augenblick durchzuckt mich ein Gedanke: schlechte Mutter. Meine Jungs fürchten sich, und ich renne vorbei, kümmere mich nicht um sie. Über den Schaden mache ich mir später Sorgen, falls ich noch in der Lage sein werde, mir über irgendetwas Sorgen zu machen.
Nach zwei Schritten in Sonias kleines Zimmer werfe ich mich auf ihr Bett, suche mit der einen Hand nach ihrem Mund, halte ihn zu. Mit der anderen taste ich unter ihrem Laken nach dem harten Metall des Wortzählers.
Sonia wimmert unter meiner Hand, und ich erhasche aus dem Augenwinkel einen Blick auf ihre Nachttischuhr. Halb zwölf.
Ich habe keine Wörter mehr übrig, erst in einer halben Stunde wieder.
»Patrick –«, forme ich mit den Lippen, als er das Deckenlicht anschaltet. Vier Augenpaare starren auf die Szene auf Sonias Bett. Es muss wie Gewaltanwendung aussehen, eine groteske Skulptur – mein sich windendes Kind, das Nachthemd durchsichtig vom Schweiß; ich ausgestreckt auf ihr, ihre Schreie erstickend und sie auf die Matratze drückend. Was für ein entsetzliches Bild wir abgeben müssen. Kindstötung in natura.
Die Leuchtziffern meines Zählwerks über Sonias Mund zeigen hundert an. Ich drehe mich zu Patrick, flehe ihn stumm an, denn wenn ich spreche, wenn die Zahl auf hundertundeins springt, wird sich der unvermeidliche Stromstoß auch auf Sonia auswirken.
Patrick kniet sich neben mich aufs Bett, löst meine Hand von Sonias Mund und ersetzt sie durch seine. »Still, meine Kleine. Still. Daddy ist hier. Daddy wird nicht zulassen, dass dir etwas passiert.«
Sam, Leo und Steven kommen ins Zimmer. Sie rangeln um die besten Plätze, und plötzlich ist kein Platz mehr für mich. Aus schlechte Mutter wird unnütze Mutter, zwei Wörter, die in meinem Kopf Pingpong spielen. Danke, Patrick. Danke, Jungs.
Ich hasse sie nicht. Ich rede mir ein, dass ich sie nicht hasse.
Aber manchmal tue ich es doch.
Ich hasse, wenn meine männlichen Familienmitglieder Sonia versichern, wie hübsch sie sei. Ich hasse, dass sie diejenigen sind, die sie trösten, wenn sie vom Fahrrad fällt, dass sie sich Geschichten über Prinzessinnen und Meerjungfrauen für sie ausdenken. Ich hasse, ihnen zuzuschauen und zuzuhören.
Mir immer wieder einzureden, dass sie nicht diejenigen sind, die mir dies angetan haben, ist eine Qual.
Verdammte Scheiße.
Sonia hat sich beruhigt, die unmittelbare Gefahr ist gebannt. Doch während ich rückwärts aus dem Zimmer schlüpfe, fällt mir auf, dass ihre Brüder vermeiden, sie zu berühren. Falls sie noch einen weiteren Anfall bekommt.
In der Ecke des Wohnzimmers steht unsere Bar, ein stabiler Rollwagen aus Holz mit der Flaschensammlung flüssiger Betäubungsmittel. Klarer Wodka und Gin, karamellfarbener Scotch und Bourbon, ein Fingerbreit Kobaltblau in der Curaçao-Flasche, die wir vor Jahren für ein polynesisches Picknick gekauft haben. Weiter hinten steht das versteckt, was ich suche: Grappa, auch als italienischer Schwarzgebrannter bekannt. Ich ziehe ihn zusammen mit einem kleinen langstieligen Glas heraus, nehme beides mit auf die hintere Veranda und warte darauf, dass die Uhr Mitternacht schlägt.
Das Trinken habe ich mir ziemlich abgewöhnt. Es ist zu deprimierend, einen eiskalten Gin Tonic zu trinken und an die Sommerabende zu denken, an denen Patrick und ich Schulter an Schulter auf dem briefmarkengroßen Balkon unserer ersten Wohnung saßen, über meine Forschungsstipendien sprachen, meine Bewerbungsunterlagen und seine infernalischen Arbeitsstunden als Assistenzarzt im Georgetown University Hospital. Außerdem habe ich Angst davor, mich zu betrinken, zu viel angetrunkenen Mut zu entwickeln und die Regeln zu vergessen. Oder auf sie zu pfeifen.
Der erste Grappa läuft runter wie Feuer; der zweite ist weicher, lindernder. Ich bin bei meinem dritten, als die Uhr das Ende des heutigen Tages verkündet und mir ein leises Ping an meinem linken Handgelenk weitere hundert Wörter zuteilt.
Was werde ich mit ihnen anfangen?
Ich gleite durch die Fliegengittertür zurück nach drinnen, tappe über den Wohnzimmerteppich und stelle die Flasche auf die Bar. Sonia sitzt aufrecht im Bett, als ich in ihr Zimmer komme, ein Glas Milch in den Händen, gestützt von Patricks Handfläche. Die Jungs sind wieder in ihre Betten, und ich setze mich neben Patrick.
»Alles in Ordnung, Liebling. Mommy ist da.«
Sonia lächelt mich an.
Doch so läuft es nicht ab.
Ich nehme meinen Drink mit auf den Rasen, vorbei an den Rosen, die Mrs Ray so sorgfältig ausgewählt und gepflanzt hat, hinaus zu dem dunklen, süß duftenden Grasfleck, wo der Flieder blüht. Angeblich soll man mit Pflanzen reden, damit sie prächtiger gedeihen; wenn das stimmt, ist mein Garten dem Tode geweiht. Heute Nacht kümmern mich jedoch Flieder und Rosen einen Dreck. Ich habe andere Kreaturen im Sinn.
»Ihr verdammten Bastarde!«, schreie ich. Und noch mal.
Im Haus der Kings flackert ein Licht auf, und die waagerechten Jalousien wackeln und teilen sich. Ist mir doch egal. Mir ist egal, ob ich den ganzen Vorort aufwecke, ob sie mich bis hinauf nach Capitol Hill hören. Ich schreie und schreie, bis meine Kehle trocken ist. Dann nehme ich einen weiteren Schluck aus der Grappaflasche, wobei einiges auf mein Nachthemd tropft.
»Jean!« Die Stimme ertönt hinter mir, dann knallt eine Tür. »Jean!«
»Verpiss dich«, knurre ich. »Sonst rede ich weiter.« Plötzlich sind mir der Stromschlag oder die Schmerzen gleichgültig. Wenn ich dabei weiter schreien kann, die Wut aufrechterhalte, das Gefühl mit Schnaps und Wörtern ertränke, wird dann der Strom weiterfließen? Mich umlegen?
Vermutlich nicht. Sie töten uns aus demselben Grund nicht, aus dem sie keine Abtreibungen bewilligen. Wir sind zu einem notwendigen Übel geworden, Objekte, die man vögeln, aber nicht hören soll.
Patrick brüllt jetzt. »Jean! Schatz, hör auf. Bitte hör auf.«
Im Haus der Kings geht ein weiteres Licht an. Eine Tür öffnet sich knarrend. Schritte sind zu hören. »Was zum Teufel ist da los, McClellan? Die Leute versuchen zu schlafen.« Der Ehemann, wer sonst. Evan. Olivia linst immer noch durch die Jalousien auf meine Mitternachtsshow.
»Verpiss dich, Evan«, brülle ich.
Evan verkündet, er werde die Polizei rufen, wenn auch nicht ganz so höflich formuliert. Gleich darauf geht das Licht hinter Olivias Fenster aus.
Ich höre Schreie – teilweise von mir –, dann wirft sich Patrick auf mich, drückt mich ins feuchte Gras, fleht mich an und redet mir gut zu, und ich schmecke Tränen auf seinen Lippen, als er mich mit Küssen zum Schweigen bringt. Mein erster Gedanke ist, ob sie Männern solche Techniken beibringen. Ob sie Ehemännern und Söhnen, Vätern und Brüdern Flugblätter mit Anweisungen ausgehändigt haben, in den Tagen, als sie uns mit diesen glänzenden Stahlbändern fesselten. Doch mir wird klar, dass sie sich so viel Mühe nicht machen würden.
»Lass mich los.« Ich liege im Gras, mein Nachthemd klebt an mir wie Schlangenhaut. Dabei merke ich, dass ich zische.
Ich merke auch, dass das Zählwerk schneller klickt.
Patrick packt mein linkes Handgelenk, schaut auf die Zahl. »Du bist drüber, Jean.«
Ich versuche mich von ihm wegzuschlängeln, ein Versuch, der ebenso aller Hoffnung entbehrt wie mein Herz. Das Gras in meinem Mund ist bitter, bis ich merke, dass ich Erde kaue. Ich weiß, was Patrick macht; ich weiß, dass er mit mir den Stromschlag absorbieren will.
Also bleibe ich still und lasse mich von ihm ins Haus führen, während das Heulen der Sirenen lauter wird.
Patrick kann mit ihnen reden. Ich habe keine Wörter mehr übrig.
8
Sonias ausdrucksloser Blick, während ich sie durch den Regen zur Bushaltestelle bringe, ist die schlimmste Bestrafung für meine grappagetränkte Schimpftirade letzte Nacht. Auf jeden Fall schlimmer als die Standpauke von Officer Sowienoch wegen der nächtlichen Ruhestörung.
Zum ersten Mal habe ich ihr nicht gesagt, dass ich sie liebe, ehe ich sie zur Schule losschicke. Ich werfe ihr einen Luftkuss zu und bedaure es sofort, als sie ihre kleine Hand an die Lippen hebt, um ihn zu erwidern.
Das schwarze Kameraauge starrt mich von der Bustür an.
Sie sind jetzt überall, diese Kameras. In Supermärkten und Schulen, Friseursalons und Restaurants, halten nach jeder Geste Ausschau, die als Zeichensprache gedeutet werden könnte, selbst in der rudimentärsten Form nonverbaler Kommunikation.
Weil schließlich nichts von dem Scheiß, mit dem sie uns geschlagen haben, irgendetwas mit Sprechen zu tun hat.
Ich glaube, es war einen Monat nach Einführung der Wortzähler, als es passierte. In der Obst- und Gemüseabteilung von Safeway. Ich kannte die Frauen nicht, hatte sie aber schon mal beim Einkaufen gesehen. Wie alle jungen Mütter aus der Nachbarschaft waren sie zu zweit oder mehreren unterwegs, erledigten ihre Besorgungen zusammen, um zur Stelle zu sein, falls eines der Kleinkinder in der Kassenschlange einen Trotzanfall bekam. Die beiden standen sich aber offensichtlich sehr nahe. Diese Nähe war das eigentliche Problem, wie ich inzwischen begriffen habe.
Man kann einer Person vieles nehmen – Geld, Job, geistige Anregung, was auch immer. Man kann ihr sogar die Wörter nehmen, ohne ihr Wesen zu verändern.
Nimmt man ihr jedoch das Zusammengehörigkeitsgefühl, sieht die Sache vollkommen anders aus.
Ich beobachtete sie, diese Frauen, wie sie gegenseitig ihre Kinder bewunderten, in stummem Pidgin auf ihre Herzen und Schläfen deuteten. Ich sah, wie sie sich neben einer Orangenpyramide mittels Fingeralphabet unterhielten und lachten, als sie sich bei einem der Buchstaben irrten, die sie vermutlich nicht mehr benutzt hatten, seit sie sich in der sechsten Klasse geheime Botschaften über Kevin oder Tommy oder Carlo geschickt hatten. Ich sah, wie entsetzt sie starrten, als sich ihnen drei Uniformierte näherten, und ich sah die Orangenpyramide zusammenstürzen, als sich die Frauen zu wehren versuchten, und ich sah, wie sie durch die automatischen Türen abgeführt wurden, sie und ihre zwei kleinen Mädchen, alle vier mit breiten Metallbändern um die Handgelenke.
Ich habe mich nicht nach ihnen erkundigt, natürlich nicht. Das war auch nicht nötig. Ich habe diese Frauen oder ihre Kinder seither nie wiedergesehen.
»Tschüss«, sagt Sonia und klettert in den Bus.