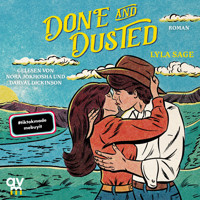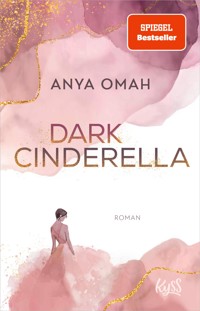Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für einen Funken Hoffnung auf eine bessere Zukunft muss der 17-jährige Mohammed mit seinem älteren Bruder aus Syrien fliehen und dafür seine Mutter zurücklassen. Die Bootsfahrt über das Mittelmeer ist nur eine Station von vielen auf der lebensgefährlichen Fluchtroute. Das Einzige, das ihm dabei Stärke schenkt, ist die schönste Erinnerung seines alten Lebens, die er zufällig bei sich hat. Währenddessen ist die 21-jährige Berlinerin Sarah nach einem traumatischen Erlebnis ihrer Kindheit auf der Suche nach sich selbst. Nach etlichen abgebrochenen Jobs führen ihre Wege zu einer Flüchtlingsnotunterkunft. In den zwischenmenschlichen Beziehungen zu den Bewohnern erkennt sie die Wünsche, Ängste und Werte des Menschen, egal welcher Herkunft und welchen Alters. Die abwechselnden Perspektiven beider Leben, jene kaum unterschiedlicher und gleichzeitig nicht ähnlicher sein könnten, zeigen die Folgen des Krieges im Nahen Osten. Werden ihre Wege sich kreuzen, bevor das nächste Schicksal sie durchkreuzt? "Jeder hat seinen Verlust erlebt, jeder jemand anderen, jeder auf eine andere Weise und dennoch ist das Ergebnis das gleiche. Nie hat man jemanden auf so etwas vorbereitet. So etwas lernt man nicht."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weil jede Geschichte es verdient, erzählt zu werden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 1
Das Licht flackert unrhythmisch im staubigen Raum, während wir von weitem der entfernten Geräuschkulisse leise Schüsse wahrnehmen.
„Kommt her meine Jungs“, sagt meine Mutter mit ruhiger Stimme. Erst nachdem ich unsicher zu meinem großen Bruder blicke, setze ich mich mit ihm auf den Teppichboden, Onkel Raed im Türrahmen angelehnt.
Sie nimmt sich viel Zeit, die richtigen Worte zu finden.
Sie blickt an die Decke, ihre Augen im dumpfen Licht der Deckenlampe glänzend und die sich darin ansammelnden Tränen reflektierend. Ihre Nervosität ist spürbar, in der sie ihre Hände aneinander reibt und ihr Kinn zu zittern beginnt, während sie versucht ihre Kraft zu sammeln, die folgenden Worte aussprechen zu können.
„Was ist denn los?“, frage ich besorgt und halte ihre Schulter.
Die Unsicherheit, dass etwas Furchtbares passiert ist und wir eine weitere liebende Person verloren haben, bereitet mir jeden Tag Angst vor plötzlichen Anrufen weinender Bekannter oder ernsthaft werdenden Gesprächen wie diesem hier.
Es kommt mir vor, als wäre es erst neulich gewesen, dass das Telefon klingelte und es uns Onkel Raeds Nummer anzeigte, kurz nachdem eine überraschende Bombe direkt in der Altstadt fiel, in der mein Vater mit ihm unterwegs gewesen war. Die Zeit schien stehenzubleiben, während wir beinahe die Mailbox rangehen ließen, bis meine Mutter genug Kraft zum Abheben sammelte.
Wir hatten gewusst, was für ein Telefonat es mit dem Bruder meines Vaters werden würde, der sich zuvor nie bei einem von uns meldete.
Ich kann mich ganz genau an das Gefühl erinnern, das ich bekam. Und an das Gefühl, das folgte. Die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen und all die Fragen, auf die ich bis heute keine Antworten weiß.
Solche Erlebnisse mit all seinen Inhalten geschehen nur einmal im Leben. Vielleicht verändern sich die Bilder der Erinnerungen, sodass sie ein verschobenes Abbild der Realität widerspiegeln oder man vergisst sie vollkommen, doch das Gefühl bleibt für immer. Als hätte man sie eben erst empfunden.
Gleichzeitig fühlen sich solche Ereignisse so an, als wären sie vor Ewigkeiten gewesen, wenn einem all die Dinge in den Kopf kommen, die seitdem passiert sind.
Mit meinen zwölf Jahren, als ich ihn verlor, war ich noch zu jung, um zu verstehen, dass nicht alles einen Sinn ergibt. Zu jung, um Dinge einfach so hinzunehmen, wie sie sind und sie zu akzeptieren. Mittlerweile ist es fünf Jahre her.
Haytham muss all das mit seinem fortgeschrittenen Alter von achtzehn Jahren so viel schwerer gehabt haben, doch gesprochen haben wir darüber nie.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Verlust jemals richtig verarbeitet habe. Auch in der Familie verloren wir selten ein Wort darüber. Keiner stellte jemals Fragen.
Jeder hat seinen Verlust erlebt, jeder jemand anderen, jeder auf eine andere Weise und dennoch ist das Ergebnis das gleiche. Nie hat man jemanden auf so etwas vorbereitet.
So etwas lernt man nicht.
Und jetzt sehe ich meine Mutter nervös auf den Teppich blickend nach Worten suchen und befürchte, dass ein solches Gespräch folgt wie einst das zwischen meiner Mutter und Onkel Raed, das wir nie zu hören bekamen.
Ich richte meinen Blick zu Haytham und Onkel Raed, während ich in ihren Gesichtern nach einer Ahnung über das suche, was jetzt kommen wird, doch sie schauen stumm zu meiner Mutter und regen sich nicht.
In den darauffolgenden wenigen Momenten, die im schweigsamen Raum vergehen, werde ich ungeduldiger, spüre die feuchte Hitze in meinem Nacken, möchte etwas sagen, doch überwinde mich nicht dazu, die Worte auszusprechen, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gefunden habe.
Schließlich blickt sie.
„Ihr werdet zu dritt mit Onkel Raed in die Türkei fliegen und von dort aus allein fliehen.“
Ihre Stimme bricht.
Mit aufgerissenen Augen und offenen Mündern erschüttere ich mit Haytham.
Ich brauche eine Sekunde, um zu verstehen, was vor sich geht. Panik beginnt in mir hochzusteigen. Kein einziger Ton will aus meinem Mund, meiner trockenen Kehle entkommen.
„Nein! Auf keinen Fall!“, widerspricht Haytham. „Wieso kommst du nicht mit?! Wir wollten zusammen nach Deutschland!“
„Wir haben nicht genug Geld für uns alle. Es ist sicherer, wenn ihr jetzt allein reist und wir nachkommen“, zittert sie.
Ich muss ununterbrochen den Kopf schütteln, während sie spricht.
„Onkel Raed wird in der Türkei bleiben und dort Geld verdienen.“
Mir fehlen die Worte. Mein Blick geht starr zwischen den Beiden hin und her.
„Das schaffen wir doch nicht allein!“, wird Haytham lauter. Er wirkt überfordert.
Meiner Mutter laufen die Tränen über ihr Gesicht, als sie sich mit den Händen verdeckend wegdreht. Wie ich sie so sehe, füllen sich meine Augen ebenfalls mit Tränen. Hitze beginnt in meinen Kopf zu steigen.
Onkel Raed greift ein: „Natürlich schafft ihr das! Wir sind das schon so oft durchgegangen. Ich werde euch bis in die Türkei begleiten und nochmal alles erklären. Außerdem bleiben wir immer erreichbar.“
Er versucht ruhig und unbesorgt zu klingen, doch ich kenne ihn gut und durchblicke seine Angespanntheit. Seine leicht geröteten Augen sind weit und starr, die Ader an der Schläfe sticht hervor. Noch nie habe ich meinen Onkel so gesehen und das macht es mir schwerer.
Doch noch weniger kann ich meine Augen von meiner Mutter lösen, die sich weinend in seinen Armen vergräbt.
„Wir wollten das alles zusammen durchziehen. Das war doch der Plan!“, schreit Haytham.
Aufgebracht steht er auf und läuft einzelne Schritte hin und her, um sich zu beruhigen.
Ich komme mir wie ein kleines Kind vor, das einen Streit der Eltern beobachtet und nur die Spannung spürt, ohne den Inhalt der Worte zu verstehen.
„Hör mal, das ist nicht möglich“, beginnt mein Onkel mit gesenkter Stimme auf ihn einzureden. „Wir hätten niemals rechtzeitig genug Geld für uns alle auftreiben können. Wir haben anfangs noch alles schön und leicht geredet, aber das ist es nicht. Sie werden bald die Grenzen in Europa schließen und bevor das passiert, müsst ihr unbedingt gehen. Ihr seid wichtiger, ihr seid noch jung-“
„Nein, nein, nein!“, unterbricht Haytham ihn lautstark.
„Wir wussten, dass ihr das nicht zulassen würdet“, beginnt mein Onkel mit kühler Stimme. „Deshalb haben wir heute Morgen die Tickets gekauft.“
Mein Hals zieht sich zusammen.
Gerade eben hatte ich noch mit dem Gedanken gespielt, bei ihr zu bleiben und auf das restliche Geld zu warten, um dann gemeinsam mit ihr nachzukommen, doch dieser ist gerade erloschen.
„Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ihr müsst gehen.“ Mein Onkel tritt zu Haytham hervor, packt seine Schultern und blickt ihm tief in die Augen: „Ihr. Schafft. Das.“
Ihre Stimmen hallen wie ein Echo in meinem Kopf.
Noch immer sitze ich regungslos am selben Fleck auf dem Boden. Ein starker Druck liegt auf meinen Ohren und lässt die gesamte Geräuschkulisse samt ihren Stimmen und Schüssen verdumpfen, der durch ein hohes, schrilles Pfeifen durchdröhnt wird.
Aus meinen aufgerissenen Augen meiner erstarrten Miene entlaufen die angesammelten Tränen, die als dicke Linie meine Wangen hinunterlaufen.
Während mein Onkel noch immer auf Haytham einredet, rasen innerhalb von Sekunden tausend verschiedene Bilder durch meinen Kopf.
Ich sehe plötzlich eine Welt ohne meine Mutter und ohne meinen Onkel vor mir. Eine Zukunft allein mit meinem Bruder in einem fremden Land. Ich sehe wie wir planlos versuchen, den Weg zu finden. Zu wenig Geld haben, irgendwo stecken bleiben und mit unserem letzten Geld um Essen kämpfen. Wie meine Mutter sich alleingelassen in den Schlaf weint, weil sie ihre Söhne vermisst. Ich sehe, wie sie tatsächlich zusammen nachkommen und wir gemeinsam glücklich werden.
Gleichzeitig jedoch sehe ich, wie ich auf ein Leben ohne sie verzichte und nicht ins Flugzeug steige, sondern bei ihr in ihren Armen bleibe. Wie ich ihr meinen Platz gewähre, mit meinem Onkel in der Türkei bleibe und wir gemeinsam hart schuften, um das letzte Geld für uns aufzutreiben.
All das sehe ich in den wenigen Sekunden, in denen ich mit meinen verweinten Augen in ihre schaue.
Währenddessen geht mein Onkel mit nun ruhiger Stimmlage alle Einzelheiten durch.
„Eure Mutter wird bei eurem Onkel Ahmed bleiben. Da ist es sicherer“, beginnt er. „In drei Tagen werden wir das Flugzeug nach Libanon nehmen.“
Drei Tage.
Diese Worte lassen mich in eine kurze Trance fallen, in der meine Umgebung verblasst und ich wieder in meine Bilder eintauche, in denen ich mich von jedem verabschieden muss, der noch bei uns ist und mir am Herzen liegt.
Obwohl wir immer wussten, dass wir eines Tages fliehen würden, rasen durch seine Worte die künftigen und letzten drei Tage in meinem Heimatdorf soeben an mir vorbei.
Er beschreibt die Vorgänge vom Umsteigen der Flüge, über wichtige Hinweise, die zu beachten sind wie Papiere, die wir vorzeigen oder noch besorgen müssen, bis hin zur Bootsfahrt über das Meer.
Die Bootsfahrt.
Ich habe mich monatelang davor gefürchtet. Ich werde sterben. Ich kann nicht schwimmen. Ich werde sterben.
Ich atme tief ein.
Ich darf meine Nerven jetzt nicht verlieren. Nicht vor meiner Mutter. Ich versuche mich voll und ganz auf meinen Atem zu konzentrieren. Blinzle einige Male, um meine Augen vor Trockenheit nicht tränen zu lassen, so wie ich es immer tue, wenn ich mich in überfordernden Situationen vom Wesentlichen ablenken will.
Jetzt senke ich meinen Blick, denke darüber nach, zu ihr rüberzusehen. Ich traue mich nicht.
Blinzeln, atmen, blinzeln, während ich versuche, meine Panik nicht nach außen dringen zu lassen.
Ein letztes Mal atme ich tief ein und schließe die Augen, als ich die Luft langsam durch meine Lippen strömen lasse, während mein Brustkorb sich senkt. Mein Puls wird langsamer und ich blicke mit neu geschöpfter Kraft zu meiner Mutter, die sich ebenfalls beruhigt hat und unauffällig ihre Tränen an ihrem Hijab abwischt.
Mein Onkel hatte offenbar all seine detailreichen Hinweise für unsere Flucht ausgesprochen und gewinnt meine Aufmerksam zurück, als er seine Rede abschließt: „Also denkt dran, ihr schafft das, ihr wisst über alles Bescheid. Wir werden es gemeinsam angehen und wieder zueinander finden. Wir müssen jetzt nur stark bleiben. Wir dürfen nicht aufgeben!“
Darauf folgen einige Minuten, in denen wir schweigsam an die Wände starren, um das Ganze sacken zu lassen.
Auch Haytham scheint sich beruhigt zu haben oder zumindest nicht zu versuchen, es zu verhindern und sitzt mit angewinkelten Knien an der Wand.
Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, die wir alle zusammen und doch distanziert dasitzen, während mit jeder folgenden Sekunde der Raum mit Schweigen gefüllt wird und uns zu erdrücken scheint.
Als der unangenehme Moment spürbar wird, in jenem ein Wort fallen sollte, jedoch keiner den Mut fasst oder weiß, welches auch nur in irgendeiner Weise die Situation verändern könnte, stützt sich meine Mutter vom Teppich auf und fängt in der Küche zu kochen an.
Das dumpfe Geräusch des schneidenden Messers füllt die Leere des Raums.
Ich blicke starr hinein und versinke in seinen Nachklängen, als Haytham plötzlich aufsteht. Sein Gesichtsausdruck skeptisch: „Und für uns gibt es jetzt auf einmal genug Geld? Anfangs sagtest du, es würde noch ein paar Wochen dauern, bis wir genug für die ganze Reise haben.“
Mein Onkel neigt seinen Kopf zu meiner Mutter, die sich aus der Küche nur für einen kurzen Blick zu ihm umdreht und ihn mit feuchten Augen anlächelt.
Seine Miene bleibt ernst.
Kurz überlegt er und sieht uns dann an: „Eure Mutter war bereit, das Armband eurer Großmutter zu verkaufen.“
Und tatsächlich entdecke ich nun die freie Stelle an ihrem Handgelenk, an der immer ihr einziges Schmuckstück glänzte, das sie vor vielen Jahren geerbt und begehrend jeden Tag getragen hatte. Ich starre mit großen Augen darauf.
Ich kann es nicht fassen.
„Mama…“, entfleucht es mir, nicht fähig, meine Gedanken in Worten zu umschreiben. „Das hättest du nicht tun müssen“, kommt es mir bei gebrochener Stimme beinahe gar nicht raus.
Sie hört kurz auf die schlechten Stellen des harten Brots zu entfernen und dreht sich zu uns um.
„Doch, das musste ich“, widerspricht sie mir ernst. „Wir hatten keine andere Wahl. Auf eure Verwandten zu warten, hätte zu viel Zeit gekostet. Deine Großmutter hätte das so gewollt.“
Ich muss fast weinen.
Schon wieder hatte meine Mutter ein Opfer geben müssen, um uns zu beschützen.
Kapitel 2
Sie zieht tief an ihrer Zigarette, lässt den Qualm eine Weile lang in ihren Lungen sich ausbreiten und bläst ihn schließlich bei langem Atem langsam als große Rauchwolke aus.
Die Zigarette hält sie zwischen Zeige- und Mittelfinger, als sie auf den glühenden Ansatz schaut, wie er rot aufleuchtet und in schwarzen Qualm sich lösend abbrennt.
Wie immer kletterten sie aus Nataschas Zimmerfenster hinaus auf das ein Quadratmeter große Stück des Daches, auf dem sie sich an die Hauswand lehnen und über die zwischen den Tannenspitzen ragenden roten Dächer hinwegschauen.
„Was wirst du tun?“, fragt Natascha, die sich neben ihr im Schneidersitz eine Zigarette dreht.
Mit verträumtem Blick sitzt Sarah da und starrt, ohne ein Auge zu zucken, in die Luft.
„Keine Ahnung“, antwortet sie schließlich, zieht noch einmal tief an der Zigarette und setzt sich nun auch mit angewinkelten Beinen auf.
Nachdem sie die begonnene Ausbildung beim Bäcker abbrach, weil sie bemerkt hatte, dass es nicht das war, was sie sich für den Rest ihres Lebens wünschte und jetzt auch noch ihren Teilzeitjob im Supermarkt hinschmiss, weil sie ihren Chef nicht leiden konnte, ist sie wieder auf der Suche nach etwas Neuem, das sie in dem freien Jahr tun könnte, bevor sie wieder eine Ausbildung oder ein Studium beginnen würde.
„Du kannst ja wieder in einem anderen Supermarkt anfangen.“
Sarah seufzt: „Das ist so öde. Wenn ich schon den Sommer arbeiten muss, dann wenigstens irgendwas Aufregendes, das ich vielleicht auch später noch weitermachen kann.“
„Und was wäre das?“
Sarah lehnt sich wieder zurück und schweigt.
„Weißt du denn schon, in welche Richtung du später mal gehen willst?“
„Keine Ahnung“, antwortet sie jetzt mit leicht genervtem Unterton.
Diese Frage hatte sie in den letzten Jahren so oft gestellt bekommen, sodass die Konfrontation der gleichen Frage in den letzten Tagen an ihren Nerven zu zerren beginnt, weil sie darauf noch immer keine Antwort weiß.
„Ach, es gibt für jeden was. Du musst dich nur mal ein bisschen genauer umschauen. Bisher hattest du ja immer nur das genommen, was sich gerade anbot und das war für dich einfach immer das Falsche.“
Sarah nickt, während sie ihre Hand durch ihr langes dunkles Haar fährt. Sie weiß, dass Natascha recht hat und es nur gut mit ihr meint, doch das sich immer wiederholende Gespräch nervt sie. Alle sagten ihr das Gleiche.
„Jetzt nur nicht aufgeben. Nicht auf dir sitzen lassen. So eine Lücke im Lebenslauf sieht richtig schlecht aus.“
Es war nicht so, dass sie auf all die Weisheiten nicht selbst kommen würde oder nicht wüsste, dass sie mit ihrem unangestrengten Verhalten nicht weiterkommt.
Sie wollte all das einfach nicht hören.
Seit dem Vorfall in ihrer Kindheit, brauchte sie zu viel Zeit, um wieder in einen normalen Alltag zu finden und tat seither nur das Nötigste. Dass sie nach der Schule dann ohne Ideen dastehen würde, hatte sie damals nicht bedacht.
Aber das eigentliche Problem war, dass sie ihre Lebensfreude nicht mehr wiederentdeckte. Das war der Grund, weshalb sie bis heute keine Begeisterung in Dingen findet, die sie dazu bewegen könnten, sich reinzuhängen, da sich die Mühe nicht auszuzahlen scheint. Etwas, das niemand in ihrem Umfeld nachvollziehen oder jemals verstehen könnte.
„Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich tun könnte. Supermärkte und Restaurants sind scheiße. Die Arbeit als Service auf Festivals war zwar cool, aber sehr stressig und viel zu spontan. Ich kann nicht immer auf Veranstaltungen warten. Und Modeläden… keine Ahnung, da halten sich alle für was Besseres.“
Natascha lacht laut auf und bringt Sarah zum Schmunzeln.
„Als würdest du überall nach einem Grund suchen, nichts machen zu müssen.“
„Ich wüsste einfach gerne, wofür ich geschaffen bin. Ich glaube jeder hat etwas, das wie sein Element ist. Du hast deins in der Kunst gefunden. Wirklich, dein Studienplatz ist einfach das Beste, was dir passieren konnte. In der Schule hab ich dich immer, statt zu schreiben, rumkritzeln sehen. Und um so einen Platz zu kriegen, muss man echt talentiert sein. Ich wünschte, ich hätte so etwas.“
Während sie spricht, schaut sie in die Ferne, als säße sie allein da und nimmt schließlich einen langen Zug ihrer Zigarette.
Natascha schaut sie mit gerührtem Blick an und schüttelt den Kopf.
„Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Du hast auch etwas. Jeder hat etwas, du musst nur genauer überlegen. Was ist es, was du wirklich willst?“
Sarah verstummt. Sie weiß es nicht.
Es folgt eine Minute, in der Natascha mit ihrer Zunge über das Zigarettenblättchen fährt, es geschickt mit den Fingern zusammendreht und Sarah ihre Zigarette im Aschenbecher ausdrückt.
„Weißt du“, beginnt Natascha lächelnd, „ich weiß noch genau, dieser eine Tag in Spanien auf unserer Klassenreise. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und gar nicht zum Essen gekommen. Dann saßen wir im Zug und haben unser Pausenbrot gegessen. Ich habe mein Erstes heruntergeschlungen, als der arme Junge durch den Wagon kam und jeden nach Geld fragte.“
Diesmal schaut Natascha, wie in die Zeit zurückversetzt, in die Ferne, während Sarah, sich nicht an die Geschichte erinnernd, gespannt zuhört.
„Ich habe gedankenlos mein zweites Brot vor seinen Augen aufgegessen, aber du hast aufgehört, ihn kurz angesehen, bis er vor dir stand und dich auch bettelnd ansah. Und dann hast du ihm, ohne weiter nachzudenken, dein Brot gegeben und gelächelt. Ich weiß noch, wie sehr sich der Junge gefreut hat und irgendwas auf Spanisch sagte. Und du hast so gestrahlt. Da wusste ich, dass du ein großes Herz hast. Mehr als alle anderen, vor allem, weil ich weiß, wie viel Hunger du hattest, weil du den ganzen Ausflug über gejammert hast.“
Natascha lacht und blickt zu Sarah rüber, die nur bescheiden kichert. „Aber mal ehrlich, von da an habe ich dich bewundert. Ich dachte, dass ich auch ein bisschen so sein möchte und dass du die Welt verändern kannst.“
Sarah prustet los, als hätte sie einen Witz gemacht.
Noch versucht Natascha ernst zu bleiben und sie mit dem Todesblick zum Schweigen zu bringen, bis sie sich schließlich nicht mehr halten kann und ebenfalls loslacht.
„Ich meine das ernst!“, ruft sie dann. „Ich meine, das war in der fünften Klasse oder so.“
Als sich Sarah langsam beruhigt, spricht Natascha weiter.
„Es sollte jetzt nicht so schnulzig werden. Aber wirklich, diesen Moment habe ich komischerweise nie vergessen. Der hat mich irgendwie geprägt. Du solltest irgendwas in dieser Richtung machen. Mit Menschen. Helfen.“
Sie reicht ihr die Zigarette, die sie gerade gedreht hatte.
„Vielleicht hilft dir das auch. Ich meine, anderen helfen, so wie dir geholfen wurde. Vielleicht fühlst du dich dann auch besser.“
Seit die Beiden in der dritten Klasse zusammengesetzt wurden, um eine Partneraufgabe im Deutschunterricht zu erarbeiten, sind sie unzertrennlich. Natascha ist die einzige Person, die Sarah wie ein Buch mit all ihren Geschichten in- und auswendig kennt, weil sie die meisten davon mit ihr teilt und sie daran gemeinsam wuchsen.
„Klingt einleuchtend“, antwortet Sarah nachdenklich.
„Also…?“
„Naja, ich kann mich ja mal umschauen.“
„Das wollte ich von dir hören!“, grinst sie. „Das kann ich mir auch richtig bei dir vorstellen. Allein dein Umgang mit Kindern ist einer, den nur du draufhast.“
„Was?“, lacht Sarah mit fragendem Blick.
„Ja, immer wenn du mit Kindern zusammen bist. Das eine Mal zum Beispiel, als du babysitten musstest.“
„Meinst du Emil aus dem Nebenhaus?“
„Ja, genau. Mit dem bist du so gut klargekommen. Auf so ganz eigene Weise, als hättet ihr eure eigene Sprache.“
„Das war ja wohl nichts Besonderes!“
„Also ich komme mit Kindern gar nicht klar. Apropos: David kommt dich endlich wieder besuchen, oder? Wann ist er nochmal da?“, stichelt Natascha grinsend.
„War das jetzt eine Anspielung darauf, dass wir irgendwann Kinder haben, oder dass er eins ist?“
„Beides“, lacht sie.
„Weder das eine noch das andere! Er kommt in einer Woche und bleibt übers Wochenende.“
Kapitel 3
Zwei Tage sind bereits vergangen, in denen ich gezwungen war, mich von allen zu verabschieden, die gezwungen sind hier zu bleiben.
Zum Abendbrot sitzen wir nun zusammen im Kreis und essen schweigend das pappige Brot, während leise der alte Fernsehkasten rauscht.
Wir mussten das Brot auf die letzten Tage aufteilen und tunken es in Soße aus einer Konserve, dessen Ablaufdatum einige Wochen her ist und mit den letzten Gemüseresten vermischt wurde.
Ein Sättigungsgefühl verspüre ich schon seit Wochen nicht mehr.
Uns allen ist der Krieg ins Gesicht geschrieben, nicht zu erwähnen die Narben, die unseren Körper zeichnen. Mein Onkel ist als Doktor noch nie der gelassenste Typ gewesen, der von Stress keinerlei Anzeichen im Gesicht zeigt. Dennoch bekam er durch die letzten Monate mehr graue Haare, als sein wahres Alter es zulassen würde.
Aber meine Mutter traf es wohl am schlimmsten.
Ich möchte gar nicht genau wissen, wie viel Gewicht sie in den letzten Monaten verloren hat. Trotz alledem werden auch ihre Falten, die immer tiefer zu geraten scheinen, von ihrem aufgesetzten, trüben Lächeln, wofür sie sich Tag täglich die Kraft für uns nimmt, überstrahlt.
Was würde ich nur dafür tun, sie glücklich zu machen.
Ich nehme mir bereits jetzt fest vor, es bis nach Deutschland und zu einer guten Arbeit zu schaffen, bis ich mir ein schöneres Armband als ihr vorheriges für sie leisten und ihr persönlich übergeben kann, wenn sie dann bei uns ist.
„Ich habe eure Wäsche vorbereitet, die ihr mitnehmen werdet“, bricht sie auf einmal das Schweigen. „Zieht morgen ein langes Hemd und eine Hose an und packt euch das weitere Hemd und die Hose ein, die ich auf eure Betten gelegt habe.“
Sie hat die letzten Tage an nichts Anderes als an unsere Abreise denken können und an jedes kleinste Detail, an das sie uns fast jede Minute erinnert.
„Und jeder von euch packt seinen Pass und die restlichen Dokumente ein“, fährt sie fort. „Das Geld wird Onkel Raed bei sich haben-“
„Schon gut!“, unterbricht mein Onkel sie schroff.
Ich blicke unauffällig kurz zu ihr, dann zu ihm und dann wieder auf mein Essen.
Meine Mutter tut dasselbe.
Wäre heute nicht der letzte Tag vor der Abreise, dann wäre mein Onkel vermutlich gröber. Doch es ist das letzte gemeinsame Abendessen, bevor wir meine Mutter zurücklassen, durch jenen Gedanken allein ich in Tränen ausbrechen könnte und das macht uns zurückhaltender.
Bloß noch die eine Autofahrt von unserer Heimatstadt Daraa bis zum Flughafen nach Damaskus wird sie uns begleiten, nur um uns dann gehen zu lassen und wieder in die gefährliche Stadt zurückzukehren.
Meinem Vater zu Liebe möchte sie im gefährlichen Dorf bleiben und all das Risiko zu sterben in Kauf nehmen. Alles, was ihr bleibt, sind die Erinnerungen. Und die stecken in der Stadt.
„Danke Mama“, sage ich leise und lächle sie unsicher an.
Wieder nimmt sie sich die Kraft, um zurückzulächeln.
Es dauert nicht lange, bis wir das bescheidene Abendessen aufgegessen haben und uns in unserer kleinen Wohnung wieder separieren.
Haytham verkriecht sich mit seinem Handy aufs Bett, mein Onkel schaltet durch die flackernden Kanäle und meine Mutter wäscht das Geschirr in der Küche ab.
Ich bringe ihr den letzten Teller, der noch auf dem Tisch steht und beobachte sie eine Weile, während ich mich neben ihr an den Schrank lehne.
Ich weiß, dass sie weiß, dass ich neben ihr stehe, dennoch spült sie reglos weiter. Zum einen scheint sie mich zu ignorieren, zum anderen wirkt ihr Verstand nur halb anwesend.
Erst als mein Onkel den Fernseher lauter schaltet, stelle ich mich näher zu ihr und schaue ihr in die Augen.
„Alles in Ordnung?“, frage ich besorgt.
Sie blickt zu mir rüber und lächelt leicht.
„Ja, danke mein Schatz.“
Kapitel 4
Es ist wieder eine der Nächte, in denen sie nicht schlafen kann.
Eigentlich sind die Nächte leichter an den Fingern abzuzählen, die sie ganz durchschläft und am Morgen vor lauter Entspannung sich streckend aufwacht.
Doch leider liegt sie viel öfter da, starrt an die Decke, obwohl es zu dunkel ist, um etwas sehen zu können, dreht sich zur Seite, presst die Augen zusammen, mit der verzweifelten Hoffnung den Schlaf erzwingen zu können, nur um sich dann wieder auf die andere Seite zu drehen und die Wand anzustarren.
Sie legt den Kopf auf ihren angewinkelten Arm und schaut auf den Digitalwecker.
04:02.
Und noch immer kein Auge zugedrückt.
Es ist in den letzten Jahren immer seltener geworden, dass sie die Bilder vor sich sieht.
Ihre winzige Hand, die Nägel in ihren glitzernden Lieblingsfarben lackiert, in der mageren Hand ihrer Mutter, zu schwach, um noch richtig greifen zu können. Bevor Sarah sie fragen kann, ob sie müde ist, sieht sie eine Träne aus ihren starr geweiteten Augen laufen, die sich daraufhin nie wieder von allein schließen.
Sie reibt sich das Gesicht, um die Bilder zu verdrängen.
Nur noch an schlechten Tagen, an denen sie sich am liebsten den ganzen Tag im Bett verkriechen würde, kommen die Erinnerungen wieder hoch.
Ihre Therapeutin, die ihr und ihrem Vater nach dem Verlust Jahre begleitete, hatte ihr geraten, Tagebuch zu schreiben. Sarah befolgte eifrig diesem Rat und als nach Notizen, Kürzel und zuletzt Symbole für ihre Erlebnisse und Emotionen folgten, begann sie ein Schema darin zu erkennen.
Sie konnte sich einen wöchentlichen Zyklus in Form eines Kurvendiagramms vorstellen. Seine Linie bildet Wellen durch tägliche Höhen und nächtliche Tiefen. Und genauso besteht die gesamte Woche aus einem einzigen Tief in der Mitte und Höhen zu Beginn und Ende der Woche.
Seit der Unterstützung ihrer Therapeutin hatte sie zwar schon viel öfter rausgehen können, das Schicksal ihrer Mutter akzeptiert und die wesentliche Angst vor weiteren Verlusten engstehender Personen überwunden, doch schlafen kann sie trotzdem kaum.
Und heute ist das wöchentliche Tief der täglichen Tiefpunkte.
Sie dreht sich ihrer Wand zu und liegt ihr so nah, dass sie ihren Atem daran spürt. Als ihr die Luft auszugehen scheint, dreht sie sich seufzend auf den Rücken und starrt an die Decke.
Sie weiß, dass nicht viel Zeit vergangen ist, seit sie das letzte Mal auf den Wecker sah, dennoch neigt sie ihren Kopf zur Seite.
04:06.
Sie drückt ihre Hände auf die Augen.
So sehr sie sich auch wünscht einzuschlafen und so sehr ihre Augen vor Müdigkeit zufallen und sich angeschwollen anfühlen, lassen es ihre Gedanken einfach nicht zu.
Jede Nacht sind es dieselben düsteren Fragen, die sie verfolgen. Warum musste sie sterben? Wieso das alles? Wozu sind wir hier? Was macht das alles für einen Sinn? Muss es einen Sinn ergeben?
So kindisch sich die Fragen für sie anhören und sie es aus Scham keinem sagen kann, so schwer lassen sie sich aus dem Kopf schlagen und durch positive Gedanken ersetzen.
Sie stellt sich oft vor, was sie eigentlich aus ihrem Leben machen könnte. Weltreisen, Länder und Kulturen erkunden, heiraten, Mutter werden, Heldin sein.
All die unbegrenzten Möglichkeiten, die für sie wahr werden könnten, wenn sie es nur wollte und sich dafür einsetzte.
Doch so schön die größten Vorstellungen auch sind, sie scheinen es nie wert.
Allein der Gedanke daran ermüdet sie und lässt sie in dem Glauben, dass sie nichts von all dem vollkommen glücklich machen könnte, weil sie den Sinn dahinter nicht versteht.
Und das macht sie unendlich traurig.
Wie könnte sie so etwas jemals einer Person erzählen, geschweige denn einer Vertrauensperson, die sie liebt. Wie könnte sie es je David sagen.
Dass sie ihn zwar liebe, doch eine wunderbare Zukunft mit ihm an ihrer Seite und wunderbaren gemeinsamen Kindern es nicht wert wären. Niemand könnte es verstehen, nicht einmal sie selbst tut es. Sie weiß nur, dass es so ist.
Sie hört Nataschas Stimme: Was ist es, was du wirklich willst?
Ihre reibenden Finger von den Augen lösend blickt sie erneut auf den Wecker.
04:07.
Sie beschließt ein Duell zu beginnen und so lange, ohne ein Blinzeln darauf zu blicken, bis die Minuten schneller vergehen.
Dabei überlegt sie, ob es am Schlafmangel liegt, dass sie am Tag müde ist und in der Nacht keinen Schlaf findet, was zu einem Teufelskreis und somit zu immer größer werdendem Schlafmangel und immer längeren Nächten führen würde.
Sogar solche Gedanken halten sie davon ab, in den Schlaf zu sinken.
Doch genauso gut weiß sie, dass sie nicht einschlafen möchte, weil sie weiß, was für immer wiederkehrende Träume sie verfolgen würden, die sie in der noch dunkleren Nacht schweißgebadet aufwachen ließen.
Sie blinzelt.
Erst Sekunden später sieht sie die rotleuchtende Zahl sich wechseln.
04:08.
Sie dreht sich auf ihren Rücken und schließt die Augen.
All die Verwirrtheit und Überforderung lässt in ihr die Vorstellung aufleben, wie sie mit dem Auto weit raus an einen großen, komplett leblosen See fährt, der sich tief, inmitten eines Waldes befindet, an dem sie sich die Seele aus dem Leib schreien kann und dessen Echo über der Stille des Wassers wiederhallt.
Als sie drei Jahre alt war, waren ihre Eltern mit ihr an einen See gefahren, an dem eine für sie unbeschreibliche Ruhe herrschte, in der sie gemeinsam für einige Stunden von der chaotischen Welt getrennt werden konnten. Eine der wenigen Erinnerungen, die sie von ihrer Mutter hat, die sie bei seelischer Überforderung immerzu an diesen See erinnern ließ.
Erst vor ein paar Monaten wurden ihr diese Zusammenhänge bewusst. Überrascht darüber, dass die Erinnerung noch tief in ihr vorhanden war, die eines Nachts wie diese zurück in den Sinn kam und ihr ihre Sehnsucht danach erklärte, die sie erst im Laufe der letzten Jahre unterbewusst bildete.
So gerne läge sie in diesem Moment am Ufer ihrer Vorstellung, sobald sie ihre Augen wieder öffnete.
Der Regen plätschert ihr ins Gesicht, der mit stürmendem Wind auf ihren Körper prasselt. Der Wasserspiegel erhöht sich, das Rauschen der fallenden Tropfen in ihren Ohren, bis das Wasser über ihren Körper klettert, die Beine, den Bauch, die Arme, den Hals, die Nase einnimmt. Der rauschende Klang erstickt, als eine dumpfe Stille sie einsaugt und in die dunkle Tiefe zieht, noch immer am Ufer liegend, während der See immer weiter hinaufsteigt. Die Dunkelheit nimmt sie ein, sie fühlt den Druck auf ihrem Brustkorb, die dünner werdende Luft in ihren Lungen. Den Mund aufreißend, schnappt sie nach Luft und atmet tief ein, während mit jedem Atemzug Blasen im Wasser hinaufsteigen, dessen Oberfläche sie nicht mehr erkennen kann. Ihr Brustkorb senkt und hebt sich, Blasen bilden sich und steigen hinauf, aus ihrer Nase, aus ihrem Mund, während sie das Gefühl hat zu ertrinken.
Noch immer ist sie in ihrem Zimmer.
04:13.
Mit brennenden Augen, zum einen wegen Müdigkeit und zum anderen aus Frust, schaut sie auf ihr Handy, liest die letzten Nachrichten ihres Freundes und versucht ihn daraufhin zu erreichen. Vergebens, da er bereits tief und fest schläft und womöglich gerade von ihr träumt. Vieles wäre so viel einfacher und erträglicher, wenn er bei ihr wäre, sie in die Arme nehmen und mit ihr gemeinsam einschlafen könnte.
Doch die Distanz war es überhaupt, durch die sie sich näherkamen und sich schließlich ineinander verliebten. Ohne ihre Vergangenheit und die schreckliche Angst vor weiteren Verlusten, hätten sie im Internet nie zueinandergefunden. Also hatte all das auch sein Gutes.
Wenn er nur wüsste, was sie jede Nacht durchmachen muss und wie unbeschreiblich schrecklich das Gefühl der ständigen Angst und Frustration ist, denkt sie sich.
Wenn sie alle nur wüssten.
Kapitel 5
Die Nacht ist eingebrochen und Haytham und mein Onkel schlafen bereits. Der Wind weht in frischen Zügen durch das Fenster.
Nachdem ich die letzte Stunde mit meinen alten Klassenkameraden, die am anderen Ende der Stadt in Sicherheit wohnen, übers Handy geschrieben hatte, fange ich jetzt erst an, meine Tasche zu packen.
Der schwarze Rucksack, den ich vor Jahren von meinem Vater geschenkt bekam, ist das Einzige, das mir von ihm blieb. Es wird mein wichtigstes Begleitstück werden, in dem ich meine einzigen Besitztümer wie Handykabel, Kopfhörer, Kopfschmerztabletten und die restlichen wenigen Papiere, die meine Identität bestätigen, zusammentue.
Ich greife hinein und prüfe, ob alles beisammen ist. Jedes einzelne Dokument durchblätternd merke ich, dass ich zittere.
Das ist alles, das meine Existenz verantwortet.
Als ich die von meiner Mutter zusammengefaltete Jeans nehme, um sie ebenfalls in meine Tasche zu packen, spüre ich etwas Kleines in der Hosentasche. Ich falte sie auf, greife hinein und spüre eine kalte Oberfläche an meinen Fingern. Danach greifend, öffne ich meine Handfläche und erblicke etwas sehr Vertrautes.
Ich muss schmunzeln.
Keine Ahnung wie es in meine Hosentasche geriet. Doch hätte ich die Wahl gehabt, etwas auszusuchen, das ich aus meinem Leben mitnehmen kann, hätte ich genau das gewählt.
Ich stecke es in die Hosentasche zurück, als mein Handy erneut summt.
Ich nehme es und tippe eine weitere Nachricht an einen Freund, der mir alles Gute wünscht.
Meine Mutter flickt mit Nadel und Faden eines ihrer alten Tücher, das durch fliegende Trümmer ein Loch bekam. Ich spüre ihren Blick auf mir liegen.
„Mohammed“, flüstert sie.
Ich blicke auf.
„Du solltest langsam schlafen gehen, ihr müsst morgen früh raus.“
Langsam nicke ich und lächle dann. Ich lege mein Handy auf den Tisch und setze mich neben sie.
Schweigen.
Ich schaue in ihre Augen wie so oft in den letzten Tagen, hoffend keine Tränen darin zu entdecken und finde sie stattdessen leicht glänzend und vom langen Tag etwas gerötet vor. Meinem Blick weichend und auf ihr Tuch runterschauend. Es liegt zwischen ihren Fingern, doch die Nadel bewegungslos.
Ich überlege zu fragen, was denn los ist, doch kenne die Antwort.
Ich habe auch Angst.
Instinktiv lege ich, ohne zu zögern, meinen Arm um sie, sitze dicht neben ihr und spüre ihren Kopf auf meiner Schulter liegen.
Das sind die letzten Stunden, in denen ich ungestört neben meiner Mutter sitzen kann. Die letzten zählbaren Stunden bevor ich von ihr getrennt werde.
Kapitel 6
Nachdem sie von ihrem Freund um zehn Uhr mit einem Anruf geweckt wurde, es nach dem einstündigen Telefonat aus dem Bett schaffte und frühstückte, sitzt sie nun an ihrem Schreibtisch und öffnet ihren Laptop.
Eigentlich würde sie auf YouTube eine Folge ihrer Lieblingssendung laufen lassen und nach der einen die nächste beginnen, bis Stunden vergangen sind, jene Tatsache sie verblüfft auf die Uhr blicken lässt, woraufhin sie beschließt, am Folgetag etwas Produktiveres zu leisten.
Doch stattdessen wird ihr auf der Startseite ein Video aus den Nachrichten vorgeschlagen.
Einen Moment lang überlegt sie, bevor sie mit dem Cursor von dem ursprünglich geplanten Video auf das neue geht und klickt.
„Dramatische Szenen an der griechisch-mazedonischen Grenze“, beginnt die Stimme aus den Lautsprechern des Laptops zu berichten.
„Polizisten setzen Blendgranaten und Schlagstöcke gegen Flüchtlinge ein. Seit Mazedonien seit der Flüchtlingskrise den Ausnahmezustand ausgerufen hat, herrschen hier verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Trotzdem gelingt es hunderten Flüchtlingen über den Stacheldrahtzaun zu klettern und auf mazedonisches Staatsgebiet zu gelangen.“
Obwohl Sarah bereits so viele Berichte über den Krieg im nahen Osten und der Flucht vieler Menschen gelesen und gesehen hat, läuft ihr erneut ein Schauer über den Rücken.
Der Anblick verzweifelter Personen, die mit Panik in ihren Augen um ihr Leben rennen und von anderen in Uniform und Schutzhelmen zurückgedrängt werden, erinnert sie an einige Spielfilme, die sie in den letzten Jahren sah und ihr schwerfallen lassen, zu glauben, dass die Bilder der Realität entspringen.
„Die meisten der Flüchtlinge sind vor der Gewalt in Syrien geflohen. In dem Bürgerkriegsland sehen sie für sich keine Zukunft. Viele wollen weiter in EU-Länder wie Deutschland oder Schweden.“
Sie erinnert sich an Bilder aus den Nachrichten, die etliche überfüllte Turnhallen zeigen.
„Nach Angaben Mazedoniens haben seit Mitte Juni zweiundvierzigtausend Flüchtlinge die mazedonische Grenze überquert. Derzeit harren im Grenzgebiet rund zweitausend Flüchtlinge aus. Die meisten von ihnen haben die Nacht bei Regen unter freiem Himmel verbracht. Vor dem Ausnahmezustand hatte die mazedonische Regierung in Skopje täglich im Schnitt eintausenddreihundert Flüchtlinge ins Land gelassen und mit Papieren für die Zugfahrt nach Serbien ausgestattet, von wo es weiter in EU-Länder gehen soll.“
Das Video ist zu Ende. Sarah scrollt ein wenig durch die Liste mit anderen Vorschlägen und klickt erneut.
„Tausende Flüchtlinge überqueren die mazedonisch-serbische Grenze zu Fuß und nehmen einen Weg von dreihundert Kilometern auf sich“, spricht ein Reporter in sein Mikrofon, hinter ihm eine endlose Menschenmasse an ihm vorbeiziehen.
„Nur wenige hundert Personen der zweitausend heute an der Grenze angekommenen Flüchtlinge nutzen die von der Regierung zur Verfügung gestellten Busse nach Serbien“, fährt er fort. „Aus Angst wieder nach Mazedonien zurückgebracht zu werden, entscheiden sich immer mehr Menschen dazu, den Weg zu Fuß weiterzugehen.“