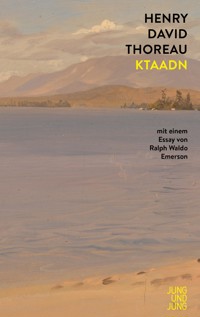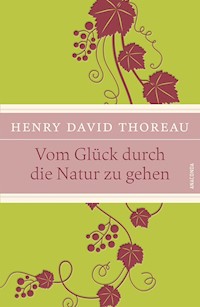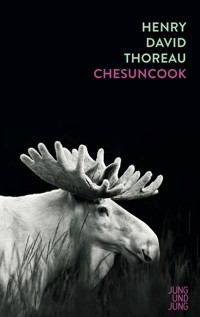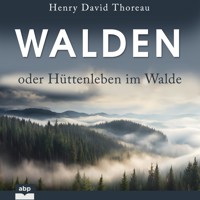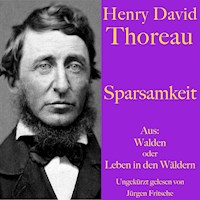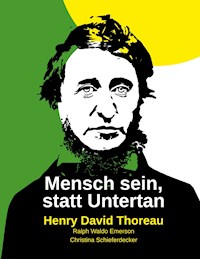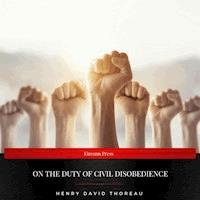Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Walden - Leben in den Wäldern" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. In Walden beschreibt Thoreau sein Leben in einer Blockhütte, die er sich 1845 in den Wäldern von Concord am See Walden Pond auf einem Grundstück seines Freundes Ralph Waldo Emerson baute, um dort für mehr als zwei Jahre der industrialisierten Massengesellschaft der jungen USA den Rücken zu kehren. Nach eigener Aussage ging es ihm dabei jedoch nicht um eine naive Weltflucht, sondern um den Versuch, einen alternativen und ausgewogenen Lebensstil zu verwirklichen.Das 1854 veröffentlichte Buch kann nicht als Roman im eigentlichen Sinne angesehen werden, vielmehr ist es eine Zusammenfassung und Ausformung seiner Tagebucheinträge, die er in den symbolischen Zyklus eines Jahres integriert und zusammenfasst. Dabei ist sein Stil geprägt von hoher Flexibilität und Sprachkunst, die die Übertragung in andere Sprachen oft erschwert hat. Die achtzehn Kapitel des Buches sind unterschiedlichen Aspekten menschlichen Daseins gewidmet, so enthält es zum Beispiel Reflexionen über die Ökonomie, über die Einsamkeit, Betrachtungen über die Tiere des Waldes oder über die Lektüre klassischer literarischer Werke. Henry David Thoreau (1817-1862) war ein amerikanischer Schriftsteller und Philosoph.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walden - Leben in den Wäldern
Inhaltsverzeichnis
Sparsamkeit
Als ich die folgenden Seiten, oder vielmehr den größten Teil derselben schrieb, lebte ich allein im Walde, eine Meile weit von jedem Nachbarn entfernt in einem Hause, das ich selbst am Ufer des Waldenteiches in Concord, Massachusetts, erbaut hatte und erwarb meinen Lebensunterhalt einzig durch meiner Hände Arbeit. Ich lebte dort zwei Jahre und zwei Monate. Jetzt nehme ich wieder am zivilisierten Leben teil.
Ich würde meine Angelegenheiten nicht so sehr der Kenntnis meiner Leser aufdrängen, wenn nicht meine Mitbürger solch genaue Erkundigungen über meine Lebensweise eingezogen hätten, daß mancher ihr Vorgehen wohl als unerträglich bezeichnen würde, während ich es, in Anbetracht der obwaltenden Verhältnisse, als sehr erklärlich und gar leicht erträglich empfand. Die einen fragten, was ich gegessen, ob ich mich einsam gefühlt oder Furcht gehabt habe usw. Andere hätten gern gewußt, welcher Teil meines Einkommens von mir zu Wohltätigkeitszwecken bestimmt gewesen sei, und wieder andere, die große Familien hatten, wollten wissen, wieviel arme Kinder ich unterstützte. Ich bitte deshalb diejenigen meiner Leser, die kein besonderes Interesse für mich fühlen, um Verzeihung, wenn ich es wage einige dieser Fragen in diesem Buche zu beantworten. In den meisten Büchern sucht man das »Ich«, die erste Person, zu vermeiden. Hier will ich sie beibehalten. Das ist, was den Egoismus anbetrifft, der einzige Unterschied. Meistens vergessen wir, daß es doch nur die erste Person ist, die redet. Ich würde nicht so viel über mich selber sprechen, wenn es einen anderen Menschen gäbe, den ich gerade so gut kennen würde. Leider bin ich durch den engen Kreis meiner Erfahrungen auf dieses Thema beschränkt. Überdies verlange ich für meine Person von jedem Schriftsteller als Vorrede oder als Schlußwort einen einfachen und ehrlichen Bericht über sein Leben, und nicht bloß das, was er über anderer Menschen Leben hörte. Einen Bericht, wie er ihn etwa aus fernem Lande an seine Verwandten schicken würde. Denn wenn er ehrlich und lauter gelebt hat, so muß das in einem weit von mir entfernten Lande gewesen sein. Vielleicht sind diese Zeilen hauptsächlich an arme Studenten gerichtet. Meine übrigen Leser müssen sich schon die Stellen, die ihnen genehm sind, aneignen. Ich hoffe zuversichtlich, daß niemand bei der Anprobe die Nähte des Rockes ausdehnt, denn der Rock kann dem, dem er paßt, vielleicht gute Dienste leisten.
Ich möchte gern mancherlei sagen – nicht so viel über die Chinesen und Sandwichsinsulaner als über Euch, die Ihr diese Zeilen lest und die Ihr in Neuengland leben sollt; etwas über Eure Zustände, hauptsächlich über Eure äußeren Zustände oder Verhältnisse in dieser Welt, in dieser Stadt, welcher Art sie sind, ob sie notwendiger Weise so schlecht sein müssen wie sie sind, oder ob sie nicht ebenso leicht verbessert werden könnten wie nicht. Ich bin kreuz und quer in Concord herumgewandert, und überall in den Läden, in den Büros und auf den Feldern gewann ich den Eindruck, daß die Bewohner auf tausendfache, merkwürdige Weise für ihre Sünden büßten. Ich habe gehört, daß die Brahmanen sich der Hitze von vier Feuern aussetzen, ins Antlitz der Sonne schauen, oder daß sie, den Kopf nach unten, über einem Feuer hängen, daß sie über ihre Schulter gen Himmel blicken, »bis es ihnen unmöglich wird ihre natürliche Stellung wieder einzunehmen, während durch die Verdrehung des Halses nur Flüssigkeiten in den Magen gelangen können.« Ich habe gehört, daß sie ihr ganzes Leben angekettet an die Wurzel eines Baumes verbringen, oder daß sie wie Raupen kriechend ungeheure Reiche ausmessen, oder mit einem Fuße auf der Spitze einer Säule stehen. Doch diese Äußerungen bewußter Reue sind kaum unglaublicher oder erstaunlicher als die Szenen, deren Zeuge ich täglich bin. Die zwölf Arbeiten des Herkules waren belanglos im Vergleich mit denen, die meine Nachbarn unternommen haben. Denn Herkules hatte nur zwölf Arbeiten zu verrichten, dann war er fertig. Ich konnte dagegen niemals beobachten, daß diese Menschen ein Ungeheuer erschlugen oder einfingen, oder daß sie irgend eine Arbeit beendigten. Ihnen fehlte der Freund Jolaos, der mit glühendem Eisen den Hals der Hydra versengte. Darum wachsen, sobald ein Kopf zerschmettert ist, zwei neue nach.
Ich sehe junge Leute, meine Mitbürger, deren Unglück es ist, daß sie Bauernhöfe, Häuser, Scheunen, Vieh und Ackergerät geerbt haben. Denn solche Dinge sind leichter erworben als an den Mann gebracht. Es stände besser um sie, wären sie auf offener Weide geboren und von einer Wölfin gesäugt, denn dann würden sie mit klareren Augen erkennen, wo das wahre Feld ihrer Tätigkeit liegt. Wer hieß sie Sklaven des Bodens sein? Warum sollen sie ihre 60 Morgen Land verzehren, wenn ein Mensch doch nur dazu verdammt ist sein Häufchen Schmutz zu essen? Warum sollen sie gleich nach der Geburt damit beginnen ihr Grab zu graben? Sie sollen ein Menschendasein führen, sich dabei mit all diesen Dingen abplagen und so gut wie möglich vorwärts zu kommen versuchen. Wie manche arme unsterbliche Seele kreuzte meinen Weg, fast erdrückt und erstickt unter ihrer Last! Sie kroch des Lebens Gleis hinab und plagte sich mit Ställen ab, die 75 zu 40 Fuß groß waren – mit Augiasställen, die niemals gereinigt wurden, mit hundert Morgen Land, Äckern, Wiesen, Weiden und Waldparzellen! Die Unbegüterten, die sich nicht mit solchen unnötigen, ererbten Fronen herumbalgen, haben genug zu tun ein paar Kubikfuß Fleisch zu beherrschen und zu kultivieren.
Doch die Menschheit krankt an einem Irrtum. Der bessere Teil der Menschen ist bald als Dünger unter den Erdboden gepflügt. Das scheinbare Verhängnis – gewöhnlich Schicksal genannt – heißt sie, wie in einem alten Buche geschrieben steht, Schätze sammeln, welche die Motten und der Rost fressen und denen die Diebe nachgraben und stehlen. Ein Narrenleben haben sie geführt: das wird ihnen am Abend ihres Daseins, vielleicht auch schon früher klar werden. Man erzählt, daß Deukalion und Pyrrha dadurch Menschen erzeugten, daß sie Steine über ihre Häupter hinter sich warfen:
»Inde genus durum sumus, experiensque laborum »Et documenta damus quia sumus origine nati.« Daher sind wir ein hartes Geschlecht, ausdauernd bei der Arbeit, Und für unsere Abkunft liefern wir selbst den Beweis.
Raleighs wohlklingende Übersetzung dieser Worte lautet:
»From thence our kind hard-hearted is, enduring pain and care, »Approving that our bodies of a stony nature are.«
So kann es gehen, wenn man einem faselnden Orakel blind gehorcht, Steine über seinen Kopf wirft und nicht sieht wohin sie fallen.
Die meisten Menschen sind, selbst in diesem verhältnismäßig freien Lande, aus reiner Unwissenheit und Verblendung so sehr durch die künstlichen Sorgen und die überflüssigen, groben Arbeiten des Lebens in Anspruch genommen, daß seine edleren Früchte nicht von ihnen gepflückt werden können. Ihre Finger sind durch übermäßige Arbeit zu plump geworden, sie zittern zu sehr bei solchem Beginnen. Tatsächlich hat der arbeitende Mensch Tag für Tag keine Zeit zur inneren Läuterung. Es ist ihm unmöglich die menschlichen Beziehungen zu den Menschen zu unterhalten. Seine Arbeit würde auf dem Markte im Preise sinken. Er hat nur Zeit eine Maschine zu sein. Wie kann der seiner Unwissenheit abhelfen – und das fordert doch seine geistige Weiterentwickelung –, der seine Kenntnisse so oft gebrauchen muß! Wir sollten ihn ab und zu aus eigenem Antrieb ernähren und kleiden, ihm eine Herzerquickung geben, bevor wir ein Urteil über ihn fällen. Die kostbarsten Eigenschaften unseres Wesens können, wie der Flaum der Früchte, nur durch die zarteste Behandlung erhalten bleiben. Doch wir behandeln weder uns selbst noch die andern so zartfühlend.
Einige von Euch sind arm, das wissen wir alle. Einige von Euch haben schwer mit dem Leben zu kämpfen und schnappen, sozusagen, von Zeit zu Zeit nach Luft. Ich bezweifle nicht, daß einige Leser dieses Buches nicht imstande sind alle die Mittagsessen, die sie in Wirklichkeit verzehrten, oder die Kleider und Schuhe, die so schnell sich abnutzen oder schon abgetragen sind, zu bezahlen, daß sie nur deshalb bis hierher gelesen haben, weil sie geliehene oder gestohlene Zeit dazu verwendeten und somit ihre Gläubiger um eine Stunde betrogen. Für mich ist es eine nackte Tatsache, daß manche von Euch ein elendes und niedriges Dasein führen, denn meine Augen sind durch die Erfahrung geschärft. Alle Eure Versuche drehen sich darum, ins Geschäft hinein- oder aus Schulden herauszukommen, aus jenem uralten Moraste, den die Römer aes alienum nannten, eines anderen Kupfer, denn einige ihrer Münzen wurden aus Kupfer verfertigt. Ihr lebt, Ihr sterbt, Ihr werdet begraben durch das Kupfer eines anderen. Immer versprecht Ihr zu bezahlen, morgen zu bezahlen, und dabei sterbt Ihr heute – bankerott. Auf alle Arten versucht Ihr Euch bei anderen einzuschmeicheln, Kundschaft zu bekommen – nur vor Gesetzesübertretungen und Gefängnis hütet Ihr Euch. Ihr lügt, schmeichelt, wählt, kriecht mit Eurer Höflichkeit in ein Schneckenhaus hinein oder dehnt Euch zu einer Wolke seichter und dunstiger Großmut aus, um Euren Nachbarn zu bewegen Euch seine Schuhe oder seinen Hut, seinen Anzug oder seinen Wagen machen zu lassen oder seinen Gewürzkram für ihn importieren zu dürfen. Ihr macht Euch krank, damit Ihr etwas für Eure kranken Tage zusammenspart, etwas, was man in einer alten Truhe oder in einem Strumpf hinter dem Wandbewurf, oder um noch sicherer zu gehen, bei einem Bankier versteckt – einerlei wo, einerlei wieviel oder wie wenig.
Ich wundere mich manchmal darüber, daß wir – ich möchte fast sagen – so frivol sein können, uns um die schmutzige, aber etwas ferner liegende Form der Sklaverei, um die sogenannte Negersklaverei zu kümmern. Gibt es doch viele schlaue und findige Sklavenhalter gerade so gut im Norden wie im Süden. Es ist hart einem südlichen, härter einem nördlichen Sklavenaufseher zu unterstehen. Am schlimmsten aber ist es um den bestellt, der sein eigener Sklaventreiber ist. Da schwätzt man vom Göttlichen im Menschen! Schaut Euch den Fuhrmann auf der Landstraße an, der zu Markte fährt bei Tag oder bei Nacht. Offenbart sich in ihm die Gottheit? Seine höchste Pflicht heißt: Füttere und tränke deine Pferde! Was gilt ihm mehr – sein Schicksal oder der Frachtverkehr? Fährt er nicht für Herrn »Nimmerrast«? Inwiefern ist er gottähnlich, inwiefern unsterblich? Seht nur, wie er sich bückt und kriecht, wie er sich planlos den lieben langen Tag quält, er der weder unsterblich noch göttlich ist, sondern nur der Gefangene und Sklave des Bildes, das er von sich selbst entwarf, und das auf seinen Taten fußt. Die öffentliche Meinung ist ein schwacher Tyrann im Vergleich zu unserer eigenen Privatmeinung. Was ein Mensch von sich selbst denkt, das ist es, wodurch sein Schicksal bestimmt oder vielmehr prophezeit wird. Wo ist der Wilberforce, Wilberforce, britischer Philanthrop, 1759-1833. Er kämpfte hauptsächlich gegen den Sklavenhandel. der es vermag, selbst in den westindischen Gebieten einer launenhaften Phantasie Selbstbefreiung durchzusetzen? Man möge ferner an die Damen des Landes denken, die bis zum letzten Tage Toilettenkissen sticken, nur um kein allzu lebhaftes Interesse an ihrem Schicksal zu verraten! Als ob es möglich wäre die Zeit totzuschlagen, ohne die Ewigkeit zu verletzen.
Die Mehrzahl der Menschen verbringt ihr Leben in stiller Verzweiflung. Was wir »Resignation« nennen ist absolute Verzweiflung. Von der verzweifelten Stadt zieht man aufs verzweifelte Land hinaus. Dort tröstet man sich mit der Tapferkeit der Sumpfotter und der Moschusratte. Eine stereotype, wenn auch unbewußte Verzweiflung ist selbst hinter den sogenannten Vergnügungen und Unterhaltungen der Menschheit verborgen. Da kann von Vergnügen nicht die Rede sein, denn das kommt nach der Arbeit. Für den Weisen ist es charakteristisch, daß er nichts Verzweifeltes unternimmt.
Wenn wir uns überlegen, was (um die Worte des Katechismus zu gebrauchen) die Hauptbestimmung des Menschen ist und worin die notwendigen Lebensbedürfnisse wirklich bestehen, so scheint es, als ob die Menschen nach reifer Überlegung die ordinäre Art zu leben gewählt hätten, weil sie ihr vor jeder anderen den Vorzug geben. Sie glauben allen Ernstes keine Wahl zu haben. Frische und gesunde Naturen erinnern sich dagegen, daß die Sonne klar aufging. Es ist niemals zu spät unsere Vorurteile aufzugeben. Auf keine Folge von Gedanken oder Taten, einerlei wie alt, kann man sich ohne Prüfung verlassen. Was jedermann nachbetet oder mit Stillschweigen als wahr dahingehen läßt, kann morgen als falsch sich erweisen – als bloßer Ansichtsdunst, den manche für eine Wolke hielten, die befruchtenden Regen auf ihre Felder ergießen würde. Was alte Leute für unausführbar halten, wir versuchen es, wir finden, daß es ausgeführt werden kann. Alte Taten für alte Leute, neue Taten für die neuen! Einst genügte das Wissen unserer Ahnen nicht, um Brennmaterial zum Unterhalten des Feuers zu sammeln. Die Menschen von heute legen ein wenig trockenes Reisig unter einen Kessel und sausen um den Erdball so schnell wie die Vögel. Den Alten würde dabei, wie man sagt, angst und bange werden. Das Alter ist nicht besser, ja kaum so gut zum Lehrmeister geeignet als die Jugend. Denn es hat nicht soviel gewonnen als es verlor. Man kann mit Recht bezweifeln, ob der weiseste Mensch irgend etwas von absolutem Wert durch das Leben gelernt hat.
In Wirklichkeit vermögen die Alten der Jugend keinen wertvollen Rat zu geben. Ihre eigenen Erfahrungen sind Stückwerk geblieben, ihr Leben ist – aus persönlichen Gründen wie sie natürlich glauben– ein solch kläglicher Mißerfolg gewesen. Und doch ist es möglich, daß sie noch etwas Selbstvertrauen übrig haben, welches diese Erfahrung Lügen straft. Sie sind ja nur weniger jung als sie gewesen sind. Ich habe einige dreißig Jahre auf diesem Planeten zugebracht, und doch habe ich bislang noch nicht die erste Silbe eines wertvollen oder selbst ernsthaften Ratschlages von meinen älteren Mitmenschen gehört. Sie haben mir nichts Zweckentsprechendes gesagt, sind dazu auch wahrscheinlich nicht imstande. Hier ist das Leben – ein im wesentlichen von mir noch nicht versuchtes Experiment. Daß sie es versuchten, nützt mir nichts. Zu irgend einer Erfahrung, die ich für wertvoll halte, haben meine Ratgeber, nach meiner Überzeugung, nichts zu sagen gehabt.
Ein Farmer erklärte mir: »Sie können nicht von Pflanzenkost allein leben, denn sie trägt nichts zur Knochenbildung bei.« Darum widmet er gläubig einen Teil des Tages der Versorgung seines Körpers mit dem Rohmaterial für Knochen. Und während er, fortwährend sprechend, hinter seinen Ochsen hergeht, wird er von ihnen und ihren durch Vegetabilien genährten Knochen mit seinem schwankenden Pfluge über alle Hindernisse hin und her gezerrt. Manche Dinge sind für gewisse Kreise wirklich Lebensbedürfnisse, und zwar für die Hilflosen und Kranken, während sie für andere bloß Luxusgegenstände, und wieder anderen völlig unbekannt sind. Es gibt Leute, die da glauben, das ganze Gebiet des Menschenlebens sei bereits von ihren Vorfahren in allen Höhen und Tiefen durchforscht, alle Dinge seien bereits besorgt. Nach Evelyn Evelyn, englischer Rechtsgelehrter. gab der Weise Salomo sogar für die Entfernung der Bäume voneinander Vorschriften. Die römischen Prätoren bestimmten wie oft man, ohne die Gerechtsame zu verletzen, seines Nachbars Grund betreten dürfe, um die abgefallenen Eicheln aufzulesen, und wieviel davon dem Nachbarn gebühre, Hippokrates hat uns sogar Anweisungen hinterlassen, wie wir unsere Nägel schneiden sollen: nämlich in gleicher Höhe mit den Fingerspitzen, weder kürzer, noch länger. Ohne Zweifel sind gerade Lebensüberdruß und Langeweile, die voraussetzen, daß alle Abwechselung und Freude im Leben ausgekostet ist, alt wie Adam. Doch der Menschen Fähigkeiten hat man noch nicht ausgemessen. Wir können auch nach dem, was bislang geschehen ist, auf das was geschehen kann, nicht schließen, so wenig ist noch versucht worden. Wo auch immer Du bisher erfolglos gewesen bist: sei nicht bekümmert, mein Kind, denn wer soll Dich für das, was Du nicht vollbracht hast, verantwortlich machen?
Wir können unser Leben an tausend einfachen Dingen erproben, zum Beispiel daran, daß die gleiche Sonne meine Bohnen reift und zugleich ein ganzes System von Weltkörpern wie unsere Erde beleuchtet. Wenn ich daran gedacht hätte, wären einige Irrtümer vermieden worden. Solche Erleuchtung besaß ich nicht, als ich Bohnen hackte! Wie wunderbar sind die Dreiecke, deren Spitzen von Sternen gebildet werden! Wie verschieden, wie weit voneinander entfernt sind in des Weltalls mannigfachen Wohnungen die Geschöpfe, die sie zu gleicher Zeit betrachten! Die Natur und das menschliche Leben sind so wandelbar wie unsere Konstitution. Wer vermag zu sagen, welche Aussicht das Leben einem andern bietet? Wäre es nicht das größte aller Wunder, wenn der eine für einen Augenblick mit den Augen der anderen sähe? In einer Stunde würden wir in allen Äonen der Welt, ja in allen Welten der Äonen leben! Geschichte, Poesie, Mythologie! – Ich habe über die Erfahrung anderer nichts gelesen, was so staunenswert und lehrreich wäre.
Im Herzensgrunde glaube ich, daß der größere Teil von dem, was meine Nachbarn für klug halten, schlecht ist, und wenn ich irgend etwas bereue, so ist es aller Wahrscheinlichkeit nach mein anständiger Lebenswandel. Was für ein Dämon beherrschte mich, daß ich mich so gut betragen habe? Sprich Deiner Weisheit Inbegriff aus, Du alter Mann, der Du siebenzig Jahre, nicht ohne in Ehren grau zu werden, gelebt hast, – ich höre eine unwiderstehliche Stimme, die mich von all dem fortlockt. Eine Generation verläßt die Unternehmungen der anderen wie gestrandete Schiffe.
Ich glaube, daß wir unbeschadet viel mehr Vertrauen haben könnten als wir zeigen. Wir sollten uns selbst gerade soviel Sorgfalt widmen, als wir ehrlich anderen schenken. Die Natur paßt sich ebensogut unserer Schwäche wie unserer Stärke an. Die unaufhörliche Angst und Anstrengung mancher Menschen ist eine nahezu unheilbare Krankheit. Wir pflegen die Wichtigkeit unserer Werke zu überschätzen! Und doch: wie viele Dinge geschehen ohne unser Zutun! Und wenn wir nun gar krank würden? Wie genau wir da Acht geben, fest entschlossen uns nicht auf unseren Glauben zu verlassen, wenn wir es vermeiden können. Den ganzen Tag sind wir auf unserer Hut, abends sprechen wir unwillig unser Nachtgebet und ergeben uns dem Ungewissen. So sehr hängen wir mit allen Fasern am Leben, daß wir es anbeten und die Möglichkeit eines Wechsels leugnen. Das ist der einzig richtige Weg, sagen wir. Und doch gibt es so viele Wege, als wir Radien von einem Mittelpunkt aus ziehen können. Jede Veränderung macht den Eindruck eines Wunders. Doch solch Wunder vollzieht sich in jedem Augenblick. Confucius hat gesagt: »Zu wissen, daß wir wissen, was wir wissen, und daß wir nicht wissen, was wir nicht wissen, das ist das wahre Wissen.« Sobald nur ein Mensch ein Ergebnis seiner Phantasie auf ein Ergebnis seines Intellekts zurückgeführt hat, werden alle Menschen ihr Leben auf dieser Basis aufbauen. Ich sehe das voraus. Wir wollen einen Augenblick überlegen, um was sich die erwähnte Müh' und Sorge dreht und in wieweit es notwendig ist uns zu mühen oder wenigstens uns zu sorgen. Es wäre recht nützlich, bedürfnislos, wenn auch inmitten äußerlicher Zivilisation, ein Grenzerleben zu führen, bloß um die gröberen Lebensbedürfnisse und die Methode ihrer Gewinnung kennen zu lernen. Man könnte auch die alten Geschäftsbücher der Kaufleute durchblättern, um zu sehen, was die Menschen am meisten kauften, was vorrätig gehalten wurde, d. h. welche Waren am wichtigsten sind. Denn der Fortschritt im Laufe der Jahrhunderte hat nur geringen Einfluß auf die Grundgesetze der menschlichen Existenz gehabt. Sind doch auch unsere Skelette wahrscheinlich von denen unserer Vorfahren nicht zu unterscheiden.
Mit dem Worte »Lebensbedürfnisse« meine ich alle Güter, die der Mensch durch seine eigene Arbeit erwirbt, die von Anbeginn oder durch lange Gewohnheit so wichtig für das menschliche Leben geworden sind, daß nur einzelne, wenn überhaupt welche, sei es im Zustand der Wildheit, aus Armut oder aus Philosophie je versuchten ohne sie auszukommen. Viele Geschöpfe haben in diesem Sinne nur ein Lebensbedürfnis – Nahrung. Der Büffel in der Prairie findet sie in einigen Quadratzoll wohlschmeckenden Grases und in einem Trunk Wasser, falls er nicht des Waldes Schutz und des Berges Schatten aufsucht. Kein Tier der Schöpfung bedarf mehr als Nahrung und Unterschlupf. Die Lebensbedürfnisse der Menschen in unserem Klima kann man ziemlich erschöpfend unter folgenden Rubriken zusammenfassen: Nahrung, Obdach, Kleidung, Feuerung. Dann erst, wenn wir uns dieser Dinge versichert haben, sind wir vorbereitet, den wahren Problemen des Lebens in Freiheit und mit einiger Aussicht auf Erfolg nachzuforschen. Der Mensch hat nicht nur Häuser erfunden, sondern auch Kleidung und das Zubereiten der Nahrung. Und möglicherweise entstand durch die zufällige Entdeckung der Wärme des Feuers und durch die damit verbundene Nutzanwendung, die anfangs Luxus war, unser heutiges Bedürfnis am Feuer zu sitzen. Wir können bei Katzen und Hunden das Annehmen derselben Gewohnheit beobachten. Durch zweckmäßige Wohnung und Kleidung bewahren wir vernünftigerweise unsere innere Wärme. Wenn wir aber mit diesen Dingen, gerade wie mit der Feuerung, nicht Maß halten, d. h. wenn die äußere Hitze größer ist als unsere Eigenwärme, gibts da nicht ein Verbrühen?
Der Naturforscher Darwin erzählte folgende überraschende Beobachtung, die er bei den Feuerländern machte: während er und seine Begleiter warm gekleidet nahe am Feuer gesessen hätten, ohne es auch nur im geringsten zu warm zu finden, sei an den nackten Wilden, die weit vom Feuer entfernt standen, »ob solchen Röstens« der Schweiß in Strömen heruntergelaufen.
Auch wissen wir, daß der Neuholländer ungestraft nackt umherspaziert, während der Europäer in seinen Kleidern fröstelt. Ist es unmöglich die Widerstandsfähigkeit dieser Wilden mit der Intelligenz der zivilisierten Menschen in Einklang zu bringen? Nach Liebig ist des Menschen Körper ein Ofen, und Nahrung die Feuerung, die den inneren Verbrennungsprozeß in der Lunge unterhält. Bei kaltem Wetter essen wir mehr, bei warmem weniger. Die animalische Wärme ist das Produkt einer langsamen Verbrennung, und Krankheit und Tod treten ein, wenn sie zu rasch von statten geht oder wenn aus Mangel an Feuerung oder an Sauerstoffzufuhr das Feuer erlischt. Natürlich kann die Lebenswärme nicht mit dem Feuer verglichen werden. Doch genug von dieser Analogie. Es ergibt sich also aus dem soeben Gesagten, daß der Ausdruck »animalisches Leben« nahezu gleichbedeutend mit dem Ausdruck »animalische Wärme« ist. Und wie die Nahrung als Feuerung betrachtet werden kann, die unser inneres Feuer unterhält – und Feuerung nur dazu dient, diese Nahrung herzustellen oder unsere Körperwärme durch Zufuhr von außen zu erhöhen – so dienen Wohnung und Kleidung auch nur dazu, die also erzeugte und absorbierte Wärme festzuhalten.
Das Hauptbedürfnis für unsern Körper besteht also darin warm zu bleiben, die Lebenswärme in ihm zu erhalten. Was für Mühen machen wir uns aber auch, nicht nur wegen unserer Nahrung, Kleidung und Wohnung, sondern auch wegen unserer Betten, die unsere Nachtkleider sind! Nest und Brust der Vögel berauben wir, um diese Wohnung in einer Wohnung herzurichten, gerade wie der Maulwurf, der sein Bett aus Gras und Blättern am Ende seines Ganges macht. Arme Menschen klagen gewöhnlich über diese kalte Welt; auf Kälte, physische sowohl wie soziale, führen wir unmittelbar einen großen Teil unserer Leiden zurück. In einigen Klimaten gestattet die Sommerzeit den Menschen eine Art paradiesisches Leben. Feuerung ist dann nicht notwendig außer zum Kochen. Die Sonne ist ihr Feuer und manche Früchte sind genügend durch ihre Strahlen gekocht. Die Nahrung wird abwechselungsreicher, ist leichter zu beschaffen. Kleidung aber und Wohnung sind ganz oder teilweise entbehrlich. Heutzutage sind in diesem Lande – ich habe das an mir selbst erfahren –, einige Werkzeuge: ein Messer, eine Axt, ein Spaten, eine Schubkarre usw., und für den Gelehrten: Lampenlicht, Schreibmaterial und die Gelegenheit einige Bücher zu benutzen die nächst wichtigen Lebensbedürfnisse. All diese Dinge sind für billiges Geld zu haben. Doch einige Toren wandern auf die andere Seite des Erdballs in unkultivierte und ungesunde Gegenden, widmen sich zehn oder zwanzig Jahre lang dem Handel, damit sie leben, d. h. sich gemütlich warm halten können, und schließlich sterben sie in Neuengland. Die im üppigen Reichtum Lebenden sitzen jedoch nicht in behaglicher Wärme, sondern in unnatürlicher Hitze; ich sagte es schon: sie werden gekocht, natürlich à la mode.
Fast jeder Luxus und viele der sogenannten Bequemlichkeiten des Lebens sind nicht nur absolut überflüssig, sondern geradezu Hindernisse für die fortschreitende Entwickelung des Menschengeschlechtes. In Hinsicht auf Luxus und Bequemlichkeit haben die Weisesten immer ein einfacheres und armseligeres Leben geführt als die Armen. Niemals war jemand an weltlichen Gütern ärmer, an inneren Gütern reicher als die alten Philosophen in China, Indien, Persien und Griechenland. Wir wissen nicht viel über sie. Merkwürdig ist, daß wir überhaupt so viel über sie wissen. Dasselbe gilt von den neueren Reformatoren und Wohltätern ihrer Völker. Nur wer den freien Blick besitzt, den freiwillige Armut eröffnet, kann unparteiisch und weise das menschliche Leben betrachten. Ein luxuriöses Leben zeitigt Luxus, sei es im Ackerbau, im Handel, in der Literatur oder in der Kunst. Heutzutage gibt es Dozenten der Philosophie, aber keine Philosophie. Wie man einst trefflich sein Leben verbrachte, darüber hört man heute trefflich dozieren. Geistreiche Gedanken und selbst die Gründung einer Schule machen noch keinen Philosophen. Vielmehr muß man die Weisheit solchermaßen lieben, daß man nach ihren Vorschriften lebt, ein Leben der Einfachheit, Unabhängigkeit, der Großmut und des Vertrauens. Einige Probleme des Lebens sollen wir nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch lösen. Der Erfolg großer Gelehrter und Denker ist häufig eine Art Höflingserfolg, kein königlicher, kein männlicher Erfolg. Mit ihrem Anpassungsvermögen schlagen sie sich kümmerlich durchs Leben, gerade wie auch ihre Väter. In keiner Hinsicht sind sie die Erzeuger einer edleren Menschenrasse. Doch warum degenerieren die Menschen stets? Warum sterben Familien aus? Wie muß der Luxus beschaffen sein, der Nationen entnervt und vernichtet? Sind wir sicher, daß nichts davon in unserem eigenen Leben vorhanden ist? Der Philosoph eilt seiner Zeit voraus, selbst in der äußeren Lebensform. Er unterscheidet sich durch seine Nahrung, Wohnung, Kleidung und durch sein Wärmebedürfnis von seinen Zeitgenossen. Wie kann man den Menschen einen Philosophen nennen, der keine besseren Methoden zur Erhaltung seiner Lebenswärme kennt, als andere Leute?
Wenn ein Mensch durch die verschiedenen Methoden, die ich beschrieben habe, gewärmt ist, was hat er dann zunächst nötig? Sicherlich nicht noch mehr Wärme derselben Art, z. B. reichlichere und reichere Nahrung, größere und prächtigere Häuser, bessere und elegantere Kleider, zahlreichere, beständigere und wärmere Feuer usw. Wenn er die Dinge erlangt hat, die für das Leben notwendig sind, ist es ihm anheimgestellt sich um etwas anderes als um das Überflüssige zu bemühen, d. h. er kann sich jetzt, wo er niedriger Arbeit enthoben ist, an das Leben selbst wagen. Der Boden ist, wie es scheint, für die Saat geeignet, denn sie hat in der Tiefe Wurzel gefaßt; so mag sie denn jetzt ihre Sprossen auch vertrauensvoll nach oben senden. Warum hat der Mensch seine Wurzeln so fest in die Erde geschlagen, wenn er nicht in demselben Maße in den Himmel dort oben wachsen will? Edlere Pflanzen beurteilt man nach ihren Früchten, die sie schließlich, frei vom Erdboden, in Luft und Licht erzeugen. Sie werden darum auch nicht wie die niederen Nährpflanzen behandelt, die, auch wenn sie zweijährig sind, nur so lange gepflegt werden, bis ihre Wurzel ausgewachsen ist und deren oberer Teil oftmals gerade zu diesem Zwecke ganz abgeschnitten wird, so daß die Menschen sie in ihrer Blütezeit gar nicht kennen würden.
Ich habe nicht die Absicht starken und mutigen Naturen Vorschriften zu geben. Sie können ihre eigenen Angelegenheiten selbst erledigen, sei es im Himmel oder in der Hölle. Sie bauen vielleicht großartiger, verschwenden freigebiger als die Reichen, und werden doch nie arm. Sie wissen selbst nicht wie sie leben – vorausgesetzt, daß es überhaupt solche Menschen gibt. Man nimmt das ja an. Auch zu denen rede ich nicht, die Ermutigung und Begeisterung gerade in den gegenwärtigen Zuständen finden und sie mit der Innigkeit und mit dem Enthusiasmus Liebender hegen und pflegen; bis zu einem gewissen Grade gehöre ich selbst zu dieser Zahl. Auch wende ich mich nicht an diejenigen, welche sich, einerlei unter welchen Umständen, gut beschäftigen, und die wissen, ob sie sich gut beschäftigen oder nicht. Nur zu der Masse jener Menschen spreche ich, die unzufrieden sind, die sich vergeblich über die Härte ihres Schicksals oder der Zeiten beklagen, während sie beides verbessern könnten. Manche Leute stöhnen auf das heftigste, sind untröstlich, weil sie, wie sie sagen, ihre Pflicht tun. Ich denke auch an die reiche und doch so unendlich arme Klasse jener Menschen, die Tand auf Tand häufen, und nicht wissen, was sie damit tun, wie sie denselben los werden können. Sie haben sich ihre eigenen goldenen oder silbernen Fesseln geschmiedet.
Wenn ich versuchen wollte zu schildern, wie ich in früheren Tagen mein Leben zu verbringen wünschte, würden wahrscheinlich diejenigen meiner Leser, die meinen wirklichen Lebenslauf kennen, überrascht sein. Diejenigen, die gar nichts davon wissen, würden einfach staunen. Ich will nur einige Unternehmungen, an denen ich meine Freude hatte, andeuten.
Bei jedem Wetter, zu jeder Tages- oder Nachtstunde versuchte ich den gegebenen Augenblick zu benutzen. Immer war ich bedacht dort festen Fuß zu fassen, wo zwei Ewigkeiten – Vergangenheit und Zukunft – zusammentreffen, d. h. gerade im jeweiligen Augenblick. Gerade dort wich ich keinen Zoll. Mit einigen Unklarheiten muß der Leser schon Nachsicht haben, denn in meinem Handwerk gibt es mehr Geheimnisse als in den meisten anderen. Und doch werden diese nicht vorsätzlich gehütet, sondern die Natur der Sache bringt es mit sich. Ich würde mit Freuden alles, was ich darüber weiß, mitteilen und niemals an meine Tür schreiben: »Zutritt verboten«.
Vor langer Zeit verlor ich einen Jagdhund, ein rotbraunes Pferd und eine Turteltaube. Noch immer suche ich sie. Zahlreich sind die Wanderer, mit denen ich über die Verlorenen sprach, denen ich die Spuren beschrieben habe und die Rufe, auf die meine Tiere hörten. Ein paar Leute hatten das Bellen des Hundes, den Hufschlag des Pferdes vernommen, ja sie hatten auch die Taube gesehen, wie sie gerade hinter einer Wolke verschwand. Und sie waren so erpicht darauf sie wieder einzufangen, als ob sie selbst sie verloren hätten.
Es gilt, nicht nur dem Sonnenaufgang und der Morgendämmerung, nein, womöglich der Natur selbst zuvorzukommen! Wie oft bin ich in der Frühe, im Sommer wie im Winter, bevor noch irgend ein Nachbar zur Arbeit sich anschickte, bei meiner Arbeit gewesen. Sicherlich haben mich manche meiner Mitbürger gesehen, wenn ich von meiner Beschäftigung zurückkehrte: Farmer, die im Zwielicht nach Boston wanderten oder Holzhacker, die zur Arbeit gingen. Allerdings, ich half der Sonne nicht wesentlich beim Aufgehen, aber zweifellos war allein schon meine Anwesenheit bei diesem Ereignis von allerhöchster Wichtigkeit.
Wie viele Herbst- und Wintertage verlebte ich außerhalb der Stadt, um zu hören, was der Wind sagte, und dann das Gehörte als Eilgut weiterzutragen: Fast mein ganzes Vermögen steckte ich hinein und verlor obendrein meinen Atem bei dem Handel, wenn ich ihm entgegenstürmte. Hätte er von politischen Parteien erzählt, Ihr könnt Euch drauf verlassen, es hätte unter »Neueste Nachrichten« alsbald in der Zeitung gestanden. An anderen Tagen hielt ich von dem Observatorium eines Felsens oder eines Baumes aus Wache, um irgend eine ungewohnte Ankunft weiter zu telegraphieren, oder ich wartete abends auf den Gipfeln der Hügel darauf, daß der Himmel sich herniedersenke, damit ich ein Stückchen davon erwischen könne. Doch ich erwischte niemals viel, und selbst das zerschmolz wie Manna in der Sonne.
Lange Zeit war ich Berichterstatter bei einer nicht sehr weit verbreiteten Zeitung, deren Herausgeber sich bisher noch nicht bewogen fühlte den größeren Teil meiner Beiträge zu drucken. So bezahlte sich, wie das bei Schriftstellern fast regelmäßig geschieht, meine Mühe nur durch meine Arbeit. In diesem Fall trug übrigens meine Mühe ihren Lohn schon in sich.
Lange Jahre hindurch war ich selbstangestellter Inspektor der Schneestürme und Regenschauer; ich tat getreulich meine Pflicht. Ich war auch Aufseher, zwar nicht der Landstraßen, aber der Waldpfade und Feldwege, die ich in allen Jahreszeiten gangbar erhielt. Auch Schluchten überbrückte ich, wenn die Fußstapfen des Publikums zu solch nützlichem Tun ermunterten.
Ich überwachte den Wildstand meiner Mitbürger, der einem pflichttreuen Hirten genug zu schaffen machte, weil das Gehege oft übersprungen wurde. Ich ließ meine Augen in die entlegenen Ecken und Winkel der Farm wandern. Zwar wußte ich nicht immer, ob Jonas oder Salomo auf diesem oder jenem Acker heute arbeitete – das ging mich auch nichts an. Ich begoß die roten Heidelbeeren, die Sandkirschen und den Nesselbaum, die Rottanne und die Schwarzesche, den weißen Wein und das gelbe Veilchen, die vielleicht sonst in trocknen Jahreszeiten verdorrt wären.
Kurz, so trieb ich es eine lange Zeit. Ich kann, ohne zu prahlen, sagen, daß ich mein Amt pflichtgetreu versah. Allmählich aber erkannte ich mehr und mehr, daß meine lieben Mitbürger gar nicht daran dachten mich in die Stadtverwaltung zu wählen oder mir eine Sinekure mit bescheidenem Gehalte zu geben. Meine Abrechnungen, deren Genauigkeit ich beschwören kann, wurden tatsächlich nie angesehen, geschweige denn anerkannt, selbstverständlich auch nie bezahlt oder »saldiert«.
Es ist noch nicht lange her, da kam ein herumziehender Indianer zu dem Hause eines in meiner Nachbarschaft wohlbekannten Rechtsanwaltes, um Körbe zu verkaufen. »Wollen Sie Körbe kaufen?« fragte er. »Nein, wir haben keinen Bedarf«, war die Antwort. »Was«, rief der Indianer, als er zur Tür hinausging, »wollt Ihr uns vielleicht Hungers sterben lassen?« Da er gesehen hatte, daß es seinen fleißigen, weißen Nachbarn gut ging, daß der Rechtsanwalt nur Argumente zu flechten brauchte um Geld und eine gute Stellung zu erhalten, kam ihm der Gedanke: Ich werde auch ein Geschäft anfangen – ich werde Körbe flechten, das ist etwas, was ich fertig bringe. Er dachte, wenn er die Körbe hergestellt habe, sei seine Pflicht und Schuldigkeit getan, Pflicht und Schuldigkeit der Weißen sei es alsdann, seine Körbe zu kaufen. Daran hatte er überhaupt nicht gedacht, daß die andern notwendigerweise sein Angebot auch des Ankaufs für wert halten oder hiervon wenigstens überzeugt werden müßten, oder daß er etwas anderes herstellen könne, was anderen kaufenswert erschiene. Auch ich hatte eine Art Korb von feinem Geflecht angefertigt, aber niemand bemühte sich ihn zu kaufen. Trotzdem glaubte ich, es sei lohnend ihn zu weben. Aber anstatt zu versuchen ihn den Leuten anzupreisen, überlegte ich vielmehr, wie ich der Notwendigkeit ihn zu verkaufen enthoben werden könnte. Es gibt nur eine Lebensweise, die von den Menschen gepriesen und als erfolgreich angesehen wird. Aber warum wollen wir von der einen so viel Aufhebens auf Kosten der anderen machen?
Als ich mir klar darüber wurde, daß meine lieben Mitbürger mir wahrscheinlich kein Büro im Rathaus, keine Pfarre oder irgend einen anderen Broterwerb anbieten würden, daß ich vielmehr mir selbst helfen müsse, wandte ich mein Augenmerk mehr denn je den Wäldern zu. Dort war ich besser bekannt. Ich beschloß, mein Geschäft sofort zu eröffnen, nicht zu warten, bis ich das übliche Kapital erworben habe, sondern die spärlichen Mittel, die ich bereits besaß, zu verwenden. Als ich zum »Waldenteich« zog, wollte ich dort weder billig noch teuer leben, sondern Privatgeschäfte möglichst ungehindert erledigen. Hätte ich mich durch Mangel an gesundem Menschenverstand, an Unternehmungsgeist oder Geschäftstalent davon abhalten lassen, – es wäre eher töricht als bedauerlich gewesen.
Ich habe mich stets bemüht strenge Geschäftsprinzipien zu erlernen. Sie sind für jedermann unumgänglich notwendig. Wer mit dem »Himmlischen Reich« Handel treibt, kann sich durch eine kleine Filiale an der Küste, in irgend einem »Salem-Hafen« Hafen an der neuenglischen Küste. eine genügende Basis schaffen. Man wird jene Artikel, die im Lande produziert werden, exportieren: viel Eis, Tannenholz und etwas Granit – alles in Schiffen, die in Amerika gebaut wurden. Das wäre keine schlechte Spekulation. Da gilt es alle Einzelheiten persönlich zu überwachen. Lotse und Kapitän, Eigentümer und Versicherungsagent zugleich zu sein, zu kaufen, zu verkaufen und die Bücher zu führen, jeden Brief, der einläuft, zu lesen und jeden Brief, der abgehen soll, zu schreiben und durchzulesen, das Eintreffen der importierten Waren bei Tag und bei Nacht zu überwachen, an vielen Orten der Küste fast gleichzeitig zu sein – oft wird nämlich die reichste Fracht in einem ganz unzivilisierten Lande gelöscht. Da gilt es sein eigener Telegraph zu sein, unermüdlich den Horizont abzusuchen und alle Schiffe, die landen wollen, anzusprechen, einen konstanten Warenversand zu unterhalten und einen entlegenen und kaufkräftigen Markt zu versorgen, die Schwankungen des Marktes genau zu verfolgen, überall die Aussichten auf Krieg und Frieden und die Tendenzen des Handels und der Zivilisation vorherzusehen, d.h. die Ergebnisse der Entdeckungsreisen vorteilhaft zu verwenden, indem man neue Durchfahrten und alle Verbesserungen der Schiffahrt benutzt. Auch Karten muß man studieren, sich die Lage von Riffen, neuen Leuchtfeuern und Bojen einprägen und ohne Unterlaß Logarithmentabellen korrigieren, denn oft zerschellt ein Schiff, das im freundlichen Hafen alsbald Anker werfen sollte, infolge eines Berechnungsfehlers an einem Felsen – man denke an das rätselhafte Schicksal von » La Perousa«. Es gilt gleichen Schritt zu halten mit allen Gebieten der Wissenschaft, den Lebenslauf aller großen Entdecker und Seefahrer, aller großen Glücksritter und Kaufherren, von Hanno und den Phöniziern an bis auf unsere Tage hinab zu studieren, kurz, man muß von Zeit zu Zeit das Lager aufnehmen, um seinen Abschluß zu machen. Solche Arbeit kann als Prüfstein für die Fähigkeiten eines Mannes gelten, solche Probleme von Gewinn und Verlust, von Verzinsung, von Taxe und Rabattbewilligung, solch sachkundige Kritik über alle Gebiete erfordert ein universelles Wissen.
Ich glaubte, daß der Waldenteich ein guter Geschäftsplatz sein müsse, nicht allein wegen der Eisenbahn oder des Eishandels. Er bietet Vorteile, die man am besten nicht verrät, wenn man klug ist. Er liefert eine gute Stellung, eine gute Basis. Newasümpfe sind nicht auszufüllen. Doch überall muß man auf selbstgefügtem Fundamente bauen. Man behauptet, daß eine Sturmflut bei Westwind mit Eisgang in der Newa St. Petersburg vom Angesicht der Erde wegfegen könne.
Da mein Geschäft ohne das übliche Kapital begonnen werden sollte, ist es nicht leicht zu erraten, woher die Mittel, die zu irgend einem solchen Unternehmen stets notwendig sind, genommen werden konnten. Was die Kleidung betrifft – um sogleich zum praktischen Teil der Frage zu kommen –, so lassen wir uns bei der Auswahl derselben vielleicht häufiger durch die Modesucht und durch die Kritik unserer Mitmenschen als durch wirkliche praktische Gesichtspunkte leiten. Wer arbeiten muß, soll nicht vergessen, daß die Kleidung erstens zur Erhaltung der Lebenswärme und zweitens – infolge unserer heutigen sozialen Verhältnisse – zum Verhüllen der Nacktheit dienen soll. Er wird dann erkennen, wie viel notwendige oder wichtige Arbeit er verrichten kann ohne den Inhalt seines Kleiderschrankes zu vermehren. Könige und Königinnen, die ihre Gewänder nur einmal tragen, können, selbst wenn diese von einem »Hoflieferanten für Herren- oder Damengarderoben« angefertigt würden, gar nicht wissen, was für eine Annehmlichkeit ein gut passender Anzug ist. Sie sind nichts weiter als hölzerne Ständer, über die man saubere Kleider hängt. Mit jedem Tage werden unsere Kleider uns selbst ähnlicher. Immer mehr nehmen sie von dem Charakter des Trägers in sich auf. Schließlich, wenn alle ärztliche Hilfe versagt hat, trennen wir uns nur zögernd von ihnen und unter solch feierlichen Zeremonien, wie wir unsern Toten erweisen. Niemals sank ein Mensch in meiner Achtung, weil er einen Fleck in seiner Kleidung hatte. Und doch: ich bin überzeugt, im allgemeinen ist man mehr darauf bedacht, moderne oder wenigstens reine und fleckenlose Kleider zu haben als ein reines Gewissen. Und selbst wenn das Loch nicht gestopft ist: das schlimmste Laster, das es verrät, heißt doch nur – Unvorsichtigkeit. Bisweilen stelle ich meine Bekannten durch Fragen wie die folgende auf die Probe: »Wer kann einen Flicken oder auch nur zwei Extranähte über dem Knie tragen?« Die meisten benehmen sich, als ob sie glaubten, durch solch eine Tat würde die Zukunft ihres Lebens ruiniert. Es würde ihnen leichter fallen, mit einem gebrochenen Bein zur Stadt hinabzuhumpeln als mit einer zerrissenen Hose. Wenn die Beine eines Herren durch einen Unfall verletzt werden, können sie oftmals wieder hergestellt werden. Doch wenn ein ähnlicher Anfall seinen Beinkleidern zustößt, gibt es keine Hilfe: denn er kümmert sich nicht um das, was achtungswert ist, sondern was als achtungswert gilt. Wir kennen nur wenige Männer, aber sehr viele Röcke und Hosen. Bekleide eine Vogelscheuche mit Deinem neuesten Anzug und stelle dich nackend neben sie – wer würde da nicht zuerst die Vogelscheuche grüßen? Als ich kürzlich an einem Kornfeld vorüberging und dort einen Hut und Rock an einem Stecken hängen sah, erkannte ich den Besitzer der Farm. Er war nur etwas mehr verwittert wie damals, als ich ihn zum letzten Mal sah. Man hat mir von einem Hunde erzählt, welcher Fremde, die sich in Kleidern dem Gehöft seines Herrn näherten, ankläffte, der aber von einem nackten Diebe leicht zum Schweigen gebracht wurde. Es ist eine interessante Frage, bis zu welchem Grade die Menschen ihren jeweiligen Rang behalten würden, wenn sie sich ihrer Kleider entledigt hätten. Könnte man in solchem Falle unter einer Anzahl gebildeter Menschen mit Sicherheit diejenigen bezeichnen, die sich des größten Ansehens erfreuen? Als Madame Pfeifer, Ida Pfeifer, Reisende, 1797–1858. Ihre Reiseberichte haben geringen wissenschaftlichen Wert. auf ihrer kühnen Weltreise von Ost nach West, heimkehrend ins asiatische Rußland gekommen war, fühlte sie, wie sie sagte, die Notwendigkeit ihr Reisekostüm mit einem andern zu vertauschen, sobald sie mit Behörden zu verkehren hatte. Denn sie war »in einem zivilisierten Lande, wo man die Leute nach ihren Kleidern beurteilt«. Selbst in unsern demokratischen Städten Neuenglands bedingt der zufällige Besitz von Vermögen, der sich in der Kleidung und in der Einrichtung zu erkennen gibt, für den Besitzer eine fast allgemeine Hochachtung. Aber die Menschen, die solche Hochachtung zollen, sind, so groß ihre Zahl auch ist, nichts weiter als Götzendiener, denen man einen Missionär schicken sollte. Außerdem ist durch die Kleidung die Näharbeit entstanden, eine Arbeit, die man endlos nennen kann. Ein Frauenkleid wenigstens wird niemals fertig.
Hat ein Mensch schließlich eine Beschäftigung gefunden, so gebraucht er keinen neuen Anzug für diese Beschäftigung. Ihm genügt der alte, der wer weiß wie lange im Staube der Bodenkammer gelegen hat. Ein Held wird ein Paar alte Schuhe länger tragen als sein Diener – vorausgesetzt, daß der Held überhaupt je einen Diener hat. Nackte Füße sind älter als Schuhe, und auch sie genügen zu jedem Vorhaben. Nur wer zu »Soireen« und zu Versammlungen am »grünen Tische« geht, muß neue Kleider haben, muß seinen Anzug so oft wechseln, wie er in ihnen wechselt. Wenn aber mein Wams und meine Hosen, mein Hut und meine Stiefel gut genug sind, um Gott darin zu dienen, so sind sie überhaupt gut. Oder nicht? War wirklich je ein alter Anzug – ein alter Rock – so sehr abgetragen, so völlig in die ursprünglichen Bestandteile aufgelöst, daß er nicht noch einem armen Burschen als milde Gabe geschenkt werden konnte, damit dieser ihn vielleicht einem noch ärmeren schenke? Oder sollen wir ihn einen reicheren nennen, da er weniger bedurfte? Ich sage Euch: Hütet Euch vor allen Beschäftigungen, die neue Kleider und nicht einen neuen Träger der Kleider verlangen. Wie kann ein neuer Anzug passen, wenn der Mensch nicht neu ist? Plant Ihr irgend ein neues Unternehmen, so versucht es in Euren alten Kleidern. Die Menschen brauchen kein bestimmtes Arbeitsfeld, sondern Arbeit oder vielmehr Erfolg. Vielleicht sollten wir uns erst dann einen neuen Anzug anschaffen – einerlei, wie zerrissen und schmutzig der alte auch ist – wenn wir fühlen, daß unser Benehmen, unsere Taten und die Fahrten unseres Lebensschiffes uns zu neuen Menschen in alten Kleidern gemacht haben. Behalten wir aber auch dann den alten Anzug, so bergen wir gleichsam neuen Wein in alten Schläuchen. Die Zeit der Mauserung muß, wie beim Federvieh, eine Krisis in unserem Leben bedeuten. Während dieser Zeit zieht sich der Taucher auf einsame Teiche zurück. Auch die Schlange wirft ihre Haut und die Raupe ihr wurmiges Wams ab, infolge einer inneren Geschäftigkeit und Ausdehnung. Kleider sind nur äußere Haut, unser »sterblich Teil«. Siehe »Hamlet«, Monolog. Denn sonst könnte man eines Tages entdecken, daß wir unter falscher Flagge segeln. Dann aber würde uns unsere eigene Meinung und die unserer Mitmenschen unnachsichtig kassieren.
Wir ziehen ein Kleidungsstück über das andere an, als ob wir wie exogene Pflanzen durch Zunahme von der Außenseite her wüchsen, unsere äußeren, oftmals dünnen und seltsamen Gewänder sind unsere Epidermis oder falsche Haut, die mit unseren Lebensvorgängen nichts zu tun hat, und hier und da ohne böse Folgen abgestreift werden kann. Unsere dickeren Gewänder, die wir beständig tragen, sind das Unterhaut-Zellgewebe oder die Rinde. Unsere Hemden aber sind unser Bast oder unsere wahre Rinde, deren Entfernung eine schwere Verletzung oder den Tod des Menschen bedingt. Ich glaube, daß alle Rassen zu bestimmten Jahreszeiten etwas dem Hemde äquivalentes tragen. Der Mensch sollte in seiner Kleidung einer solchen Einfachheit sich befleißigen, daß er selbst im Dunkeln sich anziehen kann. Er sollte in jeder Hinsicht so festgefügt und wohl versorgt leben, daß er, wenn der Feind sich der Stadt bemächtigt, wie der alte Philosoph, ohne Angst mit leeren Händen zum Tore hinausziehen kann. Da aber ein dicker Rock in den meisten Fällen so gut wie drei dünne ist, und passende Kleider zu wirklich billigen Preisen gekauft werden können, da man ferner für fünf Dollars einen dicken Rock bekommt, der ebensoviele Jahre halten wird, da man dicke Hosen für zwei Dollars, ein paar starke rindslederne Schuhe für 1 ½ Dollars, einen Sommerhut für 25 Cents und eine Wintermütze für 62 ½ Cents oder eine noch bessere für ein Spottgeld sich verschaffen kann, wenn man sie selbst macht: wer zeigt mir da den Menschen, dem, mag er im übrigen noch so arm sein, nicht von weisen Männern Hochachtung entgegengebracht wird, weil er in einem solchen selbstverdienten Anzug steckt!
Wenn ich ein Kleidungsstück von einer besonderen Art bestelle, so sagt mir meine Schneiderin mit wichtiger Miene: »Man macht das jetzt nicht so.« Dabei betont sie das »man« durchaus nicht, gerade als ob sie eine Autorität zitiere, die so unpersönlich wie das Schicksal ist. So stoße ich, wenn ich etwas nach meinen Wünschen gemacht haben will, auf Schwierigkeiten aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht glauben kann, daß ich meine, was ich sage, und daß ich derart voreilig bin. Wenn ich ihren Orakelspruch höre, versinke ich für einen Augenblick in tiefstes Nachdenken, betone für mich jedes Wort einzeln, um seinen Gehalt zu ergründen, um mir darüber klar zu werden, durch welchen Grad von Blutsverwandtschaft »man« mit »mir« verwandt ist, und welche Glaubwürdigkeit »man« in einer Angelegenheit verdient, die mich so nahe berührt. Und schließlich fühle ich mich veranlaßt, ihr mit dem gleichen mysteriösen Tiefsinn, und ebenfalls ohne jede Betonung des »man« zu antworten: »Sie haben recht, in letzter Zeit machte man es nicht so, doch man tut es jetzt.« Was nützt ihr Maßnehmen, wenn sie nicht meinen Charakter mißt, sondern nur die Breite meiner Schultern, als ob diese ein Holzpflock wären, über den der Anzug gehängt wird? Wir verehren weder die Grazien noch die Parzen sondern die Mode. Sie spinnt und webt und schneidet ab – als höchste Autorität. Der Oberaffe in Paris setzt sich eine Reisemütze auf, und alle Affen in Amerika tun dasselbe. Bisweilen verzweifle ich an der Hoffnung, daß etwas ganz Einfaches und Ehrliches in dieser Welt durch Menschenwerk vollbracht werden kann. Man müßte die Menschen erst durch eine Presse mit Hochdruck hindurchtreiben, ihre alten Anschauungen so energisch aus ihnen herausquetschen, daß sie nicht so bald wieder auf die Beine kämen. Und doch: wenn nur Einer unter der Menge gewesen ist mit einer Larve im Kopf, die aus einem Ei kroch, das Gott weiß wann dort gelegt wurde – denn selbst Feuer tötet diese Gesellschaft nicht – dann ist die ganze Mühe vergeblich gewesen. Wir wollen aber trotzdem nicht vergessen, daß uns eine Mumie ägyptischen Weizen aushändigte.
Im allgemeinen kann man meiner Ansicht nach nicht behaupten, daß die Bekleidung sich in diesem oder in einem andern Lande zum Rang einer Kunst erhoben hat. Heutzutage behelfen sich die Menschen mit der Kleidung, die sie finden können. Wie Seeleute nach dem Schiffbruch ziehen sie an, was sie am Strande finden. Sobald aber eine kleine zeitliche oder räumliche Distanz sich geltend macht, lachen sie einander wegen der Maskerade aus. Jede Generation lacht über die alten Moden und folgt ehrfurchtsvoll der neuen. Wir lächeln belustigt, wenn wir die Tracht Heinrichs VIII. oder der Königin Elisabeth anschauen, gerade als ob sie von dem König oder der Königin der Kannibaleninseln stamme. Jedes Kostüm wirkt ohne den dazu gehörenden Menschen kläglich oder grotesk. Nur durch das ernste Auge, das herausblickt, und durch das lautere Leben, das darin verbracht wurde, wird das Lächeln unterdrückt, wird die Tracht eines Volkes geheiligt. Wenn ein Harlekin einen Anfall von Kolik bekommt, muß sein Flitterstaat auch dieser Stimmung Rechnung tragen. Wenn ein Soldat von einer Kanonenkugel getroffen ist, schmückt ihn sein zerfetzter Rock wie ein Purpur.
Wegen der kindischen und barbarischen Vorliebe der Männer und Frauen für neue Muster muß sich eine – ach wie große – Anzahl von Menschen fortwährend damit beschäftigen, Kaleidoskope zu schütteln und in sie hineinzugaffen, um gerade jene Figur zu entdecken, nach der die gegenwärtige Generation verlangt. Die Fabrikanten wissen aus Erfahrung, daß dieser Geschmack nichts weiter als eine Grille ist. Von zwei Mustern, die sich nur durch die mehr oder weniger eigentümliche Farbe einiger Fäden voneinander unterscheiden, wird das eine schnell verkauft, während das andere im Schranke liegen bleibt. Nicht selten aber ist dann in der nächsten Saison dieser Gegenstand der »allermodernste«. Im Vergleich hiermit ist das Tätowieren kein so abscheulicher Gebrauch, wie man gewöhnlich annimmt. Er ist schon deswegen nicht barbarisch, weil die Farben hauttief eingetragen werden und unveränderlich sind.
Ich kann nicht glauben, daß unsere Großindustrie die beste Quelle für den Ankauf von Kleidungsstücken ist. Die Lage der Fabrikarbeiter wird jeden Tag derjenigen der englischen Arbeiter ähnlicher. Darüber braucht man sich nicht zu wundern, denn nach allem, was ich gehört und gesehen habe, ist nicht die Herstellung einer guten und sittsamen Kleidung für den Menschen, sondern die Bereicherung der Trust-Kompagnien die Hauptsache. Im Laufe der Zeit treffen die Menschen nur das, wonach sie zielen. Darum täten sie besser, auch wenn sie jetzt fehl schießen, ihr Ziel möglichst hoch zu stecken.
Allerdings kann ich nicht bestreiten, daß ein Obdach heutzutage ein Lebensbedürfnis geworden ist, obwohl ich auch Beispiele dafür anführen könnte, daß Menschen in einem kälteren Lande als dem unsern sich ohne solches fortbeholfen haben. Samuel Laing Samuel Laing, englischer Staatsmann und philosophischer Schriftsteller, 1812–1897. berichtet: »Der Lappländer schläft in seinem Gewand aus Fellen und in seinem Sack aus Fellen, den er über Kopf und Schultern zieht, jede Nacht auf dem Schnee, selbst bei Kältegraden, die einen anderen Menschen, auch wenn er in Wolle gekleidet wäre, unfehlbar töten würden.« Er sah sie mit eigenen Augen, wie sie, so gebettet, schliefen. Dann aber fügt er hinzu: »Sie sind nicht abgehärteter als andere Menschen.« Wahrscheinlich aber erkannte der Mensch schon nach einer kleinen Weile seines Erdenwallens die Bequemlichkeit, die ein Haus bietet – »die häusliche Gemütlichkeit«. Dieser Ausdruck wird wohl ursprünglich mehr das Wohlgefallen am Hause als an der Familie bezeichnet haben. Und selbst dieses Wohlgefallen kann nur ein temporäres und begrenztes sein in jenen Klimaten, wo der Gedanke an das Haus hauptsächlich durch die Winter- und Regenzeit in uns erweckt wird, und wo es zwei Drittel des Jahres lang eigentlich nur den Sonnenschirm zu vertreten hat. In unserem Klima, zumal im Sommer, diente das Haus früher fast nur als Decke während der Nacht. In der Hieroglyphenschrift der Indianer bedeutete ein Wigwam das Symbol eines Tagemarsches und eine Reihe derselben, in die Rinde eines Baumes geschnitten oder darauf gemalt, die Anzahl der Nachtlager. Der Mensch ward nicht so breitgliedrig und starkknochig geschaffen, daß er nicht danach trachten müßte, seine Welt einzuengen und einen ihm passenden Raum zu ummauern. Anfangs lebte er nackt unter freiem Himmel. Das war ganz angenehm bei heiterem, warmem Wetter und im Tageslicht. Doch die Regenzeit und der Winter – um von der glühenden Sonne gar nicht zu reden – würden sein Geschlecht gar bald im Keime zerstört haben, wenn er sich nicht schleunigst mit dem Schutz eines Hauses umgeben hätte. Es wird erzählt, daß Adam und Eva mit Blättern sich bedeckten, bevor sie noch andere Kleider trugen. Der Mensch wünschte sich ein Heim, einen warmen oder gemütlichen Platz, wo er zunächst seinen Körper, dann aber auch seine Stimmungen wärmen konnte.
Wir können uns leicht jene Zeit vorstellen, wo das Menschengeschlecht noch in den Kinderschuhen steckte, und wo irgend ein kühner Sterblicher in eine Felsenhöhle kroch, um einen Unterschlupf zu finden. Ein Kind beginnt die Welt bis zu einem gewissen Grade wieder von vorn und ist mit Vorliebe selbst bei Nässe und Kälte im Freien. Es folgt seinem Instinkt, wenn es »Haus« und »Pferd« spielt. Wer hat vergessen, mit welchem Interesse er in seiner Jugend einen überhängenden Felsen oder irgend etwas, was einer Höhle glich, betrachtete? Ein Teil jenes instinktiven Verlangens unserer ältesten Ahnen war noch in uns lebendig. Von der Höhle gelangten wir zu Dächern aus Palmblättern, aus Rinde und Zweigen, aus fest gewobener Leinwand, aus Gras und Stroh, Brettern und Schindeln, aus Steinen und Ziegeln. Schließlich wissen wir überhaupt nicht mehr was ein Freiluftleben ist, und unser Leben ist ein häusliches in mehr Beziehungen als wir glauben. Vom Herd zum Feld ist ein weiter Weg. Es wäre recht angebracht, wenn wir häufiger den Tag und die Nacht ohne Scheidewand zwischen uns und den Himmelskörpern verlebten, wenn der Dichter nicht so viel unter Dach und Fach dichten, wenn der Heilige dort nicht so lange hausen würde. Vögel singen nicht in Käfigen, und Tauben hüten ihre Unschuld nicht im Taubenschlag.
Wenn aber jemand beabsichtigt sich ein Wohnhaus zu bauen, so wird er gut tun, ein paar Unzen Yankeeschlauheit anzuwenden, sonst wird er schließlich in einem Armenhause, in einem Labyrinth ohne Schlüssel, in einem Museum, Armenhaus, Gefängnis oder in einem herrlichen Museum sich befinden. Überlegen wir uns einmal, wie schwach der Schutz zu sein braucht, der unbedingt notwendig ist! Ich sah in diesem Städtchen Penobscot-Indianer, die in Zelten aus dünnem Baumwollstoff lebten, während der Schnee rings herum fast einen Fuß hoch lag. Ja, ich hatte die Empfindung, sie würden sich freuen, wenn er noch höher läge, um sie vor dem Wind zu schützen. Früher, als die Frage, wie ich mir auf ehrliche Weise meinen Lebensunterhalt verdienen könne ohne all meine freie Zeit für meine eigentlichen Bestrebungen zu verlieren, mich noch heftiger quälte als jetzt – denn leider habe ich ein etwas dickes Fell bekommen –, sah ich oftmals eine große Kiste, die 6 Fuß hoch und 3 Fuß breit war, am Bahndamm stehen. Die Arbeiter pflegten darin während der Nacht ihre Werkzeuge zu verschließen. Ich dachte dann bei mir, daß jeder Mensch, der in arger Bedrängnis ist, eine solche Kiste für einen Dollar kaufen könne. Würde er ein paar Löcher in sie bohren, um auch der Luft Zutritt zu gewähren, so könnte er während der Nacht und zur Regenzeit hineinschlüpfen, den Deckel festhaken, nach Herzenslust seinen Stimmungen nachhängen und im Grunde seiner Seele frei sich fühlen. Das wäre noch nicht das Schlechteste und eine keineswegs zu verachtende Alternative gewesen. Man könnte wach bleiben solange man Lust hätte, aufstehen, wenn man wollte und ausgehen, ohne den Pachtherrn oder den Hausherrn wegen der Miete fortwährend auf den Fersen zu haben. Mancher Mensch, der in solch einer Kiste sicherlich nicht vor Frost gestorben wäre, wurde wegen des Mietzinses für eine größere und prächtigere Kiste zu Tode gequält. Ich scherze durchaus nicht. Das Problem »Sparsamkeit« läßt sich wohl leichthin besprechen, jedoch nicht leichthin lösen. Einst verfertigte man hier ein bequemes Haus für ein rauhes, abgehärtetes, an ein Freiluftleben gewöhntes Geschlecht aus dem Material, das die Natur fertig lieferte. Gookin, ein Aufseher über die von der Massachusetts-Kolonie unterworfenen Indianer schrieb im Jahre 1674: »Ihre besten Häuser sind sehr sauber, dicht und warm und mit Baumrinde bedeckt. In den Jahreszeiten, wo der Saft emporsteigt, wird die Rinde von den Bäumen losgeschält, und im grünen Zustand durch den Druck von Holzblöcken zu großen Platten gepreßt. ... Die gewöhnlichen Häuser werden mit Matten, die sie aus einer Art von Flatterbinsen verfertigen, bedeckt. Auch sie sind halbwegs dicht und warm, aber nicht so gut als die zuvor erwähnten ...» Einige Häuser, die ich selbst sah, waren 60 oder 190 Fuß lang und 30 Fuß breit. ...Ich habe häufig in solch einem Wigwam gewohnt und gefunden, daß er so warm war wie irgend ein bestes englisches Haus.« Er fügt hinzu, daß das Innere fast stets mit schön gearbeiteten und bestickten Matten belegt und ausgekleidet und mit verschiedenartigen Gebrauchsgegenständen versehen gewesen sei. Die Indianer waren sogar soweit fortgeschritten, daß sie die Wirkung des Windes durch eine Matte regulierten, die über einer im Dache befindlichen Öffnung hing und durch eine Schnur in Bewegung gesetzt werden konnte. Der Neubau einer solchen Wohnung nahm höchstens zwei Tage in Anspruch; das Abbrechen und Wiederaufstellen dagegen nur einige Stunden. Jede Familie besaß solch ein Haus oder hatte darin ihre Wohnräume.
Bei den Wilden besitzt jede Familie ein Obdach, welches den Vergleich mit jedem andern aushält und für gröbere und einfachere Bedürfnisse genügt. Ich glaube mich maßvoll auszudrücken, wenn ich andrerseits behaupte, daß – obwohl die Vögel ihre Nester, die Füchse ihre Höhlen und die Wilden ihre Wigwams haben – in der modernen zivilisierten Gesellschaft nur ungefähr jede zweite Familie ein Obdach besitzt. In den Großstädten, in denen die Zivilisation Hauptfachlich herrscht, ist im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung die Zahl derer, die ein eigenes Heim besitzen, äußerst klein. Der Rest bezahlt für dieses periphere, im Sommer wie im Winter unentbehrliche Kleidungsstück eine jährliche Steuer, die zum Ankauf eines ganzen Dorfes indianischer Wigwams genügen würde, die unter den obwaltenden Verhältnissen jedoch nur dazu dient den Menschen sein ganzes Leben lang arm zu erhalten. Ich habe nicht die Absicht mich hier weiter über den Nachteil, den die Miete gegenüber dem Besitz aufweist, auszusprechen. Es liegt aber auf der Hand, daß der Wilde deswegen ein Haus sein Eigen nennt, weil es so wenig kostet, während der zivilisierte Mensch meistens ein Haus mietet, weil er den Besitz nicht bezahlen kann. Die Schwierigkeit zu mieten vermindert sich dabei im Lauf der Zeit durchaus nicht. Und doch, entgegnet man mir, wenn der arme zivilisierte Mensch diese Steuer bezahlt, so erhält er eine Wohnung, die im Vergleich mit dem Obdach eines Wilden ein Palast genannt werden kann. Eine jährliche Miete von 25 bis 100 Dollars – soviel zahlt man auf dem Lande – verschafft ihm die berechtigte Nutznießung all jener Verbesserungen, die in Jahrhunderten geschaffen wurden: er kann geräumige, sauber gemalte oder tapezierte Zimmer, Rumfordkamine, Jalousien, kupferne Wasserpumpen, automatische Sicherheitsschlösser, einen bequemen Keller und manche andere Dinge benutzen. Doch wie kommt es, daß der, welcher nach Ansicht seiner Mitmenschen all dieses genießen kann, so häufig als armer Mensch inmitten der Zivilisation lebt, während der Wilde, der all dieses nicht besitzt, als Wilder reich ist. Wenn man behauptet, daß die Zivilisation einen wirklichen Fortschritt in den Existenzbedingungen des Menschengeschlechtes bedeutet – und ich glaube, daß dies der Fall ist, wenn auch nur die Weisen sie mit Vorteil zu benutzen verstehen – so muß auch bewiesen werden, daß sie bessere Wohnungen schuf ohne den Preis derselben zu erhöhen. Der Preis eines Gegenstandes aber wird mit einem größeren oder kleineren Bruchteil unseres Lebens sofort oder allmählich bezahlt. In dieser Gegend hier kostet ein Durchschnittshaus ungefähr 800 Dollars. Um diese Summe zu ersparen, sind ungefähr 15 bis 20 Lebensjahre eines Arbeiters notwendig – selbst wenn er keine Familie zu ernähren hat. Der Geldwert der Tagesarbeit eines Mannes ist hierbei auf einen Dollar veranschlagt. Denn wenn die einen mehr verdienen, verdienen die anderen weniger. Der Arbeiter hat also mehr als die Hälfte auszugeben, bevor sein Wigwam verdient ist. Setzen wir andererseits den Fall, daß er Miete zahlt, so ist das nur eine ungewisse Wahl zwischen zwei Übeln. Würde ein Wilder klug daran tun, unter solchen Bedingungen seinen Wigwam gegen einen Palast auszutauschen?
Man kann mit Recht vermuten, daß nach meiner Ansicht die Anhäufung dieses überflüssigen, als Reservefonds für die Zukunft dienenden Besitzes, soweit das Individuum in Betracht kommt, eigentlich nur deshalb von Nutzen ist, weil dadurch die Bestreitung der Begräbniskosten ermöglicht wird. Vielleicht aber wird es von dem Menschen gar nicht verlangt, daß er sich selbst begräbt. Wie dem auch sei – hier wird ein wichtiger Unterschied zwischen dem Menschen der Zivilisation und dem Wilden angedeutet. Zweifellos hat man die besten Absichten mit uns, wenn man die Lebensweise eines zivilisierten Volkes zu einer Institution erhebt, in welcher das Leben des Individuums zum großen Teil absorbiert wird, um das der Rasse zu erhalten und zu vervollkommnen. Ich möchte aber gerade zeigen, durch was für ein Opfer dieser Vorteil heutzutage erreicht wird, und darauf hinweisen, daß es doch vielleicht möglich ist unser Leben so zu verbringen, daß wir alle Vorteile aber keine Nachteile daraus ziehen. Was treibet Ihr unter Euch dies Sprichwort und sprechet: »Ihr habt allezeit Arme bei Euch«, oder »Die Väter haben Herlinge gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden«?
»So wahr ich lebe,« spricht der Herr, – »solch Sprichwort soll nicht mehr unter Euch gehen in Israel.«
»Denn siehe, alle Seelen sind mein; des Vaters Seele ist sowohl mein, wie des Sohnes Seele. Welche Seele sündigt, die soll sterben.«
Wenn ich meine Nachbarn, die Farmer von Concord betrachte, die mindestens so wohlhabend sind wie die anderen Stände, so finde ich, daß die meisten von ihnen sich zwanzig, dreißig oder vierzig Jahre abgequält haben, um die wirklichen Eigentümer ihrer Farmen zu werden, die sie gewöhnlich verschuldet geerbt, oder mit geborgtem Geld gepachtet haben. Und ein Drittel ihrer mühseligen Arbeit kann man als den Preis ihres Hauses in Rechnung setzen – in der Regel