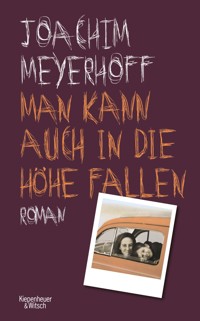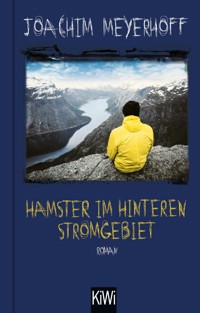9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alle Toten fliegen hoch
- Sprache: Deutsch
Zu Hause in der Psychiatrie – das kommt davon. Der zweite Band des Zyklus »Alle Toten fliegen hoch« von Joachim Meyerhoff, ein brüllend komischer und tieftrauriger Familienroman. Ist das normal? Zwischen Hunderten von körperlich und geistig Behinderten als jüngster Sohn des Direktors einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufzuwachsen? Der junge Held in Joachim Meyerhoffs zweitem Roman kennt es nicht anders – und mag es sogar sehr. Sein Vater leitet eine Anstalt mit über 1.200 Patienten, verschwindet zu Hause aber in seinem Lesesessel. Seine Mutter organisiert den Alltag, hadert aber mit ihrer Rolle. Seine Brüder widmen sich hingebungsvoll ihren Hobbys, haben für ihn aber nur Häme übrig. Und er selbst tut sich schwer mit den Buchstaben und wird immer wieder von diesem großen Zorn gepackt. Glücklich ist er, wenn er auf den Schultern eines glockenschwingenden, riesenhaften Insassen übers Anstaltsgelände reitet. Joachim Meyerhoff erzählt liebevoll und komisch von einer außergewöhnlichen Familie an einem außergewöhnlichen Ort, die aneinander hängt, aber auseinandergerissen wird. Und von einem Vater, der in der Theorie glänzt, in der Praxis aber stets versagt. Wer schafft es sonst, den Vorsatz zum 40. Geburtstag, sich mehr zu bewegen, gleich mit einer Bänderdehnung zu bezahlen und die teuren Laufschuhe nie wieder anzuziehen? Oder bei Flaute mit dem Segelboot in Seenot zu geraten und vorher noch den Sohn über Bord zu werfen? Am Ende ist es aber wieder der Tod, der den Glutkern dieses Romans bildet, der Verlust, der nicht wieder gutzumachen ist, die Sehnsucht, die bleibt – und die Erinnerung, die zum Glück unfassbar pralle, lebendige und komische Geschichten produziert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Joachim Meyerhoff
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war
Alle Toten fliegen hochTeil 2
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joachim Meyerhoff
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joachim Meyerhoff
Joachim Meyerhoff, geboren 1967 in Homburg/Saar, aufgewachsen in Schleswig, war vierzehn Jahre lang Ensemblemitglied des Wiener Burg-theaters. In seinem sechsteiligen Zyklus »Alle Toten fliegen hoch« trat er als Erzähler auf die Bühne und wurde zum Theatertreffen 2009 eingeladen. Seine Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit 2019 ist Joachim Meyerhoff Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ist das normal? Zwischen Hunderten von körperlich und geistig Behinderten als jüngster Sohn des Direktors einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufzuwachsen? Der junge Held in Joachim Meyerhoffs zweitem Roman kennt es nicht anders – und mag es sogar sehr. Sein Vater herrscht über 1200 Patienten, verschwindet zu Hause aber in sei-nem Lesesessel. Seine Mutter organisiert den Alltag, hadert aber mit ihrer Rolle. Seine Brüder widmen sich hingebungsvoll ihren Hobbys, haben für ihn aber nur Häme übrig. Und er selbst tut sich schwer mit den Buchstaben und wird immer wieder von diesem großen Zorn gepackt. Glücklich ist er, wenn er auf den Schultern eines glockenschwingenden, riesenhaften Insassen übers Anstaltsgelände reitet.
Joachim Meyerhoff erzählt liebevoll und komisch von einer außergewöhnlichen Familie an einem außergewöhnlichen Ort, die aneinander hängt, aber auseinandergerissen wird. Und von einem Vater, der in der Theorie glänzt, in der Praxis aber stets versagt. Wer schafft es sonst, den Vorsatz zum 40. Geburtstag, sich mehr zu bewegen, gleich mit einer Bänderdehnung zu bezahlen und die teuren Laufschuhe nie wieder anzuziehen? Oder bei Flaute mit dem Segelboot in Seenot zu geraten und vorher noch den Sohn über Bord zu werfen?
Am Ende ist es aber wieder der Tod, der den Glutkern dieses Romans bildet, der Verlust, der nicht wieder gutzumachen ist, die Sehnsucht, die bleibt – und die Erinnerung, die zum Glück unfassbar pralle, lebendige und komische Geschichten produziert.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Illustration
Bis hierhin und nicht weiter
Zuhause in der Psychiatrie
Die Höhe der Buchstaben
Das Geburtstagsfrühstück
Alle Vögel sind schon da
Spezialgebiet: Wüste
Das Kaffeekränzchen
Vierzig Kugeln Sorgfalt
Sehnsucht nach Schreien
Die Sportverletzung
Der Glöckner
Der große Klare aus dem Norden
Maria in der Zwangsjacke
Der Glöckner
Katzen im Querschnitt
Ich bin zwei Öltanks
Dreimal Gold
Blutsbrüder
Die JoMaHe
Der Meiler
Das Leben auf dem Land
Schneekatastrophe
Der Seemann und die Nonne
Das Schwein soll endlich abhauen
Sommerfest
Marlene
Rotary-Fasching
Die Betten
Freundinnen
Franco
Aus dem Nichts
Komm, wir reiten nach Laramie
Auferstehung
Blutsbrüder
The Final Countdown
Wer allein ist, ist auch im Geheimnis
Theorie und Praxis
Leseprobe »Man kann auch in die Höhe fallen«
Für Alma
Bis hierhin und nicht weiter
Mein erster Toter war ein Rentner.
Lange bevor in meiner Familie ein Unfall, eine Krankheit und Altersschwäche die nächsten geliebten Menschen verschwinden ließen, lange bevor ich hinnehmen musste, dass der eigene Bruder, der zu junge Vater, die Großeltern, ja selbst der Kindheits-Hund nicht unsterblich waren, und lange bevor ich in ein zwanghaftes Dauergespräch mit meinen Gestorbenen geriet – so heiter, so verzweifelt –, fand ich eines Morgens einen toten Rentner.
Ich war eine Woche zuvor sieben Jahre alt geworden und hatte diesem Geburtstag entgegengefiebert, da ich durch ihn endlich das Recht erwarb, den Schulweg allein zurückzulegen. Von einem Tag auf den anderen durfte ich nun stehen bleiben und weitergehen, wann immer ich es wollte. Das Gelände der Psychiatrie, in der ich aufwuchs, und auch die außerhalb der Anstaltsmauern liegenden Gärten, Häuser, Straßen und Gebüsche waren wie verändert, und ich entdeckte lauter Dinge, die mir in Begleitung meiner Mutter oder meiner Brüder noch nie aufgefallen waren. Ich machte etwas größere Schritte und kam mir unglaublich erwachsen vor. Dadurch, dass ich ein Einzelner war, vereinzelten sich auch die Dinge um mich herum. Gegenüberstellungen auf Augenhöhe: die Kreuzung und ich. Der Kiosk und ich. Die Schrottplatz-Mauer und ich.
Wie viele Entscheidungen ich plötzlich selbst treffen durfte, überraschte mich. An der Hand meiner Mutter hatte ich meist vor mich hin geträumt oder mit ihr geredet und mich, nie auf den Weg achtend, zur Schule bringen lassen wie einen Brief zum Postkasten.
Die erste Woche lang war ich brav, wie ich es hoch und heilig versprochen hatte, den verabredeten Weg gegangen – den Weg, in den mich meine Mutter mit allem Nach-links- und Nach-rechts- und wieder Nach-links-Gucken eingewiesen hatte, doch am darauffolgenden Montag beschloss ich, einen kleinen Umweg durch die Schrebergartensiedlung zu nehmen. Ich stieß ein grün vergittertes Tor auf und spazierte einen Pfad zwischen Miniaturanwesen, Bäumchen und Gemüsebeeten entlang. Ganz wohl war mir dabei nicht, da mein Vater mir das Betreten der Schrebergartensiedlung sogar ausdrücklich verboten hatte. »Das kommt öfter vor, dass sich in solchen Hütten irgendwelche Typen verstecken!«, hatte er mich gewarnt, »geh da bitte nicht lang. Abgemacht?« »Klar Papa, abgemacht!«
Ich pflückte mir einen unreifen Apfel, biss hinein, spuckte das saure Stückchen geschickt durch zwei Zaunlatten und schleuderte ihn so weit ich konnte über die Dächer. Ich wartete auf ein Geräusch, aber es blieb vollkommen still, so als hätte ich den Apfel direkt in die Schwerelosigkeit gepfeffert. Ich spuckte ein paarmal aus und ging weiter. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Schrebergartensiedlung so groß und unübersichtlich sein würde. An jeder Abzweigung hielt ich mich rechts und hoffte, so zu einem Tor zu gelangen, das ich genau kannte und von dem aus es nur noch ein paar Hundert Meter bis zu meiner Schule waren.
Ich sah auf meine neue Armbanduhr, die ich zum Geburtstag bekommen hatte, ohne sie mir gewünscht zu haben. Aber die Uhr war die Bedingung meiner neuen Selbstständigkeit. Schon fünf Minuten vor acht. Jetzt musste ich mich wirklich beeilen. Ich kam zu einem Gartenzaun, an dem ich schon einmal vorbeigekommen war, und ging schneller. Alle Wege sahen gleich aus, und ich versuchte, die Beklommenheit, die in mir aufstieg, zu ignorieren. Die verschlungene Lieblichkeit der eben noch aus frühmorgendlicher Ruhe erwachenden Schrebergartensiedlung war genauso dahin wie meine gerade erst geweckte Lust, sie ganz auf mich gestellt zu durchstreifen. Da hörte ich weit entfernt, aber deutlich die Schulglocke zur ersten Stunde klingeln. Ich rannte los. Der Schulranzen polterte so heftig gegen meinen Rücken, als würde mich ein übellauniger Kutscher antreiben.
Endlich kam ich auf eine lange Gerade, an deren Ende ich das gesuchte Tor sah. Als ich es erreichte, war es verschlossen, aber dahinter erkannte ich meinen Schulweg. Ich sprang in die Höhe und hielt mich an der Oberkante des Tores fest. Da das Gitter engmaschig war, rutschten meine Schuhspitzen immer wieder ab, und erst als ich meine Füße flach dagegendrückte, gelang es mir, ganz hinaufzuklettern. Ich schwang ein Bein auf die andere Seite, wollte das andere gerade nachziehen und hinunterspringen, als ich direkt im Garten links unter mir im Blumenbeet einen Mann liegen sah. Ich wusste sofort, dass es ein Toter war.
Noch heute wundere ich mich darüber, dass ich nicht im Geringsten erschrak und mich auf und davon machte. Im Gegenteil: Mit hoch gespannter Wissbegierde balancierte ich rutschend meinen Po auf dem Eisentor stückchenweise in seine Richtung. Jetzt konnte ich ihn noch besser sehen. Er war vollständig und, wie es mir vorkam, vornehm gekleidet. Ganz in Beige. Einer seiner hellbraunen sommerlichen Schuhe war ihm von der ebenfalls hellbraunen Socke gerutscht, sein Hemd steckte akkurat in der leichten Hose, und so einen geflochtenen Sommergürtel trug auch mein Vater hin und wieder. Seine Füße und Unterschenkel lagen auf der Wiese, der restliche Körper in den Blumen. Was es für Blumen waren, wusste ich nicht, aber sie waren prächtig und farbenfroh.
Warum war ich mir so sicher, dass es ein Toter war? Warum zog ich es nicht den Bruchteil einer Sekunde in Betracht, Hilfe zu holen? Warum kam es mir so vor, als ob diese Leiche für mich bestimmt wäre und mir gehörte?
Um seinen Oberkörper herum waren die Stängel geknickt, teilweise abgerissen, so als hätte er um sich geschlagen, sich im Todeskampf gewälzt, im Schmerz in die Pflanzen gegriffen. Er lag mit dem Gesicht nach unten, sein graues Haar war zerzaust. Ich konnte den Blick nicht abwenden, blieb auf meinem Aussichtstor sitzen und betrachtete ihn. Ich war hin- und hergerissen. Sollte ich mich zu ihm hinunterlassen, ins Blumenreich der Toten hinabsteigen oder doch auf der anderen Seite hinunterspringen – der Seite der Lebenden, der Autos, der Passanten und der unaufhaltsam fortschreitenden Schulstunde? Mein eines Bein hing über dem Garten, das andere über dem Gehweg. Ein Gedanke, erst noch etwas vage, verfestigte sich zu einer sensationellen Erkenntnis und bahnte sich schließlich seinen Weg über die Zunge zu den Lippen: »Ich hab einen Toten gefunden«, sagte ich leise, mehrmals und mit wachsender Begeisterung, »ich hab einen Toten gefunden.«
Ich sprang vom Tor auf die Straßenseite und rannte zur Schule, stieß das Schultor auf, jagte die Treppen hoch, sprengte in meine Klasse und überbrachte laut jubilierend die frohe Botschaft: »ICH HAB EINEN TOTEN GEFUNDEN!!!!« Die Lehrerin und alle Schüler sahen mich an, als wäre der Heiland höchstpersönlich durch die Klassenzimmerdecke gebrochen. Was ist hier los? Sind die taub?, dachte ich, riss meine Arme in die Höhe, ballte die Fäuste zum Sieg und brüllte noch lauter als zuvor: »IIIIICH HAAAAAB EINEN TOOOOOTEN GEFUNDEN!!!!!«
»Sag mal, was ist denn mit dir los«, fuhr mich da die Lehrerin mit einer mir völlig unverständlichen Gereiztheit an, »bist du noch zu retten? Hier so reinzuplatzen? Spinnst du?« Da überkam mich eine tief empfundene Nachsicht mit der Begriffsstutzigkeit meiner mich ungläubig beäugenden Mitschüler und mit den unpädagogisch entglittenen Gesichtszügen der Lehrerin. Ich durfte diese Menschen nicht überfordern. Siegessicher und betont langsam weihte ich sie in meinen Sensationsfund ein. »Bei den Schrebergärten liegt einer – das ist ein Toter. Den hab ich gefunden. Der – ist – tot!«, buchstabierte ich überdeutlich in all die offen stehenden Münder hinein. »Der liegt da zwischen den Blumen. Ein Mann. Ein Toter. Ich hab den gefunden. Ja, ich. Ich hab einen Toten gefunden!« »Setz dich mal auf deinen Platz.«
Ich schlenzte mir den Schulranzen vom Rücken und ließ mich auf meinem Stuhl nieder. Mein Gott, wie niedrig die Tischplatte war. Meine Knie passten kaum unter die Ablage. Doch das wunderte mich nicht. Wer im Besitz eines Toten ist, macht einen Sprung nach vorn, der schießt in die Höhe, der dehnt sich aus und hat einen entscheidenden Vorsprung. Die Lehrerin erhob sich von ihrem Pult, welches mir so winzig und kümmerlich vorkam wie nie zuvor, trat auf mich zu, ging in die Hocke und sah mich ernst an. Noch oft im Leben sollte mir dieser Blick begegnen, dieser Blick, der einem unmissverständlich klarmacht: »Bis hierhin und nicht weiter. Das ist jetzt nicht mehr lustig.« Dieser Blick, der einen vor die Wahl stellt, sich als Münchhausen, als Lügenbaron aus der Gemeinschaft wahrheitsliebender und aufrichtiger Mitmenschen zu verabschieden und ein unrettbarer Hochstapler zu werden oder aber zu gestehen, zu bereuen und sich von allen Unwahrscheinlichkeiten mit Abscheu abzuwenden.
Lange sah sie mich so an: »Also, was ist los? Sag die Wahrheit: Du hast was gefunden?« Ich schwieg. So, als ob mir ihre Stimme den Rückweg aus meiner Verirrung offenhalten wollte, sprach sie ein umarmendes, alle Last von den Schultern nehmendes »Komm, sag schon: Was ist wirklich passiert?«. Ich war noch außer Atem von meinem rasanten Lauf, oder richtiger, die Atemlosigkeit brach überhaupt erst jetzt aus, da ich in aller Ruhe antworten sollte.
»Ich hab was gefunden.« »Und was, bitte?« Ich schnappte nach Luft: »Einen Toten!« »Einen Toten?« »Ja.« »Und wo?« »Bei den Schrebergärten.« Noch nie, während keiner Unterrichtsstunde, ja selbst wenn der zum Schlüsselbundwerfen neigende, im Krieg durch einen Kopfschuss schwer verwundete Direktor einen erkrankten Lehrer bei uns vertrat, war es so totenstill im Klassenraum gewesen.
Je mehr ich bedrängt wurde, desto unsicherer wurde ich. Auf meinem Toten zu beharren schien plötzlich viel schwerer zu sein, als ihrer Ungläubigkeit nachzugeben und allem einfach abzuschwören, »Sie haben vollkommen recht. Entschuldigen Sie bitte« zu sagen oder »Ich glaube, ich hab mich getäuscht. Da war doch nichts. Eine Hose, ja eine Hose vielleicht, eine umgekippte Vogelscheuche. Genau, das war’s. Es tut mir so leid, dass ich zu spät gekommen bin. Es war eine Ausrede. Ich habe gar nichts gefunden und ganz sicher keinen Toten.«
Aber so leicht gab ich mich nicht geschlagen, auch wenn sie jetzt den Druck erhöhte: »Wenn das stimmt, was du da sagst, dann muss ich die Polizei rufen. Die gehen dahin, und wenn dann da nichts ist, dann – und das verspreche ich dir – bekommst du einen Heidenärger.« Oh nein, Polizei, dachte ich, was tun? Vielleicht hatte ich mich ja wirklich getäuscht, war er doch nur bewusstlos gewesen oder hatte etwas in den Blumen gesucht. Vielleicht, dachte ich verzweifelt, ist er schon längst wieder aufgestanden, hat sich seinen Schuh angezogen, die Blumen aufgerichtet, die Haare gekämmt und sich in einen Liegestuhl vor sein adrettes Häuschen gesetzt. Der Polizist würde an sein Gartentörchen treten, stellte ich mir vor, und ihn begrüßen: »Guten Tag, entschuldigen Sie die Störung, haben Sie hier irgendwo einen Toten gesehen?« »Einen Toten? Nein, Herr Wachtmeister, also ganz sicher nicht.« »Ein kleiner Junge hat behauptet, hier läge einer.« »Also so einen Quatsch hab ich ja schon lange nicht mehr gehört. In meinem Garten? Ein Toter? Das wüsste ich aber. Was sich diese Knirpse so alles ausdenken, was?« »Da haben Sie allerdings recht. Schönen Tag noch.«
Was sollte ich nur tun? Alle sahen mich an. Selbst die im Werkunterricht gefertigten Knetgummidinosaurier auf den Fensterbänken schienen mich skeptisch anzuglotzen. Aber es war doch wahr, wahr, wahr! »Ja«, sprach ich, »ich habe ihn gesehen. Im Gras. Er war tot!« »Gut.« Sie nickte. »Bleibt bitte alle – und wenn ich alle sage, meine ich alle – im Klassenzimmer auf euren Stühlen sitzen, ich bin gleich wieder da.«
Sobald sie aus der Tür war, kamen alle, aber wirklich alle zu mir gerannt. »Echt?« »Wo denn?« »Wie sah der aus?« »War der schon verfault?« Ich lehnte mich zurück und gab Antwort: »Nee, kein bisschen.« »Woher wusstest du, dass er tot war?« »Das sah man.« »Ey, wenn der noch gelebt hat?« »Vielleicht ein Mord?« »Hast du Blut gesehen?« Ich war kurz davor, der Versuchung nachzugeben und ein ganz klein bisschen Blut an seinem Hinterkopf entdeckt zu haben. Ich sah es genau vor mir. »Mord wäre natürlich schon möglich«, sagte ich, »an seinem … Nein, also Blut habe ich nicht gesehen.«
Die Lehrerin kam zurück, und die Schüler spurteten auf ihre Plätze. Sie stellte sich hinter ihr Pult, hob Schweigen gebietend die Hände und rief: »Du sollst zum Direktor kommen.« Ich stand auf und ging zur Klassenzimmertür. Sie kam zu mir, legte mir ihre Hand auf den Rücken, deren Wärme augenblicklich durch meinen Pullover drang, mir wie eine heiße Ermahnung in die Haut hineinglühte, und warnte mich flüsternd, in einem unbehaglichen Tonfall, sodass es die anderen Schüler nicht hören konnten: »Noch kannst du mir die Wahrheit sagen. Du weißt, der Direktor hasst es, wenn er angelogen wird. Also, du bist dir ganz sicher?«
Ihr Vertrauen in mich stand auch deshalb auf tönernen Füßen, da sie mich erst kürzlich einer Lüge überführt hatte. Keine große Sache, wie ich fand. Auf dem Schulhof hatten sich zwei Jungs geprügelt. Noch nie hatte ich eine Schlägerei gesehen, aber um die Kämpfenden hatte sich eine dichte Traube von Kindern gebildet. Ich versuchte, mich hineinzuquetschen, aber es gelang mir einfach nicht. Ich hörte Schnaufen und Anfeuerungsrufe. Da sah ich unsere Lehrerin über den Schulhof rennen. Gleich würde das Spektakel beendet werden. Ich rief: »Ich will auch was sehen!« Keine Chance. »Mensch, lasst mich da durch! Ich will auch was sehen!« Wieder keinerlei Reaktion. Und dann schrie ich, ohne zu überlegen, so laut ich konnte: »Ich bin Arzt!« Der äußere Rand der Schaulustigen gab nach und ich bahnte mir einen Weg. »Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt!!« Es bildete sich ein Spalier, an dessen Ende ich endlich die sich brutal schlagenden Jungen sah. So schritt ich hinein ins Zentrum: ein siebenjähriger Arzt auf dem Weg zu seinem ersten Notfall.
Da packte mich die Lehrerin im Nacken und schob mich zur Seite. »Wir sprechen uns später, verstanden?«, und sie stürzte sich wie ein beherzter Schiedsrichter zwischen die am Boden ineinander verkeilten Ringer.
In der nächsten Pause musste ich zu ihr ins völlig verrauchte Lehrerzimmer kommen, mich an einen Tisch setzen und Rede und Antwort stehen. »Was hast du da gerufen?« »Ich weiß nicht mehr.« »Das weißt du ganz genau. Lüg mich nicht an.« Ich senkte, eher zum Zeichen denn aus Überzeugung, schuldbewusst mein lockiges Haupt. »Du wiederholst jetzt sofort, was du gerufen hast! Oder ich ruf deine Eltern an.« »Ich bin Arzt!« »Bist du verrückt geworden? Was soll denn das?« »Ich wollte sagen: Mein Vater ist Arzt.« »So ein Quatsch! Und warum?« »Ich wollte was sehen.« »Was gab es denn da zu sehen?« Die Lehrerin sprach mit mir wie mit einem Begriffsstutzigen, gedehnt, überdeutlich: »Du – bist – kein – Arzt!« Ich nickte. »Wer – ist – Arzt?« »Mein Vater!« Ich sprach direkt in einen Aschenbecher vor mir, und winzige Rußpartikel schwebten in die Höhe, während ich in ihn hineinbeichtete. »Gut, geh jetzt.«
Selbst noch in den verlassenen Gängen auf dem Weg zum Direktor spürte ich die heiße Hand der Lehrerin auf meinem Rücken. Der Direktor saß hinter einem monströsen Schreibtisch. Weder die Tür noch die Fenster seines Zimmers erschienen mir groß genug, um diesen Klotz hineinzubekommen. Die ganze Schule musste um diesen Schreibtisch herumgebaut worden sein. Sofort geriet ich ins Träumen, sah einen massiven Schreibtisch an einem Kran in der Luft schweben. Bauarbeiter rufen »Etwas höher! Etwas weiter links! So ist gut!« und positionieren das Riesenmöbel perfekt ins Nichts, während drum herum die Mauern meiner Schule hochgezogen werden.
»Wo hast du ihn gefunden?« »Was?« »Wo hast du den Mann gefunden?« »Direkt oben beim Tor. Das ist aber zu. Dahinter liegt er im Garten.« »Bist du sicher?« »Ich glaube schon.« »Wie – du glaubst?« Er sah mich mit einem durchdringenden Blick an, einem richtigen Direktorenblick, der mir aber etwas stumpf vorkam, etwas verbraucht. Ich war mir sofort sicher, dass er exakt mit diesem Blick schon Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Kinder anvisiert hatte.
»Entweder du hast ihn gesehen, den Toten, oder nicht! Weißt du, ich hab in meiner Jugend viele Tote gesehen, deren Anblick vergisst man nicht so leicht.« Er sah mir tief in die Augen, aber doch irgendwie durch mich hindurch in eine andere Zeit. »Wenn die mit verdrehten Armen und Beinen gefroren im Schnee liegen, das ist kein schöner Anblick. Gegen die Kälte haben wir uns von den toten Russen die Jacken geklaut. Mir fehlen vier Zehen.« Der Direktor nahm seine Brille ab, und ich sah in seinem kahlen Schädel eine Furche, die der Bügel in die Haut gedrückt haben musste. Dieser Mann war mir zutiefst suspekt. In einer Vertretungsstunde hatte er sein Akkordeon mitgebracht, Volkslieder gesungen und schließlich geweint. Minutenlang heulte er vor der Klasse und zog das Akkordeon auf und zu, ohne dass es einen Ton von sich gab. Wie ein faltiges Tier rang das Instrument um Atem, hockte ihm röchelnd auf dem Schoß und verendete erst, als es klingelte.
»Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?« »Was? Ja sicher. Also, ich hab einen gesehen. Ganz sicher. In den Blumen.« »Sicher?« »Sicher.« »Gut!« Er nahm einen schon zu dieser Zeit altmodischen, pechschwarzen Riesentelefonhörer vom Riesentelefon. »Guten Tag. Schule Nord, Direktor Waldmann. Ich möchte etwas melden. Einer unserer Schüler hat in den Schrebergärten einen Toten gefunden.« Er hörte zu, sah mich an. »Wann war das?« »Um acht, eine Minute nach acht!«, gab ich, glücklich darüber, wenigstens dies genau zu wissen, zur Antwort. Er sagte noch zweimal »Ja, gut« und legte auf. »Du kannst jetzt zurück in die Klasse gehen.« Wie, dachte ich, das soll es schon gewesen sein? Halb aus der Tür getreten, drehte ich mich wieder um: »Soll ich denn den Polizisten nicht die Stelle zeigen, wo er liegt?« »Wenn es ihn gibt, werden sie ihn schon finden. Geh jetzt. Und Grüße an deinen Vater.« »Mach ich.«
Auf dem Rückweg in meine Klasse kam mir plötzlich die Idee, aus der Schule heraus zum Gartentor zu rennen und der Polizei zuvorzukommen, um nachzusehen, ob er noch da war. Aber in diesem Moment klingelte es, die Schüler strömten aus den wild aufgestoßenen Türen, und meine Überlegung ging im allgemeinen Trubel unter. Mitschüler umringten mich, löcherten mich mit Fragen nach dem Rentner, und anfangs gelang es mir sogar noch, die ganze Sache wahrheitsgetreu zu erzählen. Aber bald schon war es einfach zu verlockend, durch kleine Ausschmückungen meine Fragesteller und Zuhörer, darunter auch mehrere Mädchen, weiter in meinen Bann zu schlagen. Auf die Frage »Hast du sein Gesicht gesehen?« hatte ich zuerst immer mit einem klaren Nein geantwortet. Doch dann, beim dritten oder vierten »Bist du sicher, dass du nicht mehr gesehen hast?«, antwortete ich: »Vielleicht doch ein wenig. Die Nase.« »Aber wenn du seine Nase gesehen hast, musst du doch auch ein Auge gesehen haben?« »Hab ich ja auch. Die Nase und das eine Auge.« »War es auf oder zu?« »Es war ….«, ich wurde sehr leise, »… auf.« Meine Frager hatten solch eine Sehnsucht nach dem Gesicht des Verblichenen, dass sie ihn durch die Intensität ihrer Fragen nach und nach auf den Rücken drehten. Ich wollte sie nicht enttäuschen. Von Pause zu Pause wurde mein Toter gruseliger. Gegen zehn Uhr starrten seine geöffneten Augen in den Himmel, gegen zwölf Uhr hing aus dem zahnlosen Rentnermund bereits eine weißliche Zunge heraus, und der Beginn der letzten Schulstunde verhinderte nur knapp, dass ihm ein schwarz schillernder Käfer in den Schlund krabbelte.
Nach Schulschluss – in keiner Unterrichtsstunde hatte ich an diesem Vormittag auch nur das Geringste mitbekommen, da ich besessen an den Details feilte – durchbrach ich schließlich auch noch den letzten Wahrheitswall. Von einem ganzen Pulk umringt, fabulierte ich mich auf dem Pausenhof um Kopf und Kragen. Der Klassenprimus, der oft tagelang fehlte, da er an Schachturnieren in beiden Teilen Deutschlands teilnahm, und mich sonst keines Blickes würdigte, fragte: »Und du bist dir zu hundert Prozent sicher, dass er nicht mehr gelebt hat?« »Ja, eigentlich schon, obwohl …« Ich sah nachdenklich in die gebannt an meinen Lippen hängende Runde, tat plötzlich überrascht, so als würde mir ein bisher entgangenes Puzzleteil der Geschichte wieder einfallen: »Obwohl, wenn du mich so fragst … Zwei Finger der … warte mal … ja, der linken Hand haben sich unter den Blumen bewegt.« »Unter den Blumen? Wie konntest du das denn dann sehen?«, warf sein vom Schachspielen bis zum Anschlag auf Logik trainiertes Hirn ein. »Na ja«, sagte ich, überwältigt von der Aufmerksamkeit, die mir zuteilwurde, die Spannung genießend, »seine beiden Finger sind ganz langsam, wie Würmer aus der Erde, durch das Blumengestrüpp hindurch an die Oberfläche gekrabbelt.«
Die Reaktionen meiner Familie auf meinen Toten waren ganz unterschiedlich. Meine Mutter drückte mich an sich und tröstete mich: »Du Armer, ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Das klingt ja schrecklich.« Mein psychologisch geschulter Vater sprach mit mir über die Vergänglichkeit des Lebens, rückte meinen Fund in einen allumfassenden Kontext und klärte mich über die Todesart des Rentners auf: »Das klingt ganz nach einem Herzinfarkt. Er wird nicht gelitten haben. Eigentlich ein guter Tod. Morgens beim Blumenpflücken.« Danach, was ich trotz seines Verbotes überhaupt in den Schrebergärten zu suchen hatte, fragte er zu meiner Erleichterung nicht.
Meine beiden älteren Brüder glaubten mir kein Wort, obwohl ich zur ursprünglichen Fassung meiner Leichenfunderzählung – so gut ich mich nach all den Ausschmückungen überhaupt noch an sie erinnern konnte – zurückgekehrt war. Erst nachdem ich einen meiner Tobsuchtsanfälle bekommen hatte, bitterlich weinte und schluchzte »Warum glaubt ihr mir nicht? Ich schwöre es, bei allem was mir heilig ist, ich schwöre es bei meinem Leben: Ich hab einen Toten gefunden!«, trat allmählich Bewunderung anstelle ihres Skeptizismus. Sie trösteten mich und quetschten jede noch so winzige Einzelheit aus mir heraus.
Dass sich allerdings in den nächsten Tagen kein einziger Polizist bei mir meldete, dass ich nicht in die Zeitung kam – ich stellte mir ein großformatiges Bild vor, auf dem ich ernst aussehend mit dem Finger auf die Fundstelle zeigte – und dass es für Tote keinen Finderlohn gab, all das kränkte mich nachhaltig.
Wieder und wieder musste ich in den folgenden Wochen von meinem Fund berichten. In der Schule, im Schwimmverein, meinen Brüdern, Verwandten und den Freunden meiner Eltern. Ich verfeinerte die Geschichte, merkte mir gelungene Formulierungen und entwickelte sogar so etwas wie auf die Zuhörerschaft abgestimmte Varianten. Meine Mitschüler und Brüder wollten sich gruseln, das Wort »verwest« war eine sichere Bank, und der Satz »Seine geöffneten Augen starrten in den Himmel. Sie waren leicht verwest« ließ auch mich jedes Mal aufs Neue erschaudern. Männliche Erwachsene galt es durch kindlich resolutes Handeln zu beeindrucken: »Ich hab mir alles genau eingeprägt: Uhrzeit, Fundstelle, die Haltung der Leiche, und bin losgerannt, direkt zum Direktor, und hab alles gemeldet!« Dem weiblichen Publikum gegenüber ließ ich nach und nach meine Scheu vor zu großem Pathos fahren und servierte schamlos Sätze wie diesen: »Ein Windhauch wehte abgerissene Rosenblüten über den steifen Körper. Einige verfingen sich in seinem grauen Haar.«
Natürlich war es mir vollkommen klar, dass ich log, aber es kam mir so vor, als würde die Geschichte ein Eigenleben führen und ich die Verantwortung dafür tragen, ihr zu genügen, mich ihrer würdig zu erweisen. Wer findet schon einen Toten? Ich wollte unbedingt, dass sich dieses außergewöhnliche Ereignis bei mir wohlfühlte, wollte, dass es bei mir blieb, und beschenkte es verschwenderisch mit Girlanden und Arabesken.
Da geschah etwas für mich Unfassbares, etwas, das bis heute mein Leben geprägt hat. Ich erzählte meine Rentnergeschichte zum ich weiß nicht wievielten Mal, diesmal einem Freund meines ältesten Bruders. Wie immer begann ich mit meinem Entschluss, den Schulweg zu verlassen, warf den unreifen Apfel, baute die Spannung auf, verirrte mich, kletterte über das Tor und entdeckte den in seinem Beet zusammengebrochenen Mann. Um mich nicht zu langweilen, erfand ich immer neue Einzelheiten und sagte schließlich: »Da sah ich, dass er einen Ring am Finger trug. Der sah richtig wertvoll aus. Kurz überlegte ich, vom Tor zu klettern und ihm den Ring vom Finger zu ziehen. Aber da klingelte die Schulglocke, und ich rannte davon.«
Während ich das mit dem Ring erfand, schoss mir plötzlich ein heißer Schauer über den Rücken, und ich sah den Ring tatsächlich vor mir. Es stimmte! Ich hatte es gar nicht erfunden. Mein Toter trug einen goldenen Ehering an seiner leblosen linken Hand!
Ich rief: »Das stimmt. Das stimmt ja wirklich! Er trug einen Ring!« Mein Bruder und sein Freund sahen mich verständnislos an. »Wie, was soll denn das heißen: Das stimmt?« »Na, das mit dem Ring. Das stimmt wirklich!«
Nie werde ich diesen Augenblick vergessen. Ich hatte etwas erfunden, das wahr war. Der ausgedachte Ring, der aus der Luft gegriffene Ring hatte den tatsächlichen Ring, den wahrhaftigen Ring wieder zum Leben erweckt. Wie ein archäologisches Instrument hatte die Lüge ein eingeschlossenes Detail herausgekratzt und den Tiefen des Gedächtnisses wieder entrissen.
Für mich war das eine unfassbar befreiende Erkenntnis: Erfinden heißt Erinnern.
Zuhause in der Psychiatrie
Das Landeskrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in dem ich aufgewachsen bin, hieß damals und heißt auch noch heute »Hesterberg«. Es ist das größte seiner Art in Schleswig-Holstein. Mein Vater war Kinder- und Jugendpsychiater, und als er dort Direktor wurde, gab es über eintausendfünfhundert Patienten. Gegründet wurde die Anstalt bereits 1817 von einem Herrn namens Dr. Suadicani, der sich mit der Bitte um den Bau einer Irrenanstalt »zur Rettung dieser unglücklichsten Menschen, deren Not zum Himmel schreit«, an den König gewandt hatte. Alle paar Jahre wurde sie umbenannt. Zuerst hieß sie »Provinzial-Irrenanstalt«, dann »Provinzial-Idiotenanstalt«, dann »Provinzial-Heil-und Pflegeanstalt für Geistesschwache«. Dann spezialisierte sie sich auf junge Menschen und nannte sich »Heil- und Erziehungsanstalt für blöd- und schwachsinnige Kinder« und schließlich, nach hundertfünfzig Jahren, »Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hesterberg«.
Es wohnten allerdings auch viele ältere und sogar sehr alte Patienten in der Klinik, die niemals in die Erwachsenen-Psychiatrie verlegt wurden, da ihnen das Verlassen ihrer meist schon seit dem Kleinkindalter vertrauten Umgebung nicht zuzumuten war.
Bis auf eine kurz vor der Einweihung stehende moderne Klinik stammten die Gebäude aus der Zeit der Jahrhundertwende. Riesige düstere Backsteinkästen, in denen bis zu zwanzig Patienten in einem Zimmer schliefen. Lange Leitern standen an den vierstöckigen Hochbetten. Die oberen Betten konnte man verriegeln, es waren eher kleine Käfige als Betten, damit die Patienten nicht herausfielen.
Das Gelände der Psychiatrie war groß und eine Welt für sich. Es gab eine Gärtnerei, eine Großküche, eine Tischlerei, eine Schneiderei, eine sogenannte Dampfwaschanstalt, sogar ein eigenes Kohleheizwerk mit rot gemauertem Schornstein und eine Schlosserei, in der fast ausschließlich Gitter geschweißt wurden: Fenstergitter, Gitterbetten, meterhohe Umzäunungsgitter für die Stationsgärten. An einigen dieser Orte arbeiteten Patienten in einer Mischung aus Arbeitstherapie und Ausbeutung.
Unser Haus war der Mittelpunkt dieser Anlage. Die Direktorenvilla war vom Gründer der Psychiatrie ganz bewusst im Zentrum platziert worden. Der prunkvolle Bau war gleichermaßen eine Machtdemonstration wie auch ein Bekenntnis, als Direktor nicht außerhalb dieser Welt zu stehen. So bin ich aufgewachsen. Inmitten von eintausendfünfhundert psychisch Kranken, geistig und körperlich Behinderten. Meine Brüder und ich gaben den Patienten die unterschiedlichsten Namen. Wir nannten sie knallhart Idioten, Irre oder Verrückte. Aber auch die Dödies, die Blödies, die Tossen, Spaddel, Spackos und Spasties. Oder die Psychos, Mongos, die Deppen, Debilen und Trottel – der Favorit meines ältesten Bruders war: die Hirnies. Sie so zu nennen war für uns vollkommen normal. Selbst meine Eltern benutzten hin und wieder, wenn wir unter uns waren, einen dieser Ausdrücke.
Die Hälfte meines Schulweges führte mich jeden Morgen durch die Psychiatrie, und ich traf dort auf die immer selben Patienten. Gleich auf der ersten Bank, wenn ich unseren Vorgarten durch ein Törchen verlassen hatte, saß ein Junge, der nichts lieber tat, als Zigaretten mit einem einzigen Zug niederzurauchen. Er wartete dort auf meinen Vater, der ihm oft eine seiner Roth-Händle gab. Der Junge hechelte, stieß alle Luft aus, steckte sich die Zigarette in den Mund, zündete sie an und zog und zog. Ein einziger Zug – und die ganze Zigarette brannte ab! Dann spuckte er den Stummel zu den anderen vor die Bank, atmete langsam aus – so viel Rauch! – und saß da, in Schwaden gehüllt, mit glücklich vernebelten Augen.
Dann, auf der nächsten Bank, ein anderer Junge: Thorsten, der immer fragte: »Haste Parfüms? Haste Parfüms? Haste Parfüms?« Er schürzte oft unvermittelt die Lippen, machte ein ganz spitzes Kussmündchen und pustete. Blies seine Fingerkuppen an oder Fussel vom Ärmel. Wenn im Frühjahr die wolligen Fäden der Balsampappeln auf den Psychiatriebänken lagen, blies er tagelang die Bankbretter und Lehnen sauber. Von mir hat er einmal eine ganze Flasche »Lagerfeld« bekommen, angepustet, aufgeschraubt und einfach ausgetrunken.
Ein paar Meter weiter, um die nächste Häuserecke herum, begegnete ich oft einem Mädchen. Wenn sie es schaffte, sich ihren Schutzhelm herunterzuzerren, schlug sie sich die Stirn auf, um mit ihrem blutenden Kopf Sonnen, Sterne und Monde auf die Straße zu malen. Das habe ich oft gesehen, diese eingetrockneten Blutsterne auf dem Asphalt.
Im Sommer lag in einem der vielen hoch umzäunten Gärten hin und wieder ein Junge auf der Wiese. Nah am Zaun. Er hatte keine Augen. Stirn, Nase und Wangenknochen waren zu einer geschlossenen Fläche verwachsen. Auf diese von Narben durchzogene Haut waren mit einem schwarzen Filzstift Augen aufgemalt. Zwei Kreise mit Pupillenpunkt. Wie mir mein Vater erzählte, war dies sein eigener Wunsch, um sich für den Garten schön zu machen.
Dann gab es noch einen in sich gekehrten Mann, der spazieren ging, immer freundlich war und eine kalte Pfeife rauchte. Er hieß Egon. Mein Vater warnte mich vor ihm, da er gerne Drahtkleiderbügel zusammenbog und sie anderen in den Hintern steckte. Für ein paar Tage hing an unserem Küchenfenster eine Röntgenaufnahme, auf der man im Grau durchleuchteter Organe einen Klumpen Draht ausgezeichnet erkennen konnte.
Und dann war da natürlich noch Rudi, genannt Tarzan. Er kletterte gerne auf Bäume oder lag bewegungslos im Gras, auf der Lauer. Er trug stets einen sehr echt aussehenden Revolver bei sich, stürzte hervor, blitzschnell und lautlos, und hielt einem den Lauf an die Schläfe. Jeder, der ihn kannte, wusste, wie harmlos er war, machte ihm eine Freude und erschrak sich zu Tode. Tarzan liebte es, wenn man sich vor ihm auf die Knie fallen ließ und bettelte: »Bitte, bitte töte mich nicht!« Sein Kopf mit dem roten Haarbüschel war nicht viel breiter als ein Handteller.
Ein penetrantes Mädchen, genannt Bine oder Trine. Sie war klein. Als ich zehn war, war ich schon größer als sie. Traf man sie, wurde man sie nicht mehr los, und sie begleitete einen bis zum Ausgang der Anstalt. Mit piepsiger Stimme stellte sie immer dieselben zwei Fragen: »Na, wer bist du?« und »Na, wen haben wir denn da?«. Wenn ich ihr meinen Namen sagte, lachte sie, drückte mir ihre prallen Brüste in die Rippen und widersprach: »Nee, nee, wer bist du?« Ich versuchte mich loszumachen, aber sie war stark. Klammerte sich an mich, roch streng und rieb sich an mir. Egal was man sagte, es war falsch: »Na, wer bist du?« Immer wieder. Mehrmals drängte sie mich gegen eine Mauer, ließ minutenlang nicht ab von mir. »Na, wen haben wir denn da?« Ich versuchte mich loszumachen. »Nee, nee, nee. Wer bist du?«
Am Ausgang, Tor 2, spielte ein Patient Kontrolleur. Er trug eine Fantasieuniform, auf den Schultern des Jacketts angeklebte Epauletten aus Schaumstoff, das ganze himmelblaue Uniformjackett gespickt voll mit Kronkorken-Orden. Um die Hosenbeine hatte er bunte Gürtel geschnallt, deren Enden seitlich abstanden. Unter Höchstanstrengung wölbte er seine Brust, knallte seine Hacken zusammen, winkte Autos durch und fragte mich jeden Morgen: »Wohin soll’s denn gehen?« Ich sagte: »In die Schule.« Er salutierte, rief laut: »Ah, wieder ficki-ficki machen?«, und gab den Weg frei.
Ich grüßte das Wachpersonal, dem ich gut bekannt war, die Schranke wurde geöffnet, und ich verließ das Gelände.
An den beiden Toren und auch vor den Haupteingängen der Gebäude spielten sich oft dramatische Szenen ab. Entweder weigerten sich die frisch Eingelieferten, das Gelände bzw. die Gebäude zu betreten, klammerten sich an ihre Angehörigen und traten nach den Pflegern, oder aber Patienten wehrten sich mit Händen und Füßen, das Gelände bzw. die Gebäude zu verlassen, klammerten sich an die Pfleger und traten nach den Angehörigen. Sowohl der Weg in die Psychiatrie hinein wie auch der aus ihr heraus war für viele der blanke Horror.
Natürlich gab es auch die Unscheinbaren, die deutlich in der Überzahl waren, in sich versunken herumsaßen, brabbelten oder rastlos auf dem Gelände herumtigerten. Es gab eine Station, etwas abseits gelegen, wo in einem Hinterhof mehrere Bänke standen. Dort saßen Patienten, die sich auf gespenstische Art ähnlich waren. Kahl rasierte Schädel mit dicklippigen Mündern, riesigen Nasen und melancholischen Augen mit vergrößerten Pupillen. Selbst die Ohrläppchen ihrer fleischigen Ohrmuscheln schienen geschwollen und schwer. Ihre Gesichter sahen farblos aus, wie mit einem zu weichen Bleistift gezeichnet. So kauerten sie auf den Bänken oder den Rückenlehnen, und wenn die Sonne unterging, kam es vor, dass das schräge Abendlicht blutrot durch ihre Segelohren drang. Mein ältester Bruder sagte zu mir: »Schau sie dir an, wie sie da hocken und glotzen. Bisschen unheimlich, oder? Die sehen alles, riechen alles, hören alles, die kriegen zehnmal mehr mit als wir und machen den ganzen Tag absolut nix!« Wir nannten den Ort »Hinterhof der traurigen Eulen«.
Viele Patienten bekam man gar nicht zu Gesicht, da sie die Stationen nicht verlassen konnten oder durften. Sobald es das Wetter zuließ, es einmal nicht regnete, wurden die Kranken nach draußen geschoben, lagen, wenn es noch kalt war, bewegungslos mit Mützen in rollbaren Betten oder saßen in Decken eingeschlagen in Rollstühlen. Wobei die Rollstühle völlig unterschiedlich aussahen. Manche waren für winzige, verwachsene Kinder gebaut und konnten hydraulisch auf und nieder, vor und zurück gekippt werden. Andere hatten Kopfpolster, die links, rechts und von oben eng anlagen. Sogar unterm Kinn gab es einen Bügel. Die Köpfe waren wie gerahmt, lagen wie Masken in ihren Futteralen.
Viele dieser schwer körperbehinderten Kinder wurden an warmen Tagen in die Stationsgärten gelegt. Diese waren hoch eingezäunt, wie Gehege für gefährliche Tiere, und teilweise an den Oberkanten mit Stacheldraht gesichert – dabei sah man weit und breit niemanden, der solche Hindernisse er- oder sogar überklettern konnte. Da blieb ich oft stehen, hakte meine Finger in den Zaun und blickte über die mit Löwenzahn oder Gänseblümchen bedeckte Wiese hinweg, in der auf bunten Decken die Patienten wie hingestreut lagen. Einige versuchten zu krabbeln, andere rekelten sich, genossen die Sonnenstrahlen. Da ragten weit gespreizte Zehen aus dem Gras, dort eine vereinzelte Hand, die sich krallig in den blauen Himmel reckte. Manche hatten sich die Unterhosen heruntergestrampelt, und ich sah ihre Genitalien. An einem Tisch saßen Schwestern und Pfleger, rauchten und tranken Kaffee. Hinter ihnen eine Stellage, an der abgeschnallte Prothesen hingen: verschieden geformte Stütz-Korsagen mit Lederriemchen und Schnallen für die Brust, das Becken oder für Köpfe, die ohne Stütze wegsacken würden. Einem Jungen war das Stofftier aus der Hand gefallen. Es lag direkt neben ihm im Gras. Er strengte sich an, aber es gelang ihm einfach nicht, es zu erreichen. Kam ich Stunden später aus der Schule, hatte er es immer noch nicht geschafft.
Die Pfleger kannten mich und winkten, oder eine der Schwestern brachte mir etwas Leckeres zum Gitter, schob ein Stück Marmorkuchen durch den Zaunspalt.
Es war mein Zuhause.
Vom Sehen kannte ich Hunderte. Jungen und Mädchen, Jahr für Jahr hinter denselben verschmierten Fensterscheiben. Es war die große Zeit der Fingerfarbe, und expressive Farborgien bedeckten oft ganze Fensterfronten. In Kitteln standen die Patienten hinter den Scheiben und wischten und matschten das Glas voll.
Schon immer erstaunte mich, dass ich nur selten auf Patienten stieß, die miteinander spielten. Es gab einen großen Spielplatz mit einem herrlichen Hubschrauber-Klettergerüst, Schaukeln und Rutschen – doch der war meistens verwaist. Vielleicht war das sogar das Auffälligste: Obwohl das Gelände voll, ja überfüllt war, waren viele der Patienten ganz für sich, mit sich beschäftigt. Selbst wenn sie an der Hand eines Pflegers gingen, blieben sie Einzelne.
Es gab solche mit dickledernen Helmen, die aussahen, als wären sie aus Medizinbällen herausgeschnitten worden. Und andere mit wattierten Fäustlingen, die fest mit der hinter dem Rücken zu knöpfenden Jacke verbunden waren. Ihre Schuhe, Hosen und Hemden, Kleider, Pullover und Mäntel kamen aus der Altkleidersammlung. Dadurch wirkten sie wie aus der Zeit gefallen. Waren es die abgetragenen, planlos miteinander kombinierten Klamotten oder die Art und Weise, wie sie sie trugen, die stets ein Bild des Nicht-Passens, des Unbequemen, des leicht Verwahrlosten erzeugten?
Einmal geschah es sogar, dass ich einen Patienten sah, einen Jungen, der meinen ausrangierten Pullover trug. Das war ein ungutes Gefühl. Dass da etwas, was ich nicht mehr brauchen konnte, zerschlissen und ausgeleiert, für jemand anderen genau das Richtige sein sollte.
Oft war ich mir aber auch nicht sicher, ob die Kinder oder Jugendlichen, denen ich auf dem Psychiatriegelände begegnete, überhaupt Patienten waren. Es kamen immer viele Besucher. Es gab einen Kindergarten für Mitarbeiter und jede Menge ambulanter Behandlungen für Probleme aller Art.
Eine der Hauptbeschäftigungen der Patienten war es, zu rauchen. Sie taten es nie nebenher, so wie mein Vater, der mit Zigarette im Mund einen Krimi las, Auto fuhr oder, auch das kam vor, sich elektrisch rasierte. Die Patienten rauchten mit gespannter Ausschließlichkeit. Schon die Art, wie sie die Zigarette aus der Schachtel zogen, sie hielten, zum Mund führten und an ihr zogen, war von verbissener Aufmerksamkeit. Sie saßen dabei auf den Bänken, lehnten an den Mauern oder wandten sich ab, um ihre Ruhe zu haben. Den Blick nach innen gewendet, inhalierten sie tief, schienen betäubt und abwesend zu sein. Oft kam es mir so vor, als wären ihre Lippen hart vor Gier, so eng schlossen sie sich um die Filter. Sie strahlten nichts Lässiges aus, hatten keine weich abgeknickten Handgelenke, vollführten keine grazilen Schwünge, wie ich sie von den Filmstars her kannte. Sie wirkten eher so, als seien sie mit Heimlichkeiten beschäftigt, als lauerten sie schon verschlagen und gierig auf den nächsten Glimmstängel.
Erstaunlicherweise waren viele von ihnen sehr jung. Doch darum kümmerte sich niemand. Alkohol war auf dem gesamten Anstaltsgelände strengstens verboten, und nie habe ich einen Patienten mit einer Bierdose gesehen, aber Nikotin schien eine von höchster Stelle und ohne Altersbeschränkung freigegebene Droge zu sein. Auch die Pfleger, Schwestern, Ärzte, Psychologen und Therapeuten, alle rauchten und alle verteilten großzügig Zigaretten an die bettelnden Patienten. Das wenige, was die Insassen sich verdienten, gaben sie für Zigaretten aus.
Doch vor und höchstwahrscheinlich auch in keiner anderen Station wurde so obsessiv geraucht wie bei den Manisch-Depressiven. Sie qualmten die Zigaretten stets bis zu ihren rußgelben Fingerspitzen hinunter. Sie fraßen den Rauch in sich hinein, als wäre er ihre Rettung. Der Weg zum Haupteingang dieser Station war dicht bestreut mit Zigarettenstummeln, links und rechts davon, vor den Bänken lagen maulwurfshaufengroße Filter- und Stummelhügelchen. An einer Wand des Gebäudes waren über Jahre hinweg Zigaretten ausgedrückt worden. Tausende Aschepunkte besprenkelten sie, und wenn ich meine Augen etwas unscharf stellte, sahen diese schwarzen Flecken wie winzige Einschusslöcher oder Eingänge in einen gigantischen Termitenhügel aus.
Nie wieder habe ich unter freiem Himmel Menschen auf so engem Raum so exzessiv sich eine Zigarette nach der anderen anzünden sehen wie bei den Manisch-Depressiven. Mir kam es so vor, als wären sie Mitglieder einer Sekte mit gespenstischen Ritualen. Plötzlich rauchten alle synchron: Dreißig Depressive ziehen gemeinsam, inhalieren gemeinsam, stoßen den Rauch gemeinsam aus und lassen alle gemeinsam für kaum länger als eine Sekunde die Zigaretten sinken. Die Frauen unter ihnen rauchten mit noch größerer Besessenheit als die Männer. Ich habe Frauen oder Mädchen gesehen, die hingen an ihren Zigaretten wie an einem seidenen Faden aus Rauch über einem schwarzen Abgrund. Geredet wurde kaum. Ihre Gesichter standen in einer mir bis heute rätselhaften verwandtschaftlichen Beziehung zueinander. So wie sie äußerlich diese ungebremste Zigarettensucht verband, so musste, dachte ich, auch innerlich eine Gemeinschaft bestehen, eine Verzweiflungsverwandtschaft der besonderen Art.
Unvergesslich ist mir auch vor einer anderen Station eine junge Frau geblieben, die vor spastischen Zuckungen die Zigarette nicht selbst halten konnte. An den Armlehnen ihres Rollstuhls hatte sie zwei Laschen, in die sie ihre Hände schob, um sie unter Kontrolle zu bekommen. Doch sie liebte Zigaretten. Eine Schwester fixierte ihren Kopf und fütterte sie mit Rauch.
Die Höhe der Buchstaben
Die in zwei Ringen um unser Haus herum angeordneten Anstaltsgebäude waren durchbuchstabiert. Im inneren Ring standen die Buchstaben A bis G, im äußeren Ring lagen H bis P. Außerhalb dieser beiden Ringe lagen die Werkstätten und auch einige Felder. Jedes der Häuser hatte drei Stockwerke. Jedes Stockwerk war eine Station. Die Stockwerke hießen nach ihrer Lage »Oben«, »Mitte« und »Unten«. Wegen Überfüllung gab es ein paar Ausnahmen wie »Keller« oder »unterm Dach«. Hieraus ergaben sich die Stationsnamen wie zum Beispiel »A-Unten«, »J-Mitte« oder »B-Oben«. Mein Vater sprach oft von den Stationen. Er sagte dann: »Heute hat wieder einer in G-Oben gezündelt.« Oder: »M-Unten ist völlig überfüllt. Heute verlegen wir vier Fälle nach D-Unterm Dach.«
Diese Art, mit Buchstaben umzugehen, war mir so vertraut, dass ich sicher war, Buchstaben hätten unterschiedliche Höhen. Als ich schreiben lernte, begann ich Fragen zu stellen: »Schreibt man Hund mit H-Unten oder H-Oben?« Doch es war noch komplizierter. Innerhalb der Gebäude befanden sich die leichteren Fälle unten, die schweren mittig und die schwersten, hoffnungslosen oben.
Wollte ich einem von mir geschriebenen Wort besondere Bedeutung verschaffen, schrieb ich es mit hochgestelltem Anfangsbuchstaben. Die berüchtigte geschlossene Abteilung »K-Oben« machte alle geschriebenen K-Wörter mit diesem K-Oben sehr gefährlich. Käse, Krankheit, Krümel, Kaffee, Kindergarten oder Katze geschrieben mit K-Oben waren wild und kaum kontrollierbar. Ein Käse mit K-Oben stank und war ungenießbar, eine Krankheit mit K-Unten war eine nur leichte, nicht lebensbedrohliche Erkrankung, eine Katze mit K-Mitte konnte, musste aber nicht kratzen.
Die Höhe der Buchstaben verband sich mit den Krankheiten der Patienten. In L-Unten lebten die magersüchtigen Mädchen. Vor diesem Haus waren oft Körperumrisse mit Kreide auf die Straße gemalt. Die magersüchtigen Mädchen mussten sich auf diese Weise, auf dem Boden liegend, ummalen, um zu sehen, dass es sie überhaupt noch gab. Worte mit dem L-Unten der magersüchtigen Mädchen waren zerbrechlich, vom Verschwinden bedroht. Auf Licht, Locken, Leder mit L-Unten musste ich gut aufpassen. Worte, die ich nicht mochte oder vor denen ich Angst hatte, verlegte ich in die jeweilige geschlossene Abteilung. Die durften dann nicht mehr raus. In der Schule hat das zu meinen ersten, mich dann ein Leben lang verfolgenden Tobsuchtsanfällen geführt. Keiner begriff, was ich in mein Heft, oder noch schlimmer, unter dem Gelächter aller, an die Tafel kritzelte. Meine Lehrerin befahl: »Schreib doch mal bitte: Die Katze hat Hunger.« Das sah dann so aus:
Das war eine sehr böse Katze, die keinen Hunger hat. Die Lehrerin schüttelte den Kopf. Wie hätte ich mich um Groß- und Kleinschreibung, um Grammatik kümmern können? Es ging doch um etwas viel Offensichtlicheres, Schöneres. Es ging nicht um den Buchstaben als Zeichen, sondern um seine Identität, ja, sein Wesen, seinen Charakter.
Tatsächlich wurde ich nach nur vier Monaten in der ersten Klasse zu meiner völligen Überraschung wieder nach Hause geschickt. Immer öfter war ich außer mir vor Zorn gewesen, »aus dem Nichts«, wie es hieß. Schon die kleinste Ungerechtigkeit trieb mich zur Verzweiflung. Mein mittlerer Bruder klopfte mir auf die Schulter: »Gleich in der ersten Klasse sitzen bleiben! Vor dir liegt eine große Zukunft!«
Um diese schmerzliche Erfahrung zu keiner traumatischen zu machen, ersparten mir meine Eltern die Rückkehr in den Kindergarten. Ich durfte den Rest des Schuljahres zu Hause verbringen. Meine Mutter arbeitete an den Vormittagen als mobile Krankengymnastin, und ich begleitete sie auf ihren Fahrten übers Land. Während sie skeptischen Bauern mit Bandscheibenvorfällen richtiges Heben und Tragen von schweren Dingen wie zum Beispiel Düngemittelsäcken beibrachte, streunte ich umher. Oder ich spielte mit dem Spielzeug der fremden Kinder, die ja in der Schule waren. Bei der Reittherapie, die meine Mutter einmal die Woche gab, brachte sie mir in den Pausen ein paar Kunststücke auf dem Pferderücken bei. Hin und wieder nahm mich auch mein Vater mit, und dann durfte ich zusammen mit Schwerstbehinderten zur Schwimmtherapie, ließ mich mit dem Kran ins Wasser heben.
Wenn unsere Putzfrau kam, die Frau Fick hieß, blieb ich zu Hause und genoss die Zeit ohne meine Brüder in deren Zimmern. Meinen früheren Freunden war ich als gescheiterter Erstklässler suspekt. Auch ich fühlte deutlich, dass uns Welten trennten. Und die, die ich noch aus dem Kindergarten kannte, wollte ich nie mehr wiedersehen.
Dass unsere Putzfrau Frau Fick hieß, dass man so heißen konnte, dass man so tun sollte, als wäre das ein Allerweltsname, war eine Ungeheuerlichkeit für mich. Meine Brüder und ich schlossen Wetten ab. Man musste zu ihr gehen und sie, ohne hysterisch zu werden, mit ihrem Namen ansprechen: »Haben Sie vielleicht meine Turnschuhe gesehen, Frau Fick?« Mein Vater machte da auch gerne mit, und seine drei Söhne lagen versteckt um die Ecke und bissen sich in die Handballen, während wir ihn sagen hörten: »Liebe Frau Fick, wenn Sie etwas brauchen, schreiben Sie es auf den Einkaufszettel. Einen schönen Tag, Frau Fick. Ach ja, Frau Fick, schöne Grüße an Herrn Fick!«
Ihr Mann arbeitete in der Schleswiger Wetterstation, und jeden Freitag, wenn probehalber die Sirenen heulten, drückte er auf einen Knopf, das Dach der Station öffnete sich und hinaus flog ein Wetterballon, an dem ein silbernes Messgerät hing. Fünfzig Mark bekam man, wenn man es fand. Wie so viele andere Jungen der Kleinstadt bin auch ich auf dem Fahrrad diesem über unseren Köpfen entschwindenden Ballon über Stock und Stein hinterhergehetzt, abwechselnd den Blick nach oben, Kopf im Nacken, Blick nach unten, auf die Straße. Sackgassen, Holperwege oder die plötzliche Angst, sich zu verirren, die Grenze der Stadt zu weit hinter sich gelassen zu haben, beendeten die Jagd nach dem fliegenden, kleiner werdenden, in der Sonne funkelnden Schatz. Nie, nie habe ich ihn gefunden.
Diese Stadt, in der ich nicht geboren, aber aufgewachsen bin, lag gleich hinter der Anstaltsmauer und war wesentlich unübersichtlicher als das ordentlich durchbuchstabierte Psychiatriegelände. Lange hatte ich geglaubt, die meterhohe rote Backsteinmauer sei ein Schutz, eine Festungsmauer gegen Eindringlinge. Mir hatte dieser Wall immer ein sicheres Gefühl gegeben. Unser Haus war nicht nur durch einen Gartenzaun gesichert, sondern war das Herzstück einer echten Bastion mit Wächtern an den Toren. Wie das kleinste, nicht mehr in der Taille zu halbierende Püppchen einer bunt bemalten Babutschka-Schachtelwelt lag ich in meinem Bett. Um mich herum das Kinderzimmer, darum das Haus, darum der Garten mit seinem Zaun und um diesen herum die Psychiatrie mit der Mauer. Die Heimatstadt gehörte schon nicht mehr dazu.
Noch im Alter von zehn Jahren nannte ich im Ferienlager auf die Frage nach meiner Herkunft nicht den Namen der Stadt, sondern den der Psychiatrie: »Wo wohnst du?« »In Kiel.« »Und du?« »In Lübeck.« »Und du?« »Im Hesterberg.« »Im Hesterberg? Das ist doch eine Irrenanstalt!« »Ich bin da zu Hause und man sagt: Psychiatrie.« »Und wie heißt du?« »Jocki.« »Jocki? Hier steht Joachim!« »Nein, so will ich nicht heißen. Alle nennen mich Jocki.« »Also Jocki vom Hesterberg?« »Ja, ganz genau«, sagte ich.
Wenn jenseits der Mauer nichts außer Wiesen und Feldern gewesen wäre, man sozusagen direkt durch die Anstaltstore in die freie Landschaft hinausgetreten wäre, es hätte mich nicht gewundert. Mein Vater war der Direktor dieses Anstaltskosmos, und ohne groß darüber nachzudenken, ging ich fest davon aus, dass er nicht nur der Leiter der gesamten Psychiatrie war, sondern dass sie ihm voll und ganz gehörte. Er war Arzt und König in einer Person, und wenn ich mit Freunden über das Gelände ging oder auf dem Spielplatz von Haus D spielte, war ich sicher, dass dies auch mein Spielplatz ist. Wie ein Infant flanierte ich über die Straßen, schaute mal hier und mal dort herein, bekam in der Gärtnerei einen vorzeitig erblühten Weihnachtsstern geschenkt, probierte in der Großküche aus einem riesigen Topf ein wenig heißen Schokoladenpudding oder durfte im Heizwerk ein Brikett in den lodernden Ofen schleudern.
Dabei war die norddeutsche Kleinstadt vor den Toren der Anstalt eine sehens-, ja sogar besuchenswerte. Schleswig hat einen Dom mit einem nicht sonderlich alten, etwas zu kantig geratenen Turm und im Inneren den – so wurde immer behauptet, so wurde es einem schon in der Grundschule eingebläut – weltberühmten Brüggemann- oder auch Bordesholmer Altar. Wenn ich später in anderen Städten, um meine Heimatstadt näher zu beschreiben, den Namen dieses Altars erwähnte, hatte noch nie jemand von ihm gehört. Leider kann man nicht nah genug an ihn herantreten. Unmöglich, die auf Postkarten vergrößerten und markant geschnitzten Figuren im dunklen Getümmel des Originals zu erkennen.
Der Dom liegt einige Meter tiefer als die ihn umstehenden Häuser, da man im Mittelalter auf dem geweihten Grund weder Abfälle noch Fäkalien zurücklassen durfte. Im Lauf der Jahrhunderte wohnten sich die Kleinstadtbewohner um den Dom herum auf ihrem Dreck gute drei Meter in die Höhe. Wie eingesunken liegt er nun im ältesten Teil der Stadt in einer tiefen Mulde. Rein rechnerisch würden sich die Schleswiger in fünfzehntausend Jahren auf ihrem Unrat bis zur Kirchturmspitze hinaufgemüllt haben.
Eine andere Attraktion: Schloss Gottorf. Ein von einem Wassergraben umschlossener, eindrucksvoller Bau mit einer sehenswerten expressionistischen Gemäldesammlung. Wenn wir ausnahmsweise mal Besuch bekamen, fuhren wir entweder stundenlang ins Noldemuseum nach Seebüll oder mussten in die expressionistische Sammlung Schloss Gottorfs. Dort liegen in Glaskästen aufgebahrt auch die berühmten Moorleichen aus dem nahe gelegenen Haithabu, einer der größten Wikingersiedlungen, die es je gab. Jeder in meiner Heimatstadt kennt diese schwarzledernen Mumien mit den verbundenen Augen, den teilweise noch geflochtenen feuerroten Haaren, den Spangen und durchlöcherten Sackumhängen.
Auf der Suche nach ihren Wurzeln und um dem strukturschwachen Norden etwas Gutes zu tun, sind sich die Bewohner meiner Heimatstadt im Laufe der Zeit ihrer Wikingerherkunft immer bewusster geworden. Man könnte sogar so weit gehen zu behaupten, dass viele Schleswiger nie so recht wussten, wohin mit sich, und erst durch die Freilegung ihrer Wikingerseele zu sich selbst gefunden haben.
Seit vielen Jahren finden aus diesem Grund die sogenannten Wikingertage statt. Und für eine Woche im Jahr zeigen sich die Einwohner Tausenden von Besuchern, unter ihnen auch viele Dänen, von ihrer verschütteten Seite. Da kann man dann Optiker in Fellen sehen, Lehrer, die aus selbst gezimmerten, untergehenden Wikingerschiffen gerettet werden müssen, Schuhverkäuferinnen, die mit großen gebogenen Nadeln Lederlappen zu unförmigen Stiefeln vernähen, oder auch Restaurantbesitzer, die mit behörnten Helmen in historisch nachgebauten Öfen Gerichte schmoren und zähe Fladen backen. Für die durch und durch vom Wikingerbrauchtum Durchdrungenen gibt es sogar die Möglichkeit, für die gesamte Zeit der Festivitäten in eine an historischer Stätte, am Haddebyer Noor, errichtete Siedlung zu ziehen.
Obwohl laut Werbung das Hauptanliegen der Wikingertage der Versuch ist, den Wikinger von seinem schlechten Image als Grobian zu befreien und die Wikingerkultur als eine Hochkultur zu rehabilitieren, endet jeder einzelne der Wikingertage mit einem schrecklichen Besäufnis. Völlig mit sich und ihrer Wikingervergangenheit im Einklang, betrinkt sich die halbe Stadt in Lederzelten mit Met, dem hochprozentigen Wikingerbier, und die Krankenwagen fahren bis in die Morgenstunden bewusstlose Männer und Frauen in Fellen ins Krankenhaus.
Der Gipfel der Wikingerbegeisterung schlug sich in einem aberwitzig hässlichen Bauwerk nieder. An einem der idyllischsten Plätze der Stadt, direkt am Wasser gelegen, wurde der sogenannte Wikingturm gebaut. Wohl selten hat eine Kleinstadt ihren Aufbruch in die architektonische Moderne so gnadenlos vergeigt wie meine Heimatstadt. Jahrelang konnten keine Eigentümer für die kuchenstückförmigen Wohnungen gefunden werden. Es gab Gerüchte, dass sich dort Prostituierte einquartiert hätten, die einzig die herrliche Aussicht über das Ausbleiben der knausrigen Kundschaft hinwegtröstete.
Schleswig liegt an der Schlei, dem längsten Süßwasserarm Deutschlands. Bis zum Meer sind es fast vierzig Kilometer. Direkt am Ufer, im ältesten Teil der Stadt, kann man auch heute noch den Holm besuchen, eine wunderschöne Fischersiedlung mit geduckten Häusern und Hochstammrosen davor. Hier lebte, einer uralten Tradition folgend, der Möwenkönig. Er war der Einzige, der die Möweninsel betreten durfte. Auf dieser winzigen Insel inmitten der Schlei brüten Abertausende Lachmöwen. Und nur er, der Möwenkönig, durfte zur Möweninsel übersetzen, Möweneier einsammeln und verkaufen. Für seine Möweneier war Schleswig berühmt. Man musste sie lange kochen, damit die Salmonellen absterben, und da sich die Möwen hauptsächlich von den Abfällen der nahe gelegenen Böklunder-Würstchenfabrik ernährten, schmeckten die Eier immer öfter ekelerregend nach Fleisch und wurden schließlich verboten.
Doch Schleswig hatte eben auch noch eine andere Seite, ein zweites Gesicht: Neben dem Hesterberg, der riesigen Kinder- und Jugendpsychiatrie, gab es noch Stadtfeld, die Erwachsenenpsychiatrie. Auch hier lebten weitere zweitausend geistig oder körperlich behinderte Menschen. Dann gab es noch den Pauli-Hof, Schleswig-Holsteins größte Jugendstrafanstalt, zwei riesige Einrichtungen für Gehörlose, eine legendäre Gehörlosendisco, wo die Schallwellen durch den Boden bummerten, eine sechsstöckige Blindenschule ohne Fenster, das städtische Krankenhaus und unzählige Therapie- und Rehabilitationszentren. Bei nur fünfundzwanzigtausend Einwohnern war das eine Menge. Irgendwie hatte fast jeder in dieser Stadt mit Menschen zu tun, die irgendwie anders waren, der Hilfe bedurften. Im Laufe der Jahre hatte sich wie Trabanten um Schleswig herum eine Vielzahl von Privatanstalten angesiedelt. Sie bekamen ihre Patienten von den beiden großen Psychiatrien der Stadt. Egal aus welcher Richtung man nach Schleswig hineinfuhr, überall sah man am Straßenrand auf Bänken wippende oder einfach in die Landschaft hineingestellte Patienten, die einem zuwinkten. Die große Selbstverständlichkeit im Umgang der Schleswiger mit all diesen sehr speziellen Menschen war erstaunlich. Einmal sah ich, wie sich zwei Patienten mitten in der Fußgängerzone auszogen, zu tanzen begannen und einen Schlager sangen. Die Schleswiger grinsten bloß und riefen: »Kommt, zieht euch mal wieder an. Ist gut jetzt.«
Das Geburtstagsfrühstück
An seinem vierzigsten Geburtstag sagte mein Vater zu uns, meiner Mutter, meinen beiden Brüdern und mir beim Geburtstagsfrühstück, zu dem es verschiedene Räucherfische gab – Makrele, Schillerlocken, fetten Aal und die von meinem Vater sehr geschätzten Kieler Sprotten, die er ganz, mit Kopf aß, sodass man die Wirbelsäulen knacken hörte, umso besser, da er seine schönen, von den Fischen fettigen Lippen nie geschlossen hatte –, bei diesem Geburtstagsfrühstück sagte er zu uns: »Heute werde ich vierzig. Vor diesem Geburtstag habe ich mich immer gefürchtet. Auch wenn ich die Formulierung ›runder Geburtstag‹ bescheuert finde, wird dieser sogenannte ›runde Geburtstag‹ der letzte in meinem Leben sein, bei dem ich darauf hoffen kann, noch einmal doppelt so alt zu werden. Vielleicht werde ich ja achtzig. Ich würde sehr gerne achtzig werden. Mein nächster runder Geburtstag ist der fünfzigste. Hundert ist dann wohl doch etwas zu viel verlangt. Kein Mensch wird hundert. Zu Hundertjährigen kommt die Lokalzeitung, man muss das Geheimnis seines Alterns preisgeben und ohne Zähne ›Ich habe jeden Tag einen Apfel gegessen‹ nuscheln. Tizian ist angeblich hundert geworden. Habt ihr das gewusst? Ich wäre mit achtzig hochzufrieden.«
Mein Vater hielt kurz inne, fuhr sich mit der Zungenspitze über die Oberlippe, über seinen gelblichen Schnauzer: »Ich habe eine Neuigkeit für euch, eine Sensation: In zwei Monaten wird die neue Klinik fertig sein. Endlich. Und wisst ihr, wer sich zur Einweihung angekündigt hat? Seine Hoheit, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard Stoltenberg höchstpersönlich, wird uns die Ehre erweisen.« »Wirklich?« Meine Mutter strahlte. »Er kommt? Wie hast du das geschafft? Da werde ich mir etwas ganz Besonderes überlegen.« »Ja, und auch ihr drei müsst unbedingt dabei sein. Das soll ein netter Mann sein.« Mein mittlerer Bruder sagte: »Der große Klare aus dem Norden. So wird er doch genannt, oder?« »Genau wie der Schnaps – Bommerlunder!«, gab ihm mein Vater recht und sprach weiter: »Das wird ein wahrhaft großer Tag. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe beschlossen, ein paar Dinge in meinem Leben zu ändern. Ich glaube, dass so ein vierzigster Geburtstag dafür der richtige Anlass ist. Vielleicht sogar meine letzte Chance.«
Wir saßen um den Frühstückstisch herum und hörten gespannt zu. Sogar unser Hund war verwundert über den euphorischen Tonfall meines Vaters und saß still neben mir. Dort saß er bei jeder Mahlzeit, da mir häufig etwas hinunterfiel, und lauschte. Er war noch nicht ganz ausgewachsen, aber die Größe seiner puscheligen Pfoten war eine deutliche Wachstumsprophezeiung.
»Das Wichtigste, um diese achtzig Jahre erreichen zu können, um mir eine realistische Chance auf dieses gesegnete Alter zu eröffnen, ist ganz offensichtlich – da wird hier sicher keiner vehement Einspruch erheben – ein gesünderes Leben. Ja, und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören! Ich möchte aber gleich dazusagen, dass ich an meinem achtzigsten Geburtstag, und zwar am Morgen meines achtzigsten Geburtstages – wer weiß, vielleicht sitzen wir da auch alle so zusammen wie jetzt –, wieder mit dem Rauchen anfangen werde. Ich höre heute also nicht endgültig auf. Ich lege nur eine vierzigjährige Rauchpause ein. Und dünner möchte ich auch werden. Was schätzt ihr, was wiege ich?«
Mein ältester Bruder tippte hundert Kilo, mein mittlerer Bruder fünfundneunzig, meine Mutter achtundneunzig und ich zweihundert. Mein Vater schluckte den Räucheraal hinunter, wischte sich über Mund und Schnauzbart, wodurch auf seinem Handrücken eine fischfettige Schneckenspur glänzte, und sagte lachend zu mir: »Ja, da hast du vollkommen recht. Ich wiege unglaubliche zweihundert Kilo. Absolut richtig. Ich fühle mich exakt so, als ob ich zweihundert Kilo wiegen würde. Ich muss euch etwas beichten. Wenn ich im Stehen pinkele, kann ich meinen Schwanz nicht mehr sehen.« Meine Brüder und ich schrien auf. Das taten wir immer, wenn mein Vater etwas Derartiges von sich gab. Wir schüttelten uns und spielten Ekel und Entsetzen. Meine Mutter rollte mit den Augen und sagte: »Womit wir wieder beim Thema wären.« Mein Vater war ein Meister darin, aus jedem Gegenstand etwas Anzügliches zu machen. Keine Gurke, keine Zucchini, die er sich nicht vor den Hosenstall hielt. Begegnete man ihm nackt auf dem Weg von der Dusche ins Kinderzimmer, hob er mehrmals schnell die Augenbrauen und grinste zweideutig. Wenn meine Mutter auf dem Wochenmarkt zum hakennasigen Händler sagte »Sie haben aber schöne große Eier heute!«, rannen meinem Vater tagelang, sobald er nur daran dachte, vor Lachen die Tränen über seine Hamsterbacken.
»Ich wiege zurzeit hundertundsechs Kilogramm!«, gestand er bedrückt. »Am Morgen! Ich habe mir vorgenommen, sechzehn Kilo abzunehmen. Dann würde ich neunzig Kilo wiegen. Das hab ich zuletzt gewogen, als ich zwanzig war. Bis zur Einweihung der Klinik könnte ich vielleicht die