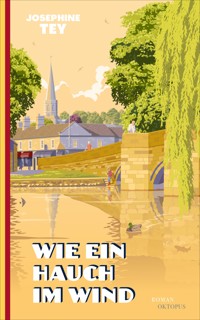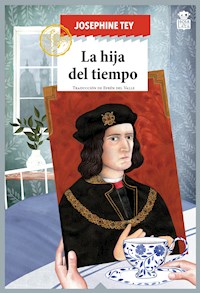Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Alan Grant
- Sprache: Deutsch
Ganz London, scheint es, steht vor dem Woffington Schlange. Nach zwei Jahren Spielzeit ist dies die letzte Woche von Wussten Sie es nicht?. Wer das legendäre Musical noch einmal sehen will, muss stundenlang vor der Theaterkasse ausharren. Als inmitten des Gedränges ein Mann ohnmächtig zusammensackt, weichen die Umstehenden erschrocken zurück: Aus seinem Rücken des Mannes ragt der Griff eines Dolchs. Der Unbekannte ist tot, heimtückisch erstochen in der Menschenmenge. Inspector Alan Grant von Scotland Yard, der mit den Ermittlungen beauftragt wird, sieht sich einer schier unlösbaren Aufgabe gegenüber: Nicht nur hat niemand der Anwesenden irgendetwas beobachtet; auch die Identität des Toten ist vollkommen unbekannt. Grant hält sich an die wenigen Indizien, die er hat - den altmodischen Typ des Dolchs, die Kleidungsstücke des Toten und die merkwürdige Mordmethode -, und tut, was er am besten kann: Er nutzt die Kraft seiner Gedanken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josephine Tey
Warten auf den Tod
Roman
Aus dem Englischen von Jochen Schimmang
Oktopus
1Mord
Es war zwischen sieben und acht Uhr an einem Märzabend, und überall in London wurden die Schranken vor den Türen zum Parkett und zur Galerie zurückgezogen. Peng, bum und klirr: Grimmige Geräusche, um ein abendliches Vergnügen einzuleiten. Aber kein letzter Trompetenstoß hätte die erschöpften Wartenden auf Thespis und Terpsichore so elektrisieren können, die geduldig in Viererkolonnen vor den Toren der Verheißung standen, wie diese Geräusche. Natürlich gab es hier und da keine Warteschlange. Vor dem Irving lagerten fünf Leute auf den beiden Stufen und opferten an Wärme, was sie an Bequemlichkeit gewannen; die griechische Tragödie war nicht populär. Vor dem Playbox war niemand; das Playbox war exklusiv und kannte so etwas wie Parkett überhaupt nicht. Beim Arena-Theater, das eine dreiwöchige Ballettsaison hatte, warteten zehn Personen vor der Galerie und eine lange Schlange vor dem Parkett. Aber am Woffington schienen sich beide Menschenketten bis ins Unendliche zu erstrecken. Schon lange zuvor war ein gebieterischer Angestellter die Reihe vor dem Parkett entlanggegangen und hatte mit einer Geste seines ausgestreckten Armes, die die Hoffnung zu guillotinieren schien, verkündet: »Alle ab hier nur noch Stehplatz.« Nachdem er so durch ein knappes Zusammenziehen eines Schultermuskels die Spreu vom Weizen getrennt hatte, kehrte er in olympischer Haltung vors Theater zurück, wo jenseits der Glastüren Wärme und Schutz warteten. Aber niemand entfernte sich aus der endlosen Reihe. Die dazu verdammt waren, noch drei Stunden länger zu warten, schienen gleichgültig gegenüber ihren Leiden. Sie lachten und schwatzten und reichten einander stärkende Stücke Schokolade in aufgerissenem Silberpapier. Nur noch Stehplatz, ja? Nun, wer würde nicht stehen wollen und sich noch daran erfreuen, in der letzten Woche von Wussten Sie es nicht?. Beinahe zwei Jahre lang war jetzt Londons Musical schlechthin gelaufen, und dies war sein Schwanengesang. Die Parkettplätze und Ränge waren Wochen im Voraus gebucht worden, und viele törichte Jungfrauen, an Warteschlangen nicht gewöhnt, vergrößerten die Menschenmasse vor den versperrten Türen, weil alle Bestechungsversuche an den Kassen erfolglos geblieben waren. Jedermann in London, so schien es, versuchte ins Woffington zu kommen, um das Stück noch einmal zu bejubeln. Um zu sehen, ob Golly Gollan seiner Revue einen neuen Gag hinzugefügt hatte – Gollan, der von einem risikofreudigen Manager vor einem Leben auf der Straße bewahrt worden war, seine Chance bekommen und sie genutzt hatte. Sie kamen, um sich ein weiteres Mal im Liebreiz und im Ruhm von Ray Marcable zu sonnen, dem Kometen, der zwei Jahre zuvor aus dem Nichts kommend am Zenit erstrahlt war und den Glanz der alten und etablierten Stars getrübt hatte. Ray tanzte wie ein schwebendes Blatt, und ihr kleines schüchternes Lächeln hatte in einem halben Jahr die Vorliebe für das strahlende Zahnpastalachen ausgestochen. Ihre Kritiker nannten das »ihren undefinierbaren Charme«, doch ihre Bewunderer fanden eine Menge außergewöhnlicher Ausdrücke dafür und behalfen sich mit Gesten und Mienenspiel, wenn Worte zu schwach waren, um ihr feenhaftes Wesen zu vermitteln. Nun ging sie nach Amerika, wie alles Gute, und nach den letzten beiden Jahren würde London ohne Ray Marcable eine unvorstellbare Wüste werden. Wer würde da nicht ewig stehen, um sie noch ein letztes Mal sehen zu können?
Seit fünf Uhr hatte es genieselt, und dann und wann griff sich ein kühler Lufthauch den Regen und strich ihn mit einem langen Pinselstrich halb spielerisch von einem Ende zum anderen über die Menge. Das entmutigte niemanden – sogar das Wetter machte an diesem Abend seine Scherze; es hatte gerade genug Geschmack, um einen passenden Aperitif abzugeben für die Kost, die auf sie wartete. Die Wartenden drehten Däumchen und machten nach Cockneymanier das Beste aus jeder Unterhaltung, die sich in der dunklen Straßenschlucht bot. Zuerst waren die Zeitungsjungen gekommen, schmale Burschen mit schmächtigen, teilnahmslosen Gesichtern und argwöhnischen Augen. Sie waren die Reihe entlanggehuscht wie ein Buschfeuer und hatten einen Schweif von Geschwätz und flatternden Zeitungen zurückgelassen. Dann legte ein Mann mit Beinen, die kürzer als sein Rumpf waren, einen zerlumpten Teppichstreifen auf das feuchte Pflaster und begann, sich selbst zu verknoten, bis er aussah wie eine Spinne, wenn sie überrascht wird; seine traurigen Krötenaugen funkelten ab und zu an völlig unerwarteten Stellen aus der sich windenden Masse hervor, sodass selbst dem hart gesottensten Zuschauer ein Schauer über den Rücken lief. Ihm folgte ein Mann, der auf einer Geige beliebte Lieder spielte, glücklicherweise sich der Tatsache nicht bewusst, dass seine E-Saite einen halben Ton zu tief gestimmt war. Dann kamen zur gleichen Zeit ein sentimentaler Balladensänger und ein synkopisches Dreimannorchester. Nachdem sie einander für einen kurzen Moment finster angesehen hatten, versuchte der Solosänger die Dinge nach dem Prinzip »Wer wagt, gewinnt« an sich zu reißen, indem er mit einem klagenden »Because you came to me« begann, aber der Chef des Orchesters reichte seine Gitarre einem Mitspieler und fing an, den Tenor anzustarren, die Arme ausgestreckt und die Hände erhoben. Der versuchte ihn zu ignorieren und über ihn hinwegzusehen, doch das war schwierig, da der Musiker einen halben Kopf größer als er selber war und überall zu sein schien. Er sang noch zwei Verse weiter, und dann schwenkte die Ballade über in bittere Vorwürfe in seiner natürlichen Stimmlage, und zwei Minuten später verschwand er in der dunklen Gasse, Drohungen und Klagen murmelnd, während das Orchester mit dem neuesten Schlager loslegte. Da das mehr nach dem Geschmack des modernen Publikums war als die unpassende Wiederbelebung abgestorbener Gefühlswelten, vergaßen sofort alle das arme Opfer höherer Gewalt und schlugen mit den Füßen den Takt. Nach dem Orchester und nacheinander kamen ein Zauberer, ein Evangelist und ein Mann, der sich mit einem Seil voller beeindruckend aussehender Knoten fesseln ließ und sich danach ebenso beeindruckend befreite.
Sie alle hatten ihren kleinen Auftritt und gingen dann weiter zur nächsten Vorstellung irgendwo anders, und jeder von ihnen, bevor er verschwand, lief die Warteschlange ab und schob sanft, aber hartnäckig einen Hut in die kärglichen Lücken zwischen den Reihen und sagte: »Danke! Danke!« als Ermutigung für die Mildtätigen. Zwischen den Programmen waren Verkäufer von Süßigkeiten, Streichhölzern, Spielzeug, ja sogar Ansichtskarten ihren Geschäften nachgegangen. Und die Menge hatte das Vergnügen geschätzt und die Pennys freigebig verteilt.
Jetzt kam Bewegung in die Reihe – eine Bewegung, deren Bedeutung die Erfahrenen sofort erkannten. Sitzhocker wurden beiseitegeschoben oder zusammengeklappt in Tragetaschen verstaut, Nahrungsmittel verschwanden, Geldbörsen wurden gezückt. Die Türen waren geöffnet. Das prickelnde, aufregende Spiel begann. Würde es Sieg, Platz oder Niederlage heißen, wenn man am Schalter angekommen war? Vorn in der Schlange, die weniger nach der mathematischen Zwei-und-Zwei-Ordnung organisiert war, als das weiter hinten der Fall war, hatte das Türöffnen für einen Augenblick die eingefahrene Gewohnheit des Engländers besiegt, seinen Platz zu halten – ich sage bewusst des Engländers, denn der Schotte hat keinen solchen Instinkt –, und es hatte ein leichtes Gerangel und eine Neuorientierung gegeben, bevor die Schlange als gedrängte und kurzatmige Masse vor dem Schalterfenster zur Ruhe kam, das sich direkt in der Tür zum Parkett befand. Das Klimpern und Rasseln von Kleingeld zeugte von den ständigen hektischen Transaktionen, die die Glücklichen in den siebten Himmel brachten. Allein das Geräusch ließ die weiter hinten Stehenden unbewusst nach vorn drücken, bis die Menge vorn so hörbar protestierte, wie es die gepressten Lungen zuließen, und ein Polizist die Reihe entlangging, um die Leute zu beruhigen. »Gut jetzt, gut jetzt, halten Sie sich ein bisschen zurück. Es ist Zeit genug. Durch Drängeln kommen Sie auch nicht rein. Alles zu seiner Zeit.« Dann und wann torkelte die ganze Reihe ein paar Zentimeter nach vorn, wenn sich ganz vorn die Befreiten zu zweit und zu dritt von ihrer Spitze lösten, wie Perlen von einer gerissenen Schnur. Jetzt hielt eine dicke Frau sie alle auf, die in ihrem Beutel nach mehr Geld suchte. Diese Närrin hätte ganz sicher schon vorher herausfinden können, wie viel sie genau brauchte, anstatt sie alle aufzuhalten. Als sei sie sich der allgemeinen Feindschaft bewusst, drehte sie sich zu dem Mann hinter ihr um und sagte ärgerlich: »Hey, ich wäre ganz dankbar, wenn Sie aufhören würden zu schieben. Kann eine Dame hier nicht mal ihre Geldbörse herausnehmen, ohne dass alle ihre Manieren vergessen?«
Aber der Mann, den sie angesprochen hatte, reagierte nicht. Sein Kopf war auf die Brust gesunken. Nur die Spitze seines weichen Hutes begegnete ihrem empörten Blick. Sie schnaubte verächtlich, drehte sich von ihm weg zur Kasse und legte freiweg das Geld hin, das sie gesucht hatte. Und während sie das tat, sackte der Mann langsam auf seine Knie, sodass die hinter ihm beinahe über ihn stolperten, verharrte einen Augenblick lang so und kippte dann noch langsamer nach vorn auf sein Gesicht.
»Der Kerl ist ohnmächtig geworden«, sagte jemand. Für eine kurze Weile waren alle erstarrt. Sich in einer Menge vor allem um sich selbst zu kümmern, gehört heutzutage ebenso zum Selbsterhaltungstrieb wie die Wandlungsfähigkeit eines Chamäleons. Vielleicht würde irgendwer sagen, dass er den Kerl kannte. Aber keiner tat das; und schließlich raffte sich ein Mann mit größerem sozialem Gefühl oder aber mehr Eigendünkel auf, um dem Zusammengebrochenen zu helfen. Er hatte sich gerade über den erschlafften Haufen gebeugt, als er innehielt und zurückprallte, als sei er gestochen worden. Eine Frau kreischte dreimal entsetzlich; und die schiebende, wogende Menge gefror plötzlich zu einem unbeweglichen Bild.
Im klaren weißen Licht der nackten Glühbirne an der Decke sah man den Körper des Mannes, freigelegt durch den instinktiven Rückzug der anderen, in jeder Einzelheit. Aus dem grauen Tweed seines Mantels ragte schräg ein kleines silbernes Ding, das in dem unheilvollen Licht bösartig blinkte.
Es war der Griff eines Dolchs.
Noch beinahe bevor der Ruf »Polizei!« ertönte, war der Wachtmeister von seiner Befriedungstätigkeit am Ende der Schlange zurückgekommen. Beim ersten der Frauenschreie hatte er sich umgedreht. Niemand schrie so, außer wenn er plötzlich mit dem Tod konfrontiert war. Nun prägte er sich einen Augenblick das Bild ein, beugte sich über den Mann, drehte sein Gesicht sacht ins Licht, ließ es los und sagte zu dem Mann am Schalter:
»Rufen Sie einen Krankenwagen und die Polizei.«
Er wandte seinen reichlich schockierten Blick der Menge zu.
»Kennt hier jemand den Mann?«
Aber keiner bezeugte Bekanntschaft mit dem reglosen Bündel auf dem Boden.
Hinter dem Mann hatte ein wohlhabendes Paar aus einem Vorort gestanden. Die Frau jammerte ununterbrochen und beinahe ausdruckslos: »Lass uns nach Hause gehen, Jimmy! Oh, lass uns nach Hause gehen!« Auf der anderen Seite des Schalters stand die dicke Frau, festgehalten durch diesen plötzlichen Schrecken. Sie umklammerte ihre Karte fest mit ihren schwarzen Baumwollhandschuhen, machte aber keine Anstalten, sich einen Platz zu sichern, nun, da der Weg frei vor ihr lag. In der Warteschlange verbreitete sich die Nachricht wie Feuer in einem Stoppelfeld – ein Mann war ermordet worden! –, und die Menge in dem schräg abfallenden Vestibül geriet plötzlich in heillose Verwirrung, weil einige wegkommen wollten von der Sache, die ihnen jeden Gedanken an Unterhaltung verdorben hatte, während andere nach vorn drängten, um etwas zu sehen, und einige Ungehaltene darum kämpften, den Platz zu verteidigen, für den sie so viele Stunden angestanden hatten.
»Lass uns nach Hause gehen, Jimmy! Lass uns bloß nach Hause gehen!«
Zum ersten Mal sagte Jimmy etwas. »Ich glaube nicht, dass wir das machen können, altes Mädchen, bevor die Polizei entschieden hat, ob sie uns braucht oder nicht.«
Der Wachtmeister hörte ihn und sagte: »Recht haben Sie. Sie können nicht einfach gehen. Die ersten sechs hierbleiben, wo Sie sind … und Sie, meine Dame«, sagte er zu der dicken Frau gewandt. »Der Rest kann weiter.« Er winkte den anderen, wie er den Verkehr an einem liegen gebliebenen Wagen vorbeigewunken hätte.
Jimmys Gattin brach in hysterisches Schluchzen aus, und die dicke Frau machte ernste Vorhaltungen. Sie war hierhergekommen, um die Show zu sehen, und wusste über den Mann rein gar nichts. Die vier Leute hinter dem Paar aus dem Vorort wehrten sich ebenso dagegen, in eine Sache verwickelt zu werden, über die sie nichts wussten, mit Ergebnissen, die man nicht vorhersehen konnte. Auch sie bekundeten ihr Unverständnis.
»Kann schon sein«, sagte der Polizist, »aber das können Sie alles auf der Wache vorbringen. Sie haben nichts zu befürchten«, fügte er zur Beruhigung hinzu, angesichts der Umstände wenig überzeugend.
Langsam kam die Schlange voran. Der Pförtner holte von irgendwo einen grünen Vorhang und bedeckte damit den Leichnam. Das Klimpern und Rasseln von Münzen setzte wieder ein und ging weiter, eintönig wie Regen. Der Pförtner verließ seine gewohnte Jupiterhöhe und bot den sieben Ausgestoßenen an, ihnen ihre rechtmäßigen Plätze freizuhalten, bewegt durch ihre Not oder durch die Hoffnung auf Belohnung. Zur gleichen Zeit trafen die Ambulanz und die Polizei von der Gowbridge-Wache ein. Ein Inspektor vernahm kurz jeden der sieben Zurückgehaltenen, notierte Namen und Adressen, und entließ sie mit der Auflage, sich jederzeit bereitzuhalten. Jimmy führte seine schluchzende Frau zu einem Taxi, und die anderen fünf gingen langsam und ernsthaft zu ihren Plätzen, die der Pförtner geschützt hatte wie eine brütende Henne, genau in dem Moment, als der Vorhang sich hob für die Abendvorstellung von Wussten Sie es nicht?.
2Inspektor Grant
Superintendent Barker drückte einen sorgfältig manikürten Zeigefinger auf die elfenbeinerne Klingeltaste auf der Unterseite des Tisches und ließ ihn dort, bis ein Bote erschien.
»Sagen Sie Inspektor Grant, dass ich ihn sehen möchte«, sagte er dem Boten, der sich alle Mühe gab, vor dem großen Mann unterwürfig zu erscheinen, in seinem Bemühen aber gehindert wurde durch die Anfänge eines Bauches, der ihn zwang, sich etwas aufzurichten, um sein Gleichgewicht zu behalten, und durch seine Nasenspitze, die die Verkörperung der Unverschämtheit war. Seiner Mängel schmerzlich bewusst, verschwand der Bote, um seine Botschaft an den Mann zu bringen und die Erinnerung an seine Verwirrung zu begraben unter der nüchternen Perfektion von Ordnern und Briefpapier, von denen man ihn weggerufen hatte, und augenblicklich kam Inspektor Grant und grüßte seinen Chef fröhlich von gleich zu gleich. Und die Miene seines Chefs hellte sich unwillkürlich auf.
Wenn Grant einen Vorteil hatte, der über das gebotene Pflichtgefühl und eine gute Portion Intelligenz und Mut hinausging, dann war es der, dass er nicht im Geringsten wie ein Polizeibeamter aussah. Er war mittelgroß und von leichtem Körperbau, und er war … nun, wenn man sagt elegant, denkt jeder natürlich sofort an so etwas wie eine Schneiderpuppe, eine Perfektion jenseits aller Individualität, und Grant war alles andere als das. Aber wenn man sich eine Eleganz vorstellen kann, die nicht nach Schneiderpuppe aussieht, dann hat man Grant. Barker hatte sich jahrelang vergeblich darum bemüht, es im Chic mit seinem Untergebenen gleichzutun; alles, was er erreichte, war, dass er zu ausgesucht angezogen aussah. Ihm fehlte das Gespür für Kleidung, wie ihm das Gespür für die meisten Dinge fehlte. Er war ein Roboter. Aber das war schon das Schlimmste, was man über ihn sagen konnte. Und wenn er sich erst einmal in Bewegung gesetzt und hinter jemandem her war, dann wünschte dieser Jemand in den meisten Fällen, er wäre nie geboren worden.
Jetzt betrachtete er seinen Untergebenen mit einer von keinem Neid getrübten Bewunderung, genoss die Ära des »frisch wie der junge Morgen«, die er mit sich brachte – er selber hatte fast die ganze Nacht mit Ischias wach gelegen – und kam zur Sache.
»Gowbridge dreht langsam durch«, sagte er. »Tatsächlich geht Gow Street so weit, dass sie von einer Verschwörung reden.«
»Oh, ja? Hat sie jemand hinters Licht geführt?«
»Nein, aber die Sache von gestern Abend war das fünfte große Ding in ihrem Distrikt innerhalb von drei Tagen, und sie haben die Nase voll. Sie wollen, dass wir diesen Fall übernehmen.«
»Welcher ist das? Die Warteschlangengeschichte, nicht wahr?«
»Richtig, und Sie werden die Untersuchungen leiten. Also fangen Sie an. Sie können Williams haben. Von Barber möchte ich, dass er nach Berkshire geht wegen des Einbruchs in Newbury. Die Leute da vor Ort brauchen erst einmal eine Menge Lobhudeleien, weil man ihnen uns vor die Nase gesetzt hat, und das kann Barber besser als Williams. Ich denke, das ist alles. Gehen Sie am besten gleich in die Gow Street. Alles Gute.«
Eine halbe Stunde später befragte Grant den Polizeiarzt von Gowbridge. Ja, sagte der, der Mann sei schon tot gewesen, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Waffe war ein dünnes, extrem scharfes Stilett gewesen. Es war links von der Wirbelsäule in den Rücken des Mannes gestoßen worden, und zwar mit solcher Kraft, dass der Schaft die Kleidung des Mannes zu einem Pfropfen gepresst hatte, der das Austreten des Blutes verhinderte. Nur ein paar Tropfen waren aus der Wunde gekommen, ohne aber nach außen zu treten. Seiner Meinung nach war der Mann schon vor einer beachtlichen Zeit – vielleicht zehn Minuten oder mehr – erstochen worden, bevor er endlich zusammenbrach, als die Leute vor ihm weitergegangen waren. In einem solchen Gedränge werde jemand einfach durch die Menge aufrecht gehalten und nach vorn geschoben. Tatsächlich sei es in einem so dicht gepackten Haufen schier unmöglich hinzufallen, selbst wenn einer das wollte. Er halte es für höchst unwahrscheinlich, dass der Mann von dem Stoß mit dem Stilett überhaupt etwas mitbekommen habe. Bei solchen Gelegenheiten gebe es so viel Drücken und Quetschen und unbeabsichtigte kleine Rempeleien, dass ein plötzlicher und nicht zu schmerzhafter Stoß gar nicht bemerkt werde.
»Und was wissen wir über den, der zugestochen hat? Irgendwelche Besonderheiten?«
»Nein, nur, dass der Mann stark war und außerdem Linkshänder.«
»Keine Frau?«
»Nein, man braucht mehr Kraft als eine Frau, um die Klinge so tief zu treiben, wie das geschehen ist. Sehen Sie, es gab keinen Platz, um auszuholen. Der Stoß musste aus einer Ruheposition ausgeführt werden. O nein, das war die Arbeit eines Mannes. Und zwar eines sehr entschlossenen Mannes.«
»Können Sie mir irgendetwas über den Toten selber sagen?«, fragte Grant, der gern zu jedem Punkt einer Untersuchung eine wissenschaftliche Stimme hörte.
»Nicht viel. Gut ernährt … wohlhabend, würde ich sagen.«
»Intelligent?«
»Ja, sehr sogar, möchte ich meinen.«
»Was für ein Typ?«
»Womit er befasst war, meinen Sie?«
»Nein, das kann ich selber herausfinden. Ich meine, was für ein … ich glaube, Sie würden es Temperament nennen.«
»Ah, ich verstehe.« Der Arzt dachte für einen Moment nach. Er sah seinen Gesprächspartner ein bisschen zweifelnd an. »Nun, das kann niemand mit Sicherheit sagen, das verstehen Sie gewiss?«, und als Grant das zugegeben hatte, fuhr er fort: »Aber ich würde ihn den Typ ›aussichtsloser Fall‹ nennen.« Er hob seine Augenbrauen fragend zum Inspektor und fügte hinzu, nachdem er sah, dass dieser verstanden hatte: »Sein Gesicht zeigt, dass er genug praktische Fähigkeiten hatte, aber seine Hände waren die eines Träumers. Sie werden es selbst sehen.«
Zusammen sahen sie sich den Leichnam an. Es war der eines jungen Mannes von neunundzwanzig oder dreißig, hellhaarig, mit haselnussbraunen Augen, schlank und mittelgroß. Die Hände waren, wie es der Doktor gesagt hatte, lang und schlank und an manuelle Arbeit nicht gewöhnt. »Vermutlich hat er viel gestanden«, sagte der Arzt mit einem Blick auf die Füße des Mannes. »Und beim Gehen hatte er den linken großen Zeh etwas nach innen gedreht.«
»Glauben Sie, dass sein Mörder irgendwelche anatomischen Kenntnisse hatte?«, fragte Grant. Es war beinahe unvorstellbar, dass so ein kleines Loch das Leben eines Mannes beendet hatte.
»Die Sache ist nicht mit der Präzision eines Arztes ausgeführt worden, falls Sie das meinen. Was anatomische Kenntnisse angeht, die hat praktisch jeder, der alt genug ist und den Krieg überstanden hat. Aber es kann einfach nur ein glücklich geführter Stoß gewesen sein … Und ich denke, das war so.«
Grant dankte ihm und sprach dann mit den Beamten der Gow Street. Auf einem Tisch war der spärliche Tascheninhalt des Mannes ausgelegt. Grant spürte eine leise Bestürzung, als er sah, um wie wenig es sich handelte. Ein weißes Baumwolltaschentuch, ein bisschen loses Kleingeld (zwei Halfcrownstücke, zwei Sixpence, vier Shilling, vier Pennys und ein halber), und – überraschenderweise – ein Militärrevolver. Das Taschentuch war schon älter, trug aber keine Wäschezeichen oder Initialen. Der Revolver war voll geladen.
Grant sah sich die Sachen schweigend und leicht angewidert an. »Gibt es irgendwelche Wäschezeichen in seiner Kleidung?«
Nein, es gab nichts derart.
Und keiner hatte auf den Leichnam Anspruch erhoben? Keiner, der Nachforschungen nach jemandem angestellt hätte?
Nein, niemand außer der verrückten Alten, die bei jedem Toten, den die Polizei fand, behauptete, ihn zu kennen.
Gut, er wollte sich die Kleidung allein ansehen. Sorgfältig untersuchte er jedes einzelne Stück. Sowohl der Hut als auch die Schuhe waren viel getragen, die Schuhe so oft, dass der Name des Herstellers, den man im Futter hätte finden sollen, verblasst war. Der Hut war damals bei einer Firma gekauft worden, die Geschäfte quer durch London und im ganzen Land hatte. Beide waren gute Qualität und, obwohl oft getragen, in keiner Weise schäbig. Der blaue Anzug war modisch, wenn auch vielleicht etwas zu ausgeprägt im Schnitt, und dasselbe ließ sich von dem grauen Mantel sagen. Die Unterwäsche war gut, wenn nicht sogar kostspielig, und das Hemd war von gängigem Farbton. Genau betrachtet, hatten all diese Sachen einem Mann gehört, der entweder selber auf Kleidung Wert gelegt oder mit Leuten verkehrt hatte, die das taten. Ein Handelsreisender für Herrenausstatter vielleicht. Wie die Gowbridge-Leute gesagt hatten, gab es nirgends Wäschezeichen. Das konnte entweder bedeuten, dass der Mann seine Identität verbergen wollte oder dass seine Wäsche normalerweise zu Hause gewaschen wurde. Da es keine Spuren dafür gab, dass Zeichen entfernt worden waren, war die zweite Erklärung naheliegender. Auf der anderen Seite war der Name des Schneiders sorgfältig vom Anzug entfernt worden. Dies und die Geringfügigkeit der Habe, die bei dem Mann gefunden worden war, deuteten sicher auf einen Wunsch seinerseits hin, seine Identität zu verbergen.
Schließlich – der Dolch. In seiner bösartigen Zierlichkeit war er eine verruchte kleine Waffe. Der Griff war aus Silber, knapp zehn Zentimeter lang, und stellte die Figur eines Heiligen dar, mit einem Bart und in einer Kutte. Hier und da war er mit Emailmalerei in hellen primitiven Farben bedeckt, wie sie die Heiligenbilder in katholischen Ländern ziert. Im Großen und Ganzen war es ein Typ, der in Italien und an der spanischen Südküste ziemlich weit verbreitet war. Grant befühlte ihn vorsichtig.
»Wie viele Menschen haben ihn in der Hand gehabt?«, fragte er.
Die Polizei hatte ihn beschlagnahmt, sobald der Mann im Krankenhaus eingeliefert war und er entfernt werden konnte. Seitdem hatte ihn niemand berührt. Aber der Ausdruck von Genugtuung auf Grants Gesicht verschwand, als man hinzufügte, dass er auf Fingerabdrücke untersucht worden und das Ergebnis gleich null war. Nicht einmal ein verwischter Abdruck verdarb die glänzende Oberfläche des schmucken Heiligen.
»Nun gut«, sagte Grant, »ich nehme das mit und sehe weiter.« Er hinterließ Anweisungen für Williams, die Fingerabdrücke des Toten zu nehmen und den Revolver auf Besonderheiten zu untersuchen. Seinem eigenen Eindruck nach war es ein stinknormaler Militärrevolver, dessen Typ in Großbritannien seit dem Krieg etwa so verbreitet war wie Standuhren. Aber, wie schon erwähnt wurde, Grant hörte gern die jeweiligen Autoritäten in ihrem Fach. Er selbst nahm ein Taxi und verbrachte den Rest des Tages damit, die sieben Personen zu befragen, die dem Unbekannten gestern Abend am nächsten gestanden hatten, als er in sich zusammensackte.
Während das Taxi ihn hierhin und dorthin fuhr, ließ er seine Gedanken schweifen und überdachte die Situation. Er hatte nicht die leiseste Hoffnung, dass einer der Befragten irgendwie von Nutzen sein könnte. Jeder einzelne von ihnen hatte jede Bekanntschaft mit dem Mann während der ersten Befragung bestritten, und es war nicht wahrscheinlich, dass sie ihre Meinung inzwischen geändert hatten. Außerdem, wenn einer von ihnen früher einen Freund zusammen mit dem Toten gesehen hätte, wäre er nur zu bereit gewesen, das zu sagen. Grants Erfahrung sagte ihm, dass neunundneunzig Leute gern nutzlose Informationen anbieten und nur einer sich zurückhält. Schließlich hatte der Arzt gesagt, dass der Mann schon einige Zeit vor seiner Entdeckung erstochen worden war, und kein Mörder würde in der unmittelbaren Nähe seines Opfers bleiben, bis die Tat endlich ans Licht kam. Selbst wenn der Mörder die Möglichkeit eines Bluffs in Betracht gezogen hatte, waren die Chancen, dass man eine Verbindung zwischen ihm und seinem Opfer herstellte, doch zu groß, als dass ein einsichtiger Mann (und ein Mann, der auf Selbsterhaltung bedacht ist, ist in der Regel klug genug) sich darauf einlassen würde. Nein, der Mann, der es getan hatte, hatte die Warteschlange schon einige Zeit verlassen. Er musste jemanden ausfindig machen, der den Ermordeten vor seinem Tod bemerkt und in einem Gespräch mit jemandem gesehen hatte. Natürlich gab es die Möglichkeit, dass kein Gespräch stattgefunden hatte, dass der Mörder einfach nur den Platz hinter seinem Opfer eingenommen hatte und nach der Tat entwischt war. In diesem Fall musste er jemanden finden, der einen Mann beobachtet hatte, der sich aus der Schlange davonstahl. Das sollte nicht so schwierig sein. Man konnte die Presse um Hilfe angehen.
In aller Muße dachte er über den Typus des Täters nach. Kein echter Engländer würde eine solche Waffe benutzen. Wenn er überhaupt Stahl benutzte, dann nahm er ein Rasiermesser und schnitt jemandem die Kehle durch. Aber seine normale Waffe war ein Knüppel, und wenn der nicht zu Hand war, eine Feuerwaffe. Dies war ein Verbrechen, das mit einem Einfallsreichtum erdacht und einer Raffinesse ausgeführt worden war, die dem englischen Denken fremd waren. Dieses Raffinement ließ sofort an einen Südländer denken, oder wenigstens an jemanden, der südländische Lebensgewohnheiten kannte. Ein englischer Matrose, der viel in Mittelmeerhäfen verkehrte, könnte das getan haben. Aber auf der anderen Seite, wäre ein Matrose in der Lage, an so einen subtilen Tatort wie die Warteschlange zu denken? Er hätte doch eher an eine dunkle Nacht und eine verlassene Straße gedacht. Das Pittoreske der ganzen Sache war eindeutig lateinisch. Ein Engländer war von dem Verlangen besessen, zuzuschlagen. Die Art und Weise, wie das geschah, interessierte ihn gewöhnlich nicht.
Das führte ihn zu der Frage nach dem Motiv, und er dachte über die einleuchtendsten nach: Diebstahl, Rache, Eifersucht, Angst. Das Erste war ausgeschlossen; in solch einer Menge hätten die Taschen des Mannes ein halbes Dutzend Mal durch einen erfahrenen Praktiker geleert werden können, mit keinem größeren Aufwand, als ihn eine Fliege zur Landung braucht. Rache oder Eifersucht? Hochwahrscheinlich – Südländer waren in ihren Gefühlen notorisch verletzlich; eine Beleidigung nagte ein Leben lang, ein verirrtes Lächeln auf der Seite ihrer Angebeteten, und sie liefen Amok. War der Mann mit den Haselnussaugen – er war unzweifelhaft attraktiv gewesen – zwischen einen Südländer und sein Mädchen geraten?
Aus welchem Grund auch immer glaubte Grant das nicht. Er verlor die Möglichkeit nicht aus den Augen – aber er glaubte nicht daran. Blieb noch die Angst. War der geladene Revolver für den Mann bestimmt gewesen, der das silberne Stück Stahl in den Rücken seines Besitzers stieß? Hatte der Tote vorgehabt, den Südländer bei der nächsten Begegnung zu erschießen, und hatte der Mörder das gewusst und in Angst gelebt? Oder war es umgekehrt? War es der Tote, der eine Waffe zur Verteidigung getragen hatte, die ihm allerdings nicht geholfen hatte? Aber dann war da auch das Bemühen des Unbekannten, seine Identität abzustreifen. Unter diesen Umständen verwies der geladene Revolver eher auf Selbstmord. Aber wenn er an Selbstmord dachte, warum verschob er ihn dann und ging ins Theater? Welche anderen Motive veranlassten einen Menschen dazu, sich anonym zu machen? Kontakt mit der Polizei – Haft? Wollte er jemanden erschießen und für den Fall, nicht entkommen zu können, sich selber zu einem Namenlosen machen? Das war möglich.
Wenigstens war es ziemlich sicher, dass der Tote und der Mann, den Grant mental als Südländer eingestuft hatte, einander gut genug gekannt hatten, dass zwischen ihnen die Fetzen geflogen waren. Grant glaubte nicht an Syndikate als Urheber pittoresker Morde. Syndikate erfreuten sich an Raub und Erpressung und anderen erbärmlichen Methoden, um für nichts etwas zu bekommen, und an ihnen war selten etwas Pittoreskes, wie er aus bitterer Erfahrung wusste. Darüber gab es gegenwärtig in London keine nennenswerten Syndikate, und er hoffte, es werde auch keine geben. Auftragsmord langweilte ihn zu Tode. Was ihn interessierte, war die Auseinandersetzung zwischen Intellekt und Intellekt, zwischen Gefühl und Gefühl. Wie beim Südländer und dem Unbekannten. Nun, er musste sein Bestes tun, um herauszufinden, wer der Unbekannte war – das würde ihn zu dem Südländer führen. Warum hatte niemand nach ihm gefragt? Natürlich war es noch früh. Er konnte jede Minute von jemandem identifiziert werden. Alles in allem konnte er für seine Angehörigen gerade mal für den Zeitraum einer Nacht als »vermisst« gelten, und nicht sehr viele Leute beeilen sich, einen Ermordeten in Augenschein zu nehmen, nur weil ihr Sohn oder Bruder für eine Nacht fortgeblieben ist.
Mit Geduld, Umsicht und wachem Geist befragte Grant die sieben Personen, die er hatte sehen wollen – im sehr wörtlichen Sinn. Er war nicht davon ausgegangen, von ihnen wertvolle Informationen zu bekommen, sondern wollte sie sehen, um sie einschätzen zu können. Er traf sie alle bei ihrer gewöhnlichen Tätigkeit an, mit Ausnahme von Mrs James Ratcliffe, die ans Bett gefesselt war und vom Arzt behandelt wurde, der den nervösen Schock bedauerte, den sie erlitten hatte. Grant sprach mit ihrer Schwester, einem charmanten Mädchen mit honigfarbenem Haar. Als sie in den Salon kam, war es ganz offensichtlich, wie widerwärtig ihr der Gedanke war, dass irgendein Polizeibeamter mit ihrer Schwester in ihrem gegenwärtigen Zustand sprechen sollte. Der leibhaftige Anblick des Polizeibeamten setzte sie dann derart in Erstaunen, dass sie unwillkürlich ein zweites Mal auf seine Karte sah, und innerlich lächelte Grant ein wenig deutlicher, als er es sich nach außen zugestand.
»Ich weiß, Sie hassen meinen Anblick«, sagte er entschuldigend, und nicht alles in seinem Ton war Schauspielerei, »aber ich wünschte doch, Sie würden mich zwei Minuten mit Ihrer Schwester sprechen lassen. Sie können mit der Stoppuhr vor der Tür stehen. Oder natürlich auch mit hineinkommen, wenn Sie wollen. In dem, was ich mit ihr zu besprechen habe, gibt es keine Geheimnisse. Ich leite nur einfach die Untersuchungen in diesem Fall, und es ist meine Pflicht, mit den sieben Menschen zu sprechen, die dem Mann gestern Abend am nächsten standen. Es würde mir enorm helfen, wenn ich sie heute Abend alle von der Liste streichen und morgen früh ganz neu beginnen könnte. Verstehen Sie das? Es ist eine pure Formalie, aber würde mir helfen.«
Wie er gehofft hatte, waren seine Argumente erfolgreich. Nach kurzem Zögern sagte das Mädchen: »Ich gehe hinein und schaue, ob ich sie überzeugen kann.« Ihre Darstellung von Charme und Aussehen des Inspektors musste in rosigsten Farben erfolgt sein, denn sie kam schneller zurück, als er erhofft hatte, und führte ihn nach oben ins Zimmer ihrer Schwester. Dort befragte er eine Frau, die in Tränen aufgelöst war und beteuerte, dass sie den Mann nicht einmal bemerkt hatte, bevor er umfiel, und deren feuchte Augen ihn die ganze Zeit mit ängstlicher Neugier betrachteten. Ihr Mund war hinter der Barrikade eines Taschentuchs verborgen. Grant wünschte sich, sie möge es für einen Moment wegnehmen, denn er hatte die Theorie, dass Münder mehr verrieten als Augen – besonders, wenn es sich um Frauen handelte.
»Standen Sie hinter ihm, als er zu Boden sackte?«
»Ja.«
»Und wer stand neben ihm?«
Sie konnte sich nicht erinnern. Niemand kümmerte sich um etwas anderes als darum, in dieses Theater zu kommen, und im Übrigen achtete sie nie auf andere Leute auf der Straße.
»Es tut mir leid«, sagte sie unsicher, als er Anstalten machte zu gehen. »Ich wäre Ihnen gern nützlicher gewesen. Ich sehe immer noch den Dolch, und ich würde alles tun, damit der Mann, der das getan hat, ins Gefängnis kommt.«
Und als Grant draußen war, hatte er sie aus seinem Gedächtnis gestrichen.
Ihr Gatte – er musste in die City fahren, um ihn zu sehen, obwohl er alle in den Yard hätte bestellen können, aber er wollte sehen, wie sie den ersten Tag nach dem Mord verbrachten –, ihr Gatte also war hilfreicher. Als die Türen geöffnet wurden, sagte er, hatte es heftige Bewegung in der Schlange gegeben, und die Positionen, die sie zu ihren Nachbarn eingenommen hatten, hatten sich etwas verändert. Soweit er sich erinnern konnte, gehörte die Person, die neben dem toten Mann und vor ihm selber gestanden hatte, zu einer Vierergruppe unmittelbar davor, und war mit ihr hineingegangen. Wie seine Frau sagte er, dass er den Mann nicht bewusst wahrgenommen hatte, bevor er umgefallen war.
Die anderen fünf erwiesen sich als ebenso unschuldig und ebenso wenig hilfreich. Keiner hatte den Mann bemerkt. Das erstaunte Grant nun doch ein bisschen. Wie konnte ihn überhaupt niemand bemerkt haben? Schließlich musste er die ganze Zeit da gewesen sein. Man steckt nicht in einer Warteschlange fest, ohne eine höchst unangenehme Form von Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und selbst der Unachtsamste wird sich an das erinnern, was seine Augen gesehen haben, selbst wenn er sich dessen in dem betreffenden Moment gar nicht bewusst ist. Grant rätselte immer noch herum, als er in den Yard zurückkehrte.
Dort ließ er der Presse einen Aufruf zukommen, in dem jeder, der einen Mann die Schlange hatte verlassen sehen, aufgefordert wurde, sich bei Scotland Yard zu melden. Ebenso gab er eine genaue Beschreibung des Mannes und so viel Informationen über den Fortgang der Untersuchungen, wie schon an die Öffentlichkeit gegeben werden konnten. Dann rief er Williams und ließ sich einen Bericht über seine Arbeit geben. Die Fingerabdrücke des Toten waren genommen worden, wie er es angeordnet hatte, berichtete Williams, aber sie waren polizeilich nicht bekannt. Auf den einschlägigen Listen konnten keine entsprechenden Abdrücke gefunden werden. Der Waffenexperte hatte am Revolver keinerlei Besonderheiten bemerken können. Er war vermutlich aus zweiter Hand, war oft gebraucht worden und natürlich eine starke Waffe.
»Oho«, sagte Grant angewidert. »Ein richtiger Experte!«, und Williams grinste.
»Nun, er sagte, es gab kein besonderes Merkmal«, erinnerte er sich.
Und dann rückte er damit heraus, dass er den Revolver auf Fingerabdrücke untersucht hatte, bevor er ihn an die Experten weitergab, und dass er sehr viele gefunden und sie fotografieren lassen hatte. Nun wartete er auf die Abzüge.
»Saubere Arbeit«, sagte Grant, ging ins Büro des Kommissars und nahm die Abzüge von den Fingerabdrücken des Toten mit. Er gab Barker ein kurzes Fazit des Tages, ohne irgendwelche Theorien über Südländer hinzuzufügen, ausgenommen die Bemerkung, es handele sich um ein sehr unenglisches Verbrechen.
»Wir haben verdammt wenig in der Hand«, sagte Barker. »Eigentlich nichts außer dem Dolch, und der verweist eher auf einen Roman als auf ein handfestes und ehrliches Verbrechen.«
»Das ist genau das, was ich denke«, sagte Grant. »Ich frage mich, wie viele sich wohl heute vor dem Woffington anstellen«, fügte er unvermittelt hinzu.
Wie Barker sich zu dieser faszinierenden Frage geäußert haben würde, wird der Welt für immer vorenthalten bleiben, weil in diesem Moment Williams eintrat.
»Die Abdrücke vom Revolver, Sir«, sagte er lakonisch, und legte sie auf den Tisch. Grant nahm sie ohne großen Enthusiasmus und verglich sie mit den Abdrücken, die er geistesabwesend mitgenommen hatte. Nach kurzer Zeit wurde er starr vor Aufmerksamkeit wie ein Pointer. Es gab fünf deutliche Abdrücke und viele unvollständige, aber weder die deutlichen noch die mangelhaften stammten von dem Toten. Den Abdrücken lag ein Bericht von der zuständigen Abteilung bei. In ihren Listen gab es von den hier vorliegenden Abdrücken keine Spur.
In seinem Büro setzte Grant sich hin und kam ins Grübeln. Was bedeutete das, und von welchem Wert war es, das zu wissen? Gehörte der Revolver nicht dem Toten? War er vielleicht nur ausgeliehen? Aber selbst in dem Fall hätte es einen Hinweis darauf gegeben, dass er vorübergehend im Besitz des Toten gewesen war. Oder war das nicht der Fall gewesen? War er ihm von jemand anderem in die Tasche gesteckt worden? Aber man kann nicht etwas von dem Gewicht und dem Ausmaß eines Militärrevolvers in die Tasche eines Mannes schieben, ohne dass dieser es merkt. Nicht bei einem Lebenden jedenfalls, allerdings – es hätte nach dem Dolchstoß passiert sein können. Aber warum, warum? Keine Lösung, so weit hergeholt auch immer, bot sich an. Er nahm den Dolch aus dem Papier, in das er gewickelt war, und besah ihn sich unter dem Mikroskop, konnte sich dadurch aber nicht in eine bessere Stimmung zaubern. Er fühlte sich ausgebrannt. Besser, er ging raus und ein bisschen spazieren. Es war kurz nach fünf. Er würde zum Woffington gehen und mit dem Mann sprechen, der gestern Abend Pförtner gewesen war.
Es war ein herrlicher ruhiger Abend, der Himmel rosa gefärbt wie eine Primel, und London dagegen abgesetzt als eine blasse Tuschzeichnung aus verschwommenem Lavendel. Grant atmete die Luft dankbar ein. Der Frühling kam. Wenn er den Südländer geschnappt hatte, würde er sich absetzen – wenn es sein musste, aus Krankheitsgründen – und irgendwohin angeln fahren. Wohin? Am besten fischen konnte man zweifellos im schottischen Hochland, aber die Gesellschaft dort war sterbenslangweilig. Er würde an den River Test gehen, vielleicht nach Stockbridge. Forellenangeln war keine große Sache, aber es gab dort ein gemütliches Pub und allerbeste Gesellschaft. Und er würde sich ein Pferd leihen und ein geeignetes Gelände finden, um zu reiten. Und Hampshire im Frühling!
In dieser Art träumte er, während er schnell das Embankment entlangging, von Dingen, die von den augenblicklichen Problemen meilenweit entfernt waren. Das war Grants Methode. Barkers Motto hieß: »Kau es durch! Kau es wieder und wieder durch, im Wachen und Schlafen, und du wirst schließlich auf den Kern der ganzen Sache kommen.« Für Barker passte das, für Grant nicht. Grant hatte einmal gesagt, dass er, als er alles durchgekaut hatte, an nichts mehr denken konnte als an den Schmerz in seinem Kiefer, und er hatte es so gemeint. Er hatte herausgefunden, dass er nicht weiterkam, wenn ihn etwas vor ein Rätsel stellte und er sich darin verbiss, und dass er seinen Sinn für die wahren Maßstäbe verlor. Wenn er in eine Sackgasse geraten war, gönnte er es sich deshalb, für eine Zeit lang »die Augen zu schließen«, wie er es nannte, und wenn er sie wieder »öffnete«, sah er die Dinge gewöhnlich in einem neuen Licht, das bis dahin unbekannte Gesichtspunkte enthüllte und das alte Problem in völlig neue Verhältnisse rückte.
Im Woffington hatte es nachmittags eine Matinee gegeben, aber jetzt fand er das Theater in seinem gewöhnlichen Zustand abgeschotteter Verlassenheit am Eingang und trübseliger Unordnung dahinter vor. Der Pförtner war im Haus, aber niemand konnte genau sagen wo. Am frühen Abend hatte er scheinbar viele verschiedene Pflichten. Nachdem einige keuchende Boten aus den Eingeweiden des Gebäudes zurückgekehrt waren mit der Nachricht, »Nein, Sir, da gab es keine Spur von ihm«, schloss sich Grant selber der Suche an und stellte den Mann schließlich in einem düsteren Durchgang hinter der Bühne. Nachdem Grant erklärt hatte, wer er war und was er wollte, wurde der Mann in seinem Stolz und seinem Eifer überaus redselig. Er war es gewöhnt, in nächster Nähe mit der Aristokratie des Theaters zu verkehren, aber es passierte nicht jeden Tag, dass er sich von gleich zu gleich mit einem viel erhabeneren Wesen unterhalten konnte, einem Inspektor des Criminal Investigation Department. Er strahlte, er verschob ständig den Sitz seiner Mütze, er fummelte an seinen Ordensbändern herum, er wischte seine Handfläche am Hosenboden ab, und er hätte auch ausgesagt, er habe in der Warteschlange einen Affen gesehen, wenn er dem Inspektor damit eine Freude hätte machen können. Grant grummelte innerlich, aber der Teil von ihm selbst, der immer ein wenig abseitsstand, was immer er auch tat – der Zuschauer in ihm, von dem er so viel hatte – erfreute sich daran, was für ein Original der alte Junge doch war. Mit jenem Hinweis, dass man sich eventuell noch einmal wiedersehen werde, der dem Berufsdetektiv zur zweiten Natur geworden ist, nahm er freundlich Abschied von so viel ergebener Nutzlosigkeit, als er eine charmante Stimme sagen hörte, »Mein Gott, das ist ja Inspektor Grant!« und, als er sich umdrehte, Ray Marcable in ihrer Freizeitkleidung sah, offensichtlich auf dem Weg in ihre Garderobe.
»Suchen Sie einen Job? Ich fürchte, so spät kriegen Sie nicht einmal mehr eine Komparsenrolle.« Ihr immer noch kleines Lächeln neckte ihn ein wenig, und ihre grauen Augen sahen ihn unter den leicht herabhängenden Lidern freundlich an. Sie waren einander vor einem Jahr begegnet, als ihr ein irrsinnig teurer Kosmetikkoffer gestohlen worden war, das Geschenk eines ihrer reichsten Verehrer, und obwohl sie sich seitdem nicht mehr gesehen hatten, hatte sie ihn offensichtlich nicht vergessen. Wider seinen Willen fühlte er sich geschmeichelt – auch wenn der Zuschauer in ihm das registrierte und sich darüber amüsierte. Er erklärte, was ihn in dieses Theater getrieben hatte, und das Lächeln auf ihrem Gesicht verschwand sofort.
»Ach, der arme Kerl!«, sagte sie. »Aber hier ist noch einer«, fügte sie sofort hinzu und legte eine Hand auf seinen Arm. »Haben Sie den ganzen Nachmittag damit verbracht, Fragen zu stellen? Ihre Kehle muss ja ganz trocken sein. Kommen Sie, wir wollen in meiner Garderobe einen Tee trinken. Meine Garderobiere ist da und wird uns einen kochen. Wir machen Schluss, wissen Sie. Das ist immer traurig nach so einer langen Zeit.«
Sie führte ihn zu ihrer Garderobe, einem Ort, der halb mit Spiegeln und halb mit Kostümen vollgepackt war und mehr nach einem Blumenladen als einem Raum aussah, in dem Menschen sich aufhalten sollten. Sie zeigte mit einer Handbewegung auf die Blumen.
»Meine Wohnung kann nicht mehr alle aufnehmen, deshalb muss der Rest hierbleiben. Meine Vermieter waren sehr höflich, aber sie haben doch sehr entschieden gesagt, dass sie es mit noch mehr Blumen nicht mehr aufnehmen könnten. Und ich kann schlecht sagen ›keine Blumen‹, wie man das bei Beerdigungen macht, ohne die Leute zu verletzen.«
»Blumen schenken ist alles, was die meisten Leute für Sie tun können«, sagte Grant.
»O ja, ich weiß«, sagte sie. »Ich bin nicht undankbar. Nur überwältigt.«
Als der Tee fertig war, schenkte sie ihm ein, und die Garderobiere bot Mürbegebäck aus einer Dose an. Als er seinen Tee umrührte und sie sich selber eingoss, gab ihm sein Intellekt einen plötzlichen Stoß, so wie ein unerfahrener Reiter sich ans Maul seines Pferdes klammert, wenn er sich erschreckt. Sie war Linkshänderin!
Gütiger Himmel!, dachte er gleich danach angewidert bei sich selber, du verdienst nicht nur einen Urlaub, du brauchst einen. Was soll so eine Feststellung wohl bedeuten? Was glaubst du wohl, wie viele Linkshänder es in London gibt? Langsam drehst du durch.
Um das Schweigen zu brechen, und weil es das Erste war, was ihm einfiel, sagte er: »Sie sind Linkshänderin.«
»Ja«, sagte sie so gleichgültig, wie das Faktum es verdiente, und fragte ihn weiter nach den Untersuchungen aus. Er erzählte ihr das, was morgen auch in der Presse stehen würde, und beschrieb ihr den Dolch als das interessanteste Detail in dem ganzen Fall.
»Der Griff ist eine kleine Heiligenfigur aus Silber mit blauer und roter Emailverzierung.«
Er sah ein plötzliches Flackern in Ray Marcables ruhigen Augen.
»Wie bitte?«, sagte sie unwillkürlich.
Er war drauf und dran zu sagen »Sie haben so ein Messer gesehen?«, änderte dann aber seine Meinung. Er wusste sofort, dass sie Nein sagen und dass er ihr gezeigt haben würde, dass er etwas gemerkt hatte. Er wiederholte die Beschreibung, und sie sagte:
»Ein Heiliger! Wie merkwürdig! Und wie geschmacklos! Und doch, ich denke, bei einem so gewaltigen Unternehmen wie einem Verbrechen möchte man, dass jemand es segnet.«
Kühl und liebreizend streckte sie ihre linke Hand nach seiner Tasse aus, und während sie sie wieder füllte, beobachtete er ihr ruhiges Handgelenk und ihre gelassene Art und fragte sich, ob auch diese Beobachtung von seiner Seite aus übertrieben war.
»Sicher nicht«, sagte sein anderes Selbst. »Kann sein, dass die Atmosphäre außergewöhnlicher Orte dich beeinflusst, aber in dem Stadium, dass du Gespenster siehst, bist du noch nicht.«
Sie sprachen über Amerika, das Grant gut kannte und wohin sie zum ersten Mal ging, und als er aufbrach, war er ihr aufrichtig dankbar für den Tee. Über dem Tee hatte er alles vergessen. Es war jetzt egal, wie spät er zu Abend aß. Aber draußen fragte er den Pförtner nach Feuer für seine Zigarette, und während eines weiteren Aufwallens von Tratsch und gutem Willen erfuhr er, dass Miss Marcable sich gestern Abend ab sechs Uhr in der Garderobe aufgehalten hatte, bis man sie zum ersten Auftritt rief. Lord Lacing war bei ihr, sagte er mit einem vielsagenden Heben der Augenbrauen.
Grant lächelte und nickte und ging, aber als er auf dem Weg zurück in den Yard war, lächelte er nicht mehr. Was bedeutete das plötzliche Flackern in Miss Marcables Augen? Keine Furcht. Nein. Wiedererkennen? Ja, das war es. Mit ziemlicher Sicherheit Wiedererkennen.
3Danny Miller
Grant öffnete die Augen und sah forschend an die Decke seines Schlafzimmers. In den letzten paar Minuten war er rein technisch wach gewesen, aber sein Gehirn, noch eingehüllt in den wohligen Dämmer des Schlafs und sich der unangenehmen Kühle des Morgens schon bewusst, hatte ihm das Denken verweigert. Aber obwohl der intellektuelle Teil seiner selbst noch nicht erwacht war, war er sich mehr und mehr eines seelischen Missvergnügens bewusst geworden. Etwas Unerfreuliches wartete auf ihn. Etwas extrem Unerfreuliches. Diese wachsende Gewissheit hatte seine Schläfrigkeit vertrieben, und seine Augen öffneten sich zur Decke, auf der das frühe Sonnenlicht und das Schattengeflecht einer Platane ein Netzmuster bildeten; und sie öffneten sich zur Erkenntnis des Unerfreulichen. Dies war der Morgen des dritten Tages der Nachforschungen, der Tag der gerichtlichen Untersuchung, und er konnte dem Beamten nicht das Geringste präsentieren. Er hatte nicht die kleinste Spur.
Seine Gedanken wanderten zurück zu gestern. Am Morgen, der Tote war noch immer nicht identifiziert, hatte er Williams die Krawatte des Mannes gegeben, das neueste und individuellste Kleidungsstück, das man an ihm gefunden hatte, und ihn losgeschickt, um London durchzukämmen. Die Krawatte war wie der Rest der Kleidung in der Filiale einer Ladenkette gekauft worden, und es gab die kleine Hoffnung, dass irgendein Verkäufer sich an denjenigen erinnern würde, dem er das Stück verkauft hatte. Selbst wenn das der Fall war, hieß das noch nicht, dass es sich dabei um ihren Mann handelte. Faith Brothers mussten allein in London einige Dutzend Krawatten mit diesem Muster verkauft haben. Aber es gab immer diese allerletzte Chance, und Grant hatte zu viel der merkwürdigsten Glücksfälle erlebt, um irgendeine Spur zu vernachlässigen. Als Williams gegangen war, kam ihm ein Gedanke. Er hatte ja diesen ersten Einfall gehabt, dass der Mann Handelsreisender für eine Bekleidungsfirma gewesen sein könnte. Vielleicht kaufte er seine Kleidung nicht im Laden. Vielleicht war er für Faith Brothers tätig. »Versuchen Sie herauszufinden«, hatte er zu Williams gesagt, »ob irgendjemand, auf den die Beschreibung des Toten passt, in letzter Zeit in einer der Filialen tätig war. Wenn Sie irgendetwas Interessantes sehen oder hören – egal, ob Sie es für wichtig halten oder nicht –, lassen Sie es mich wissen.«
Allein im Büro, hatte er die Morgenpresse durchgesehen. Er hatte sich nicht lange mit den verschiedenen Berichten über den Mord in der Warteschlange aufgehalten, dafür aber den Rest der Nachrichten mit ziemlicher Aufmerksamkeit geprüft, angefangen mit den Kleinanzeigen. Nichts davon ließ jedoch bei ihm irgendeine Saite erklingen. Ein Foto von ihm selber mit der Unterzeile »Inspektor Grant, der die Untersuchungen im Mordfall Warteschlange leitet«, ließ ihn frösteln. »Blödmänner!«, sagte er laut. Dann hatte er eine Liste der vermissten Personen zusammengestellt und studiert, die ihnen von allen Polizeistationen in Großbritannien gemeldet worden waren. Fünf junge Männer wurden an verschiedenen Orten vermisst, und die Beschreibung des einen, der aus einer kleinen Stadt in Durham verschwunden war, hätte auf den Toten passen können. Nach langem Warten war es Grant gelungen, die Polizei von Durham ans Telefon zu bekommen, nur um zu erfahren, dass der Vermisste früher einmal Bergarbeiter gewesen und nach Meinung des Durhamer Inspektors ein übler Kunde war. Und weder »Bergarbeiter« noch »übler Kunde« passte auf den Toten.
Der Rest des Morgens ging für Routinearbeit drauf: Vorbereitung auf die gerichtliche Untersuchung und andere notwendige Formalitäten. Etwa zur Mittagszeit hatte Williams ihn aus der größten Filiale von Faith Brothers im Strand angerufen. Nicht nur, dass sich keiner an einen solchen Käufer erinnerte, es erinnerte sich auch keiner daran, jemals eine solche Krawatte verkauft zu haben. Es war keine aus einer Serie, die sie in letzter Zeit im Laden gehabt hatten. Das hatte ihn veranlasst, mehr Informationen über die Krawatte selbst einzuholen, und er war in die Zentrale gefahren und hatte nach dem Manager gefragt, dem er die Situation erklärte. Der Manager schlug vor, der Inspektor solle die Krawatte für eine Weile freigeben, sodass sie zur Fabrik nach Northwood geschickt werden könne, wo man eine Liste der Bestimmungsorte aller Lieferungen dieser Krawatte circa innerhalb des ganzen letzten Jahres erstellen werde. Williams fragte jetzt um die Erlaubnis, dem Manager die Krawatte auszuhändigen.