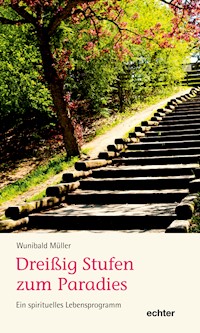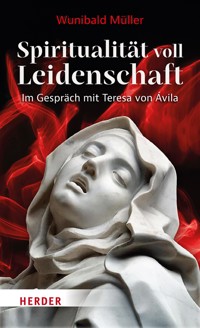14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wunibald Müller hat sich sein Leben lang persönlich und beruflich mit Gott und der Kirche auseinandergesetzt. Das verlangte von ihm, Stellung zu beziehen, sich zu Wort zu melden, auch auf die Gefahr hin, damit anzuecken und in Ungnade zu fallen. Mit diesem sehr persönlichen Buch legt er kritisch Rechenschaft darüber ab, warum er trotz aller Krtik an der Kirche in ihr bleibt und was sie ihm bedeutet. Dabei wird er es aber nicht belassen. Er entfaltet seine klare Vision von Kirche, wohlwissend dass es sich dabei nur um einen ganz persönlichen, vorläufigen und unvollkommenen Versuch handelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über den Autor:
Wunibald Müller hat sich sein Leben lang mit Gott und der Kirche auseinandergesetzt. Das verlangte von ihm, Stellung zu beziehen, auch auf die Gefahr hin, damit anzuecken und in Ungnade zu fallen. Mit diesem sehr persönlichen Buch legt er kritisch Rechenschaft darüber ab, warum er trotz aller Kritik in der Kirche bleibt.
Dr. Wunibald Müller, geb. 1950, ist Theologe, Psychologe und Psychotherapeut. Der Leiter des Recollectio-Hauses der Abtei Münsterschwarzach ist Autor zahlreicher Bücher zu Themen der Spiritualität, Lebenshilfe und Psychologie.
Über das Buch:
»Bezogen auf Gott gibt es bei mir eine innere Gewissheit, dass es ihn gibt, Kräfte in unsere Welt und in mein Leben einwirken, die unser und mein bewusstes Tun und Können überschreiten. Mit der Kirche ist das anders. Es hat eine Weile gedauert, bis ich Gott und Kirche auseinanderhalten konnte. Das war und ist für meine Gottesbeziehung von großer Bedeutung. Welche Bedeutung die Kirche für mich heute hat und ob sie heute und in Zukunft meine Kirche sein kann oder sein wird, hängt vor allem davon ab, inwieweit das mit meinem Glauben an Gott in Einklang zu bringen ist.«
Wunibald Müller
Warum ich dennoch in der Kirche bleibe
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Verlagsgruppe Random House weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.Copyright © 2016 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Weiss Werkstatt, München
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-19988-3V001
www.koesel.de
Inhalt
Prolog
Das Wasser des Lebens
Vorwort
Behütet und Aufbruch
Kindheit, Internat, Schule
Studienjahre in Freiburg und Jerusalem
Studienjahre in Würzburg und Berkeley
Die Herausforderung
Die Freiburger Zeit
Konflikte mit Rom
Klerikalismus
Im Dienst der Kirche
Das Recollectiohaus
Der Missbrauchsskandal
Sexualität und Kirche
Homosexualität und Kirche
Zölibat
Meine Vision von Kirche
Eine Kirche, die das Herz der Menschen erwärmt
Eine Kirche, der es zuerst um Gott geht
Ausblick
Angekommen sein
Literatur
Wer die Kirche liebt,
muss auch bereit sein,
an der Kirche,
mit der Kirche
und durch die Kirche zu leiden.
Bernhard Häring CSSR
Prolog
Das Wasser des Lebens
Das Wasser des Lebens, beseelt von dem Wunsch, sich auf der Erde zu zeigen, sprudelte unablässig und ohne Anstrengung aus einem natürlichen Brunnen. Die Menschen kamen von überall her, um von dem magischen Wasser zu trinken, und spürten, dass es sie nährte, da das Wasser so klar, so rein und belebend war. Doch die Menschen waren nicht zufrieden damit, die Dinge in ihrem paradiesischen Zustand zu belassen. Mit der Zeit fingen sie an, einen Zaun um den Brunnen zu bauen, Eintrittsgeld zu verlangen, Besitzansprüche auf das Grundstück zu erheben. Sie schufen Vorschriften, wer Zutritt zum Brunnen hat und wer nicht, und brachten Schlösser an den Zugangstoren an. Sehr bald war der Brunnen im Besitz der Mächtigen und der Elite.
Das Wasser ärgerte sich darüber und empfand das als eine Beleidigung. Es hörte auf zu fließen und begann, an einem anderen Ort zu sprudeln. Die Leute, die das Grundstück rund um den ersten Brunnen besaßen, waren so beschäftigt mit ihren Machtsystemen und Besitzansprüchen, dass sie gar nicht mitbekamen, dass das Wasser aufgehört hatte zu fließen. Sie fuhren fort, das nicht mehr vorhandene Wasser zu verkaufen, und nur wenige merkten, dass die ursprüngliche Kraft des Wassers verloren gegangen war. Aber einige Unzufriedene machten sich mit großem Mut auf die Suche nach dem neuen Brunnen.
Die gute Botschaft ist: Das Wasser fließt weiter. Wenn ich diese Geschichte auf die katholische Kirche übertrage, stimmt mich das sehr nachdenklich. Die Menschen sehnen sich nach dem lebendigen Wasser, sie sehnen sich nach spiritueller Nahrung, die sie wirklich nährt. Doch finden sie dieses lebenspendende Wasser nicht an den Plätzen, die für sich in Anspruch nehmen, der Ort zu sein, an dem es fließt.
Ich finde es wichtig, dass die katholische Kirche nicht länger mit großer Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass sie das lebendige Wasser anbietet, das den spirituellen Durst der Menschen zu stillen vermag. Nicht, dass ich an der Anwesenheit Gottes in unserer Welt zweifle. Nein! Das tue ich nicht. Gerade, weil ich nicht daran zweifle, ist es für mich wichtig, dass die Kirche der Ort ist, an dem die Menschen das lebendige Wasser, nach dem sie sich sehnen, finden, und ich kann es durchaus verstehen, dass sie es anderswo suchen, wenn sie es dort nicht finden oder ihnen der Zugang zu diesem Wasser verwehrt wird.
Ab und zu ergeht es mir hier wie dem Trappisten Thomas Merton, der in einem Brief an die Theologin Rosemary Radford Ruether (in: Tardiff 1995,17) schreibt: »Ich frage mich manchmal, ob die Kirche echt ist. Ich glaube es, wie du weißt. Aber manchmal frage ich mich, ob ich verrückt bin, das zu glauben. Bin ich Teil eines großen Schwindels? Ich drücke mich vielleicht nicht so gut aus, wie ich möchte: Ich spüre echtes Vertrauen in die Tatsache, dass Christus in der Welt präsent ist, und daran zweifle ich keinen Augenblick. Aber ist diese Präsenz dort, wo wir es von ihr behaupten? Wir zeigen alle irgendwo hin, aber mein Verdacht ist, dass wir in die falsche Richtung zeigen.«
Mir helfen Menschen wie Thomas Merton oder Bruder David Steindl-Rast, die meinen Blick für das Wesentliche schärfen, ohne, so hoffe ich, dabei den Blick zu trüben für das, was nicht gut ist an der Kirche, was es zu beanstanden oder auch abzulehnen gibt. Bruder David Steindl-Rast vergleicht die Tradition der Kirche mit einer rostigen Wasserleitung. Würden wir die unterirdischen Wasserleitungen, über die wir unser Trinkwasser bekommen, sehen, würden wir, so meint er, nie wieder Wasser trinken. Doch auch wenn sie verrostet sind, bringen sie reines Wasser. Dieses reine Wasser aber ist die frohe Botschaft, die am Anfang steht, die lebendig wie eine Fontäne klaren Wassers empor springt (vgl. Anselm Grün/David Steindl-Rast 2015, 81).
Vorwort
Vor einiger Zeit hatte ich eine heftige Diskussion mit unseren Kindern, bei der es um die katholische Kirche ging und warum ich in der katholischen Kirche bleibe. Es war eine harte Diskussion, bei der unsere Kinder nichts ausließen, was gegen die katholische Kirche und die Zugehörigkeit zu ihr spricht. Ich konnte die Kritik unserer Kinder an der Kirche gut hören, kannte die von ihnen genannten Argumente aus anderen Diskussionen, und doch war es anders als sonst, wenn ich mit diesen Fragen konfrontiert wurde. Die Diskussion beschäftigte mich noch lange und machte mich auch traurig.
Unsere Kinder versuchten, mich zu verstehen, sie respektieren meine Haltung. Aber, so mein Eindruck, es gelang mir nicht, ihnen wirklich zu vermitteln, was mir meine Kirche bedeutet und warum ich sie nicht verlassen kann oder nicht verlassen will. Dazu kam sicher auch, wenn ich ehrlich bin, meine Betroffenheit darüber, wie viel Distanz, ja Ablehnung ich bei ihnen gegenüber dem feststellen musste, was mir immer noch viel bedeutet. Dazu kam, dass ich mir die Frage stellte, wie sehr ich tatsächlich bereit bin, mich ernsthaft und radikal damit auseinanderzusetzen, ob die katholische Kirche tatsächlich immer noch meine Kirche ist und ob ich es vor mir selbst verantworten kann, mich weiterhin zu ihr zu bekennen.
Ich habe mich ein Leben lang mit Gott auseinandergesetzt. Auch heute tue ich das. Bezogen auf Gott gibt es bei mir eine innere Gewissheit, dass es Gott gibt, Kräfte in unsere Welt und in mein Leben einwirken, die unser und mein bewusstes Tun und Können überschreiten. Mit der Kirche ist das anders. Es hat eine Weile gedauert, bis ich Gott und Kirche auseinanderhalten konnte. Das war und ist für meine Gottesbeziehung von großer Bedeutung. Welche Bedeutung die Kirche für mich heute hat und ob sie heute und in Zukunft meine Kirche sein kann oder sein wird, hängt vor allem davon ab, inwieweit das mit meinem Glauben an Gott in Einklang zu bringen ist.
So will ich, zusätzlich dazu motiviert durch die Diskussion mit unseren Kindern am Ende meiner beruflichen Tätigkeit im kirchlichen Dienst, der Frage nachgehen, was mich in der katholischen Kirche bleiben lässt. Ich will es mir selbst erklären, meinen Kindern verständlicher machen, aber auch so manchen, die mich mit dieser Fragestellung konfrontieren, zumindest zu erklären versuchen. Dabei werde ich auf meine eher äußeren Erfahrungen mit der katholischen Kirche, der sogenannten offiziellen Kirche, dann aber auch auf meine mehr inneren Erfahrungen mit Kirche eingehen.
Nicht zuletzt durch den kirchlichen Dienst, zunächst in der Erzdiözese Freiburg, später – über 25 Jahre – als Leiter des Recollectiohauses der Benediktinerabtei Münsterschwarzach, habe ich Einblicke in die katholische Kirche gewonnen, die einzigartig schön und zugleich furchtbar erschreckend waren. Sie haben natürlich in die eine und in die andere Richtung entsprechende Auswirkungen auf mein Bild von Kirche, aber auch mein Verhältnis zur katholischen Kirche gehabt.
Dazu kommt: Ich habe mich schon sehr bald nicht nur als irgendein Mitglied meiner Kirche verstanden, sondern als einer, der es als seine Aufgabe sieht, mit dazu beizutragen, dass diese Kirche die Kirche ist, die ich meine Kirche nennen kann. Das aber verlangte von mir, Stellung zu beziehen, mich zu Wort zu melden, auch auf die Gefahr hin, damit anzuecken und in Ungnade zu fallen. Das gilt für mich bis heute und hat sicher dazu beigetragen, dass ich noch in der Kirche bin, während viele andere, unter ihnen Menschen, die mir viel bedeuten, ihr längst den Rücken zugekehrt haben.
Ich will mir mit diesem Buch selbst Rechenschaft darüber ablegen, warum ich in der Kirche bleibe, und dabei natürlich auch aufzeigen, was sie mir bedeutet. Ich will es dabei aber nicht belassen. So werde ich auch meine Vision von Kirche entfalten, wohlwissend, dass es sich dabei nur um einen ganz persönlichen, vorläufigen, unvollkommenen Versuch handelt, das zu beschreiben, was ich mir unter Kirche vorstelle und wo sie den Menschen von heute, uns, dienen, vor allem aber mit dazu beitragen kann, dass Gott, der die Liebe ist, konkret erfahrbar und fühlbar ist.
Ich schreibe dieses Buch am Ende meiner Tätigkeit im kirchlichen Dienst. Ich habe bewusst so lange damit gewartet. Ich habe mich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zu Wort gemeldet, auf kirchliche Missstände aufmerksam gemacht, mich für Randgruppen, wie schwule Männer und lesbische Frauen, eingesetzt oder auf die Nöte zölibatär lebender Priester hingewiesen. Das erwuchs aus meinem Verständnis von Kirche und der Aufgabe, die sich daraus für mich ergab. Mir war es wichtig, bei meiner Kritik durchscheinen zu lassen, dass es mir um meine Kirche geht, die ich – früher hätte ich das ohne darüber nachzudenken gesagt – liebe, die mir jedenfalls, immer noch, viel bedeutet. Auch war mir in allen diesen Jahren wichtig, der Kirche und später natürlich auch der Abtei Münsterschwarzach gegenüber loyal zu sein, wusste ich doch aus eigener Erfahrung, dass Rom, wenn ich mich kritisch äußere, auf den zuständigen Bischof Druck ausübt, der dann den Druck an die entsprechenden Verantwortlichen, sprich Abtei beziehungsweise deren Abt, weitergibt, mich zu maßregeln. Das hielt mich nicht davon ab, Kritik zu üben, führte aber auch dazu, dass ich manches vorsichtiger formulierte, als ich es hätte formulieren können oder manchmal auch müssen.
Diese Zurückhaltung will ich und muss ich mir nicht länger auferlegen. Dazu kommt, dass mit Papst Franziskus die Atmosphäre der Angst, die unter Johannes Paul II. und Benedikt XVI. in der Kirche vorherrschte, einer Atmosphäre gewichen ist, in der es weit mehr als früher möglich ist zu sagen und zu schreiben, was man denkt und für richtig erachtet, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen, sollten diese Überlegungen oder Überzeugungen angeblich nicht in Einklang zu bringen sein mit der Lehre der Kirche. Dennoch macht man sich, so denke ich, etwas vor, wenn man glaubt, dass die alten Mechanismen, das alte Denken, aber auch die so lange vorherrschende Angst in der Kirche, damit ausgemerzt oder vertrieben worden sind. Sie haben die Kirche noch nicht verlassen.
Ich will und werde jedenfalls in aller Freiheit über meine Erfahrungen mit der Kirche berichten. Ich bin selbst gespannt darauf, was mir dadurch deutlicher wird. Vor allem aber hoffe ich, damit meinen Kindern und manch anderen verständlicher zu machen, warum ich dennoch in der Kirche bleibe, was mir die Kirche bedeutet, was ich ihr verdanke, was mich, so vermute ich, bis zu meinem Lebensende an ihr festhalten lässt.
Ich widme dieses Buch unseren Kindern Dorothea und Thomas Morus.
Herrn Uwe Globisch vom Kösel-Verlag danke ich für die unkomplizierte und ermutigende Begleitung.
Wunibald Müller
Behütet und Aufbruch
Kindheit, Internat, Schule
Möglichst kirchenkonform leben
Die Kirche meiner Kindheit war die vorkonziliare Kirche, die in allen Bereichen meines Lebens sich bemerkbar machte und großen Einfluss auf mich ausübte. Wir wollten eine gut katholische Familie sein. Das zeigte sich natürlich zunächst darin, dass wir selbstverständlich jeden Sonntag in den Gottesdienst gingen und zum Leidwesen von uns Kindern auch in die damals noch übliche Nachmittagsandacht gehen mussten, die für uns einfach nur langweilig war. Die Geisteshaltung meines Vaters, die meine Mutter mittrug, kommt in einem Brief zum Ausdruck, den er an den von ihm sehr geschätzten, ja, verehrten Pater Wunibald Kellner, Benediktiner in der Abtei Münsterschwarzach, nach dem ich auch meinen Namen erhielt, im Dezember 1950 schrieb:
Zunächst darf ich Ihnen mitteilen, dass unsere beiden Kinder Maria und Benedikt bereits schon am 21. September 1950 von unserem Herrgott ein Brüderchen bekamen. Wir haben ihm in der hl. Taufe den Namen Wunibald gegeben. Im Stillen hatten wir ja auf ein Schwesterchen, eine Scholastika, gehofft, aber wir haben uns trotzdem über alle Maßen über unseren kleinen Wunibald gefreut. Er ist ein gesundes, munteres Bürschchen. Hoffentlich ist es uns vergönnt, ein echt christliches Familienleben aufzubauen und weiterzuführen. Leider geben die schweren dunklen Wolken am politischen Himmel Anlass zu ernsthaften Bedenken in dieser Hinsicht. Doch wir wollen mit festem Gottvertrauen weitermachen!
In Pfarrer Joseph Schmitt, Stadtpfarrer, wie wir ihn nannten, der selbstbewussten Kreisstadt Buchen im Odenwald, erlebte ich einen Priester, der treu seinen Dienst tat. Da gab es nichts Auffälliges an ihm. Er war korrekt, fast würde ich sagen neutral, eben ein treuer Diener seiner Kirche, an deren Weisungen er sich, so zumindest der äußere Eindruck, uneingeschränkt hielt. Zu dieser Zeit – wir befinden uns in den Fünfzigerjahren – war das auch kein Problem. Auch nicht für mich. Dazu kam, dass mein Vater sehr kirchenhörig war und ihm zumindest in dieser Zeit viel daran gelegen war, kirchenkonform zu leben. Das ging so weit, dass ich einmal den damaligen Kaplan fragen musste, ob ich in den Film Ben Hur gehen dürfe, obwohl ich noch keine 12 Jahre alt war, was dieser ablehnte. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, dass an einem Spätnachmittag, als ich wohl von einer Ministrantenrunde nach Hause kam, mein Vater weinend vor dem Radiogerät in der Küche saß und mir traurig mitteilte, dass gerade die Nachricht gemeldet wurde, Papst Pius XII. sei gestorben.
Die Erfahrung des Heiligen
Sehr positiv habe ich den Augenblick in Erinnerung, als ich das erste Mal zur heiligen Kommunion gegangen bin. Ich sehe mich heute noch, wie ich voller Erwartung in der damals noch nicht umgebauten Buchener Stadtpfarrkirche die Treppe zum Hochaltar hochging und dann den Leib Christi empfing. Das war für mich ein überwältigender Moment, bei dem ich, so würde ich es heute ausdrücken, eine Ahnung von dem erleben durfte, was mit der Erfahrung des tremendum et fascinosum, der Erfahrung des Heiligen, am ehesten beschrieben werden könnte.
Wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, dann zählt dieser Moment mit zu den tiefsten Erfahrungen, die ich zunächst einmal mit Kirche verbinde, die aber, wenn ich genauer hinschaue, eine Erfahrung ist, die über Kirche oder meine Zugehörigkeit zur Kirche weit hinausgeht. In diesem Augenblick war ich zutiefst berührt und erfüllt von dem Bewusstsein, dass Jesus, und damit Gott, bei mir einkehrt. Ich könnte diese Erfahrung analytisch auseinandernehmen, sie mir psychologisch als Ergebnis der entsprechenden Hinführung zur ersten heiligen Kommunion im Rahmen des Kommunionunterrichtes erklären und so weiter und so fort. Ich habe das aber nicht getan und werde es auch in Zukunft nicht tun.
Mein Herz geben
Meine Mutter war eine tiefreligiöse Frau. In ihrem Nachlass entdeckte ich ein Büchlein von ihr, dem sie offensichtlich ab und zu ihre innigsten Gedanken anvertraute. Es berührte mich sehr, darin zu lesen, welch eine innige Beziehung sie zu Jesus pflegte, zu dem sie wie zu einem Freund redete. Sie hatte sicher nie etwas von Teresa von Avila gelesen, die das Beten vergleicht mit einem Gespräch mit unserem Freund Jesus. Genau diese Art von Beten pflegte sie. Sie hatte aber auch ein inniges Verhältnis zu Maria. Oft bin ich mit ihr, vor allem im Mai, in die Lourdeskapelle in Buchen gegangen, um dort mit ihr mit Inbrunst Marienlieder zu singen. Weiter war sie eine große Verehrerin der heiligen Rita. Ihr Rita-Büchlein halte ich hoch in Ehren. Wenn ich jetzt am Sonntag mit meiner Frau in die Augustinerkirche in Würzburg gehe, in der die heilige Rita besonders verehrt wird, und am Ende des Gottesdienstes auf die Rita-Andachten hingewiesen wird, verbinde ich das mit meiner Mutter und mich mit ihr.
Auch wenn ich selbst kein besonderes Verhältnis zur Marienverehrung habe, kann ich auch heute noch aus tiefster Seele Marienlieder singen und das, was dabei bei mir und in mir an Sehnsucht, an Ergriffenheit, ausgelöst wird, einfach zulassen. Glauben heißt auf Lateinisch credere, in dem die Worte cor und dare enthalten sind, also das Herz geben. Glauben meint also mein Herz geben. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Ich habe es daher noch nie gemocht, wenn manche glauben, sich über die einfachen gläubigen Menschen abfällig äußern zu müssen, habe ich doch so viele Male erlebt, wie dieses Glauben, bei dem ich mein Herz gebe, Menschen in schwierigsten Lebenssituationen Mut und Kraft verliehen hat.
Der kleine Benediktiner
War der Einfluss von Kirche bis zu meinem 12. Lebensjahr schon sehr stark in meinem Leben, so verstärkte er sich noch durch die Entscheidung, auf das Gymnasium zu gehen, allerdings nicht in das Gymnasium, das sich gegenüber unserem Haus in der Schüttstraße in Buchen befand, sondern in das der Benediktiner von Münsterschwarzach. Das aber brachte es mit sich, dass ich von nun an im Internat leben würde. Zu dieser Zeit verbrachte man die ersten Schuljahre in einem Priorat der Abtei, dem Kloster St. Ludwig, das keine 20 km entfernt von der Abtei am Main gegenüber dem Winzerort Wipfeld gelegen war.
In ein Internat eines Ordens zu gehen, war damals vergleichbar mit einem Ordenseintritt. Der Tagesablauf orientierte sich am klösterlichen Rhythmus, der von Gebet und Arbeit bestimmt war. Der Tag begann um 6.00 Uhr mit der Statio, bei der wir uns, wie das für die Mönche üblich ist, vor der Kapelle aufstellen mussten, um dann gemeinsam zum Gottesdienst in die Kapelle einzuziehen. Danach, noch vor dem Frühstück, war eine kurze Studienzeit anberaumt. Erst beim anschließenden Frühstück war die Zeit des Schweigens aufgehoben. Nach dem Frühstück begann die Schule, danach war das Mittagessen, nach dem Mittagessen fand eine kurze Dankandacht in der Kapelle statt. Am Nachmittag gingen wir jeden Tag unter Leitung des Präfekten spazieren, danach stand die Arbeitszeit an. Wir wurden den verschiedenen Betrieben des Klosters zugeordnet, um dort für eine Stunde mitzuarbeiten oder Arbeiten auf dem Gelände des Klosters zu verrichten. Dieser Zeit schloss sich eine fast dreistündige Studienzeit an, die wir im Studiensaal – wobei wieder Stillschweigen vorgeschrieben war – verbrachten, unterbrochen von einer halbstündigen Pause. Danach gab es Abendessen, gefolgt von der Rekreationszeit, und schließlich der Abschluss des Tages, natürlich wieder in der Kapelle mit dem gemeinsamen Abendgebet. Der Tag war zu Ende, schweigend gingen wir zum Schlafzimmer, das ich mit 40 anderen Schülern teilte.
In diese Zeit meines Aufenthaltes in St. Ludwig fiel die Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Anlässlich der Eröffnungsfeier war eigens ein Fernseher angeschafft worden, sodass wir in der Turnhalle die Eröffnungszeremonie verfolgen konnten. In einer feierlichen Prozession, als seien wir selbst Konzilsteilnehmer – Billy, der die entsprechende Figur hatte, machte den Papst Johannes XXIII. –, zogen wir in die Turnhalle ein.
Doch es dauerte einige Jahre, bis der Geist des Konzils sich in der Kirche bemerkbar machte, vor allem aber mich selbst, mein Herz, erreichte und schließlich mein Denken und dann auch mein Verhältnis zur Kirche beeinflusste. Ich durchlebte zuvor eine seelisch sehr schwere Zeit, deren Ursache ich bis heute noch nicht ganz durchschaut habe. Irgendwann, sicher auch als Reaktion auf den Verlust der elterlichen Geborgenheit, entwickelte ich eine Lebenseinstellung, die ihren wesentlichen Sinn darin sah, sich für andere Menschen aufopfern zu müssen. Ich fastete, deckte mich in der Nacht bewusst auf, um zu frieren, wollte es wohl so manchen Heiligen, die ich mir zum Vorbild genommen hatte, gleichtun.
Irgendwann kam ich aus dieser Haltung heraus, und doch, so glaube ich, haben diese Erfahrungen tief in mir etwas bewirkt. Ist es eine besondere Sensibilität für Leid, die sich daraus entwickelte, ein besonderes Spüren dafür, wenn es anderen nicht gut geht? Ich bin später wiederholt Situationen begegnet, bei denen ich spürte, da ist jemand ganz am Ende, ja, suizidal, und dann erfuhr ich im Nachhinein, dass die Person aus dem Leben geschieden ist. Oder als Student stellte ich fest, dass Kommilitonen, die Probleme hatten, auffällig häufig sich an mich wandten. Irgendwie muss ich etwas ausgestrahlt haben, dass sie dachten, der versteht mich.
Ich erwähne das, weil diese Erfahrungen, so vermute ich, auch eine Rolle spielen, wenn es um meine Erfahrungen mit der Kirche und letztlich natürlich mit Gott geht. Dabei geht es vor allem auch um den Beruf, den ich zunächst anstrebte, und um den, den ich dann tatsächlich ergriff, und dabei auch um meine Berufung, wenn ich diesen großen Begriff zunächst einmal etwas ungeschützt gebrauchen möchte.
Eigentlich sollte ich Benediktiner werden. So hatte es sich jedenfalls mein Vater gewünscht. In einem Brief an den bereits erwähnten Pater Wunibald Kellner spricht mein Vater deutlich von diesem Wunsch, den ich bei ihm wohl auch so spürte. Da ich meinem Vater gefallen wollte, tat ich natürlich alles, um seinen Wunsch zu erfüllen. Eigentlich hatte mein Vater vor dem Krieg überlegt, bei den Benediktinern in Münsterschwarzach einzutreten. Da daraus aber nichts geworden war, sollte das jetzt wohl durch meinen älteren Bruder Benedikt, der mit mir im Internat war, und mich »nachgeholt« werden.
In einem Brief an Pater Wunibald aus dem Jahre 1963 schreibt mein Vater anlässlich des 25. Jahrestages der Wiederbesiedelung der Abtei:
Überaus groß ist meine Freude, dass zwei meiner Buben heute im dortigen Seminar sein dürfen, darunter einer, der Ihren Namen trägt. Man kann es sicherlich nicht wägen und messen, was die Begegnung mit Münsterschwarzach und mit den Mönchen des hl. Benedikt für mich im bisherigen Leben bedeutet hat. Immer habe ich jedenfalls versucht, benediktinischen Geist in meiner Familie zu wecken und zu erhalten.
Aufbruch
Bereits 1961 hatte mein Vater Pater Wunibald geschrieben, wie viel ihm daran gelegen ist, seine drei Buben »dem Herrgott zu schenken«, wie er es formuliert. Es steigen ganz unterschiedliche Gefühle in mir auf, wenn ich in seinem Brief lese:
Unser Wunibald und unser Burkard (mein jüngerer Bruder) wollen auch nach St. Ludwig … Wenn man immer wieder hört, wie groß die Not und der Mangel an Missionaren in den Missionsländern ist, möchten wir als Eltern hoffen, dass alle drei Missionare werden. Wir wollen gerne unsere Buben dem Herrgott schenken, wenn er dieses Geschenk von uns annimmt.
Der Herrgott hat dieses Geschenk jedenfalls nicht angenommen, weil er natürlich bei aller Würdigung der Interessen meines Vaters zuerst mich und meine Brüder in den Blick genommen und sich überlegt hat, was er mit uns vorhat. Das war aber etwas anderes als das, was sich der Vater gewünscht hatte. Mein Bruder Benedikt ist Psychiater geworden, hat geheiratet und hat mit seiner Frau Birthe drei Kinder. Mein Bruder Burkard ist heute bei einer Versicherung angestellt, mit Hanne verheiratet und hat drei Kinder. Meine Schwester Maria, die Älteste von uns Kindern, die an einem Marienfest zur Welt gekommen ist, sonst hätte sie den Namen Scholastika bekommen, ist Krankenschwester geworden, hat geheiratet und mit ihrem Mann Norbert ebenfalls drei Kinder.
Ich bin nicht bei den Benediktinern in Münsterschwarzach eingetreten. Nach St. Ludwig ging es zunächst nach Münsterschwarzach, von dort aus dann nach Würzburg ins Internat St. Benedikt und auf das dortige Riemenschneider-Gymnasium. Ich unterbrach nach der Mittleren Reife die Schulzeit und war für eine kurze Zeit Postulant bei den Missionsbrüdern des heiligen Franziskus in Bug bei Bamberg, mit dem Ziel, als Missionar nach Paraguay zu gehen. Der Wunsch des Vaters wirkte nach. Doch sehr schnell spürte ich, dass das nicht mein Weg ist. Ich traf die Entscheidung, wieder auf die Schule zu gehen und zwar in die Spätberufenenschule der Karmeliten in Bamberg.
Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich blühte dort regelrecht auf. Das verdanke ich vor allem auch Lehrern wie Gerdi und Erwin Zehentmeier. Es war, wie wenn ein Knoten in mir geplatzt wäre und ich jetzt endlich alle meine Kreativität zulassen und entfalten konnte. Ich wurde Klassensprecher und Schulsprecher und entdeckte endlich auch die Welt außerhalb der Kirche. Zu dieser Zeit hatte mein einst sehr heiles Bild von Kirche schon einige Kratzer bekommen. Zuvor war ich noch ganz kirchenfixiert gewesen, sammelte Papstbilder, während andere in meinem Alter sich für Schauspieler interessierten oder die Bravo lasen.
Ein erstes Umdenken bewirkte bei mir die Lektüre von Heinrich Bölls Ansichten eines Clowns. Da äußerte sich jemand zur katholischen Kirche auf eine Weise, die für mich neu war. Ich hätte mich ja auch darüber empören können, wie frech und respektlos da jemand über die Kirche schrieb. Aber das war nicht der Fall. Ich wurde kritischer. Das hatte sicher auch mit der Person Heinrich Bölls zu tun, der mir als der gute Mensch erschien, weil er in dem, was er schrieb, eine Haltung an den Tag legte, die von einem Grundwohlwollen gegenüber den Menschen geprägt war, die mir zutiefst entsprach. Später erging es mir ähnlich auch bei Graham Green, dessen Katholizismus, seine Offenheit für das Geheimnisvolle, seine Sensibilität für das Schuldhafte, sein Überwinden des Schwarz-Weiß-Denkens mich ansprachen. Für meine spätere Arbeit als Psychotherapeut, vor allem auch für Priester und kirchliche Mitarbeiter, hat mir das sehr geholfen, auch, so hoffe ich, ohne etwas zu beschönigen, um selbst im niedrigsten Priester eine Art Heiligkeit zu entdecken, die mit der Schmach einhergeht, wie es in dem Roman Die Tochter Sions von Josef Vital Kopp heißt.
Der Priester in mir
Ich bin nicht Priester geworden und dennoch würde ich von mir sagen, dass ich eine starke priesterliche Seite habe. Damit meine ich, dass es, unabhängig davon, ob jemand Priester oder Priesterin einer bestimmten Kirche ist, ein inneres Priestertum gibt. Da bin ich jemand, zu dem es wesentlich gehört, sich dem Heiligen zu geben, im Dienst des Heiligen zu stehen. Das meint ja auch das lateinische Wort für Priester, nämlich sacerdos, das aus den Worten sacer, also heilig, und dare, was mit geben übersetzt werden kann, besteht. Es ist jemand, der für das Heilige, die Welt des Religiösen sensibel ist. Das trifft jedenfalls auf mich zu. Ich habe diese Offenheit und Sensibilität bei vielen Männern und Frauen festgestellt, die nicht Priester oder Pastorin sind, während ich sie bei manchen amtlich bestellten und kirchlich geweihten Priestern schmerzlich vermisste.
Ich kann meine priesterliche Seite sehr gut in meinem Beruf als Psychotherapeut leben, aber auch darüber hinaus, etwa wie ich durchs Leben gehe, wie ich Menschen begegne, wie ich meine Beziehung zu Gott pflege. Ich glaube, ich kann es, was mich betrifft, so sogar besser leben als in der Gestalt des offiziellen Priesters der katholischen Kirche. Dieser Rahmen wäre mir zu eng, ganz abgesehen davon, dass die Abhängigkeit von einem Bischof, dessen mögliche Einseitigkeit mich zusätzlich in Loyalitätskonflikte bringen würde, für mich zu einer großen Herausforderung werden würde.
Ein Generalvikar äußerte einmal, dass er seine Priester nicht ins Recollectiohaus schicken würde, weil das Priesterbild, das wir dort vertreten würden, nicht seinen Vorstellungen entspräche. Wir haben aber im Recollectiohaus nicht irgendein bestimmtes Priesterbild, das wir forcieren würden. Im Recollectiohaus sollen Priester, unabhängig davon, welches Bild sie als Priester von sich haben, die Chance bekommen, an dem zu arbeiten, was sie – auch als Priester – weiterbringt. Wichtig ist, dass sie sich in ihrer »Rolle« wohlfühlen, sie sich als stimmig erleben, sie natürlich auch sensibel dafür sind oder werden, wie ihr Verhalten auf die anderen wirkt, und ob ihr Dasein und Wirken ihnen selbst und denen, für die sie da sind, zum Segen gereicht.
Das ist das eine. Auf der anderen Seite habe ich persönlich ein Priesterbild, das dem des besagten Generalvikars vermutlich nicht entspricht. In seiner Diözese wird vom Priester an erster Stelle erwartet, dass er der konservativen Linie des Bischofs uneingeschränkt Folge leistet. Es ist das klerikale Priesterbild, das hier vorherrscht, also der Kleriker sich wesentlich vom Laien unterscheidet, vor allem aber der Bischof wie ein König regieren darf, alle um ihn herum ihm zu Diensten sein müssen. Wehe, es wagt einer, sich dem zu widersetzen! Er wird sofort zur Ordnung gerufen.
Als ich im Zusammenhang mit der Missbrauchsaffäre den Bischof dieser Diözese wegen seines Umgangs mit einem Priester, der einen Minderjährigen missbraucht hatte, öffentlich kritisierte, rief mich der Generalvikar an, um mich mit Vorwürfen zu überschütten. Ich wies ihn in seine Schranken und erneuerte ihm gegenüber meine Kritik am Bischof, der, so mein Eindruck, das Gespräch mit verfolgte, da mir von seinem Sekretär zunächst mitgeteilt worden war, der Bischof wolle mich sprechen. Bewusster Bischof fand es übrigens nicht für angebracht, bei einem Besuch in einem Gefängnis, in dem er zu einer offiziellen Feier eingeladen worden war, seinen priesterlichen Mitbruder zu besuchen, der dort wegen eines Missbrauchsvergehens einsaß. Damit wollte er nichts zu tun haben.
Ich erwähne das, weil es für mich ein Beispiel dafür ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, einem Bischof, der sich einfach nicht korrekt verhält, nur weil er der Bischof ist, nicht zu widersprechen, weil sich das angeblich nicht gehört und von dem betroffenen Bischof oft dann auch noch als Majestätsbeleidigung betrachtet wird. Eine Majestätsbeleidigung muss man aber nicht ernst nehmen, sondern ahnden, indem man den Beleidiger abstraft. Leider war es und ist es zum Teil auch heute noch so, dass die Umgebung eines Bischofs sich nicht getraut, den Bischof, der sich danebenbenimmt oder sich Dinge herausnimmt, die ihm nicht zustehen, damit zu konfrontieren. Wozu eine solche Zurückhaltung führen kann, haben die Ereignisse um Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst in Limburg gezeigt. Dessen zum Teil sehr eigenartigen Verhaltensweisen waren ja nicht erst mit der kostspieligen Bischofs-Wohnung zutage getreten. Wer wirklich hinhörte, was die kirchlichen Mitarbeiter über ihn berichteten, konnte nur den Kopf schütteln. Doch niemand in seiner Umgebung, auch nicht seine bischöflichen Mitbrüder, hatte den Mut, ihm zu widersprechen, da er als Bischof anscheinend sakrosankt ist.
Ich denke an einen anderen Bischof, der seinen Hut nehmen musste, von dem seine Umgebung lange Kenntnis davon hatte, dass er sich schon am Vormittag einen Cognac gönnte. Niemand getraute sich, ihn damit zu konfrontieren. Einen Vorgesetzten mit seinen Alkoholproblemen zu konfrontieren, ist an sich schon äußerst schwierig und heikel, dies gar bei einem Bischof zu tun, nahezu unmöglich. Es dauerte lange, bis endlich die verantwortlichen bischöflichen Mitbrüder die notwendigen Schritte unternahmen und den Papst überzeugen konnten, dass der Bischof nicht länger tragbar war.
Studienjahre in Freiburg und Jerusalem
Meine Liebe zum Alten Testament und den biblischen Stätten
Mit dem Abitur im Jahre 1972 ließ ich die Schulzeit hinter mir – ich war inzwischen 21 Jahre alt – und begann an der Universität Freiburg mit dem Theologiestudium. Für das Studium der Psychologie hatte ich mich zu spät beworben, sodass ich erst ein Jahr später, dann aber schon in Würzburg, zusätzlich zur Theologie auch Psychologie studieren konnte.
Aus der Freiburger Zeit ist mir vor allem der Alttestamentler Alfons Deissler in guter Erinnerung. Damals hörte ich seine Einführung in das Alte Testament. Später, als ich in Freiburg tätig war, erlebte ich ihn öfters im Rahmen von Veranstaltungen der Priesterfortbildung, für die ich verantwortlich war. Alfons Deissler gehört für mich zu den Alttestamentlern, zu denen ich auch Erich Zenger, Notker Füglister und Ernst Haag zähle, die für mich durch ihre Person das Alte Testament verkörperten. Meine Liebe zum Alten Testament verdanke ich auch ihnen. Wer einmal erlebt hat, wie innigst Alfons Deissler von Hosea und Amos gesprochen hat, für den werden diese Propheten lebendig, ja, der lässt sich ergreifen von dem Propheten Hosea (6,6 und 11,8), wenn er Gott sprechen lässt: »Ich habe Lust an der Liebe und nicht an Opfern«, oder: »Mein Herz ist anderen Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt.«
Meine Liebe zum Alten Testament oder, wie man heute oft auch sagt, Ersten Testament hat sich bis heute erhalten. Dazu trug auch mein Studienaufenthalt von 1974 bis 1975 in Jerusalem bei. Die Texte des Alten Testamentes wurden dort zu Fleisch. Das traf auch auf viele Texte des Neuen Testamentes zu. Neben der Landschaft waren es auch hier vor allem Personen, die mir einen tieferen Zugang zu den Inhalten der Bibel verschafften. Ich denke an Pater Elpidius Pax und Pater Bargil Pixner, die mich dafür sensibel machten, dass es, wie ein Buch von Bargil Pixner heißt, ein fünftes Evangelium gibt, dem wir in der Landschaft und den Orten und Plätzen begegnen, von denen in der Bibel berichtet wird. Diese Orte, die Landschaft, die Atmosphäre sind geblieben. Mich zog es während meines Studienaufenthaltes immer wieder nach Tabgha, dem Ort der Brotvermehrung, direkt am See Genezareth gelegen.
Auch bei meinen späteren Israelaufenthalten hielt ich mich am liebsten in dem sogenannten biblischen Dreieck auf, also in der Gegend um Bethsaida, Kafarnaum und Choraziin. In Tabgha gibt es eine Stelle, die laut Bargil Pixner die Stelle sein könnte, an der sich Jesus am liebsten aufgehalten hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht und es ist mir auch egal. Aber ich bin gerne dort gewesen und habe mir vorgestellt, dass Jesus sich hier aufgehalten hat und vor allem in dieser Gegend gewirkt hat. Oder ich bin in aller Frühe noch vor Sonnenaufgang an den See gegangen, habe einen Text aus den Evangelien gelesen, der mit der Gegend hier in Verbindung gebracht wird, und habe dann einfach, mit Blick auf den See und die ihn umgebende Landschaft, den Text in mir nachwirken lassen.
Diese Erfahrungen waren für mich und für meinen Glauben nicht weniger wichtig als das Studium der Theologie und da vor allem der Exegese, die mir einen Einblick in die Welt der Theologie, die Entstehung der alten Texte, ihre Intentionen, ihre scheinbaren oder tatsächlichen Widersprüche, gaben. Hier lernte ich, sosehr das anfangs auch zu einer Verunsicherung beigetragen hat, dass es eine Wahrheit über das Leben und Wirken Jesu, seine Wunder usw. gibt, die man zu erklären versuchen kann, die aber, trotz aller wissenschaftlicher, archäologischer, geschichtlicher Bemühungen, unerklärbar und unsagbar bleibt, sosehr es sinnvoll und hochinteressant ist zu versuchen, sie zu beschreiben und zu erklären.