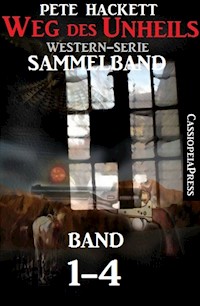
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Inhalt dieses Buchs entspricht 500 Taschenbuchseiten. (499) Als Nelson Elliott an diesem Morgen das Haus verließ, um sich beim Brunnen zu waschen, war die Welt noch in Ordnung. Doch das Unheil näherte sich der Pferderanch bereits auf pochenden Hufen. Das Schicksal begann ein neues Kapitel im Leben des Pferdezüchters zu schreiben. Die Feder führte der Tod... Sammelband Weg des Unheils (Band 1-4) Western von Pete Hackett Über den Autor Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war – eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen. Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weg des Unheils, Band 1-4 (Western-Sammelband)
Pete Hackett
Published by BEKKERpublishing, 2019.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Copyright-Seite
Sammelband | Weg des Unheils (Band 1-4) | Western von Pete Hackett
Über den Autor
Band 1 | Ein Mann schwört Rache
Band 2 | Wenn Satan seine Helfer schickt
Band 3 | Wenn die Hoffnung stirbt
Band 4 | Warren Elliott – ein Mann geht durch die Hölle
Further Reading: 10 Extra Western Januar 2020: Sammelband
Also By Pete Hackett
About the Publisher
Sammelband
Weg des Unheils (Band 1-4)
Western von Pete Hackett
Pete Hackett Western - Deutschlands größte E-Book-Western-Reihe mit Pete Hackett's Stand-Alone-Western sowie den Pete Hackett Serien "Der Kopfgeldjäger", "Weg des Unheils", "Chiricahua" und "U.S. Marshal Bill Logan".
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war – eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
––––––––
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2013 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Band 1
Ein Mann schwört Rache
Als Nelson Elliott an diesem Morgen das Haus verließ, um sich beim Brunnen zu waschen, war die Welt noch in Ordnung. Doch das Unheil näherte sich der Pferderanch bereits auf pochenden Hufen. Das Schicksal begann ein neues Kapitel im Leben des Pferdezüchters zu schreiben. Die Feder führte der Tod ...
Morgendunst hüllte die Hügel ringsum ein. Über dem nahen Fluss hingen weiße Nebelbänke. Die Sonne, die noch hinter dem Horizont verschwunden war, färbte den Himmel über den Bergen im Osten blassrot. Der Tag versprach wieder heiß zu werden.
Nelson Elliott war ein dunkelhaariger Mann von zweiunddreißig Jahren. Er war nur mit einer schwarzen Hose bekleidet. Der Oberkörper des großen Mannes war hager, unter der Haut zeichneten sich Muskeln und Sehnen ab, die darauf schließen ließen, dass sich Nelson Elliott sein tägliches Brot mit harter, körperlicher Arbeit verdiente.
Noch war es kühl. In den Büschen zwitscherten die Vögel. Die Pferde in den Corrals hatten sich erhoben und zu weiden begonnen. Linus, der deutsche Schäferhund, kam aus seiner Hütte, ließ sich auf die Hinterläufe nieder und beobachtete seinen Herrn. Nelson Elliott bediente die Winde des Brunnens und hievte einen Eimer voll Wasser in die Höhe. Das Stück Kernseife, das er mit aus dem Haus gebracht hatte, lag auf dem gemauerten Brunnenrand, über den er auch das grüne Handtuch gehängt hatte.
Der Pferderancher seifte sich das Gesicht und den Oberkörper ein. Das Wasser war kalt und belebte ihn. Joan, seine Frau, kam aus dem Wohnhaus. Sie war neunundzwanzig, ihre langen Haare waren brünett, ihr schmales Gesicht war sonnengebräunt und bestach nicht so sehr durch seine Regelmäßigkeit, sondern mehr durch seine Wärme und Fraulichkeit, die es ausstrahlte. Joan ging zum Hühnerstall, öffnete das mit einem rostigen Draht bespannte Gatter und die Hühner liefen gackernd in den staubigen Hof.
Nelson Elliott trocknete sich ab. Joan hatte aus der Scheune eine Schwinge mit Korn geholt und fütterte die Hühner. Im Wohnhaus fing ein Kind an zu weinen. Als Nelson Elliott sah, dass Joan die Schwinge abstellen wollte, um nach Barry, dem dreijährigen Jungen zu sehen, rief er: „Ist schon in Ordnung, Joan. Ich kümmere mich um den Kleinen. Füttere du nur das Vieh.“
Der Pferdezüchter ging schnell ins Haus. Aus der Schlafkammer drang das jämmerliche Weinen des Jungen. Der Geruch von frischem Kaffee erfüllte die Küche. Der Mann betrat die Schlafkammer und nahm den Kleinen aus seinem Bett. „Ruhig, kleiner Mann, ganz ruhig. Gleich gibt es etwas zwischen die Zähne.“
Augenblicklich hörte Barry zu weinen auf. „Wo ist Mom“, fragte der Junge.
„Sie füttert die Hühner“, antwortete der Mann. „Aber Mama kommt gleich ins Haus, und dann gibt es Frühstück. Du brauchst nicht mehr zu weinen, mein Kleiner.“
Nelson Elliott tätschelte sanft den Rücken seines Sohnes.
In dem Moment rief Joan: „Nelson, he, Nelson, der Farm nähern sich vier Reiter.“
Nelson Elliotts Gesicht verschloss sich. Er legte den Jungen ins Bett zurück. „Bleib in dem Raum, Barry, und weine nicht. Papa und Mama sind da. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Gleich kommt Mom und holt dich zum Frühstück. In Ordnung, mein Kleiner?“
„Kommt Mom wirklich gleich?“
„Sicher, mein Junge, du hast mein Wort.“ Nelson Elliott strich dem Knaben über die struppigen Haare, dann verließ er die Schlafkammer, zog die Tür hinter sich zu, holte seine Winchester aus dem Schrank und verließ das Haus.
Joan näherte sich ihm. Ihre Züge verrieten Anspannung. „Sie kommen von Süden“, erklärte sie. „Also nehme ich an, dass sie nicht zu Irving Langdon gehören.“
„Geh ins Haus, Joan“, murmelte Nelson Elliott. „Man kann nie wissen ...“
Joan schritt an ihm vorbei.
„Verriegle die Tür“, rief ihr Nelson Elliott hinterher, als sie über die Türschwelle trat.
Die Reiter näherten sich der Ranch im Schritttempo. Die Hufe ihrer Pferde rissen kleine Staubfahnen in die kühle Morgenluft. Einzelheiten konnte Nelson Elliott nicht erkennen. Aber bald konnte er das Pochen der Hufe vernehmen, schließlich auch das Klirren der Gebissketten und das Prusten der Pferde.
Die Männer lenkten die Tiere zwischen Stall und Scheune hindurch in den Ranchhof. Sie waren stoppelbärtig, verstaubt und verschwitzt. Müde zogen die Pferde die Hufe durch den Staub.
Linus, der Schäferhund, hatte sich erhoben und blickte den Reitern entgegen. Plötzlich knurrte er, dann begann er zu bellen.
„Ruhe, Linus!“, gebot Nelson Elliott, und seine Stimme klang scharf.
Der Hund bellte noch zweimal, dann war er still. Aber seine Nackenhaare hatten sich aufgestellt und er hatte die Ohren angelegt.
Nelson Elliott repetierte und nahm das Gewehr an die Hüfte. In ihm begannen die Alarmsirenen zu schrillen. Die Kerle sahen nicht gerade Vertrauen erweckend aus. Das Misstrauen, das Nelson Elliott befiel, ging tief.
Das metallische Geräusch des Durchladens veranlasste die Reiter, die Pferde zu zügeln. Aus entzündeten Augen starrten sie Nelson Elliott an. Einer der Kerle, ein dunkelhaariger Bursche Mitte dreißig, befeuchtete sich mit der Zungenspitze die trockenen, rissigen Lippen, dann rief er mit staubheiserer Stimme: „Hallo, Ranch! Sei versichert, Mister, dass wir nicht mit unlauteren Absichten kommen.“
„Ihr kommt aus der Felswüste. Ohne wichtigen Grund reitet kein Mensch durch diese Ödnis.“
Der dunkelhaarige Reiter legte seine Hände übereinander auf das Sattelhorn. „Wir wollten nach Maricopa. Aber irgendwie müssen wir vom richtigen Weg abgekommen sein. Wo befinden wir uns? Wohin müssen wir uns wenden, um nach Maricopa Wells zu gelangen?“
„Ihr befindet euch fünf Meilen südlich von Gila Bend. Maricopa Wells habt ihr um etwa vierzig Meilen verfehlt. Reitet nach Norden, dann erreicht ihr die Überlandstraße. Folgt ihr nach Osten. Und wenn ihr etwa vierzig Meilen geritten seid, erreicht ihr Maricopa Wells.“
„Ein weiter Weg, Mister. Unsere Gäule sind am Ende. Unseren letzten Proviant haben wir gestern Mittag verzehrt. Wir haben Hunger und Durst. Was dagegen, wenn wir uns eine Stunde hier auf der Ranch ausruhen? Ich sehe Hühner. Vielleicht kannst du uns ein paar Eier in die Pfanne schlagen.“
Die Kerle gefielen Nelson Elliott nicht. In den hohlwangigen Gesichtern hatte ein unsteter Lebenswandel unübersehbare Spuren hinterlassen. Sie wirkten heruntergekommen und auf besondere Art verwegen. Jeder der vier war mit einem schweren Revolver bewaffnet, in den Scabbards steckten Gewehre. Etwas Raubtierhaftes haftete jedem von ihnen an, etwas Animalisches. Ein unsichtbarer Strom von Härte und Kompromisslosigkeit ging von ihnen aus. Sie starrten Nelson Elliott an wie Wölfe, die eine Beute gestellt hatten und sich im nächsten Moment auf sie stürzen würden, um sie zu zerfleischen. Nelson Elliott fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Und er hatte nicht vor, dem Quartett Gastfreundschaft zu gewähren. Deshalb stieß er hervor: „Reitet weiter. Wir haben selbst kaum genug zum Leben. In einer Stunde könnt ihr in Gila Bend sein. Dort gibt es einen Mietstall und einen Saloon. Ihr bekommt in Gila Bend für euch und eure Pferde alles, was ihr braucht.“
„Du bist nicht sehr freundlich, Mister“, stieg es grollend aus Kehle des Dunkelhaarigen. In seinen braunen Augen zeigte sich ein bedrohliches Flackern.
Der Blick, mit dem er Nelson Elliott musterte, bereitete diesem geradezu körperliches Unbehagen. Er gab sich einen Ruck. „Reitet weiter!“, gebot er und hob das Gewehr etwas an.
„Na schön.“ Der Dunkelhaarige zeigte ein kantiges Grinsen. Die Lippen gaben ein lückenhaftes Gebiss frei. „Wir können dich nicht zwingen, uns Gastfreundschaft zu gewähren. Sag mir nur noch deinen Namen, Mister.“
„Weshalb interessiert er dich?“
„Ich merke mir die Namen der Leute, die mich schlecht behandeln.“
„Verschwindet!“
Der Dunkelhaarige spuckte aus, nahm die Hände vom Sattelknauf und trieb sein Pferd an. Das Tier setzte sich in Bewegung. Die anderen Reiter folgten. Sie ritten zum Fluss, lenkten die Pferde durch eine Lücke im Ufergestrüpp und ins Flussbett hinein. Das Wasser spritzte. Auf der anderen Seite trieben die Kerle ihre Pferde die Uferböschung hinauf und verschwanden wenig später um einen Hügel aus Nelson Elliotts Blickfeld.
Durch das offene Fenster erklang Joan Elliotts besorgte Stimme: „Das waren Sattelstrolche, vielleicht sogar Banditen. Wenn du mich fragst, dann stand ihnen die Verworfenheit in die Visagen geschrieben. Möglicherweise hat sie die Flucht vor dem Gesetz in die Felswildnis getrieben. Hoffentlich war es kein Fehler, sie davonzujagen, Nelson. Diese Sorte ist oftmals höllisch nachtragend.“
Es klang wie ein böses Omen.
„Ich werde heute auf der Ranch bleiben“, murmelte Nelson Elliott. „Die Fahrt nach Gila Bend, um einige Vorräte zu besorgen, verschiebe ich auf morgen oder übermorgen.“
Während er sprach, starrte der Pferdezüchter versonnen in die Richtung, in die das Quartett verschwunden war. Wie eine Warnung vor drohendem Unheil zuckte es durch sein Gehirn. Irgendetwas lauerte im Hintergrund seines Bewusstseins, das ihn zutiefst beunruhigte - das sich allerdings seinem Verstand entzog.
*
Es war gegen Mittag, als sich von Süden her ein ganzer Reitertrupp der Ranch näherte. Die Sonne stand hoch im Zenit. Die Hitze war nahezu unerträglich. Als Nelson Elliott in den Hof trat, war es, als berührten Flammen sein Gesicht. Der Pferdezüchter entspannte sich, als er an der Brust des vordersten Reiters einen Stern glitzern sah. Er senkte das Gewehr, das er an der Seite im Anschlag hielt und gebot Linus, der sich erhoben hatte und der Kavalkade entgegen starrte, sich niederzulegen. Der Hund folgte aufs Wort.
Das Rudel kam auf den Ranchhof. In der Hofmitte zerrten die Reiter die Pferde in den Stand. Der Mann mit dem Sechszack an der Brust trieb seinen Vierbeiner noch ein Stück weiter, dann parierte auch er das Tier und rief heiser: „Hallo, Ranch! Ich bin Deputy Sheriff Wade Forrester. Wir kommen von Hickiwan herauf und verfolgen vier Kerle, die in dem Ort die Bank überfallen haben. Ihre Spur führt hierher.“
Bei dem Deputy handelte es sich um einen etwa dreißigjährigen Mann mit sandfarbenen, strähnigen Haaren und tiefliegenden, wasserhellen Augen. Das Gesicht war knochig und hohlwangig. Jetzt war es mit einer dünnen Schicht aus Schweiß und Staub bedeckt.
„Die Kerle waren heute Morgen hier auf der Ranch“, gab Nelson Elliott zu verstehen. „Sie forderten von mir Gastfreundschaft. Nachdem ich abgelehnt habe, sind sie weitergeritten.“
„Es handelt sich um Dave Lewis und seine Banditen“, erklärte der Deputy und schwang sich aus dem Sattel. Über die Schulter rief er: „Tränkt die Pferde am Fluss. Belford, sei so gut und kümmere dich um meinen Gaul. In einer halben Stunde reiten wir weiter.“
Steifbeinig näherte sich der Gesetzeshüter dem Rancher, schließlich ließ er sich auf der Bank neben der Haustür nieder. „Die Schufte haben den Kassierer niedergeknallt. Es ist fraglich, ob Callaghan durchkommt. Aber auf Lewis’ Konto gehen schon einige Morde. Leider kann man Kerle wie ihn nur einmal hängen.“
„Sie wollten nach Maricopa Wells“, sagte Nelson Elliott. Danach nagte er einen Moment an seiner Unterlippe, dann fuhr er fort: „Ich denke, wir hatten ziemlich viel Glück, als uns die Banditen ungeschoren ließen. Wenn sie es darauf angelegt hätten, wäre ich wohl chancenlos gewesen.“
„Die vier sind tödlicher als die Cholera“, murmelte der Deputy. „Zusammengesetzt aus Skrupellosigkeit, Brutalität, Habgier und allem, was unmenschlich und grausam macht. Ja, auch ich bin der Meinung, dass Sie riesiges Glück hatten, Mister – äh ...“
„Mein Name ist Elliott – Nelson Elliott. Ich lebe seit etwas über vier Jahren hier am Fluss und züchte Pferde.“
In dem Moment kam Joan aus dem Haus, auf dem Arm trug sie den kleinen Barry. Neugierig fixierte der Junge den fremden Mann mit dem Stern an der Brust.
„Meine Frau Joan“, sagte Nelson Elliott.
Der Deputy erhob sich und lüftete seinen Stetson. „Guten Tag, Ma’am. Ich hoffen, wir bereiten Ihnen keine Unannehmlichkeiten.“
Eindringlich musterte er die Frau. In seinen Augen blitzte es auf. Einen Moment lang glaubte Joan den Ausdruck von Habgier in seinem Blick zu erkennen. Sie fühlte Beklemmung.
Der Deputy ließ sich wieder nieder und zeigte ein verkniffenes Grinsen.
„In keiner Weise“, antwortete die junge Frau und lächelte. Im nächsten Moment aber wurde sie ernst, und sie sagte: „Ich konnte durch das offene Fenster alles hören. Mir waren die vier Kerle gleich nicht geheuer. Dass es sich aber um eine Bande von gewissenlosen Mördern handelt ...“
„Auf Lewis’ Kopf sind tausend Dollar Fangprämie ausgesetzt – tot oder lebendig. Von den anderen Kerlen ist jeder fünfhundert wert.“
„Eine Menge Geld“, murmelte Nelson Elliott versonnen und starrte mit leerem Blick in die Ferne.
Der Deputy erhob sich und reckte die Schultern. „Zu wenig, um von den Schuften in Stücke geschossen zu werden. Sobald die Pferde getränkt sind und wir uns ein wenig die Beine vertreten haben, reiten wir weiter. Und sollten sich Lewis und seine Sattelwölfe hier noch einmal blicken lassen, dann schießen Sie erst und stellen dann die Fragen.“
Nelson Elliott nickte.
Der Gesetzeshüter stakste zum Fluss.
Wieder schaute Nelson Elliott grüblerisch in die Richtung, in die am Morgen die vier Banditen geritten waren.
Joan, die ihn beobachtete, sagte: „Du denkst an das Geld, Nelson, nicht wahr? Zweitausendfünfhundert Dollar. Sicher, wir könnten es gut gebrauchen. Dennoch solltest du nicht weiter darüber nachdenken. Ich lasse nicht zu, dass du den Schuften folgst. Barry und ich brauchen dich. Also vergiss es.“
Nelson Elliotts Backenknochen mahlten. Er hatte die Augen ein wenig zusammengekniffen. „Mit zweitausendfünfhundert Dollar wären wir endgültig aus dem Schneider, Joan“, murmelte Nelson Elliott. „Ich ...“
Mit harter, klirrender Stimme fiel ihm Joan ins Wort: „Denke nicht mehr daran, Nelson. Als du vor über vier Jahren den Stern des Town Marshals zurückgegeben hast, legtest du mir gegenüber einen Schwur ab. Du hast geschworen, niemals wieder einen Revolver zu tragen und niemals mehr einen rauchigen Job – welchen auch immer -, auszuüben. Wir haben gemeinsam diese Ranch gegründet. Vor drei Jahren kam Barry und wir sind eine Familie. Ich lasse nicht zu, dass du deinen Schwur brichst und deine Haut zu Markte trägst.“
„Schon gut, Darling, schon gut“, murmelte Nelson Elliott. „Ich werde den Schwur nicht brechen. Keine Sorge. Der Colt bleibt in der Truhe.“
Niemand ahnte in dieser Minute, dass sich über der Ranch bereits die dunklen Wolken des Unheils zusammenballten. Die Würfel des Schicksals rollten ...
*
Es war die Zeit des Sonnenuntergangs. Die runde Scheibe der Sonne stand über dem bizarren Horizont im Westen und brachte einige Wolkenbänke zum Glühen. Die Schatten waren lang und wuchsen immer schneller über den heißen Hof der Elliott Ranch. Nelson Elliott hatte an diesem Tag die Corrals ausgebessert und ein Rudel Pferde ausgesondert, das er in einigen Tagen nach Gila Bend zum Verkauf bringen wollte. Das Gewehr hatte sich immer in greifbarer Nähe befunden. Er hatte einer Bande von Mördern die Gastfreundschaft verweigert. Und nun fürchtete er ihre Rache. Dabei war Nelson Elliott alles andere als ein furchtsamer Mann. Er war vorsichtig und argwöhnisch – Eigenschaften, die ihm während der Zeit als Town Marshal zur zweiten Natur geworden waren. Das war so. In diesem gnadenlosen Land, in dem das Gesetz auf sehr schwachen Beinen stand und oftmals auch versagte, lernte man seine Lektionen entweder schnell – oder man verschwand in einem einsamen Grab.
Nelson Elliott schritt über den Hof. Linus lag vor seiner Hütte im Staub, hatte den mächtigen Schädel zwischen seine Vorderläufe gebettet, und beobachtete den Pferdezüchter fast gelangweilt.
Als Nelson Elliott sich in der Hofmitte befand, peitschten Schüsse. Der Rancher bäumte sich auf, ließ das Gewehr fallen und griff sich mit beiden Händen an die Brust. Im nächsten Moment brach er zusammen. Linus, der sich mit einem Ruck erhob, wurde mit dem erneuten Krachen einiger Gewehrschüsse herumgeschleudert, heulte gequält auf und fiel dann auf die Seite. Ein Zittern durchlief den Hundekörper, dann lag er still.
Joan Elliott rannte aus dem Haus, das Gesicht vom Entsetzen und von der Fassungslosigkeit gezeichnet. Bei ihrem Mann ließ sie sich auf die Knie niedersinken. „Nelson“, entrang es sich ihr. „Mein Gott, Nelson ...“ Erschüttert starrte sie in das reglose Gesicht des Mannes. Die Augen waren halb geöffnet. In ihnen spiegelte sich nur noch die absolute Leere des Todes.
Die Frau hob das Gesicht und starrte nach Norden. Ihre Lippen zuckten, ihre Nasenflügel vibrierten leicht. Das alles überstieg ihr Begriffsvermögen. Es gelang ihr nicht, einen klaren Gedanken zu fassen. Ihre Brust hob und senkte sich unter keuchenden Atemzügen. Es war, als würde sie von einer unsichtbaren Hand gewürgt.
Und jetzt sah sie vier Reiter. Sie lenkten ihre Pferde eine Hügelflanke hinunter und näherten sich der Ranch.
Wie von Schnüren gezogen erhob sich Joan Elliott ...
*
Die Ladentür wurde geöffnet und die Glocke bimmelte durchdringend. Warren Elliott, der sich in der kleinen Werkstatt neben dem Verkaufsraum befand und einen Revolver zusammensetzte, erhob sich und begab sich in den Laden. Es roch nach Bohnerwachs. Am verstaubten Fenster tanzten einige Fliegen auf und ab. Einige krochen auf der Scheibe herum.
Auf der anderen Seite der Theke stand Deputy Sheriff Dale Roberts. Sein Gesicht mutete an wie versteinert, der Blick seiner Augen war ernst.
„Ah, Dale“, sagte Warren Elliott freundlich. „Hast du wieder einmal dein Gewehr ruiniert, oder ist es dieses Mal deine Gürtelkanone, die ich reparieren muss.“
Der Deputy atmete durch.
Das Lächeln in Warren Elliotts Zügen gerann. Unvermittelt spürte er, dass es um mehr ging als nur um ein kaputtes Gewehr oder einen Revolver. „Vorhin war ein Bote von der Langdon Ranch bei mir“, begann der Gesetzeshüter. Seine Stimme klang kehlig. Sein Blick irrte ab. „Drei Cowboys, die zufällig auf die Ranch deines Bruders kamen ...“
„Verdammt, Dale, was ist los? Wenn drei Cowboys von der Irving Langdon auf der Ranch meines Bruders waren, dann ganz sicher nicht zufällig. Raus mit der Sprache, was ist geschehen?“
„Sie haben deinen Bruder und Joan gefunden – tot.“
Warren Elliotts Züge entgleisten regelrecht. Der Mann war wie vor den Kopf gestoßen. Sekundenlang brachte er keinen Laut über die Lippen. Er schluckte, räusperte sich, griff sich an die Stirn und würgte schließlich hervor: „Nelson und Joan sind tot? Gütiger Gott. Was – was ist mit Barry?“
„Der Kleine ist spurlos verschwunden. Dein Bruder und deine Schwägerin wurden ermordet, Warren. Joan hat man darüber hinaus ...“
Der Deputy brach ab. Alles in ihm weigerte sich, den Satz zu Ende zu führen.
„Was?“
Warren Elliott übte mit seinem fragenden, geradezu zwingenden Blick Druck auf den Deputy aus.
„Sie haben Joan vergewaltigt, ehe sie sie töteten.“
„Es waren also mehrere?“ Die Stimme des Gunsmith’ von Gila Bend klang rau und belegt, seine Stimmbänder wollten ihm kaum gehorchen. Unter seinem linken Auge zuckte ein Nerv. Mit einer fahrigen Geste seiner rechten Hand strich er sich über das Gesicht.
„Den Spuren nach zu schließen – ja. Mehr weiß ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, was der Langdon-Reiter zu berichten wusste. Ich werde ein Aufgebot zusammentrommeln und nehme an, dass du mitkommst, Dale.“
„Sicher, ja“, murmelte Warren Elliott. Er war erschüttert und fassungslos, das Begreifen war von schmerzhafter Schärfe, sein Innerstes war aufgewühlt und seine Gedanken begannen zu wirbeln.
„Wir treffen uns in einer halben Stunde vor dem Office“, gab der Deputy zu verstehen.
Ein Ruck durchfuhr Warren Elliott. „So lange kann ich nicht warten. Darum werde ich vorausreiten, Dale. Bei allen Heiligen ...“
Eine Viertelstunde später verließ Warren Elliott Gila Bend. Er schonte das Pferd nicht und benötigte für die fünf Meilen bis zur Ranch seines Bruders eine gute halbe Stunde. Am Haltebalken vor dem Ranchhaus standen ein halbes Dutzend Pferde. Die Haustür stand offen. Warren Elliott sah den toten Schäferhund vor seiner Hütte liegen. Der Anblick schnürte ihm den Hals zu.
Warren Elliott saß ab. Er ließ das abgetriebene Pferd einfach stehen. Es prustete und trottete zum Wassertrog beim Brunnen. Aus dem Haus drangen Stimmen. Warren Elliott trat ein. Im Schlafzimmer traf er auf die Männer, denen die Pferde am Holm gehörten. Es waren Irving Langdon und einige seiner Reiter. Die beiden Toten hatten sie auf die Betten gelegt. In Joans weit aufgerissenen Augen spiegelten sich noch das letzte Entsetzen ihres Lebens und die Verzweiflung wider, die sie in ihren letzten Minuten empfunden hatte.
Das Herz Warren Elliotts raste. Einen Moment lang wurde ihm schwindlig. Der Raum und die Männer von der Langdon Ranch verschwammen vor seinen Augen. Aber dann klärte sich sein Blick wieder. Sechs Augenpaare waren auf ihn gerichtet, Ernst prägte jeden Zug im Gesicht der Männer. Irving Langdon, ein fünfzigjähriger, grauhaariger Mann mit kantigem Gesicht, stieß hervor: „Es gibt eine Reihe von Spuren, Warren. Ein Rudel Reiter ist von der Ranch aus nach Norden geritten. Die Kerle haben die Tiere vorher am Fluss getränkt. Schätzungsweise waren es sieben oder acht.“
„Elliott und Joan sind tot“, entrang es sich Warren Elliott. „Was ist aus Barry geworden? Haben ihn die Kerle mitgenommen? Was haben Sie gegebenenfalls mit dem Jungen vor?“
Irving Langdon zuckte mit den Schultern. „Wir wissen es nicht. Dein Bruder und Joan sind seit mindestens vierundzwanzig Stunden tot. Es war Zufall, dass drei meiner Reiter ...“
„Zufall!“ Warren Elliott schrie das Wort geradezu hinaus. „Dir war doch die Ranch meines Bruders seit langem ein Dorn im Auge, Langdon!“
„Was willst du damit zum Ausdruck bringen, Elliott?“, kam es grollend von dem Rinderzüchter. Sein Blick war hart, dieser Mann kannte kein Entgegenkommen. Seine Stimme klang drohend.
Sekundenlang presste Warren Elliott die Lippen zusammen, so dass sie nur noch einen dünnen, blutleeren Strich bildeten. Schließlich aber winkte er ab und sagte: „Nichts, Langdon, ich will damit nichts zum Ausdruck bringen.“
Die Atmosphäre im Raum war plötzlich angespannt. Finstere Blicke taxierten Warren Elliott. Von den Langdon-Männern ging eine stumme Drohung aus.
„Denk nicht mal mehr an so etwas, Warren“, knurrte Irving Langdon. „Niemand von der Langdon Ranch hat etwas mit diesem scheußlichen Verbrechen zu tun. Es ist richtig: Ich habe mehrmals versucht, deinen Bruder zum Verkauf seiner Ranch zu überreden, weil ich sein Land gut als Weideland gebrauchen hätte können und ich meinen Rindern einen weiteren Zugang zum Fluss geschaffen hätte. Dein Bruder hat abgelehnt, und ich begann es zu akzeptieren.“
„Schon gut, Langdon, schon gut. Ich wollte weder dir noch einem deiner Männer zu nahe treten.“
Warren Elliott konnte den Anblick der beiden Toten nicht länger ertragen und ging nach draußen. Tief atmete er durch. Die Luft war heiß und seine Lungen füllten sich wie mit Feuer. Sein Pferd stand beim Tränketrog und äugte zu ihm her. Mit dem Schweif schlug es nach den blutsaugenden Bremsen an seinen Seiten. Aber die lästigen Biester ließen sich nicht vertreiben.
Warren Elliott begann, die Ranch zu umrunden. Er registrierte die Spuren von mehreren Reitern, die sich der Ranch von Süden genähert hatten. Und er sah die Fährte, die sich deutlich im verstaubten Gras abzeichnete und die nach Norden führte. Einige Hufabdrücke wiesen jedoch in südliche Richtung.
Und aus dieser Richtung näherte sich nun ein Pulk Reiter. Der Stern an der Brust Dale Roberts’ reflektierte das grelle Sonnenlicht. Eine Staubfahne wallte hinter den Reitern her. Am Rand des Hofes traf Warren Elliott mit dem Aufgebot zusammen. Die Männer aus Gila Bend zerrten ihre Pferde in den Stand. Gebissketten klirrten, Sattelleder knarrte, die Pferde stampften und scharrten mit den Hufen, eines der Tiere wieherte hell.
„Irving Langdon ist mit fünf seiner Reiter im Haus“, erklärte Warren Elliott.
„Warum bist du nicht drin, Warren?“, wollte der Deputy wissen.
„Ich habe mich nach Spuren umgeschaut, bevor sie nicht mehr wahrzunehmen sind. Sieht so aus, als wäre ein Rudel Reiter von Süden gekommen und nach Norden weitergezogen. Einige Spuren führen aber auch nach Süden. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll.“
„Wenn das Rudel, das du gesehen hast, die Richtung nach Norden beibehalten hätte, dann müsste es in Gila Bend angelangt sein. In der Stadt sind aber keine Reiter angekommen.“
„Ich folge der Fährte“, murmelte Warren Elliott und ein entschlossener Zug hatte sich in seinen Mundwinkeln festgesetzt. „Ich werde mich nicht selbst drum kümmern können, Dale. Darum bitte ich dich, zu veranlassen, dass mein Bruder und meine Schwägerin in die Stadt geschafft und dort angemessen beerdigt werden. Für die Kosten komme ich natürlich auf.“
„Die Bande hat mindestens vierundzwanzig Stunden Vorsprung“, gab der Deputy zu bedenken. „Wenn sie zur Überlandstraße geritten ist, verliert sich spätestens dort ihre Spur. Du bist nicht gerüstet für einen längeren Ritt, Warren. Aber selbst wenn du die Bande einholst – was dann? Du bist – im Gegensatz zu deinem Bruder - kein Kämpfer, Warren.“
„Ich bin Gunsmith, und ich weiß mit einer Waffe umzugehen. Egal ob Revolver oder Gewehr – ich treffe damit jedes Ziel. Wenn es mir gelingt, die Mörder meines Bruder und meiner Schwägerin einzuholen, werde ich sie zur Rechenschaft ziehen. Und ich werde sie nach dem Verbleib meines kleinen Neffen fragen.“
„Das hört sich an wie ein Schwur“, murmelte der Deputy.
„Das ist ein Schwur“, stieg es dumpf aus Warren Elliotts Kehle. „Ich werde nicht ruhen, bis der letzte der Mörder bezahlt hat.“
*
Zwei Stunden später gelangte Warren Elliott nach Shawmut. Die Stadt lag fünfzehn Meilen östlich von Gila Bend an der Postkutschenstraße, die bis nach Yuma in der südwestlichen Ecke des Arizona-Territoriums führte. Zwischen den beiden Häuserzeilen verbreitete sich die Straße zur Main Street. Hinter den Wohnhäusern mit den oftmals falschen Fassaden hatten die Bewohner der Ortschaft Schuppen, Scheunen und Stallungen errichtet. Außerdem gab es Corrals, Koppeln und Pferche, in denen die Nutztiere der Einwohner weideten.
Warren Elliott war schon einige Male in der Stadt und kannte sich aus. Vor dem Hoftor des Mietstalls schwang er sich vom Pferd, führte das Tier am Kopfgeschirr in den Hof und strebte dem offen stehenden Stalltor zu. Nachdem er die Lichtgrenze unter dem Tor überschritten hatte, empfingen ihn Düsternis und scharfer Stallgeruch. Am Ende des Stalles stand das Tor zum Freigelände offen.
Warren Elliott schlang den langen Zügel lose um einen Querbalken und stapfte steifbeinig zu diesem Ausgang. In einer Fence weideten über ein Dutzend Pferde. Der Stallmann hockte auf dem Gatter und schnitzte an einem Stock herum.
„He, Dexter!“
Die Stimme entfernte sich von Warren Elliott und erreichte den bärtigen Burschen auf der oberen Corralstange. Er riss den Kopf herum, sprang auf den Boden und kam schnell heran. „Hallo, Elliott. Lange nicht gesehen in Shawmut.“
„Guten Tag, Dexter. Sind in den vergangenen vierundzwanzig Stunden mehrere Reiter in die Stadt gekommen?“
Der Stallbursche nickte. „Es war Deputy Sheriff Forrester aus Hickiwan, der auf der Fährte eines höllischen Quartetts geritten kam. Einige Meilen weiter südlich legten die Banditen dem Aufgebot einen Hinterhalt. Zwei der Reiter aus Hickiwan wurden getötet, einer schwer verwundet, zwei weitere trugen nur leichtere Blessuren davon. Forrester hat den Schwerverletzten in Shawmut zurückgelassen und hat sich mit dem Rest seiner Truppe wieder auf die Fährte der Bande gesetzt. Weshalb interessieren dich diese Leute, Warren?“
„Sie nahmen den Weg über die Ranch meines Bruders. Als sie weiterritten, waren mein Bruder und meine Schwägerin tot. Mein dreijähriger Neffe ist spurlos verschwunden.“
„Allmächtiger!“ Der Stallmann bekreuzigte sich. „Ich – ich kannte Nelson sehr gut“, stammelte er dann. „Er – wurde - ermordet?“
„Ja, eiskalt und skrupellos. Wo finde ich den Verwundeten?“
„Bei Doc Canby.“
„Okay, Dexter. Mein Pferd steht im Stall. Ich bitte dich, das Tier zu versorgen. Ich hole es in einer Stunde wieder ab.“
Warren Elliott ging vor Joshua Dexter her in den Stall, zog die Winchester aus dem Scabbard und machte sich dann auf den Weg zum Haus des Arztes. Zehn Minuten später stand er am Bett des verwundeten Mannes, der mit dem Gesetzeshüter von Hickiwan geritten war. Sein Name war Henry Brewster.
Brewster berichtete mit stockender Stimme: „Es handelt sich um Dave Lewis, Jim Strother, Jack Willard und Sam Higgins. Sie haben in Hickiwan die Bank überfallen und den Kassierer niedergeschossen. Wade Forrester hat ein Aufgebot zusammengestellt. Auch ich habe mich gemeldet. Als säße uns der Leibhaftige im Nacken sind wir hinter der Bande hergeritten.“
Brewster machte eine Pause. Das Sprechen strengte ihn offensichtlich an. Schweiß perlte auf seiner Stirn. In seinen Zügen und auf dem Grund seiner Augen wühlte der Schmerz von der Schusswunde in seiner rechten Brustseite.
Warren Elliott drängte den Verwundeten nicht. Dieser fuhr schließlich fort: „Wenige Stunden nach Lewis und seinen Sattelwölfen waren wir auf der Ranch Ihres Bruders. Wir haben dort die Pferde getränkt und eine halbe Stunde pausiert. Ihr Bruder erzählte Forrester, dass er Lewis und seinen blutigen Verein am Morgen von der Ranch gejagt hat.“
Die Stimme Brewsters war zuletzt schwächer geworden. Mit einem verlöschenden Laut endete er. Sein Atem rasselte. Seine Lider flatterten.
„Vielleicht sollten Sie jetzt gehen“, mahnte der Arzt, der neben Warren Elliott am Bett stand. „Sie sehen es selbst, Elliott. Brewster ist ...“
„Es geht schon wieder“, keuchte der Verwundete. „Ich – ich schaffe das schon, Doc.“ Er richtete die entzündeten, fiebrigen Augen auf Warren Elliott. „Ihr Bruder befürchtete, dass die Bande zurückkehrt, um ihm sein unfreundliches Verhalten heimzuzahlen. Das hat uns zumindest Forrester erzählt. Nach etwa einer halben Stunde sind wir weitergeritten. Die Bande hat sich bei Ihrem Bruder nach dem Weg nach Maricopa Wells erkundigt. Wir folgten der Fährte. Nachdem wir einige Meilen geritten waren, knallte es plötzlich. Die Banditen hatten uns einen Hinterhalt gelegt. Als ich wieder zu mir kam, lag ich hier in diesem Bett, von Doc Canby erfuhr ich, dass mich Forrester nach Shawmut gebracht hatte und dann mit dem Rest des Aufgebots weiter der Bande gefolgt ist.“
„Dave Lewis“, murmelte Warren Elliott. Er sprach den Namen wie eine Beschwörungsformel.
„Am schwarzen Brett beim Depot der Butterfield Overland Mail Company hängen die Steckbriefe der Schufte“, gab der Arzt zu verstehen. Und grimmig fügte er hinzu: „Das Gesetz ist scheinbar nicht imstande, diesen gewissenlosen Verbrechern das blutige Handwerk zu legen. Jagen Sie sie, Elliott, stellen und töten Sie die Hurensöhne. Sie sind die Luft nicht wert, die sie atmen. Diese Sorte ist nur in der Hölle gut aufgehoben.“
„Ich werde nicht ruhen“, murmelte Warren Elliott. „Aber um Vergeltung geht es mir nur in zweiter Linie. Diese elenden Bastarde haben meinen kleinen Neffen entführt. Ich will den Knaben finden. Und wehe den Schuften, wenn sie ihm auch nur ein Haar gekrümmt haben.“
Warren Elliott verließ das Haus des Arztes, holte sich die Steckbriefe vom Depot der Overland Mail Company, aß im Saloon und kehrte dann zum Mietstall zurück. Dexter, der Stallmann, hatte das Pferd gefüttert und getränkt und ihm den Sattel abgenommen. Jetzt half er Warren Elliott, das Tier wieder zu satteln. Dann ritt der Gunsmith auf der Poststraße nach Gila Bend. Es war finster, als er zu Hause ankam. Niemand wartete auf Warren Elliott. Seine Frau war vor vier Jahren bei der Entbindung ihres ersten Kindes gestorben. Auch das Kind überlebte nicht. Seitdem lebte Warren Elliott alleine. Er schlief bis zum Sonnenaufgang, dann machte er sich fertig, holte sein Pferd aus dem Stall und ritt zur Bank, wo er sich tausend Dollar auszahlen ließ.
Als er vor der Bank aufs Pferd stieg, sah er Deputy Sheriff Dale Roberts schräg über die Main Street auf sich zukommen. Zwei Schritte vor Warren Elliott hielt der Gesetzeshüter an. Der Schatten, den seine Gestalt warf, berührte den Gunsmith. „Was hast du herausgefunden, Warren?“, erkundigte sich Roberts.
Warren Elliott berichtete mit knappen Worten. Der Hilfssheriff unterbrach ihn kein einziges Mal. Erst, als Elliott geendet hatte, stieß er hervor: „Jage diese Aasgeier, bis ihnen die Zungen zu den Hälsen heraushängen, Elliott. Ich wünsche mir, dass du deinen Neffen wohlbehalten findest und ihn zurückbringst. Gott möge mit dir sein.“
„Danke, Dale.“ Warren Elliott schwang sich aufs Pferd, ruckte im Sattel und schnalzte mit der Zunge. Der Rotfuchs setzte sich in Bewegung. Im Schritttempo verließ Warren Elliott die Stadt. Dale Roberts schaute ihm hinterher, bis er über einen Höhenzug aus seinem Blickfeld verschwand.
Es war heller Tag. Warren Elliott ritt auf der Überlandstraße nach Osten. Das staubige Band der Butterfield Stage-Route schwang sich wie der geringelte Leib einer riesigen Schlange ostwärts und umging Bodenfalten sowie Gruppen von ausgewaschenen, von Wind und Regen zerfressenen Felsen.
Hass auf die Mörder seines Bruders und seiner Schwägerin zerfraß sein Denken. Mit dem Verstand hatte er bereits akzeptiert, dass Nelson und Joan tot waren. In seinem Innersten aber konnte er sich damit nicht abfinden. Außerdem quälte ihn die Sorge um Barry, seinen Neffen. Er fragte sich, was die Banditen leitete, als sie den Knaben entführten.
Um die Mitte des Vormittags erreichte Warren Elliott Shawmut. Er suchte noch einmal den Verwundeten Mann aus Hickiwan im Haus des Arztes auf und ließ sich von ihm genau erklären, wo der Überfall auf das Aufgebot stattgefunden hatte.
Warren Elliott verließ die Stadt. Bald umgab ihn nur noch Wildnis. Meile um Meile trug der Rotfuchs den Mann nach Südwesten. Um ihn herum erstreckte sich ein Gebiet zerklüfteter Hügel und dunkler Kämme, zwischen denen kleine Prärien mit braun verbranntem Büffelgras eingebettet lagen. In rauchiger Ferne ragten die blauen Konturen der Berge in ein Meer von weißen Wolken hinein.
Und vor dieser Kulisse nahm Warren Elliott die schwarzen, kreisenden Punkte am Himmel wahr. Es waren Aasgeier – Todesvögel. Warren Elliott hatte angehalten und beobachtete sie. Lautlos zogen sie ihre Bahnen. Warren Elliott wusste, dass bei dem Überfall zwei Pferde getötet worden waren. Und er sagte sich, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Er trieb den Rotfuchs in eine schnellere Gangart.
Die toten Pferde lagen in einer staubigen Mulde, in der kniehoch Kreosot wuchs. Einige der Geier hatten sich bei den Kadavern niedergelassen und rissen mit ihren scharfen Schnäbeln das Fleisch von den Knochen. Myriaden von Mücken hatten sich auf den leblosen Tierkörpern niedergelassen.
Zwei der Geier stritten sich flügelschlagend und zornig krächzend um ein Stück Fleisch. Einige andere der hässlichen Vögel hatten ihr schauriges Mahl unterbrochen und beäugten misstrauisch den Reiter, der etwa zwanzig Yards entfernt den Rotfuchs pariert hatte. Das Tier schnaubte unruhig. Wahrscheinlich stieg ihm der faulige Geruch des Todes in die Nase.
Henry Brewster hatte erzählt, dass die Banditen auf einem Hügel im Norden lauerten. Er zog das Pferd halb um die rechte Hand und spornte es an. Der Rotfuchs trabte auf den Einschnitt zwischen den steilen Abhängen zu. Aus den Hügelflanken erhoben sich Felsen in allen Größen und Formen. Dazwischen wucherten dorniges Gestrüpp und hartes Büschelgras. In der Hügellücke stieg Warren Elliott ab, band das Pferd an einen Strauch, zog die Winchester aus dem Scabbard und stapfte den Abhang hinauf.
Der Anstieg war beschwerlich. Bald rann Warren Elliott der Schweiß über Stirn und Wangen. Sein Atem ging schneller, die Füße wurden schwer wie Blei. Die hochhackigen Reitstiefel mit den Sporen behinderten ihn.
Warren Elliott kam oben an. Auch hier erhoben sich Felsen bis zu Mannshöhe. Der Boden war staubig und von Geröll übersät. Es gab kaum Schatten. Die Vegetation bestand in genügsamen Comas und Ocotillos.
Atmung und Herzschlag nahmen bei Warren Elliott wieder den regulären Rhythmus an. Er ging weiter, trat zwischen zwei Felsen und richtete den Blick hangabwärts. In einer Entfernung von etwa hundert Yards lagen die toten Pferde. Das Krächzen der Geier erreichte selbst auf diese Entfernung Warren Elliots Gehör.
Warren Elliott schaute sich um, und er bemerkte einige Patronenhülsen im Staub. Er hob sie auf und betrachtete jede einzelne von allen Seiten. Keine der Kartuschen wies irgendein besonderes Merkmal wie Kratzspuren oder kleine Dellen auf. Dennoch schob der Mann die Hülsen ein.
Auf diesem Hügel hatten die Banditen die Posse aus Hickiwan erwartet. Und ohne jede Warnung und mit einer Brutalität sondergleichen hatten sie das Feuer eröffnet. Beim Gedanken daran kam bei Warren Elliott wieder der Hass – in rasenden, giftigen Wogen, kalt und stürmisch wie ein Blizzard.
Warren Elliott begann nach Spuren zu suchen. Und er fand einige Hinweise, die ihm verrieten, dass sich die Bande nordostwärts gewandt hatte.
Elliott fiel ein, dass sich die Banditen bei seinem Bruder bezüglich des Weges nach Maricopa Wells erkundigt hatten.
*
Die Schatten waren lang und von Osten her schob sich diesig die Dämmerung ins Land, als Warren Elliott zwischen die ersten Häuser von Maricopa Wells ritt. Auf der Straße und in den Gassen waren nur vereinzelt Menschen zu sehen. Vor dem Depot der Overland Mail Company saß ein bärtiger Mann auf einer Bank und saugte an seiner Pfeife.
Warren Elliott lenkte den Rotfuchs zur Postkutschenstation, parierte das Tier und legte die Hände locker auf den Sattelknauf. „Guten Abend, Sir.“
Der Stationer stieß eine Rauchwolke durch die Nase heraus, dann erwiderte er den Gruß und musterte den Reiter fragend.
„Sind gestern oder heute vier Reiter in Maricopa Wells angekommen?“, fragte Warren Elliott. „Möglicherweise hatten sie einen kleinen Jungen – drei Jahre alt – bei sich.“
„Es kommen täglich Reiter nach Maricopa Wells“, erklärte der Stationer. „Aber vier Reiter mit einem kleinen Jungen wären mir sicher nicht entgangen. Was hat es mit den Männern auf sich? Und weshalb sollten sie einen kleinen Jungen durch die Gegend schleppen.“
„Es sind Mörder, Vergewaltiger und Kidnapper“, stieß Warren Elliott hervor. „Vielen Dank, Sir.“ Er tippte gegen die Krempe seines Hutes und ritt weiter. Beim Office des Town Marshals stieg er aus dem Sattel, leinte das Pferd an den Hitchrack und zog das Gewehr aus dem Scabbard. Gleich darauf betrat er das Office. In dem Raum war es düster. Muffiger Geruch stieg Warren Elliott in die Nase. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann von etwa vierzig Jahren, dessen Mund von einem riesigen, schwarzen Schnurrbart verdeckt wurde. Vor ihm lag eine aufgeschlagene Kladde, in der rechten Hand hielt er eine Schreibfeder. Neben der Kladde stand ein geöffnetes Tintenglas.
Warren Elliott murmelte einen Gruß und warf einen Blick auf das Ziffernblatt des Regulators, dessen Messingpendel gleichmäßig hin und her schwang und der ein monotones Ticken verbreitete. Es war 19 Uhr 30.
„Was führt Sie zu mir?“, fragte der Town Marshal, nachdem er Elliotts Gruß erwidert hatte. Er legte die Feder weg und lehnte sich auf dem Stuhl zurück.
Warren Elliott holte die Steckbriefe, die er in Shawmut vom Anschlagbrett der Postkutschenstation genommen hatte, aus der Westentasche, faltete sie auseinander, hielt sie dem Stadtmarshal hin und sagte mit verstaubter, heiserer Stimme: „Dave Lewis und seine zweibeinigen Wölfe haben der Ranch meines Bruders südlich von Gila Bend einen höllischen Besuch abgestattet. Sie haben meinen dreijährigen Neffen entführt. Und es deutet einiges darauf hin, dass sie nach Maricopa Wells geritten sind.“
Der Marshal nahm die Steckbriefe. „Eine üble Geschichte. Haben die Kerle Ihren Bruder getötet?“
„Ihn und meine Schwägerin. Ehe sie starb, ging Joan wahrscheinlich durch die Hölle. In der Nähe von Shawmut lauerte die Bande einem Aufgebot aus Hickiwan auf, wo sie die Bank überfallen und den Kassier niedergeschossen hat. Zwei Männer wurden getötet, einer wurde schwer verwundet.“
Der Town Marshal studierte die Steckbriefe, dann heftete er den Blick auf Warren Elliott und sagte: „Die Steckbriefe liegen auch bei mir im Schreibtisch. Gila Bend liegt im Maricopa County. Haben Sie sich schon an den County Sheriff gewandt?“
„Nein. Der County Sheriff sitzt in Phönix, und er kann mir sicher nicht helfen. Wenn er die Fangprämie für die Banditen erhöht nützt mir das nichts. Ich sagte es doch, Marshal: Diese Halsabschneider haben meinen kleinen Neffen entführt. Darum darf ich keine Zeit verlieren.“
„Schon klar“, murmelte der Town Marshal und gab Warren Elliott die Steckbriefe zurück, schaute schweigend zu, wie dieser sie zusammenlegte und wieder einsteckte, dann zuckte er mit den hageren Schultern. „Die Kerle sind nicht in Maricopa Wells. Tut mir leid. Ich hätte es erfahren, wenn vier Reiter mit einem Knaben angekommen wären. Auch frage ich mich, wozu diese Banditen einen kleinen Jungen mit sich herumschleppen sollten. Das sind Gehetzte, Ausgestoßene, Verfemte. Jeder, der sie erkennt, darf ihnen ein Stück heißes Blei servieren. Der Junge wäre doch nur Ballast für diese Bastarde.“
„Die Chiricahuas kaufen weiße Knaben, die sie zu Kriegern züchten. Auch in Mexiko kaufen sie Kinder ...“
Der Town Marshal lachte gallig auf. „Geronimo und seine rothäutigen Renegaten treiben sich irgendwo in der Sierra Madre herum und haben mit sich selbst genug zu tun. Der Stern dieser roten Heiden ist am Verglühen. Was Mexiko anbetrifft, so liegt es südlich von Gila Bend. Da Sie annehmen, dass die Outlaws nach Norden geritten sind, müssten sie sich immens in der Richtung geirrt haben.“
Zuletzt klangen die Worte des Gesetzeshüters fast ein wenig spöttisch.
In dem Moment waren draußen Stimmen zu hören. Ein Mann schien ziemlich aufgeregt zu sein. Die Tür flog auf und ein mittelgroßer, dürrer Bursche stolperte ins Office. Sein Gesicht war von einem dichten Bartgeflecht überwuchert, so dass nur noch die große, gerötete Hakennase und die kleinen, listigen Augen zu sehen waren. Der Mann sah abgerissen, um nicht zu sagen verwahrlost aus.
Ihm folgte ein junger Bursche mit einem Sechszack an der linken Brustseite.
Der Town Marshal verdrehte die Augen. „Was ist mit dir schon wieder los, Randy?“, fragte er, schaute aber nicht den heruntergekommenen Burschen, sondern seinen Vertreter fragend an.
Der Deputy sagte: „Er hat schon wieder im Saloon gebettelt. Randy hat keinen rostigen Cent in der Tasche und kein Dach über dem Kopf. Ich habe ihn wegen Landstreicherei festgenommen.“
„Er hat mich hierher bugsiert wie einen ...“
„Halts Maul, Randy!“, schnitt der Town Marshal dem bärtigen Burschen schroff das Wort ab. „Du weißt, dass ich einige Regeln für diese Stadt festgelegt habe. So ist vor allem Betteln verboten. Himmel, wie oft habe ich dir schon geraten, das Saufen aufzuhören, dir eine Arbeit zu suchen und ...“
„Wer nimmt mich denn?“, krächzte Randy wie ein kranker Rabe und hob beide Hände. Eine Geste der Hilflosigkeit. Wahrscheinlich hatte der Trinker längst resigniert.
„Nun ja ...“ Der Town Marshal stemmte sich am Tisch in die Höhe. „Auf Landstreicherei steht eine Woche Gefängnis, Randy. Für dich eine gute Gelegenheit, deinen guten Willen zu zeigen und diesen Laden wieder mal richtig zu säubern.“ Der Gesetzesmann grinste markig. „Eigentlich bin ich ganz froh, dass es dich in unserer Stadt gibt.“
Warren Elliott empfand Mitleid mit dem alten Knaben, denn er glaubte Angst und Verzweiflung in seinen dunklen Augen zu erkennen. Wahrscheinlich ließ man ihn hier im Office eine Woche lang wie einen Sklaven schuften, um ihn dann wieder auf die Straße zu werfen. „Kommt an Stelle der Gefängnisstrafe auch eine Geldbuße in Frage?“, erkundigte sich Warren Elliott.
Die Brauen des Town Marshals schoben sich zusammen. „Randy kann sich mit zwanzig Dollar freikaufen. Aber zwanzig Dollar bringt er schätzungsweise in den nächsten fünf Jahren nicht zusammen. Was soll’s? Er ist bei mir im Jail gut aufgehoben.“
„Lassen Sie ihn laufen, Marshal. Ich bezahle das Geld.“
Von Randy kam ein überraschter Laut. Ungläubig starrte er Warren Elliott an. Dort, wo sein Mund vor Überraschung offen stand, klaffte das graue, verfilzte Bartgestrüpp auseinander.
Auch der Town Marshal und sein Vertreter zeigten sich erstaunt. „Sie wollen für ihn zwanzig Bucks berappen?“, stieg es geradezu ungläubig aus der Kehle des Marshals. „Das ist eine Menge Geld, Mister, dafür muss ein Cowboy zwei Drittel des Monats hinter Kuhschwänzen herjagen.“
Warren Elliott holte zwanzig Dollar aus seiner Brieftasche und legte sie auf den Schreibtisch. Eine Zehndollarnote hielt er Randy hin. „Kauf dir damit ein Ticket, Oldtimer, und fahre mit der Stagecoach in eine andere Stadt, in der die Stadtgesetze nicht ganz so restriktiv gehandhabt werden.“
Randy nahm den Zehner und ließ ihn blitzschnell in der Tasche seiner Weste verschwinden. „Dafür wird dich der Himmel belohnen, Mister“, entrang es sich ihm ergriffen. Er schniefte. Dann schaute er den Town Marshal an, sein Blick wurde trotzig, er schnarrte: „Jetzt kannst du deinen Dreck selbst hinausfegen, Sternschlepper. Und sei versichert, dass ich die nächste Kutsche nehme ...“
Randy schoss Warren Elliott noch einen dankbaren Blick zu, dann wirbelte er herum und rannte aus dem Office. Krachend flog hinter ihm die Tür zu. Es mutete an wie eine Flucht.
„Die zwanzig Bucks haben Sie zum Fenster rausgeworfen, Mister“, murmelte der Marshal. „Und damit, dass Sie Randy zehn Dollar obendrein schenkten, haben Sie ihm ganz sicher keinen Gefallen erwiesen. Ich glaube nicht, dass er es bis zur Postkutschenstation schafft. Er wird das Geld – hm, in Brandy anlegen.“
Warren Elliott winkte ab. „Ich werde mich ein wenig in Maricopa Wells umhören, Marshal. Dagegen haben Sie doch sicher nichts einzuwenden.“
„Grundsätzlich nicht. Doch wenn Sie wider Erwarten fündig werden sollten, rate ich Ihnen, mich zu informieren, ehe Sie auf eigene Faust loslegen. Wenn in Maricopa Wells die Kugeln fliegen, dann nicht ohne meine Beteiligung. Andernfalls kann ich höllisch ungemütlich werden. Ich denke, wir verstehen uns, Mister – äh ...“
„Elliott – Warren Elliott.“
„Danke. Halten Sie sich an die Regeln, die in meiner Stadt gelten, Elliott. Dann, schätze ich, können wir beide gut miteinander auskommen.“
*
Als Warren Elliott sein Pferd losband, wurde er angerufen. „He, Fremder!“ Er drehte den Kopf und sah in der Mündung einer Gasse Randy, den Trinker. Elliott nahm den Rotfuchs am Kopfgeschirr und führte ihn zu der Gassenmündung. „Warum sind Sie nicht unverzüglich zur Postkutschenstation gelaufen, Randy?“
„Ich werde Maricopa Wells verlassen, Mister. Aber ich wollte nicht verschwinden, ohne Ihnen danke zu sagen. Noch nie war jemand gut zu mir. Mein ganzes Leben lang bin ich nur hin und her geschubst worden. Wenn du nichts bist und wenn du nichts hast ...“
„Jeder ist selbst seines Glückes Schmied, Randy.“
„Ich weiß, ich weiß. Aber auch Sie sehen nicht aus wie einer, der ein Leben in Ruhe und Beschaulichkeit führt. An Ihnen klebt der Staub der Maricopa Berge. Glühende Hitze, Staub, Skorpione und Klapperschlangen. Kein Mensch, der nicht einen besonderen Grund hat, begibt sich freiwillig in diese Hölle. Erst gestern Nachmittag kam ein Kerl daher. Sein Pferd hatte ein Hufeisen verloren und der Hombre war halb verdurstet. Ich ...“
„Auch er kam von Süden herauf?“
„Ja. Der arme Hund war ziemlich am Ende. Ich habe ihn angesprochen und ihn gefragt, ob ich ihm helfen könnte. Ich spreche des Öfteren mal Fremde an, denn hin und wieder springen ein paar Cent für mich heraus. Der Kerl aber war ausgesprochen unfreundlich und meinte, dass ich mich zum Teufel scheren solle.“
„Wie sah der Mann aus?“ Warren Elliott verspürte eine seltsame Erregung. Sein Herz schlug einige Takte schneller, in ihm war eine jähe, vibrierende Ungeduld.
Randy wiegte den Kopf, dann murmelte er: „Anfang dreißig, dunkelhaarig, sechs Fuß groß, schmales, kantiges Gesicht ... Ich denke, es handelte sich um einen ziemlich hartbeinigen Hombre. Er trug den Revolver ziemlich tief geschnallt. Wenn Sie mich fragen, haftete ihm der Geruch von Pulverdampf an. Ein zweibeiniger Wolf ...“
Warren Elliott zog die Steckbriefe aus der Tasche, reichte sie Randy und sagte: „Sehen Sie sich die Gesichter der Kerle an, Randy. Vielleicht ist das Bild des Burschen dabei.“
Der Oldtimer faltete die vergilbten Blätter auseinander, heftete seinen Blick auf das Bild, schüttelte den Kopf und nahm sich den nächsten Steckbrief vor. „Das ist er“, stieß er hervor. „Das ist der Hombre, der mit dem lahmen Gaul aus der Wildnis kam. He, sind Sie ein Sheriff oder vielleicht sogar ein Staatenreiter? Heiliger Bonifatius! Man wirft diesem Burschen Raub und Mord vor. Da hatte ich ja direkt Glück, dass er mich nicht abknallte, als ich ihn ansprach.“
„Bei Ihnen ist nichts zu holen, Randy“, versetzte Warren Elliott und ein starres, kaum wahrnehmbares Lächeln umspielte seine trockenen, rissigen Lippen. Er nahm die Steckbriefe, schaute den obersten an und murmelte: „Sam Higgins. – Haben Sie eine Ahnung, wohin der Bursche sich gewandt hat, Randy?“
„Ich vermute, dass er sich zum nächsten Hufschmied begeben hat. Es gibt zwei in Maricopa Wells. Soll ich Sie zu ihnen führen?“
„Ich bitte darum, Randy.“
In der Zwischenzeit war die Sonne untergegangen. Ihr Widerschein ließ den Himmel über den Bergen im Westen purpurn glühen. Die Schatten waren verblasst, auf dem ganzen Land lag ein rötlicher Schein und verlieh ihm einen besonderen Zauber.
Warren Elliott schritt neben dem Trinker her die Main Street hinunter. Den Rotfuchs führte er am Zaumzeug. Unter ihren Schritten mahlte der feine Sand, der sich, wenn es regnete, in knöcheltiefen Schlamm verwandelte.
Schon der erste Schmied, zu dem Randy den Mann aus Gila Bend führte, sagte: „Ja, der Bursche war bei mir. Ich habe seinem Gaul ein neues Eisen verpasst. Schien mir ein recht mürrischer Zeitgenosse zu sein. Ich habe versucht, ein paar belanglose Worte mit ihm zu wechseln, aber er zeigte sich wortkarg und einsilbig. Also gab ich es auf.“
„Nannte er ein Ziel?“, erkundigte sich Warren Elliott.
„Er fragte lediglich, wo er in Maricopa übernachten könnte. Ich nannte ihm Sulvers Hotel.“
„Dann will ich mich dort mal nach dem Burschen erkundigen“, knurrte Warren Elliott und fixierte den Trinker. „Zeigen Sie mir den Weg, Randy?“
„Betätigst du dich jetzt als Fremdenführer, Randy?“, fragte der Schmied mit einem breiten Grinsen. „Seit wann ernährt ein solcher Job seinen Mann?“
Randy schoss ihm einen vernichtenden Blick zu, dann krächzte er: „Lach nur, Hanson. Gib aber Acht, dass dir das Lachen eines Tages nicht vergeht. Ich ... Ach was!“ Randys Rechte wischte wegwerfend durch die Luft. „Kommen Sie, Mister. Ich bringe Sie zu Sulvers Hotel.“
Wenig später stellte Warren Elliott dem Rezeptionisten im Hotel die Frage nach Sam Higgins. Der Mann sagte: „Seit gestern sind bei mir vier Leute abgestiegen. Einer mit dem Namen Higgins ist nicht dabei.“ Er griff unter den Tresen und holte das Gästebuch hervor, schlug es auf und blätterte die Seite mit den letzten Eintragungen her. „Hollister“, las er, „Hellman, Coulter, McAllister. Das sind die Namen der Männer, die gestern bei mir eincheckten.“
Warren Elliott zeigte dem Mann den Steckbrief von Sam Higgins. Der Rezeptionist betrachtete sich das Bild eingehend, dann nickte er. „Es könnte sich um McAllister handeln. Er ist heute Früh weitergeritten.“ Wie zur Bestätigung seiner weiteren Worte nickte er ein weiteres Mal. „Ja, das ist McAllister.“ Er kratzte sich hinter dem Ohr. „Heiliger Rauch! Wenn ich gewusst hätte, wen ich beherberge ...“
„Erzählte er Ihnen, wohin er sich wenden wollte?“, fragte McQuade.
„Nein. McAllister – ich meine Sam Higgins war ausgesprochen schweigsam. Ein düsterer Bursche, der ungute Gefühle in einem weckt. Ich ahnte gleich, dass mit ihm etwas nicht stimmt.“
„Wo hatte er sein Pferd untergestellt?“
„Im hoteleigenen Stall. Sprechen Sie mal mit dem Pferdeknecht. Vielleicht weiß er mehr.“
Sie begaben sich in den Stall. Bei dem Stallmann handelte es sich um einen bärtigen Oldtimer mit schadhaftem Gebiss, der unablässig auf einem Priem herumkaute. Auf Warren Elliotts Frage antwortete er: „Er fragte mich, wie er auf dem schnellsten Weg nach Bradford Well käme.“
„Das sind gut und gerne hundert Meilen!“, entfuhr es Warren Elliott.
„Ja, hundert Meilen sind es wohl“, pflichtete der Stallbursche bei. „Ich habe McAllister die Poststraße empfohlen, die am Centennial Wash entlang nach Nordwesten führt.“
„Ich kenne diesen Weg“, murmelte Warren Elliott. Nachdem sie den Stall verlassen hatten, fragte der Mann aus Gila Bend: „Was treibt den Banditen nach Bradford Well? Wenn sein Pferd lahmte, währe es doch das Normalste auf der Welt gewesen, dass seine Kumpane irgendwo außerhalb der Stadt auf ihn gewartet hätten.“
„Ich kann Ihnen die Antwort auf Ihre Frage nicht geben“, krächzte Randy. „Aber kann es nicht sein, dass sich die Bande getrennt hat und dass die Kerle vereinbarten, sich in Bradford Well zu treffen. Immerhin werden sie hier im Arizona-Territorium gejagt wie tollwütige Hunde.“
„Sicher“, murmelte Warren Elliott versonnen. „Das ist nicht von der Hand zu weisen. – Danke, Randy. Ich werde mir im Hotel ein Zimmer nehmen und morgen Früh ziemlich zeitig aufbrechen. Sie sollten meinen Ratschlag beherzigen und Maricopa Wells verlassen. Hier kriegen Sie keinen Fuß auf den Boden. Und versuchen Sie, künftig die Finger vom Brandy zu lassen.“
„Sie sind ein guter Mann“, versetzte Randy. „Ich werde für Sie beten.“
Die beiden Männer verabschiedeten sich mit einem Händedruck voneinander, Warren Elliott holte seine Satteltaschen und das Gewehr und begab sich in die Hotelhalle.
*
Als die Sonne ihre ersten wärmenden Strahlen über die Hügel im Osten ins Land schickte, verließ Warren Elliott die Ortschaft. Um die Mitte des Vormittags erreichte er die Quelle des Waterman Wash. Der Creek war nahezu ausgetrocknet und nur noch ein Rinnsal. Er folgte ihm nach Nordwesten. Rechter Hand erhoben sich die bizarren Felsgebilde der Sierra Estrella. Auf dem Gras glitzerte noch der Tau. In den Büschen zwitscherten die Vögel.
Sam Higgins hatte einen Vorsprung von vierundzwanzig Stunden. Warren Elliott sagte sich, dass es der Bandit nicht besonders eilig haben würde, denn er hatte keine Ahnung, dass er verfolgt wurde. Wenn er Glück hatte, holte er ihn vielleicht noch vor Bradford Well ein.
Warren Elliott ritt schnell, war aber darauf bedacht, den Rotfuchs auf keinen Fall zu verausgaben. Die Sonne kletterte unaufhaltsam ihrem höchsten Stand entgegen. Das Land lag unter einem flirrenden Hitzeschleier. Schweißgeruch zog ganze Schwärme kleiner Stechmücken an. Die Hitze sog Pferd und Reiter geradezu das Mark aus den Knochen. Hin und wieder ließ der Mann aus Gila Bend das Tier saufen, ab und zu saß er ab und wusch sich den Schweiß aus dem Gesicht. Sein Hemd war unter den Achseln und zwischen den Schulterblättern durchnässt. Der Ritt war eine Tortur für Pferd und Reiter.
Schließlich stand die Sonne fast senkrecht über dem einsamen Reiter. Halbrechts vor ihm – vor einem lang gezogenen Hügel - lagen die Gebäude einer Ranch. Das Haupthaus besaß kein Stockwerk, das Dach war flach, vor zwei Fenstern hingen die Läden schief in den Angeln. Es gab einige Schuppen und einen Stall. Ein teilweise zusammengebrochener Corral war verwaist. Wie es schien, war die Ranch verlassen. Alles wirkte grau in grau. Die Ranch war dem Verfall preisgegeben. Dennoch entschloss sich Warren Elliott, hinzureiten.
Auf dem sandigen Hof zwischen den verfallenden Gebäuden wuchs hüfthoch das Unkraut. Der heiße Südwind trieb Staubspiralen vor sich her. Tumbleweeds, die der Wind aus der Wildnis herangetragen hatte, hatten sich an den Wänden der Hütten oder im Unkraut verfangen.
Warren Elliott fiel dem Rotfuchs abrupt in die Zügel, als aus einer der Fensterhöhlungen ein Gewehrlauf geschoben wurde und eine klirrende Stimme rief: „Steig von deinem Gaul und heb die Flossen zum Himmel! Wenn du zur Waffe greifst, stirbst du. Ich spaße nicht. Also mach schon, Mister, oder muss ich dir erst ein paar Bleistücke um die Ohren knallen.“
Warren Elliott wollte, als er den Gewehrlauf wahrnahm, automatisch nach der Winchester greifen, aber sein Verstand holte diesen Reflex ein. Er legte die Hände aufs Sattelhorn und verlagerte das Gewicht seines Oberkörpers auf die durchgestreckten Arme. Sein Blick hatte sich an dem kleinen Fenster verkrallt. Der Stahl des Gewehrlaufes glitzerte frostig im Sonnenlicht. Von dem Mann, der die Winchester hielt, konnte Warren Elliott nichts sehen. Er rief: „Du musst von mir nichts befürchten, Hombre. Ich bin ein harmloser Pilger auf dem Weg nach Bradford Well. Ich dachte, dass ich auf dieser Ranch etwas Schatten finden würde, denn ich wollte mir und meinem Pferd eine Stunde Ruhe gönnen. Lebst du hier, Mister?“
„Ja, ich lebe hier. Erst gestern war einer hier, dem es gelungen ist, mir Sand in die Augen zu streuen. Er kam zu Fuß an. Sein Gaul war irgendwo in der Ödnis in einen Präriehundbau getreten und hatte sich das Bein gebrochen. Er musste es erschießen. Nun, ich wollte dem Burschen helfen und bot ihm eines meiner drei Pferde an. Außerdem schlug ich ihm ein halbes Dutzend Eier in die Pfanne. Er fraß sich voll, und dann hielt er mir seine Gürtelkanone unter die Nase. Nun sind meine drei Pferde und mein guter Sattel fort. Bis Buckeye sind es fünfzehn Meilen. Diese Strecke schafft kein Mensch zu Fuß. Ich sitze hier fest. Du kommst mir mit deinem Gaul also wie gerufen, Sonny. Doch jetzt steig ab und hebe die Hände. Oder muss ich dir Beine machen?“
In den letzten Worten lag eine unüberhörbare, tödliche Drohung. Die Anspannung, die von Warren Elliott Besitz ergriff, bereitete ihm geradezu körperliches Unbehagen. Er war dem Kerl im Ranchhaus auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Die Situation erforderte eine rasche Entscheidung. Hinter Warren Elliotts Stirn wirbelten die Gedanken. Ihm war klar, dass ein kleiner Fingerdruck genügte, um ihm den flammenden Tod zu schicken.
Er musste Zeit gewinnen.
Angesichts der drohend auf ihn gerichteten Winchester gab es im Moment keine andere Möglichkeit als sich zu fügen. Warren Elliott nahm die Hände in die Höhe, hob das rechte Bein über das Sattelhorn und ließ sich vom Pferderücken gleiten.
„Geh drei Schritte vom Gaul weg!“, gebot der Bursche im Haus. Seine Stimme hatte jetzt den Klang brechenden Stahls.
Warren Elliott gehorchte. Jeder seiner Sinne war aktiviert, seine Muskeln und Sehnen waren gestrafft. Sein Gesicht war wie aus Granit gemeißelt. Von seinen Zügen war nicht abzulesen, wie sehr er sich das Hirn nach einem Ausweg zermarterte. „Der Kerl, der dir die Pferde gestohlen hat – war er etwa dreißig, sechs Fuß groß und dunkelhaarig?“
Der Gewehrlauf verschwand aus der Fensterhöhlung.
Warren Elliott ergriff die Chance, die sich ihm bot. Er rannte zu einem Schuppen. Aus den Augenwinkeln sah er eine Gestalt in der Tür des Ranchhauses. Ein Schuss krachte. Das Mündungslicht verschmolz mit dem grellen Sonnenlicht, der peitschende Knall stieß über den Hof. Geistesgegenwärtig hatte sich Warren Elliott in den Staub geworfen. Das Geschoss pfiff über ihn hinweg. Die Detonation rollte hinaus in die Wildnis und wurde von den hallenden Echos vervielfältigt, bis sie mit leisem, geisterhaftem Raunen verebbte.
Behände war Warren Elliott in den Schutz des Schuppens gekrochen. Er zog den schweren Coltrevolver und spannte den Hahn. klickend drehte sich die Trommel um eine Kammer weiter.
Sein Gegner war aus der Tür des Ranchhauses verschwunden. Er ließ seine Stimme erklingen: „Freu dich nur nicht zu früh, Mister. Ich kriege den Gaul. Und du bleibst hier zurück – und zwar tot.“
„Noch lebe ich, mein Freund!“, versetzte Warren Elliott grollend. „Und du darfst mir glauben, dass ich es dir nicht leicht machen werde. Kaum vorstellbar, dass du hier lebst, Hombre. Was sichert deinen Lebensunterhalt? Ich habe nicht ein einziges Rind in der Nähe der Ranch gesehen.“
Der Bursche im Ranchhaus schwieg.
Warren Elliott wurde schlagartig klar, dass der Kerl ernst machte. Er wollte das Pferd, und um in seinen Besitz zu gelangen ging er notfalls über Leichen – über seine, Warren Elliotts Leiche.
Es ging um Leben oder Tod.
Warren Elliott stellte sich auf den Kampf ein. Etwas in ihm verhärtete, ein entschlossener Zug brach sich Bahn in sein kantiges Gesicht ...
*
Warren Elliott kauerte im Schatten der Hütte. Eng schmiegte er sich an die Holzwand. Die Hand mit dem Revolver hielt er in Gesichtshöhe, die Mündung wies zum Himmel. Er fürchtete seinen Gegner nicht, war aber auch nicht so dumm, ihn zu unterschätzen. Deshalb war er konzentriert und auf blitzschnelle Reaktion eingestellt.
Sein Pferd stand mitten im Ranchhof und hatte den Kopf erhoben, als witterte es irgendetwas. Auf den Nieten des Sattels und des Zaumzeugs brach sich das Sonnenlicht. Ungeschützt war das Tier der prallen Sonne ausgesetzt.





























