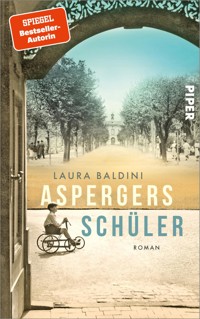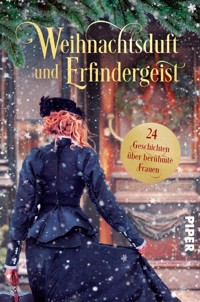
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das perfekte Geschenk für alle Mütter, Schwestern und Freundinnen. Ein Adventskalender über berühmte Frauen, eine Reise durch die Jahrhunderte mit unterschiedlichen Weihnachtsfesten und Traditionen. »Wien glitzerte in vorweihnachtlicher Pracht. In den Einkaufsstraßen standen geschmückte Christbäume, der Duft nach Zimt und gebrannten Nüssen strömte aus den Konditoreien, und die zarte Schneehaube tat ihren Rest dazu, Wien in die Kulisse eines Weihnachtsmärchens zu verzaubern.« Nichts ist schöner als die Vorfreude auf Weihnachten! Gemütlich mit einer Tasse Tee auf dem Sofa kann mit diesen 24 Kurzgeschichten über beeindruckende Frauen die Zeit bis Heiligabend wunderbar genossen werden. Maria Montessori backt Panettone, Audrey Hepburn tanzt im Nussknacker, Margarete Steiff baut eine besondere Krippe mit ihren Teddybären und die Queen schreibt eine Weihnachtsrede in Sandringham und viele weitere herzerwärmende Geschichten über inspirierende Frauen. Der Zauber von Weihnachten weht durch die Seiten, für jeden Tag ein kleines Abenteuer voller Weihnachtsduft und Erfinderinnengeist. Plus Bonuskapitel für die Feiertage! Kurzgeschichten von Bestsellerautorinnen wie Laura Baldini, Eva-Maria Bast und Bettina Storks und vielen weiteren. »Die Autorinnen haben hier ein bezauberndes Werk geschaffen. Zum am Stück weglesen oder auch für jeden Tag eine Geschichte. Einige Frauen waren mir unbekannt, ihre Stories aber so interessant, dass ich unbedingt mehr über sie erfahren will. Ein bezauberndes Buch, welches mich gehörig in Weihnachtstimmung versetzt hat. Ein etwas anderer, aber ein wirklich ansprechender Adventskalender, ein schönes Geschenk zur Vorweihnachtszeit. Ich möchte es allen Leserinnen ans Herz legen, die etwas andere Adventskalender mögen.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Wenn die Charaktere jemanden sehr interessieren, es gibt zu jedem Charakter beim Piper Verlag einen ganzen Roman, die sehr zu empfehlen sind. Ich selbst habe schon einige davon gelesen und diese Kurzgeschichten können einem Lust auf mehr machen. Diesem Kurzgeschichtenband vergebe ich 5 Sterne und empfehle es als perfekte Lektüre als Adventskalender. Damit machen Sie nichts verkehrt!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Weihnachtsduft und Erfindergeist. 24 Geschichten über berühmte Frauen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Michaela Retetzki
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Covermotiv: Guter Punkt, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com und Getty Images PlusAlle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
Maria Montessori – Der Duft von Panettone
Maria Tecla Artemisia Montessori – Biografie
2
Audrey Hepburn – Das Kleid der Zuckerfee
Audrey Hepburn – Biografie
3
Irena Sendler – Ein Weihnachtswunder in der Tram
Irena Sendler – Biografie
4
Anna Freud – Londoner Weihnachten
Anna Freud – Biografie
5
Mata Hari – Schneeflocken sind Engelsküsse
Mata Hari – Biografie
6
Ada Lovelace – Es gibt keine Geister, Mr Dickens!
Ada Lovelace – Biografie
7
Nellie Bly – Allen Widerständen zum Trotz
Nellie Bly – Biografie
8
Hildegard von Bingen – Die Stadt hinter dem Stall
Hildegard von Bingen – Biografie
9
Sophie Charlotte von Bayern – Ein Veilcheneis an Heiligabend
Sophie Charlotte in Bayern – Biografie
10
Rosalind Franklin – Ein Schneemann in Südfrankreich
Rosalind Franklin – Biografie
11
Josephine Brunsvik – Weihnachten mit der unsterblichen Geliebten
Josephine Brunsvik – Biografie
12
Marie Tussaud – Der Weihnachtsengel
Marie Tussaud – Biografie
13
Josephine Peary – Nachthunde
Josephine Peary – Biografie
14
Dian Fossey – Weihnachtsgeschenke in Karisoke
Dian Fossey – Biografie
15
Alice von Battenberg – Ein Weihnachtsbrief von der Front
Alice von Battenberg – Biografie
16
Dora Maar – Schlingen Sie um Ihre Fesseln das Herz Ihres ergebensten Bewunderers
Dora Maar – Biografie
17
Bertha von Suttner – Kinder des Schicksals
Bertha von Suttner – Biografie
18
Hermine Heusler-Edenhuizen – Der Engel mit dem Lichterbaum
Hermine Heusler-Edenhuizen – Biografie
19
Karen Blixen – Die Sterne leuchten überall
Karen Blixen – Biografie
20
Emily Warren Roebling – Sieben Schneeschaufler schaufeln sieben Schaufeln Schnee
Emily Warren Roebling – Biografie
21
Margarete Steiff – Giengener Krippenspiel
Margarete Steiff – Biografie
22
Estée Lauder – Die Frau vom Weihnachtsmann
Estée Lauder – Biografie
23
Lale Andersen – Lales Weihnachtswunder
Lale Andersen – Biografie
24
Astrid Lindgren – Wer braucht schon einen Tannenbaum?
Astrid Lindgren – Biografie
25
Queen Elizabeth II. – Die erste Weihnachtsbotschaft im Fernsehen
Queen Elizabeth – Biografie
26
Katharine Hepburn – Tausend Lichter über dem Broadway
Katharine Hepburn – Biografie
Autorenviten
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Maria MontessoriDer Duft von Panettone
Laura Baldini
Rom, 1909
Seit Wochen herrschte im Casa dei Bambini im Arbeiterviertel San Lorenzo in Rom eine fröhliche Vorfreude. Es war das zweite Weihnachtsfest, das die Kinder hier gemeinsam feierten. Im vorletzten Sommer hatten die Stadtväter Roms die Schule eröffnet. Es handelte sich um ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Maria Montessori, die international renommierte italienische Ärztin, die sich auch als Pädagogin einen Namen gemacht hatte, leitete das Projekt. Ziel war es, die unbeaufsichtigten Kinder der Arbeiterfamilien von der Straße zu holen, damit das generalsanierte Stadtviertel nicht sofort wieder verwüstet wurde.
Die Erziehungsmethoden, die die junge, engagierte Ärztin anwandte, waren nicht unumstritten. Sie ging völlig neue Wege in der Pädagogik und war davon überzeugt, dass Kinder von sich aus lernen wollten. Von Zwang und Strafen hielt sie nichts. Ihre Methoden zeigten bei den meisten Kindern Erfolg.
Eines ihrer Sorgenkinder war im Moment Giovanni. Während sich alle anderen Kinder an den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest beteiligten, weigerte sich Giovanni mitzuhelfen. Dabei war er stets ein aufgeweckter Junge gewesen. Irgendetwas schien ihn zu bedrücken, doch er wollte nicht darüber reden. Hartnäckig lehnte er Marias Angebote ab.
»Giovanni, willst du Anna nicht beim Putzen unterstützen? Wir wollen doch, dass der Unterrichtsraum bei der Weihnachtsfeier glänzt.«
Mit finsterem Gesicht schüttelte der Junge den Kopf.
»Ein paar Tannenzweige aufhängen und mit Goldsternen schmücken?«
Wieder verneinte der Junge.
»Ein Musikstück einstudieren?« Im Nebenraum probten drei Kinder Tu scendi dalle stelle. Der Klang von Flöten wurde immer wieder von fröhlichem Lachen unterbrochen.
Giovanni hatte auch dazu keine Lust. Stattdessen setzte er sich in eine Ecke und widmete sich halbherzig einer Mathematikaufgabe. Maria konnte sehen, dass er unkonzentriert war. Keine der Rechenaufgaben würde richtig gelöst sein. Warum ließ sich der Junge von der Vorfreude der anderen nicht anstecken? Gab es ein tragisches Ereignis in seiner Familie? Davon hätte Maria gehört. In diesem Stadtteil blieb nichts lange geheim. Die Bewohner kannten die großen und kleinen Geheimnisse ihrer Nachbarn. Es gab keinen von außen ersichtlichen Grund, warum sich der Junge in diesem Jahr nicht auf Weihnachten freuen konnte. Im letzten Jahr war er eines von den Kindern gewesen, die es nicht hatten erwarten können, die ersten Goldsterne auszuschneiden.
»Ich weiß, womit ich dich begeistern kann.« Maria startete einen weiteren Versuch. »Am Nachmittag backen wir Pandoro und Panettone.«
Giovannis großer Traum war es, eines Tages Zuckerbäcker zu werden. Er liebte die Düfte einer Backstube und interessierte sich für Rezepte aller Art. Im letzten Jahr hatte er zu Weihnachten wunderschöne Lebkuchenherzen gebacken. Doch in diesem Jahr konnte nicht einmal die Aussicht auf den Höhepunkt des Advents seine Laune heben.
»Ich mag keinen Panettone«, sagte er leise.
»Das glaube ich dir nicht«, widersprach Maria. »Komm am Nachmittag vorbei und beweise es mir.«
Giovanni antwortete nicht, doch Maria ging davon aus, dass er sich den Nachmittag nicht entgehen lassen würde.
Kurz vor fünf schoben Maria und ihre Mitarbeiterin Sophia mehrere Tische in den Unterrichtsraum. Sie holten Mehl, Zucker, Rosinen, Nüsse und kandierte Marillen aus der Küche.
Als die ersten Kinder zurück in die Schule kamen, war alles vorbereitet.
»Ich will den Teig kneten«, rief Luigi und zappelte vor Begeisterung am Stand.
»Aber zuvor heißt es Händewaschen!« Maria schickte alle in den Waschraum. Suchend sah sie sich um. Wo war Giovanni? Wollte er wirklich nicht kommen? Der Junge liebte Süßigkeiten, er schwärmte für Panettone.
»Weiß jemand, warum Giovanni nicht hier ist?«, fragte Maria die anderen Kinder.
Keines hatte eine Antwort.
Es wurde ein lustiger Nachmittag, bei dem eine Menge Mehl auf dem Boden landete und die Kinder ausgelassen Teig kneteten und Rosinen sowie Nüsse naschten. Schon bald duftete es im Unterrichtsraum nach Vanille, Zucker und Hefe. Während der Hefeteig ruhte, wurde der Raum wieder sauber gefegt. Ein paar Kinder stimmten dazu ein Weihnachtslied an. Maria ließ ihren Blick immer wieder zur Tür und zum Fenster gleiten. Wo blieb Giovanni? Sie machte sich Sorgen. Als Sophia mit zwei der Jungs die ersten Kuchenformen in die Küche trug, meinte Maria ein trauriges Kindergesicht am Fenster zu sehen. Eine helle Nase war platt gegen die Fensterscheibe gedrückt. Sofort sprang sie auf und eilte zur Tür. Aber das Kind war weg. Sie konnte nur noch die Schritte vernehmen, die in der Dunkelheit verklangen. Jemand lief eiligst davon. Maria war sich sicher, dass es Giovanni gewesen war.
Am nächsten Morgen erschien er nicht zum Unterricht. Es war höchste Zeit, bei der Familie nachzufragen. Maria würde mit den Eltern reden müssen.
Als am späten Nachmittag alle Kinder die Schule verlassen hatten, machte sich Maria auf den Weg. Die Familie Lamponi wohnte in dem Viertel von San Lorenzo, das noch nicht saniert worden war. Erst im kommenden Jahr würde man die Barracken abreißen und moderne, hübsche Mietshäuser errichten. Im Moment gab es kein fließendes Wasser, die Wohnungen waren beengt und feucht. Es stank nach Schimmel und billigem Essen. Auf Leinen, die zwischen den Häusern gespannt waren, hing Wäsche, die bei diesen Temperaturen niemals trocknen würde. Die Menschen schlüpften in nasse Kleidung. Gaslaternen zwischen den Wohnblocks flackerten und boten nur notdürftig Licht. Im dritten Stockwerk eines baufälligen Gebäudes fand Maria Giovannis Zuhause. Sie war noch nie bei ihm gewesen und kannte nur Giovannis Mutter von der Schuleinschreibung.
Beherzt stieg Maria die wackelige Treppe hoch, klopfte an die Tür und lauschte. Es war ungewöhnlich still für eine siebenköpfige Familie. Maria klopfte noch einmal.
Eine Frau mit grauem, müdem Gesicht öffnete. »Ja bitte?«
»Guten Abend, ich bin Maria Montessori, die Lehrerin Ihres Sohnes. Darf ich eintreten?«
Überraschung machte sich auf dem Gesicht breit. Widerwillig öffnete die Frau die Tür weiter.
»Ist Giovanni zu Hause?«
»Nein.«
»Wo ist er um diese Zeit noch?«
»Ich dachte, er sei in der Schule.«
Ein Mann trat aus dem Nebenzimmer. »Wenn es Probleme mit ihm gibt, dann geben Sie uns Bescheid«, meinte er finster. »Der Junge stellt nur Unfug an. Er hat eine Lektion verdient.«
»Was für Unfug?«, fragte Maria vorsichtig. Sie entschied sich, vorerst nichts von Giovannis Fernbleiben vom Unterricht zu erzählen. Sie wusste, dass in vielen Familien Gewalt an der Tagesordnung stand. Die meisten Eltern waren der Meinung, dass eine Strafe die Kinder zu besseren Menschen machen würde.
»Er hat unser Weihnachtsessen ruiniert«, sagte der Vater verärgert.
»Wie kann das sein?«, fragte Maria.
»Ich habe die Einkäufe in die Küche gestellt«, erklärte die Mutter leise. Sie wirkte bei Weitem nicht so grantig wie ihr Mann. »Mehl, Eier, Zucker. Eben alles, was ich für einen Panettone benötige. Als wir alle in der Fabrik waren, hat sich Giovanni darangemacht, einen Panettone für uns zu backen. Aber dabei ist alles schiefgelaufen, was nur danebengehen kann. Der Kuchen ist verbrannt. Jetzt haben wir keine Zutaten mehr für einen neuen. Das Geld reicht nicht für einen weiteren Einkauf. Wir werden Weihnachten ohne Nachspeise feiern.«
»Ich hätte ihm einen Tracht Prügel verabreichen sollen«, schimpfte Herr Lamponi.
»Warum?«, fragte Maria entsetzt. »Meinen Sie nicht, der Junge hat schon genug Strafe erhalten?«
»Haben Sie ihn etwa verprügelt?« Giovannis Vater wirkte überrascht.
»Gott bewahre!«, rief Maria. »Natürlich nicht.«
»Was hat er dann für eine Strafe bekommen?«
»Stellen Sie sich vor, was in Ihrem Jungen jetzt vorgeht«, bat Maria. »Statt seiner Mutter zu helfen, wie er es zweifellos vorgehabt hatte, hat er das Weihnachtsessen für die ganze Familie ruiniert. Bestimmt hat er die ganze Nacht geweint. Mir scheint, dass das Strafe genug ist.«
Beide Eltern starrten Maria erstaunt an. Schließlich sagte Herr Lamponi: »So einen Unsinn habe ich noch nie gehört.« Doch er sprach sehr leise, und Maria hoffte, dass er über ihre Worte zumindest nachdenken würde.
»Weshalb sind Sie eigentlich gekommen?«, fragte Frau Lamponi.
Zum Glück hatte Maria ein Rechenheft in ihrer Tasche. Giovannis Eltern würden nicht erkennen, dass es sich nicht um das Heft ihres Sohnes handelte. Sie legte es auf den Küchentisch.
»Und deshalb sind Sie extra den Weg zu uns gelaufen?« Misstrauisch musterte Herr Lamponi sie.
»Ihre Wohnung lag auf dem Weg.« Maria log, ohne mit der Wimper zu zucken, dann verabschiedete sie sich und ging wieder. Gerade als sie das traurige Wohnhaus verlassen und auf die Straße treten wollte, kam ihr Giovanni entgegen. Er hielt erschrocken inne.
»Wo warst du?«, wollte Maria wissen. »Wir haben dich in der Schule vermisst.«
Verlegen starrte der Junge auf seine löchrigen Schuhe. Unruhig trat er von einem Fuß auf den anderen. »Ich habe Arbeit gesucht«, gestand er schließlich.
»Um einen frischen Panettone zu kaufen?«
Beschämt nickte Giovanni.
»Hast du denn Arbeit gefunden?«, fragte Maria sanft. Es war falsch, dass ein achtjähriger Junge nach Arbeit suchte. Er gehörte in die Schule, wo er rechnen, lesen und schreiben lernen sollte.
Niedergeschlagen zuckte Giovanni mit den Schultern. »Der Gemüsehändler hat mich den ganzen Nachmittag Kisten schleppen lassen, aber er hat mich nicht dafür bezahlt.«
»Er hat dich nicht entlohnt?«
»Zwei Kilo verschrumpelte Äpfel hat er mir gegeben, mehr nicht«, sagte Giovanni. Tränen traten in seine Augen. Er hob eine Papiertüte hoch.
»Morgen gehst du nicht mehr zum Gemüsehändler«, sagte Maria streng. »Der Mann nutzt dich bloß aus.«
»Aber dann haben wir zu Weihnachten keinen Panettone.«
»Dann ist es eben so«, sagte Maria. »Viel wichtiger ist es, dass eure Familie zusammen ist und gemeinsam feiert.«
Die ersten Tränen kullerten über Giovannis eingefallenen Wangen. »Meine Familie sieht das anders.«
Leider konnte Maria dem Jungen nicht widersprechen. »Ich wünsche mir von dir, dass du morgen wieder in die Schule kommst«, sagte sie ernst. »Kisten schleppen ist eine Aufgabe für erwachsene Männer, aber nicht für kleine Jungen, hast du mich verstanden?«
Giovanni schluckte bloß.
»Und ich will, dass du bei unserer Weihnachtsfeier dabei bist.« Maria wartete so lange, bis Giovanni nickte.
»Versprochen?«
Er reichte ihr zur Bekräftigung die Hand, erst dann wünschte Maria ihm einen schönen Abend.
Tatsächlich kehrte der Junge am nächsten Tag zurück zum Unterricht. An diesem Vormittag konnte sich kaum ein Kind auf die Arbeit konzentrieren. Alle fieberten auf den Nachmittag hin. Als es draußen dunkel wurde, war es endlich so weit. Die Kerzen auf dem Tisch wurden angezündet, die zwei großen Panettoni und ein Pandoro hereingetragen. Es gab heiße Limonade in schönen Gläsern. Gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen. Die goldenen Weihnachtssterne funkelten im Kerzenschein. Es roch nach Tannenreisig. Der Duft mischte sich mit dem Vanille- und Zimtaroma der Panettoni.
Luigi durfte den ersten Panettone aufscheinen und auf die weißen Porzellanteller verteilen. Reihum wurden die kleinen Stücke weitergegeben. Alle freuten sich auf die süße Köstlichkeit, nur Giovannis Gesicht blieb ernst. Auch der zweite Kuchen, ein goldbraun glänzender Pandoro, wurde in gleich große Stücke geschnitten. Sie waren winzig klein. Keines der Kinder schien sich daran zu stören, schließlich stand noch ein dritter Kuchen auf dem Tisch. Diesmal war es Maria, die den Teller zu sich zog. Aber statt nach einem Messer griff sie nach buntem Geschenkpapier. Anna kicherte hinter vorgehaltener Hand. Auch die anderen Kinder wirkten aufgeregt. So als könnten sie nicht erwarten, was gleich passieren würde. Maria band eine wunderschöne dunkelrote Schleife um den Kuchen. Niemand schien darüber überrascht. Anna kicherte noch lauter. Nur Giovanni beobachtete ihr Tun fassungslos. Als der Kuchen zu einem hübschen Paket geschnürt war – er sah prächtiger aus als die Kuchen in den Konditoreien in Roms Innenstadt –, stand der Klassenälteste Luigi auf. Würdevoll nahm er das Paket hoch und überreichte es Giovanni. »Frohe Weihnachten!«
»Wie, aber …?« Giovanni stotterte verlegen. Weiter kam er nicht, denn nun riefen alle Kinder gemeinsam: »Buon Natale!«
»Wir wollen, dass du den Kuchen mit deiner Familie zu Weihnachten isst«, erklärte Maria.
»Wir alle!«, sagte Luigi, und alle nickten zustimmend.
»Und nächstes Jahr musst du unbedingt wieder mit uns backen!«, meinte Anna. »Du hast uns gefehlt.«
»Oder können wir zu Ostern wieder backen?«, fragte Luigi. »Eine Colomba Pasquale?«
»Au ja!«, riefen die Kinder.
Maria lachte. »Jetzt ist erst einmal Weihnachten!« Sie war gerührt. Als sie heute im Morgenkreis von Giovannis Problem erzählt hatte, war der Vorschlag, einen der Panettoni herzugeben, von den Kindern gekommen. Ausnahmslos alle waren bereit gewesen, auf einen der drei Kuchen zu verzichten. Sie war unglaublich stolz auf die Kinder. Als sie gemeinsam noch einmal Tu scendi dalle stelle anstimmten, fühlte sie sich so wunderbar weihnachtlich wie nie zuvor. Sie hatte eben das schönste Geschenk erhalten. Kinderaugen, die glänzten, weil sie teilen durften.
Maria Tecla Artemisia Montessori – Biografie
Maria wurde am 31. August 1870 als Tochter einer gebildeten Frau und eines Beamten im italienischen Chiaravalle geboren. Sie wuchs wohlbehütet in ihrer elitären Familie in Rom auf, wo sich bereits in ihrer frühen Schulzeit ein besonderes Interesse für Naturwissenschaften abzeichnete. Daher besuchte Maria dort eine technische Oberschule, bevor sie ebenfalls in Rom Naturwissenschaften und Medizin studierte. Ihre Promotion erhielt Maria im Jahr 1896, somit wurde sie zu einer der ersten Ärztinnen Italiens. Im selben Jahr setzte sie sich auf dem Internationalen Kongress für Frauenbestrebungen in Berlin für italienische Frauen ein. Im Jahr 1898 bekam sie ihren Sohn Mario, dieser wuchs jedoch, bis er vierzehn Jahre alt war, bei einer Pflegefamilie auf, da Maria nicht verheiratet war. Ein Jahr später übernahm Maria die Leitung des Heilpädagogischen Instituts in Rom und entwickelte didaktische Unterrichtsmaterialien. Ihr Fokus lag schon früh auf dem Umgang mit geistig behinderten Kindern und der Möglichkeit für diese, optimal pädagogisch betreut zu werden. In den folgenden Jahren studierte Maria Anthropologie, Psychologie und Erziehungsphilosophie. Außerdem stellte sie verschiedene anthropologische Untersuchungen an und beschäftigte sich mit den neuropsychiatrischen Grundlagen, auf denen ihre Pädagogik in den Kinderhäusern beruhte. Diese Methoden (Il metodo della pedagogia scientifica) wurden erstmals 1909 veröffentlicht und danach stets erweitert. Nach einer Begegnung mit Mussolini wurde 1924 die Montessori-Methode an Schulen in ganz Italien eingeführt, jedoch 1939 wieder verboten. Danach kehrte Maria Italien den Rücken zu und verbreitete ihre Methoden auf der ganzen Welt. Darunter beispielsweise in Indien, wo sie Ghandi kennenlernte und Grundsätze einer Erziehung zum Frieden formulierte. Dreimal wurde Maria für den Friedensnobelpreis nominiert und verbrachte ihre letzten Jahre in den Niederlanden, wo sie 1952 starb.
Wer mehr über Maria Montessori wissen möchte:
Laura Baldini, Lehrerin einer neuen Zeit: Maria Montessori – Die schwerste Entscheidung ihres Lebens traf sie für das Wohl der Kinder, Piper Verlag, 978-3-492-06240-4
Audrey HepburnDas Kleid der Zuckerfee
Juliana Weinberg
London, September 1948
Die Strahlen der spätnachmittäglichen Herbstsonne fielen durch die hohen Fenster der Ballettschule am Piccadilly Circus, vergoldeten den honigbraunen Parkettboden und warfen funkelnde Lichtreflexe auf die deckenhohen Spiegel. Die Elevinnen waren allesamt erschöpft, den ganzen Tag hatten sie an der Stange geübt, die fünf Positionen perfektioniert, Arabesquen, Grand battement jeté und Brisé trainiert.
Audrey wechselte einen vielsagenden Blick mit ihren Freundinnen Moira und Alice und rieb sich verstohlen den Knöchel, der nach einem misslungenen Sprung schmerzte. Natürlich blieb dies der gestrengen Madame Rambert nicht verborgen.
»Nicht schlappmachen!« So winzig sie war – Audrey und die anderen Schülerinnen schätzten ihre Größe auf ein Meter fünfzig –, so autoritär wirkte sie, wenn sie sich mit ihrem Stöckchen vor einem der Mädchen aufbaute und es mit bohrenden Blicken durchdrang. »Alle Ballerinen haben dann und wann Schmerzen, das gehört zu unserem Metier dazu! Eine professionelle Tänzerin beißt die Zähne zusammen und lächelt trotzdem! Hat man Ihnen das an Ihrer Provinzschule in den Niederlanden nicht beigebracht, Miss Hepburn?«
Audrey presste die Lippen zusammen. Dass Madame immer auf ihrer niederländischen Herkunft herumreiten musste! »Tut mir leid«, murmelte sie und strich sich das kurze braune Haar aus der Stirn, denn Madame Rambert würde nicht eher Ruhe geben, bis dass sie sich entschuldigt hatte. Die Meisterin maß sie noch einmal mit funkelnden Augen, dann ließ sie es gut sein und klatschte in die Hände.
»Mädchen! Schluss für heute. Doch bevor Sie gehen, möchte ich noch eine Ankündigung machen. Setzen Sie sich doch einen Moment.«
Erleichtert, den harten Drill für heute hinter sich zu haben, lockerten die Ballettschülerinnen ihre schmerzenden Muskeln, tranken einen Schluck aus ihren Wasserflaschen und setzten sich im Halbkreis auf das Parkett.
»Was sie wohl ankündigen will?«, flüsterte Moira, ein blasses Mädchen mit dunkelblonden Haaren, die sie zu einem akkuraten Chignon geschlungen trug. »Dass sie in Rente geht und wir eine junge, sympathische und freundliche Lehrerin bekommen?«
Audrey kicherte in sich hinein. »Mach dir keine Hoffnungen, Madame steht im Ballettsaal, bis sie hundert ist.«
»Und dann bricht sie eines Tages tot an der Stange zusammen«, raunte Alice und befestigte eine Haarnadel in ihren dunklen, zu zwei Nestern aufgesteckten Haaren neu.
»Silence!«, donnerte Madame Rambert, und die Mädchen verstummten augenblicklich. Sie hasste jede Form der Zügellosigkeit, auch wenn es nur um übermütiges Schwatzen ging – aber Himmel, Audrey und ihre Freundinnen waren gerade mal neunzehn, da konnte man nicht den ganzen Tag ernst bleiben, mochte der Unterricht an der berühmten Ballettschule noch so anstrengend und fordernd sein! »Mädchen, es geht schnurstracks auf Weihnachten zu.«
Audrey ließ den Blick aus dem Fenster schweifen; die Herbstsonne war einem milden Abendlicht gewichen, und eine bunte Wolke aus leuchtend roten und gelben Blättern trieb gerade vorbei. Wer dachte bei solcher Farbenpracht an Weihnachten?
»Die Zeit vergeht schneller, als man denkt.« Madame Rambert schritt vor dem Halbkreis der Schülerinnen auf und ab. »Vor allem, da ich dieses Jahr eine Weihnachtsaufführung mit Ihnen plane, die gut vorbereitet und einstudiert werden will.«
Ein Raunen ging durch die Schar. Auch Audrey steckte mit Alice und Moira die Köpfe zusammen.
»Eine Aufführung?«, wisperte Alice. »Herrlich! Welches Stück Madame wohl ausgesucht hat?«
Moira rieb sich erwartungsvoll die Hände. »Ob wir alle eine Rolle bekommen?«
In Audrey entspann sich ein Tagtraum, in dem sie sich in einem schneeweißen Tutu über eine mit künstlichem Schnee bedeckte Bühne tanzen sah. Ihre Großeltern aus dem niederländischen Arnheim wollten zu Weihnachten zu Besuch kommen, wäre es nicht wundervoll, wenn sie ihr Enkelkind auf der Bühne bewundern konnten? Und wer weiß, vielleicht brachte eine bedeutende Rolle in einem schönen Weihnachtsstück Audrey dem ersehnten Ziel, Primaballerina zu werden, ein Stück näher?
»Silence, les filles!« Madame pochte mit ihrem Stöckchen ungehalten auf den Boden. »Das Stück, das ich im Kopf habe, ist von Tschaikowski …«
»Der Nussknacker!«, entschlüpfte es einem rothaarigen Mädchen, bevor es sich erschrocken die Hand vor den Mund schlug.
»Richtig.« Madame betrachtete sie säuerlich. »Der Nussknacker. Wie gesagt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Dépêchons-nous. Beginnen wir mit der Rollenvergabe.«
Als Audrey mit der U-Bahn nach Mayfair fuhr, wo sie mit ihrer Mutter Ella eine beengte Wohnung in einem viktorianischen Stadthaus bewohnte, war es bereits dunkel. In den meisten Häusern brannte Licht, und am Himmel stand die schmale Sichel des Mondes.
»Mutter!« Aufgeregt stürmte sie durch die Tür und legte achtlos ihren Mantel sowie die Balletttasche ab. »Stell dir vor, wir führen an Weihnachten den Nussknacker auf.«
»Das sind ja großartige Neuigkeiten, ich freue mich.« Ella, der man mit ihren knapp fünfzig Jahren noch immer die gediegene Baroness ansah, obwohl sie ihren Titel abgelegt hatte, befand sich in der Küche und deckte den Tisch. Es würde Brot mit einem Hauch Margarine und einer Tomate für jede von ihnen geben. Mit ihrem Lohn, den sie für ihre Dienste als Hausmeisterin sowie für diverse andere Gelegenheitsarbeiten bekam, konnten sie keine großen Sprünge machen. Ella hatte in den Niederlanden alles aufgegeben, um ihre Tochter nach London zu begleiten, wo diese ein Stipendium für Madame Ramberts Ballettschule ergattert hatte. Audrey würde ihr für immer dankbar sein, dass sie sie unterstützte, ihren großen Traum zu verwirklichen.
»Und, welche Rolle hast du bekommen?« Ella bedeutete Audrey, sich zu setzen, und sie begannen mit der kargen Mahlzeit.
»Ach …« Audreys eben noch so enthusiastische Miene trübte sich. »Leider keine wichtige. Ich bin lediglich die Zweitbesetzung der Zuckerfee.«
»Oh.« Ella bestrich ihr Brot dünn mit Margarine. Ob sie enttäuscht war, dass ihre Tochter in der Ballettschule nicht stärker glänzte? Doch sie lächelte aufmunternd. »Aber das macht doch nichts. Zweitbesetzungen sind wichtig. Ihr Ballerinen trainiert so hart, und es kommt gewiss öfter vor, dass sich eine verletzt und pausieren muss, nicht wahr? Dann ist man froh, eine Zweitbesetzung im Hintergrund zu haben.«
Audrey lachte, aber es klang hohl. »Grace, die die Zuckerfee tanzt, ist sehr robust, Mutter. Sie hatte noch nie einen verstauchten Fuß oder einen lädierten Knöchel. Wahrscheinlich werde ich während der Aufführung die ganze Zeit hinter dem Vorhang sitzen und durch einen Spalt zusehen.«
»Dann bekommst du bestimmt beim nächsten Mal eine größere Rolle«, tröstete Ella sie.
Das bezweifelte Audrey, doch sie behielt ihre Gedanken für sich. Als sie noch in den Niederlanden gelebt hatten, wo Audrey zuerst die Ballettschule in Arnheim und später, nach dem Krieg, die in Amsterdam besucht hatte, hatte ihre Zukunft rosiger ausgesehen als jetzt. Damals war sie der unangefochtene Star der Truppe gewesen, und die Lehrerinnen hatten in ihr die Hoffnung geweckt, eines Tages im Rampenlicht der großen Bühnen zu stehen. Doch seit sie in London war, merkte sie immer stärker, dass ihr die englischen Mädchen voraus waren. Lag es daran, dass ihr Körper während der Kriegsjahre in den Niederlanden sehr ausgezehrt und schwach gewesen war, gab es unter der deutschen Besatzung ja kaum noch Lebensmittel?
Rasch schob sie ihre beunruhigenden Erinnerungen beiseite – sie wollte nicht mehr daran denken. Sie wünschte sich so sehr, zu tanzen, anmutig wie eine Feder über die Bühne zu schweben, ihre Gefühle durch geschmeidige Bewegungen auszudrücken, sich in der Musik aufzulösen und eins mit ihr zu werden. Sie würde alles tun, um dies zu erreichen.
London, Dezember 1948
Die Aula war festlich geschmückt, das Bühnenbild fertiggestellt. Ein verschneiter Märchenwald, ein behagliches Zimmer, ein riesiger, prächtig behangener Weihnachtsbaum bildeten nur einige der Szenarien.
Madame Rambert hatte die Mädchen die letzten Wochen und Monate unermüdlich zu Höchstleistungen angetrieben. Audreys Darbietungen als Zuckerfee hatte die Ballettmeisterin mit zusammengezogenen Augenbrauen beobachtet, doch hatte sie mit Schimpftiraden gespart, sodass Audrey davon ausging, ihre Sache ganz gut zu machen.
Einmal ließ sich Madame sogar zu einem kleinen Lob herab. »Pas mal, pas mal du tout.«
Nur Grace, die Erstbesetzung der Zuckerfee, wurde mit Audrey nicht warm. »Es ist egal, wie gut oder schlecht du tanzt«, zischte sie am Tag der Generalprobe, einen Tag vor Heiligabend, bereits am frühen Morgen in der Umkleide. »Du hast keine Chance, morgen auf der Bühne zu stehen. Wie du siehst, bin ich kerngesund und quietschfidel.«
Mit gesenktem Blick schnürte Audrey ihre Spitzenschuhe. »Was bist du denn so garstig, Grace?«
»Sie ist nur neidisch«, mischte sich Moira ein, die ihre Haare streng nach hinten frisierte. »Weil du wider Erwarten eine tolle Zuckerfee abgibst. Ist es nicht so, Gracie?«
»Ihr seid es, die neidisch seid.« Mürrisch schlüpfte Grace in ihr Kostüm. »Du, Moira, und du, Alice, ihr dürft gerade mal als Schneeflocken über die Bühne schweben, und Audrey kommt nicht hinter den Kulissen hervor.«
»Abwarten.« Alice stemmte ärgerlich die Hände in die Hüften. »Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.«
Die Angesprochene warf ihr einen finsteren Blick zu. »Ich glaube aber schon, findet euch endlich damit ab, dass ihr immer nur die zweite Geige spielen dürft.«
Audrey zog ihre beiden Freundinnen rasch aus der Umkleide zum Tanzsaal. Sie verspürte wenig Lust auf Streitereien, es war am besten, sich gar nicht auf Grace’ Sticheleien einzulassen, denn was sollte das bringen?
»Mädchen!«, schnarrte Madame Rambert, die heute besonders griesgrämig wirkte. Ob sie sich Sorgen machte wegen der Aufführung? »Das ist unsere Generalprobe. Geben Sie noch einmal alles, ich möchte nicht, dass Sie mir morgen Schande machen. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Wie Sie wissen, ist mein Institut eines der angesehensten der Welt.«
Audrey und ihre Freundinnen hörten ungeduldig zu. Sie kannten Madames Rede, die diese stets vor wichtigen Ereignissen hielt, auswendig.
»Die Aula wird morgen sehr voll sein – unser Haus ist ausverkauft! Nicht nur Ihre Eltern werden da sein, auch viele Gönner und Kenner der Szene beehren uns. So manch eine Schülerin bekam nach einer ähnlichen Vorstellung auf der Stelle ein Engagement in Paris oder Mailand angeboten!«
Audrey sah, wie Grace der Lehrerin mit glänzenden Augen lauschte, wahrscheinlich malte sie sich bereits aus, wie sie als Zuckerfee Furore machen und in ein bekanntes Ensemble aufgenommen werden würde. Es versetzte ihr einen kleinen Stich, dass sie diese Chance nicht hatte, sie war ja nur die Zweitbesetzung und würde überhaupt nicht tanzen dürfen. Aber sie wollte guten Mutes bleiben. Ihre Großeltern aus den Niederlanden waren gestern angereist, sie freute sich wahnsinnig über den Besuch und darauf, die Feiertage mit ihnen zu verbringen. War Familie letztendlich nicht das Einzige, was zählte?
Audrey saß heute die meiste Zeit auf dem Bänkchen, sie fühlte sich wie eine Ersatzspielerin beim Fußball, doch Madame Rambert wollte sich offenbar ganz auf die Erstbesetzungen von Klara, Fritz, dem Prinzen, dem Mäusekönig, der Zuckerfee und den anderen wichtigen Rollen konzentrieren, um noch an letzten Feinheiten zu feilen.
»Es wird wundervoll werden.« Ein Mädchen, das eine Blume tanzte, saß neben Audrey und seufzte verträumt. »Ich habe gehört, dass auch die Presse kommt. Stell dir nur vor, wir kommen in die Zeitung!«
Audrey nickte lächelnd. Es war ihr nicht wichtig, in der Zeitung zu stehen, Hauptsache, Mutter und die Großeltern saßen im Publikum und genossen den Abend. Die letzten Jahre, vor allem die harten Kriegswinter, die noch in allen Köpfen herumspukten, waren schrecklich gewesen.
»Mon dieu!«, polterte da Madame Rambert. »Grace, was sollen diese Sperenzchen! Stehen Sie auf, tout de suite!«
Audrey, die in Gedanken an Oma und Opa aus dem Fenster gesehen hatte – der Dezemberhimmel war wolkenverhangen und grau –, schreckte zusammen und starrte auf die Bühne. Grace saß in sich zusammengefallen und mit schmerzverzerrtem Gesicht mitten auf der Bühne und hielt sich den Fuß, offenbar war sie beim Tanzen gestürzt.
»Es geht nicht«, klagte sie in jämmerlichem Tonfall. »Es tut zu weh.«
Unruhe entstand unter den Schülerinnen. Morgen war die Aufführung! Eine Verletzung tags zuvor kam einem Albtraum gleich. Kaum vorstellbar, dass Grace so schnell wieder tanzen konnte.
»Stellen Sie sich nicht so an!« Madame Rambert zog Grace an den Trägern ihres prächtigen fliederlila Feenkostüms mit den vielen Volants, um sie zum Aufstehen zu nötigen. Doch Grace rührte sich keinen Fingerbreit.
»Es geht wirklich nicht, Madame …!« Heiße Tränen sprangen aus ihren Augen. Probeweise stellte sie den Fuß auf, um sogleich wieder in einen schiefen Schneidersitz zurückzusinken. »Ich will ja, aber … aber ich kann nicht …!«
Audrey saß wie festgefroren auf der Bank und beobachtete die Vorgänge auf der Bühne. Ihr Herz trommelte, als wollte es sich gleich überschlagen, sie war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Dann fällt Ihr Auftritt morgen ins Wasser.« Madame klang schnippisch, fast beleidigt, so als hätte Grace sie durch ihren Sturz persönlich angegriffen.
Moira reichte der heulenden Grace ein Taschentuch. »Ich will morgen tanzen … unbedingt … Sie soll nicht auf der Bühne stehen, die Zuckerfee ist meine Rolle …« Böse starrte sie Audrey an, die betreten zu Boden sah.
»Wir können nicht immer das tun, was wir wollen.« Madame Rambert winkte zwei Mädchen in Schneeflockenkostümen heran und wies sie an, Grace zu stützen und sie in die Umkleide zu bringen. »Ihr Kostüm hängen Sie auf einen Bügel, der Concierge soll Ihnen ein Taxi rufen, das Sie nach Hause bringt.« Suchend sah sie sich um, bis sie Audrey erblickte. Diese wurde blass und verkrampfte die Hände.
»Miss Hepburn, jetzt schlägt unerwartet doch noch Ihr Stündlein.« Madame ignorierte Grace, die sich stöhnend und weinend hinausbegleiten ließ, völlig. »Tanzen Sie sich warm, dann holen Sie sich das Kostüm aus der Umkleide und ziehen es an. Es wird Ihnen passen.« Sie musterte Audreys knochige Gestalt. »Wie lange können Sie heute Abend bleiben? Sie brauchen eine Extratrainingseinheit, es könnte spät werden.«
»Das ist kein Problem.« Audreys Stimme war heiser vor Aufregung. Sie spürte Moiras und Alice’ Blicke, die begeistert auf ihr ruhten. Wie schön, Freundinnen zu haben, die sich mit ihr freuten, auch wenn die Tatsache, dass sie morgen wirklich und wahrhaftig die Zuckerfee tanzen durfte, erst allmählich in ihr Bewusstsein sickerte. »Ich kann so lange bleiben, wie es nötig ist.«
Nach dem Aufwärmen lief sie rasch in die Umkleide, die verlassen und leer im trüben winterlichen Licht lag, und stieg über die Schuhe und Taschen der anderen Mädchen. Als sie nach dem Gewand der Zuckerfee griff, erstarrte sie. Sie fühlte sich, als gefröre ihr das Blut in den Adern, als söge ihr eine Eiseskälte jegliche Energie aus dem gesamten Körper. Das fliederfarbene Bühnenkostüm war zerfetzt, kaputt, verdorben. Die Schnitte, mit denen die Volants durchtrennt, teilweise gänzlich abgeschnitten worden waren, sahen akkurat ausgeführt aus, so als hätte der Übeltäter – oder besser, die Übeltäterin? – eine Schere benutzt. Auch die Armträger hingen lose, losgelöst vom Kleid. Das Gewand war nur mehr ein Fetzen, unbrauchbar und zerstört. Audrey sank auf die Holzbank und schlug sich die Hände vor das Gesicht. Für kurze Zeit war sie so glücklich gewesen, morgen auftreten zu dürfen, doch nun war ihr Traum zu Staub zerfallen. Es war alles verloren. Ohne Kostüm würde die Zuckerfee nicht tanzen dürfen.
Die zwei Mädchen, die Grace zuvor in die Umkleide eskortiert hatten, gaben unbehaglich zu, dass sie mitbekommen hatten, wie Grace den Hausmeister nach einer Schere gefragt habe, und sie hatten auf dem Rückweg zur Aula bereits das erste Ratsch! des reißenden Stoffes vernommen, Grace aber nicht anschwärzen wollen. Madame stampfte vor Wut mit dem Fuß auf, das Gesicht dunkelrot verfärbt.
»Unerhört!«, wetterte sie. »C´est la castastrophe! Was soll nun werden? Leider haben wir keine Ersatzkostüme, alle sind vergeben. Sollen wir die Aufführung absagen? Das ist das Einzige, was mir einfällt.« Sie ließ ihren zierlichen Körper auf die Bank fallen und rieb sich erschöpft die Stirn.
Die Mädchen scharten sich unwohl um die strenge Meisterin. Noch nie hatten sie sie derart niedergeschlagen erlebt, trotz ihrer geringen Größe wirkte sie stets wie ein Feldwebel, der sie herumkommandierte, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Alice sah Audrey auffordernd an, als wäre es an ihr, die Situation zu retten. Tatsächlich ratterte es in Audreys Kopf. Irgendwie musste das Kostüm doch zu reparieren sein, es war schlicht undenkbar, dass die Vorstellung ins Wasser fallen würde, nur weil Grace in ihrer Enttäuschung keinen anderen Ausweg als blanke Zerstörung gesehen hatte.
Sie drückte sich den violetten Stoff an die Brust. »Ich … ich nehme das Kostüm mit nach Hause …«
»Wozu?« Madame sah zu ihr auf, Hoffnungslosigkeit in den Augen. »Denken Sie, es flickt sich über Nacht auf wundersame Weise von selbst?«
»Nein, aber …« Audrey biss sich auf die Lippen. Die Situation war verzwickt, aber irgendwie musste das Kleid doch zu retten sein. Hatten sie sich im Krieg nicht auch Kleider aus allen möglichen Stoffen geschneidert, aus Vorhängen, Tischdecken oder Kissenbezügen, weil es keine Textilien mehr zu kaufen gab? »Meine Großmutter ist zu Besuch. Sie wird mir helfen, das Kostüm wieder vorzeigbar zu machen.«
Madame Rambert schnaubte. »Ihre Großmutter müsste eine Zauberin sein, um das zu schaffen.«
Sie waren die ganze Nacht zugange, Audrey, Ella und Großmutter. Großvater sang derweil zu Weihnachtsliedern aus dem Radio und sprach dem Glühwein zu, der in einem Topf auf dem Herd köchelte. Zwar waren sie alle leicht nervös, aber dennoch beschwingt. Das gemeinsame Vorhaben schweißte sie zusammen, so wie damals während des Krieges, als Ella und Audrey bei den Großeltern untergekommen waren und sie sich alles Mögliche einfallen ließen, um an ein bisschen Brot oder ein paar Kartoffeln zu kommen.
»Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen«, verkündete Großmutter mit grimmiger Entschlossenheit. »Du bist die ideale Zuckerfee, Liebling, deshalb wirst du morgen tanzen!«
»Besser gesagt, heute.« Großvater unterbrach sein Geträller, mit dem er Jingle Bells begleitete. »Seht mal auf die Uhr.« Tatsächlich war es bereits zwei Uhr in der Nacht.
»Egal, wie spät es sein mag.« Ella setzte einen feinen Stich in den Stoff. »Wir bekommen das Kleid noch heute Nacht fertig. Schlafen können wir am Abend nach der Vorstellung. Doch du legst dich besser ein paar Stunden ins Bett, Schatz.«
Eigentlich hätte Audrey müde sein müssen, doch sie war zu aufgekratzt. Sie fand ihr Kleid beziehungsweise das, was sie aus dem kümmerlichen Stofffetzen nähten, einfach zauberhaft, auch wenn es keinerlei Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Stück haben würde. Wie Madame Rambert reagieren würde? Würde sie toben oder einfach nur froh sein, dass die Zuckerfee in irgendeinem Kleid steckte?
Madame Rambert hielt auf der Bühne eine Begrüßungsrede, dann trat sie hinter die Kulissen und scheuchte ihre wartenden Ballerinen zusammen. Es war so weit: Die Aufführung des Nussknackers begann. Audrey schielte durch den Spalt im Vorhang und beobachtete atemlos Klara und Fritz und die anderen Tänzerinnen, die am Anfang des Stücks auftraten. Die Stille im Saal war mit den Händen greifbar, alle Blicke des im Dunkeln sitzenden Publikums schienen auf die Bühne geheftet, die weich beleuchtet war.
»Du bist dran, Audrey!«, zischte Moira.
Audrey war so in der Musik aufgegangen, dass sie beinahe ihren Auftritt verpasst hätte! Madame bohrte ihr den Zeigefinger in den Rücken und schob sie auf die Bühne, verdrehte ein letztes Mal die Augen über Audreys unkonventionelles Kostüm. »Schön ist es nicht, aber selten«, hatte sie gesagt, als sie Audrey zu Beginn des Abends erblickt hatte. Moira und Alice sowie die anderen Mädchen hatten sich ausgeschüttet vor Lachen, das Kleid jedoch ehrfürchtig bestaunt.
»Du siehst aus wie einem Märchen entsprungen«, hatte Alice geschwärmt.
Mit glühendem Gesicht trat Audrey ins Scheinwerferlicht, getragen von der Musik. Ihr großer Auftritt – wie sehr hatte sie sich ihm entgegengesehnt!
Ein Flüstern ging durch das Publikum, dann klatschte jemand enthusiastisch; wahrscheinlich war es ihr Großvater, doch aufgrund der Finsternis in den Stuhlreihen vermochte sie niemanden zu erkennen. Bald zollte ihr das gesamte Publikum Applaus, und aus der vordersten Reihe vernahm sie Worte wie »Dieses Kostüm! Ein Traum!« oder »So muss eine wahre Zuckerfee aussehen!«.
Audrey begann zu tanzen, flog in ihrem Kostüm über die Bühne. Der Tüll, aus dem es geschneidert war, besaß eine etwas andere Farbschattierung als das Originalkleid, denn er stammte von der Gardine im Badezimmer und war eher lavendelblau als fliederlila. Doch anders als das ursprüngliche Kleid war es reichlich und fantasievoll geschmückt – weiche Federn, die von Großmutters bestem Hut stammten (eigentlich hatte sie ihn heute zu der Aufführung tragen wollen), schmiegten sich an Audreys schmale Taille, und rosa-weiß gestreifte Zuckerstangen hingen herab wie Pendel und schwangen bei jedem Schritt hin und her. Eigentlich hatte Ella vorgehabt, die Süßigkeiten in Audreys Strumpf zu stecken, den diese über dem Ofen im Wohnzimmer aufgehängt hatte, in der übermütigen Hoffnung, Santa Claus möge ihn befüllen. Die schimmernden Bahnen des Badezimmertülls schmückten golden glänzende Pailletten; nur wer genauer hinsah, erkannte, dass es sich dabei um Stanniolpapiere handelte, in die Bonbons eingewickelt gewesen waren. Großmutter hatte sie sorgfältig angenäht.
Am Ende der Aufführung badeten die Zuschauer Audrey in nicht enden wollendem Beifall; begeisterte Rufe erschollen aus den Zuschauerrängen, am lautesten rief natürlich Großvater: »Zugabe! Zugabe!«
Audrey verbeugte sich überglücklich. Dieser unerwartete Erfolg war ihr schönstes Weihnachtsgeschenk. Wer hätte gedacht, dass sie, obwohl sie nur die Zweitbesetzung war, doch noch gefeiert wurde? Ein Hindernis wie ein zerstörtes Kleid vermochte sie nicht aufzuhalten. Ob ihr Traum, eine berühmte Primaballerina zu werden, irgendwann wahr werden würde? Oder zeichnete das Schicksal einen ganz anderen Weg für sie vor?
Audrey Hepburn – Biografie
Audrey Hepburn wurde am 4. Mai 1929 in der Nähe von Brüssel in Belgien geboren. Sie hatte zwei ältere Halbbrüder. Während des Zweiten Weltkriegs zog sich ihre Mutter Ella Baroness van Heemstra mit ihr zu den Großeltern nach Arnheim in den Niederlanden zurück, wo sie die deutsche Besatzung miterlebte.
Audreys ganze Leidenschaft galt dem Ballett, und so zog sie nach dem Krieg mit ihrer Mutter nach London, um dort eine bekannte Ballettschule zu besuchen, scheiterte dort jedoch letztendlich. Es folgten kleine Rollen in Revuen und Filmen, mit dem Film Ein Herz und eine Krone gelang ihr 1953 der Durchbruch.
Es folgten viele bekannte Filme, wie z. B. Sabrina, Krieg und Frieden, Ein süßer Fratz, Geschichte einer Nonne, Frühstück bei Tiffany, My fair Lady, Wie klaut man eine Million? und viele andere. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Oscar, einen Emmy, einen Grammy und zwei Tony Awards. Damit zählt sie zu den wenigen Künstlern, die alle vier großen Preise gewannen.
Nachdem sie sich von der Leinwand zurückgezogen hatte, engagierte sie sich als UNICEF-Sonderbotschafterin für Projekte in zahlreichen armen Ländern.
Audrey war zweimal verheiratet, in erster Ehe mit dem Schauspieler Mel Ferrer, der der Vater ihres Sohnes Sean (geboren 1960) ist, in zweiter Ehe mit dem italienischen Psychiater Andrea Dotti, Vater ihres Sohnes Luca (geboren 1970). Aber erst in dem niederländischen Schauspieler Robert Wolders fand sie die große Liebe.
Audrey starb am 20. Januar 1993 in ihrem Anwesen La Paisible in der Schweiz.
Noch heute gilt sie als eine der schönsten und elegantesten Frauen der Welt.
Wer mehr über Audrey Hepburn erfahren möchte:
Juliana Weinberg, Audrey Hepburn und der Glanz der Sterne, Ullstein Verlag, 978-3-548-06392-8
Irena SendlerEin Weihnachtswunder in der Tram
Lea Kampe
Warschau, 1942
Als sich die junge mittelblonde Frau im dicken Mantel dem Ghettotor an der Leszno Straße näherte, beachteten die Wachen sie kaum. Ihre Nasen waren rot vor Kälte, unter ihren Kappen trugen sie Ohrenschützer, und da die Frau täglich im Ghetto ein und aus ging, mussten sie nicht mehr auf ihren Ausweis sehen, um zu wissen, dass sie Irena Sendler hieß – eine Krankenpflegerin, die unter den Eingepferchten da drinnen nach dem Rechten sah.
An ihrem mal spöttischen, mal mitleidigen Lächeln konnte Irena ablesen, was die Wachen über sie dachten. Für sie war sie ein sentimentales Weibchen, das glaubte, den Kranken und Hungernden im Ghetto allein durch ihre Anwesenheit helfen zu können – denn Essen oder Medikamente durfte sie nicht hineinbringen. Erst vor wenigen Tagen hatte einer der Männer sie zynisch daran erinnert, dass ihre »Arbeit« im Ghetto jetzt ohnehin bald ein Ende finden würde, denn schon seit Juli wurden täglich mehrere Tausend Ghettobewohner aus ihren Häusern getrieben und zum Umschlagplatz geführt, wo die Viehwagen auf sie warteten … und aus dem Vernichtungslager Treblinka vor den Toren Warschaus kam keiner von ihnen zurück. »Das Ghetto liquidieren«, so nannten sie das. Leid und Tod verblassten hinter einer Sprache, die um einzuhaltende Transportquoten kreiste. Jeden Tag suchte Irena in den Gesichtern der Deutschen nach Antwort auf die Frage, wie man Mensch sein konnte und gleichzeitig die Ermordung Zehn-, nein, Hunderttausender Männer, Frauen und Kinder als rein bürokratische und logistische Herausforderung betrachtete – doch sie fand sie nicht. Der festgetretene, vereiste Schnee knirschte unter Irenas Füßen, und sie musste an sich halten, um die abgemagerten bettelnden Gestalten nicht zu beachten, die die Ghettostraßen säumten. Viele von ihnen hatten keine Bleibe mehr, und jeden Morgen waren die schmutzig verkrusteten Straßen und Hofeingänge mit Erfrorenen und Verhungerten übersät. Dass Irena nicht allen helfen konnte, war schwer zu akzeptieren, und doch musste sie genau das tun, wenn sie überhaupt helfen wollte. Irena steckte die Hände mit den Fäustlingen in die Manteltaschen und lehnte sich leicht gegen den schneidenden Wind, in dem ein paar vereinzelte Schneeflocken trieben, die von anderswo herzukommen schienen. Konzentriert sein, nur an die eine vor ihr liegende Aufgabe denken, mahnte sie sich selbst – so wie die Menschen im Ghetto, die längst aufgehört hatten, sich die Frage nach dem Warum zu stellen. Die Hölle überleben – irgendwie –, war das Einzige, was noch zählte, und genau hier kam Irena ins Spiel. Es hatte mit einem Baby begonnen, das sie und ihre jüdische Freundin Ala, die im Ghetto lebte, in einer Wohnung neben seiner toten Mutter gefunden hatten. In einer Kurzschlussreaktion hatte Irena das winzige Mädchen noch am selben Abend unter ihrem Mantel aus dem Ghetto geschmuggelt und bei mutigen polnischen Pflegeeltern untergebracht. Erst danach war ihr klar geworden, wie leicht die unbedachte Aktion hätte schiefgehen können, und dass sie nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Leben des Kindes riskiert hatte. Dennoch war ihr sofort klar gewesen, dass sie weitermachen musste – mit Bedacht und System. Seither hatte Irena zusammen mit einer Handvoll von Freundinnen und Kolleginnen aus dem Sozialamt, wo sie arbeitete, viele weitere Kinder in den sogenannten arischen Teil Warschaus geschleust, und ihre Methoden waren immer kreativer geworden. Vor allem aber gehörte gute Planung dazu. Dass sie und ihr kleines privates Netzwerk an Helferinnen und Helfern mittlerweile finanziell von der Untergrundorganisation Żegota unterstützt wurden, hatte ihrer fieberhaften Aktivität Auftrieb gegeben, denn so konnten sie den Pflegefamilien und Klöstern, die die geschmuggelten Kinder aufnahmen, finanzielle Unterstützung anbieten.
An diesem eiskalten Weihnachtsmorgen war Irena auf dem Weg in die Mila Straße. Das angeschlagene Wohnhaus, in dem Frau Ryba mit ihrer fünfjährigen Tochter Halina lebte, lag in der Nähe der Mauer, die mit ihren achtzehn Kilometer Länge das circa drei Quadratkilometer große Ghetto umschloss. Die Haustür war nur angelehnt, und Irena sah beim Hinaufsteigen in den dritten Stock ihren weißen Atem.
Auf dem Absatz angekommen, klopfte sie leise an die Tür. Im Inneren rührte sich nichts, doch Irena war nicht entmutigt. Sie wusste, was ihre Ankunft für die Mutter bedeutete, die in der Wohnung mit ihrem Mädchen auf ihr Kommen harrte. Noch einmal klopfte sie, diesmal etwas lauter, und tatsächlich wurde die Tür vorsichtig geöffnet. Durch den schmalen Spalt erkannte Irena Frau Rybas braune Augen. Wortlos nickte sie ihr zu, und die Tür öffnete sich so weit, dass sie hineinschlüpfen konnte.
»Sie sind gekommen«, sagte Frau Ryba leise statt einer Begrüßung, und Irena war sich nicht ganz sicher, ob Erleichterung oder Enttäuschung in ihrer Stimme mitschwang.
»Ja«, sagte sie nur. »Wie geht es Halina?«
Beim Namen ihrer Tochter füllten sich Frau Rybas Augen mit Tränen, die sie unterdrückte, indem sie kurz, aber heftig den Kopf schüttelte, sich umdrehte und Irena in die Küche vorausging. Neben dem Tisch stand das kleine Mädchen, an seiner Seite ein mit einem Strick umwickeltes Köfferchen ohne Schnallen. Das Mädchen war mager wie seine Mutter. Irena bemerkte die knochigen Finger und knubbeligen Knie der dünnen Beine, die nur zur Hälfte durch ein Kleidchen bedeckt wurden, in das Halina unter normalen Umständen nicht mehr hineingepasst hätte. Frau Ryba ging vor ihrer Tochter in die Knie und zog ihr die Strümpfe hoch, doch sie fanden keinen Halt und rutschten wieder herunter. Immer heftiger zog Frau Ryba, als hinge das Gelingen des bevorstehenden Unterfangens nur davon ab, und obwohl sie ihr den Rücken zuwandte, konnte Irena sehen, dass sie weinte. Unruhig rieb sich Irena die klammen Finger. Die kleine Halina wirkte wie erstarrt, ihre Augen waren weit aufgerissen, und wenn ihre Mutter nun zu schluchzen anfing, könnte es sein, dass die Kleine auf der Flucht zusammenbrach und Umstehende auf sich aufmerksam machte. Irena setzte sich auf einen Stuhl neben die Kleine.
»Hallo, Halina«, sagte sie freundlich. »Wir haben uns letzte Woche schon kennengelernt, erinnerst du dich?«
Halina nickte zögerlich, doch sie sah sie nicht an, sondern tastete mit den Händen nach den Wangen ihrer Mutter. Die legte ihre eigenen auf die Händchen der Tochter. Sekundenlang sahen sie sich an, und wie immer fühlte sich Irena wie ein Eindringling. Sie war hier, um dieses Mädchen von seiner Mutter zu trennen – konnte es etwas Schlimmeres geben? Doch, es gab etwas Schlimmeres, und genau deshalb hatte Frau Ryba zugestimmt, ihr Kind aus dem Ghetto schmuggeln zu lassen und den sicheren Tod gegen die ungewisse Chance auf ein Überleben in einer fremden Welt mit fremden Menschen zu tauschen. Ein Leben ohne sie, die Mutter, aber doch ein Leben.