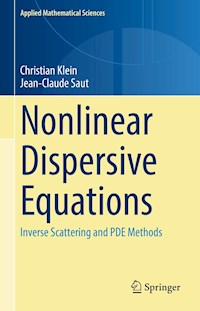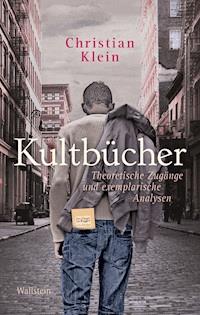25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bücher haben in ganz besonderem Maße unsere Geschichte, unser Denken und unser Selbstverständnis geformt. Die Autoren stellen 99 Bücher vor, die wesentlichen Einfluss auf die Kulturnation Deutschland hatten. In den Fokus rücken Texte aus ganz verschiedenen Bereichen: literarische Werke stehen neben naturwissenschaftlichen Abhandlungen, Lexika neben philosophischen Traktaten und politischen Kampfschriften. Pointiert wird das Besondere des jeweiligen Buches benannt. Unterhaltsame Episoden vermitteln Wissenswertes zu Entstehungsumfeld und historischem Hintergrund. Unter den Autoren finden sich Martin Luther, Immanuel Kant, J.W. Goethe, Karl Marx, Konrad Duden, Max Planck, aber auch J.K Rowling und Hape Kerkeling. Die packenden Kurzporträts in chronologischer Folge ermöglichen auch einen originellen Zugriff auf wichtige Wegmarken der deutschen Geschichte. Fest steht: Will man begreifen, was Deutschland ausmacht, kommt man an Büchern nicht vorbei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas von Arnauld/Christian Klein
Weil Bücher unsere Welt verändern
Vom Nibelungenlied bis Harry Potter
Impressum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.de abru ar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitungdurch elektronische Systeme.
wbg THEISS ist ein Imprint der wbg.
© 2019 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitgliederder wbg ermöglicht.Redaktion: Eva Harker, MünsterSatz: schreiberVIS, Seeheim
Umschlaggestaltung: Jutta Schneider, Frankfurt am MainUmschlagabbildung: fotolia © sveta
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbgwissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-3747-4
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-3765-8eBook (epub): ISBN 978-3-8062-3766-5
Menü
Buch lesen
Innentitel
Informationen zum Buch
Informationen zu den Autoren
Impressum
Einleitung
Leipzig, Buchmesse. Wie jedes Jahr stellen die Verlage ihre Neuheiten vor. Eines der aktuellen Bücher dieser Saison wird alle anderen nicht nur in puncto Verkaufszahlen in den Schatten stellen. Sein Titel: Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Wir schreiben das Jahr 1534. Der Wittenberger Theologe Martin Luther hat nach jahrelanger Arbeit seine Bibelübersetzung abgeschlossen und veröffentlicht. Schnell verbreitet sich das Werk in der lesekundigen Bevölkerung und über die Kanzeln überall dort, wo auf Deutsch gepredigt wird. Gemäß Luthers protestantischer Sendung bringt »seine« Bibel das Evangelium unters Volk und trägt zugleich zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache bei, die damals in vielen Mundarten und Dialekten gesprochen wird. Szenenwechsel: Gut einhundert Kilometer von Leipzig entfernt und gut zweihundertvierzig Jahre später, Weimar 1775. Auf Einladung des gerade achtzehnjährigen Herzogs kommt der junge Johann Wolfgang Goethe in die provinzielle, aber aufstrebende Residenzstadt. Ein Jahr zuvor hatte er mit seinem Roman Die Leiden des jungen Werther einen Sensationserfolg gelandet, der einer ganzen Generation aus der Seele zu sprechen schien, weil er statt auf Nutzen zu setzen das Gefühl zu seinem Recht kommen ließ. Die Leser identifizierten sich mit Werther, was besonders augenfällig in dem aufkommenden Modetrend wurde: Blauer Frack und gelbe Weste drückten ein neues, freiheitliches Lebensgefühl aus. Goethe selbst reist in dieser Kluft nach Weimar, und kurze Zeit später trägt der ganze Hof die »Werther-Mode«. Dritte Szene, noch einmal gut einhundertsiebzig Jahre später: In der Nacht vom 23. auf den 24.Mai 1949 tritt das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Eine provisorische Verfassung für den westdeutschen Teilstaat, die nicht bei allen sogleich auf Gegenliebe stößt. Im Bayerischen Landtag fällt sie durch. Nach noch einmal gut vierzig Jahren wird das Grundgesetz zur Verfassung des wiedervereinigten Deutschland. Heute prägt es neben der Arbeit der Staatsorgane vor allem über seinen Grundrechtsteil das politische und gesellschaftliche Leben insgesamt. Von seinen »Vätern« und »Müttern« hat es sich längst emanzipiert. Es immer aufs Neue mit Leben zu füllen und an die Erfordernisse der jeweiligen Jetztzeit anzupassen, ist zur Aufgabe der staatlichen Institutionen und des gesellschaftlichen Diskurses selbst geworden.
Unsere Welt ist ständig in Veränderung. Und ihre Entwicklung verläuft beileibe nicht immer geradlinig. Sie wird geprägt von unvorhersehbaren Einflüssen, erfährt Brüche und Sprünge. Anders gesagt: Die Welt, wie wir sie heute kennen, ist das Ergebnis steten Wandels, in dem Denkweisen hinterfragt, Traditionen abgelöst, Staatswesen reformiert (oder revolutioniert), gesellschaftliche Strukturen umgestaltet werden. Fragt man nach Ursachen für diese Veränderungen, nach Motoren dieses Wandels, dann denken die meisten wohl spontan an historische Ereignisse wie Krönungen, Krisen oder Kriege. Es fallen ihnen technische Erfindungen oder handfeste weltanschauliche Auseinandersetzungen ein. Nur die wenigsten werden als Antwort bestimmte Buchtitel nennen. Dabei spielt die Literatur eine ganz herausragende Rolle, wenn es um Neuerungen im Denken, um kulturellen und gesellschaftlichen Wandel geht. Es waren eben häufig Bücher, die Veränderungen einleiteten oder ganz wesentlich verstärkten, indem sie revolutionäre Ideen und Gedanken propagierten, indem sie neue Weltsichten und Erkenntnisse verbreiteten, kulturelle Muster und Verhaltensregeln etablierten oder eine Stimmung, die in der Luft lag, so verdichteten, prägende Situationen und Zustände so pointiert auf den Punkt brachten, dass es die Leser ins Herz traf. Unsere drei Eingangsbeispiele führen das anschaulich vor Augen. Will man also verstehen, wie eine Gesellschaft entstanden ist, wodurch sie geformt wurde und was sie ausmacht, kommt man an Büchern nicht vorbei.
Neunundneunzig solcher Bücher stellt der vorliegende Band vor. Neunundneunzig Bücher, die für unsere Welt von besonderer Bedeutung waren und sind. Sie alle haben Einfluss auf gesellschaftliche Veränderungen und auf die Herausbildung zentraler Vorstellungen genommen oder den Zeitgeist in besonders wirkmächtiger Weise eingefangen. »Unsere Welt«, das kann »unser aller Welt« heißen, denn in allen Erdteilen haben Bücher solche Wirkungen entfaltet. Es genügt etwa auf den Koran zu verweisen oder auf die Bedeutung, die Harriet Beecher Stowes Roman Onkel Toms Hütte für die Abschaffung der Sklaverei in den USA hatte. Neunundneunzig Bücher buchstäblich aus aller Welt vorzustellen, würde allerdings die Frage nach der Auswahl und der Vergleichbarkeit der Werke noch drängender stellen als im Falle des vorliegenden Bandes. Dessen Ansatz ist bescheidener: Er nimmt solche Bücher in den Blick, die auf besondere Weise in Deutschland ihre Wirkung entfaltet haben. Doch was heißt hier »Deutschland«? Als Nationalstaat ist Deutschland noch nicht einhundertfünfzig Jahre alt und existiert in seinen aktuellen Grenzen überhaupt erst seit wenigen Jahrzehnten. Für die Zwecke dieses Bandes kommt es auf solche letztlich politischen Organisationsfragen zum Glück nicht an. Entscheidend ist vielmehr jener vor allem durch die deutsche Sprache zusammengehaltene Kulturraum, den die nach staatlicher Einheit strebende politische Romantik des frühen 19. Jahrhunderts zur Kultur»nation« verklärte.
Dass dieser Kulturraum keineswegs isoliert steht, bedarf kaum der Betonung. Deutsche Kultur und Mentalität waren und sind immer Teil eines größeren, primär europäischen Zusammenhangs. Die Auswahl unserer Beispiele setzt daher an den Anfängen der Überlieferung von Texten ein. Sie nimmt – ausgehend von der Antike – naheliegenderweise zunächst vor allem Titel aus einem europäischen Kontext in den Blick, die entscheidenden Anteil daran hatten, dass Deutschland als Kultur- und Sozialraum geschaffen und geformt wurde. Ab dem 18. Jahrhundert sind es dann vor allem deutsche Autoren, deren Werke im Fokus stehen, wobei natürlich auch sie in vielfältiger Weise Impulse von außen empfangen haben.
Die Textauswahl will zum einen jene Titel vorstellen, die für bestimmte Neuerungen im Denken, für spezifische gesellschaftliche oder kulturelle Veränderungen entscheidend waren, die also Wandel einleiteten und mitgestalteten. Zum anderen aber werden immer wieder auch solche Bücher präsentiert, die bestimmte gesellschaftliche Zustände oder kulturelle Entwicklungen einfangen und abbilden. Es finden sich also neben Titeln, die Wandel initiierten, auch solche, die Wandel dokumentieren. »Zum einen, zum anderen« – das suggeriert, es ließe sich hier eine klare Grenze ziehen. Das indes ist kaum möglich. Ein »Kultbuch« wie Goethes Werther ist ebenso ein Kind des Zeitgeistes, wie es seine Zeit, die Werther-Zeit, prägte. Nichts anderes gilt für Darwins Über die Entstehung der Arten oder Sigmund Freuds psychoanalytisches Hauptwerk Das Ich und das Es. Denn die »creatio ex nihilo«, die Schöpfung aus dem Nichts, gibt es nicht.
Es liegt auf der Hand, dass der hier skizzierte Anspruch nur dann einzulösen ist, wenn die Auswahl der Beispiele möglichst breit angelegt ist und Texte aus allen denkbaren Wissens- und Themengebieten in den Fokus rückt. Auch muss der Begriff »Buch« in einem weiten Sinne ausgelegt werden. Und so stehen in diesem Band literarische Werke neben mathematischen Abhandlungen, es finden sich Berichte von Entdeckern und die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Beobachtungen, es werden autobiografische Reflexionen, Reden, philosophische Traktate und politische Kampfschriften ebenso präsentiert wie Gesetzessammlungen oder Lexika. Denn es sind eben Bücher aus all diesen Bereichen, die bedeutsam waren für die Gesellschaft und das Denken in Deutschland – und es bis heute sind.
Eine gelegentlich knifflige Aufgabe war es, die Bücher zeitlich einzuordnen. Wo ein Werk nach und nach in mehreren Teilen publiziert wurde, haben wir das Veröffentlichungsjahr des ersten Bandes gewählt. In der Regel haben wir das Jahr der Erstveröffentlichung zugrunde gelegt. Wo Abweichungen von diesem Prinzip sinnvoll schienen, etwa weil der Autor große Überarbeitungen vorgenommen hat, die dazu führten, dass der Text erst in dieser neueren Fassung seine nachhaltige Wirkung entfaltete, wird das im jeweiligen Artikel erläutert. Und dann ist da noch das Phänomen, dass manche Bücher erst nach langem Dornröschenschlaf rezipiert wurden, zumindest in Deutschland. Das Nibelungenlied etwa erhielt erst im 19. Jahrhundert seinen Status als der Klassikertext des deutschen Mittelalters. Und auch der Diwān des Hafis wurde erst durch die Übersetzungen und Nachdichtungen aus der Feder Rückerts und Goethes zur Keimzelle der deutschen Orientbegeisterung. Weil sich aber die Rezeption meist schwer datieren lässt und auf eine Entdeckung nicht selten eine oder mehrere Wiederentdeckungen folgten, haben wir hier das Jahr der ersten Veröffentlichung zugrunde gelegt. Wo allerdings – vor allem im 20. Jahrhundert – die Übersetzung eines in einer anderen Sprache verfassten Buches der Erstveröffentlichung auf den Fuß folgte, fiel unsere Wahl auf das Jahr der deutschen Erstausgabe.
Die größte Herausforderung bestand in der Auswahl der vorgestellten Bücher. Mit ihr erheben wir zwar einen gewissen Anspruch auf Plausibilität, aber keinen auf Repräsentativität. Natürlich haben wir uns bei der Zusammenstellung der Titel etwas gedacht. Wir wissen aber sehr wohl, dass wir uns hier nicht im Bereich objektiver Maßstäbe bewegen, sondern zwar begründbare, aber letztlich subjektive Entscheidungen getroffen haben. Vermutlich könnte jede Leserin und jeder Leser spontan eine ganze Reihe weiterer Bücher nennen, deren Aufnahme man mit guten Gründen ebenso hätte erwägen können. Zu einem Band wie dem vorliegenden gehört unserer Meinung nach aber auch die eine oder andere Überraschung, Irritationen inklusive. So haben wir zum Beispiel auf die Aufnahme der Bibel verzichtet, was zu Stirnrunzeln Anlass geben mag. Sie taucht dann aber in Gestalt der eingangs erwähnten Lutherbibel in unserer Sammlung auf.
Unsere Auswahl versteht sich also weder als ein Beitrag zu Kanon-Debatten noch als ein Sinnstiftungsangebot in Fragen der kulturellen Identität. »Prodesse et delectare«, nützen und unterhalten, so ließe sich in Anlehnung an Horaz ebenso bescheiden wie unbescheiden die Absicht zusammenfassen, die wir mit diesem Band verfolgen. Wer sich darauf einlassen mag, den laden wir ein, mit uns auf dieser ganz besonderen Buchmesse von Stand zu Stand zu schlendern und einen Blick auf Bücher aus fast dreitausend Jahren zu werfen, um sich informieren, gelegentlich überraschen und vor allem gut unterhalten zu lassen!
um 700 v. Chr.
Homer
Ilias
Der Beginn der europäischen Literatur
Das Versepos Ilias wird heute oft an den Anfang der europäischen Literaturgeschichte gestellt, unbestreitbar ist es eines der ältesten und bedeutendsten Werke der Weltliteratur. In vierundzwanzig Gesängen schildert der Dichter Homer eine kurze Phase aus dem Trojanischen Krieg, wofür er auf frühzeitliche Lieder und mündlich überlieferte Sagen zurückgreift. Seine Darstellung der mythologischen Götter- und Heldenwelt prägt seit der Antike die gesamte europäische Geistes- und Kulturgeschichte.
Am Anfang steht der Zorn. Weil Agamemnon, der Anführer des griechischen Heeres, seine Beute, die Tochter eines Apollon-Priesters, zurückgeben muss, um den Gott zu besänftigen, nimmt er sich stattdessen das Beutemädchen des Achilleus, was diesen schwer erzürnt. Von dem »unnennbaren Jammer«, der auf diesen »bitteren Zank« folgt, handelt die Ilias. Sie schildert einundfünfzig Tage im letzten Jahr des Krieges der Griechen gegen die Trojaner, in denen die zehnjährige Belagerung der Stadt Troja (griech. Ilios) eine entscheidende Wendung erfährt. Kunstvoll wird dabei die Endphase des Konflikts mit Rückblenden auf Szenen aus früheren Kriegsjahren verknüpft. Der Auslöser des Krieges, der Raub der Helena, konnte beim Publikum vorausgesetzt werden und wird daher nur kurz erwähnt: Die Gattin des spartanischen Königs Menelaos war von Paris, dem Sohn des trojanischen Königs Priamos, nach Troja mitgenommen worden, woraufhin die vereinten Griechen gegen Troja zogen. Auch der eigentliche Kriegsverlauf galt als bekannt, und entsprechend konzentriert sich die Ilias auf die inneren Regungen der Menschen und Götter.
Im Mittelpunkt steht jener Held Achilleus, der bis auf seine Ferse (die sprichwörtliche Achillesferse) unverwundbar ist und der durch Agamemnon in seiner Ehre verletzt beschließt, nicht mehr unter diesem zu kämpfen. Obwohl die Griechen in der Folge keine Schlacht mehr gewinnen und fast vor der Niederlage stehen, bleibt Achilleus stur. Sein Freund und Vertrauter Patroklos jedoch zieht in die Schlacht und wird von Hektor, dem älteren Bruder von Paris und Heerführer der Trojaner, getötet. Außer sich vor Trauer über dessen Tod wütet Achilleus auf dem Schlachtfeld und kann schließlich Hektor besiegen. In blindem Zorn schleift er dessen Leichnam um die Mauern Trojas und anschließend über zehn Tage lang immer wieder um das Grabmal des Patroklos. Erst als sich König Priamos als Bittsteller ins Lager der Griechen schleicht und um die Leiche seines Sohnes fleht, zeigt Achilleus Gefühl: Beide weinen gemeinsam um die Menschen, die sie verloren haben. So wird mit der Auslösung von Hektors Leichnam auch das Ausgangsproblem im ersten Vers der Ilias, der Zorn des Achilleus, aufgelöst. Die ehrenvolle Bestattung Hektors, für die ein elftägiger Waffenstillstand eingehalten wird, beschließt die Ilias. Die letzte der drei Totenansprachen hält seine Schwägerin, sodass am Ende der Ilias noch einmal jene Frau das Wort hat, die am Ausgangspunkt des ganzen Krieges stand: Helena. Damit kommt die ins Zentrum gerückte Etappe zu einem Abschluss, und gleichzeitig rückt der große Rahmen des Krieges wieder in den Blick. Denn nach der kurzen Waffenruhe wird dieser fortgesetzt, aber das Publikum weiß: Mit dem Tod Hektors ist der Untergang Trojas eingeleitet.
Auch wenn über das Leben Homers kaum etwas bekannt ist – man geht davon aus, dass er wohl in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. gelebt hat –, so betrachtet man es aufgrund der künstlerischen Gesamtkomposition des Textes heute weitgehend als gesichert, dass die mehr als fünfzehntausend in Hexameter verfassten Verse der Ilias in schriftlicher Form fixiert wurden. Damit gelten sie als eines der ersten Zeugnisse der europäischen Literatur. Seit der Antike haben sich bildende Künstler produktiv mit der Ilias auseinandergesetzt, und von Dichtern wurde sie (sowie ihre jüngere Schwester, die Odyssee, die die Irrfahrten des Odysseus auf dem Rückweg von Troja zum Thema hat) jahrtausendelang als eine Art Steinbruch genutzt, indem sie einzelne Episoden oder Motive verarbeiteten. Kaum ein Autor, der etwas auf sich hielt, hat sich nicht mit Homer auseinandergesetzt. Auch die Historiker orientierten sich auf der Suche nach Informationen zum Trojanischen Krieg lange an Homers Ausführungen, die das Bild der griechischen Mythologie definierten und damit die kulturelle Identität Europas bis heute mitbestimmen.
Doch die Rolle des Werkes für die europäische Kulturgeschichte geht weit über seine historische Bedeutung oder motivische Anleihen hinaus, denn die Ilias zeigt idealtypisch, was Literatur alles leisten kann – und zwar im Hinblick auf Form, Charaktere, Sprache und Relevanz. Die kunstvolle, dramatische Handlungsstruktur, die Individuen, Heere und Götter ineinanderwebt, sowie die Komplexität von Achilleus’ Charakter, der zwischen Wut, Stolz, Rache, Trauer und Mitleid changiert, bieten schon all das auf, was ab dem 18. Jahrhundert den Roman so populär werden lassen sollte. Das Ganze wird in einer eigenen intensiven Diktion festgehalten, die wesentlichen Anteil an der Wirkung des Werkes gehabt haben dürfte. Einzelschicksal und Gesamtsystem sind bei Homer unlösbar verquickt, denn Achilleus setzt zur persönlichen Genugtuung die Gemeinschaft aufs Spiel, die zwar am Ende siegreich, aber auch im Innersten verunsichert bleibt. Hinter dem abwechslungsreichen Plot wird damit eine drängende gesellschaftspolitische Frage verhandelt, die die Griechen der damaligen Zeit umtrieb: Wie sind als allgemeingültig angenommene Normen im Lichte einer sich wandelnden Gesellschaft neu auszulegen? So geht es zunächst scheinbar um wenig, nämlich um den Zorn eines einzelnen jungen Mannes, im Grunde aber von Anfang an um alles: um das Verhältnis zu den Göttern, die Fragilität der Existenz und die Konsequenzen des individuellen Handelns – letztlich um die conditio humana. Was für ein Auftakt für die europäische Literatur!
um 440 v. Chr.
Herodot
Historien
Der Vater der Geschichtsschreibung und der Kampf der Kulturen
Nichts weniger als eine umfassende Darstellung der Entwicklung der gesamten damals bekannten Welt hatte Herodot im Blick, als er seine Historien anfertigte. Er entfaltete ein Panorama aller Völker und Kulturen und kam den Bedürfnissen seiner Zeitgenossen nach, den eigenen zivilisatorischen und historischen Standort zu bestimmen. Damit markiert sein Werk nicht nur die erste Geschichte des Abendlandes, die in ihrer Konzentration auf die Perserkriege und damit auf die Frontstellung zwischen Europa und Asien teils bis heute fortwirkende kulturelle Muster und Klischees prägte, sondern setzte auch Maßstäbe im Hinblick auf die Arbeit der Geschichtsschreiber.
Ein Kalenderspruch besagt, dass nur derjenige seinen Weg findet, der weiß, wo er herkommt. In dieser Sichtweise ist die vermeintlich rückwärtsgewandte Arbeit des Historikers immer zukunftsorientiert, denn aus dem Verständnis der Vergangenheit lassen sich idealerweise Erkenntnisse für Gegenwart und Zukunft ableiten. Diese Doppelperspektive ist schon den Historien von Herodot eingeschrieben, die gemeinhin als eine Art Gründungstext der Geschichtsschreibung gelten.
Über das Leben des »Vaters der Geschichtsschreibung« (Cicero) ist nur wenig bekannt. Herodot wurde wohl um 485 v. Chr. in Halikarnassos, dem heutigen Bodrum, geboren und wuchs auf der Insel Samos auf. Nach dem gescheiterten Versuch, den herrschenden Tyrannen seiner Geburtsstadt zu stürzen, unternahm er zahlreiche Reisen (unter anderem nach Ägypten oder Mesopotamien), die er wohl für Handelsaktivitäten nutzte, und verfertigte nebenbei Reiseberichte. Er ließ sich in Athen nieder, wo er vermutlich um 425 v. Chr. starb, freundete sich mit Sophokles an und kam in Kontakt mit dem Staatsmann Perikles.
Zentrale Themen seiner Universalhistorie in neun Büchern sind die Entstehung und Abfolge der Konflikte und Kriege zwischen Griechen und Persern bis zur Schlacht bei den Thermophylen und der endgültigen Niederlage der Perser im Jahr 479 v. Chr. Bereits im ersten Satz der Vorrede entfaltet Herodot die Komplexität seines Vorhabens, wenn er schreibt: »Die Darstellung der Erkundung des Herodot aus Halikarnassos ist dies, damit weder das von Menschen Geschehene durch die Wirkung der Zeit verblasse noch die großen und staunenswerten Werke, ob sie nun von Hellenen oder Barbaren aufgewiesen wurden, ohne Kunde bliebe; unter anderem geht es insbesondere darum, aus welcher Ursache sie miteinander Krieg führten.« Mit der Aussage, sich auf das »Menschengemachte« zu konzentrieren, grenzt er sich vom götterorientierten Mythos ab. Indem er seinen Namen nennt und das Folgende als Ergebnis seiner Forschungstätigkeit (»Erkundung«) markiert, drückt er der Geschichtsschreibung seinen Stempel auf – eigene Forschung wird zur Voraussetzung des Schreibens. Darüber hinaus interessiert er sich neben Aktionen und Handlungen (»das von Menschen Geschehene«) auch für allgemeine Kulturleistungen (»staunenswerte Werke«) und betont somit den grundlegenden Anspruch seiner Ausführungen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Griechen und »Barbaren« stehen für ihn stellvertretend für allgemeine Prinzipien der Weltgeschichte: dass nämlich Machtversessenheit und Machtvergessenheit in den Untergang führen – diese Entwicklung zu veranschaulichen ist Kern seines Vorhabens. Dem Expansionsdrang der Perser folgend kann er weit ausholen und über die fremden Länder und Völker berichten, die sich mit deren Aggression konfrontiert sahen. Dabei versucht er, die bekannte Welt in ihrer ganzen Größe und Vielgestaltigkeit in den Blick zu bekommen.
Herodot bemüht sich darum, die vermeintlichen Besonderheiten der Völker zu erklären – weshalb er bisweilen auch als der Begründer der Anthropologie betrachtet wird –, und beruft sich dabei unter anderem auf klimatische Besonderheiten: Der karge und fordernde Lebensraum der Griechen habe sie hart gemacht, während »die Barbaren« aufgrund der Fruchtbarkeit ihres Landes verweichlicht seien. Daneben stellt er mit Blick auf die Organisationsform des Soziallebens fest, dass die Unterordnung unter einen Alleinherrscher zur Feigheit erziehe, während die Griechen in Freiheit aufwüchsen. Auch wenn Herodot bisweilen differenziert und ja im ersten Satz anerkennt, dass »die Barbaren« ebenfalls Großes hervorgebracht haben, werden hier doch Stereotype gesetzt, die dem Widerstand der Griechen die Dimension eines Kulturkampfes einschreiben: Mit einer Niederlage gegen »die Barbaren« würden freiheitliche Lebensart und eine ganze Zivilisation verschwinden. Das impliziert allerdings nicht nur eine Kampfansage der Griechen an den äußeren Feind, sondern richtet sich viel eher noch als Mahnung nach innen, die freiheitliche Selbstorganisation nicht unter dem Vorwand der Bedrohung zu opfern oder sie sich im Zuge innergriechischer Kämpfe beschneiden zu lassen.
In seinem multiperspektivischen Werk setzt Herodot alle Kniffe des Erzählens ein, um zu unterhalten, wie etwa Einblicke in die Innenwelten der historischen Akteure. Mit zahlreichen Verweisen auf mythische Zeiten, in denen noch die Götter auf Erden walteten, schreitet er nicht nur geografisch den Raum der bekannten Welt aus, sondern schlägt auch historisch den größtmöglichen Bogen und hat den Blick fest in die Zukunft gerichtet. Denn der Sieg über die Perser ist für ihn nicht der Schlusspunkt einer griechischen Erfolgsgeschichte, sondern mahnendes Exempel.
Die Historien haben nicht nur die Sichtweise von Herodots Zeitgenossen auf die Welt geprägt und viele Regionen, Kulturen, Sitten und Phänomene erstmals überhaupt beschrieben; sie gelten ungeachtet aller kritischen Diskussionen um ihre Zuverlässigkeit auch heute noch als zentrale Quelle zum Verständnis des griechisch-persischen Konfliktes.
um 330 v. Chr.
Aristoteles
Politik
Von natürlicher Geselligkeit und guter Herrschaft
In seiner Politik untersucht Aristoteles Entstehung und Formen politischer Gemeinschaften, ausgehend von der Idee des Menschen als sozialem Wesen (zoon politikon) und auf der Grundlage seiner Lehre vom »guten Leben« (Eudämonismus). Seit ihrer Wiederentdeckung im 13. Jahrhundert hat die Schrift Generationen von Denkern inspiriert, auch in Deutschland. Während man noch bis ins 19. Jahrhundert hinein in der politischen Philosophie von regelrechten aristotelischen Schulen sprechen kann, sind es seither eher einzelne Elemente, die diesem Klassikertext entlehnt werden.
»Nach seinem Tode dauerte es zweitausend Jahre, bis die Welt wieder einen ihm auch nur annähernd ebenbürtigen Philosophen hervorbrachte«, schrieb der englische Philosoph Bertrand Russell über Aristoteles. Aristoteles (384–322 v. Chr.), der Schüler Platons und Lehrer Alexanders des Großen, gilt heute als einer der Überväter der Philosophie. Im europäischen Mittelalter stand er zunächst im Schatten Platons – im Gegensatz zur islamischen Welt, wo die meisten seiner Werke schon im 9. Jahrhundert in arabischer Sprache vorlagen. Gelehrte wie Avicenna (ibn Sīnā) oder Averroës (ibn Rušd) ließen sich von Aristoteles inspirieren. In Europa wurden seine Schriften erst im 13. Jahrhundert wiederentdeckt. Eine Schlüsselrolle spielten dabei der in Paris und Köln lehrende Albertus Magnus und sein Schüler Thomas von Aquin. Die Verbreitung der aristotelischen Lehren – von der Logik bis zur Naturphilosophie – muss sich danach rasant vollzogen haben. Schon Ende des Jahrhunderts beklagte der Franziskaner Petrus Johannes Olivi: »Man glaubt ihm ohne Grund – wie einem Gott dieser Zeit.«
Wiederentdeckt wurde damals auch Aristoteles’ Politik. Über die Entstehung der Schrift wissen wir wenig. Wahrscheinlich wurden posthum verschiedene Arbeiten zusammengefügt. Den roten Faden bildet der Gegenstand: Entstehung und Aufbau der Polis sowie ihre Regierungsformen. Für Aristoteles ist die Polis – der Stadtstaat der griechischen Antike – eine natürliche Erscheinung; natürlich deshalb, weil der Mensch von Natur aus ein soziales Wesen ist, ein zoon politikon. Um in der Verfolgung des Endziels jeder menschlichen Gemeinschaft – des »guten Lebens« – von anderen unabhängig zu sein, schließen sich kleinere Gruppen (Familie, Hausgemeinschaft, Dorf) zur Polis zusammen. Zur Herrschaft in der Polis kommen für Aristoteles allerdings nur freie Männer in Betracht. Frauen und Kinder werden durch die Trennung zwischen Polis und Hausgemeinschaft (Oikos) von den politischen Geschäften ausgenommen. Der Oikos als der Ort des Wirtschaftens (daher auch: Ökonomie) steht unter der Leitung des Hausherrn, dem die rechtlosen Sklaven ebenso »natürlich« untergeordnet sind.
Im zweiten Teil der Schrift unterscheidet Aristoteles die Regierungsformen nach der Anzahl der Herrschenden: Monarchie (Einzelherrschaft), Aristokratie (Herrschaft der Besten, d.h. der Weisesten) und Politie (Herrschaft aller Bürger, wobei Ämter nur Wohlhabenden offenstehen und die Armen die Reichen nicht überstimmen können). Alle drei sind auf Verwirklichung des Gemeinwohls angelegt; weil aber der Ausschluss großer Teile der Einwohnerschaft zu Unmut führen kann, verspricht die Politie im Allgemeinen am ehesten Stabilität. Den drei »guten« Regierungsformen stellt Aristoteles ihre Verfallsformen gegenüber, in denen Eigennutz regiert: Tyrannis, Oligarchie und Demokratie. Die Demokratie verurteilt er nicht pauschal; ihre radikale Form aber, in der alle freien Einwohner gleichberechtigt mitbestimmen, begünstige Demagogie und führe zur Herrschaft der Willkür. Anders als sein Lehrmeister Platon, der in der Politeia die Utopie einer Philosophenherrschaft entwirft, schreibt Aristoteles nicht über die ideale Verfassung. Seine Systematisierung versteht er als Theorie auf empirischer Grundlage.
Vor allem die Staatsbegründung, aber auch die Lehre von den Regierungsformen hat durch die Jahrhunderte Denker inspiriert, um Antworten auf Fragen ihrer Zeit zu finden. Zum Beispiel Thomas von Aquin, der aus der Idee »natürlicher« Gemeinschaft folgerte, dass es neben der göttlichen Ordnung auch eine menschlich geschaffene gebe. Dies verhalf der Lehre vom Dualismus geistlicher und weltlicher Macht zum Durchbruch, die im Investiturstreit noch unterlegen war (sinnbildlich der Gang Heinrichs IV. nach Canossa im Jahre 1077). Philipp Melanchthon verfasste 1530 einen Kommentar zur Politik, in dem er Luthers theologisch begründete Ablehnung der Bauernkriege philosophisch flankierte: Weil die Ordnung natürlichen Ursprungs sei, liege auch der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit in der Natur des Menschen. Er begründete eine protestantische Schule des politischen Aristotelismus, deren Zentrum die Universität Helmstedt wurde. Ihr einflussreichster Repräsentant, Hermann Conring, baute auch auf Aristoteles, um den Zynismus der Macht in Machiavellis Lehre von der Staatsräson durch Sittlichkeit zu bändigen. Im 19. Jahrhundert ist es vor allem Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der von Aristoteles wichtige Impulse empfängt. Auf der Unterscheidung von Oikos und Polis beruht seine Trennung zwischen bürgerlicher Gesellschaft und staatlicher Herrschaft; auch dass Hegels Staat die sittliche Vervollkommnung seiner Bürger zum Ziel hat, ist Aristoteles verpflichtet.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein denken politische Philosophen im aristotelischen System. Seitdem sind es eher einzelne Elemente der Politik, die etwa Hannah Arendt, Joachim Ritter oder Vertreter des Kommunitarismus entlehnt haben. Die Klassifikation der Regierungsformen wiederum steht am Anfang der modernen Lehre von den politischen Systemen. Ein Klassiker also, der bis heute inspiriert – trotz des harschen Urteils, das Bertrand Russell über Aristoteles’ Schrift fällt: »Ich glaube, sie enthält nicht viel, was für einen heutigen Politiker noch von praktischem Wert wäre.«
um 300 v. Chr.
Euklid
Die Elemente
Ein Weg zur reinen Erkenntnis
Euklid wird von vielen als einflussreichster Mathematiker betrachtet, dessen wichtigste Abhandlung, Die Elemente, als eines der erfolgreichsten Lehrwerke aller Zeiten gilt. Mit über eintausend verschiedenen Editionen ist es nach der Bibel das in den meisten Ausgaben gedruckte Buch und wohl eines der meistrezipierten Werke der Menschheitsgeschichte. Euklid systematisiert darin die Summe des mathematischen Wissens seiner Zeit und führt beispielhaft vor, wie eine exakte Wissenschaft zu arbeiten habe. Kaum einem anderen Werk wird ein vergleichbar großer Einfluss auf die Methodik des wissenschaftlichen Denkens zugesprochen.
Auch diejenigen, die sich nicht unbedingt mit Freude an den Mathematikunterricht erinnern, können vermutlich einige Formeln noch immer auswendig. Doch weder der Satz des Pythagoras noch der Satz des Thales würde heute ohne Euklid zum Allgemeingut zählen. Denn auch wenn natürlich vor Euklid schon bedeutende Mathematiker wie eben Pythagoras oder Thales wirkten und vielen weitaus mehr mathematische Kreativität zugeschrieben wird, so standen deren Erkenntnisse doch vereinzelt und waren nicht in einem umfassenden Denksystem verbunden, das erst Euklid mit Die Elemente vorlegte. Euklid betritt darin nur zum Teil mathematisches Neuland, wie etwa mit dem Beweis dafür, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Seine Leistung liegt vor allem darin, das bereits Entdeckte auf den Gebieten der Geometrie, Arithmetik, Algebra und Zahlentheorie erstmals zu kartografieren und in eine zusammenhängende Ordnung zu bringen. Dabei greift er auf philosophische Konzepte Platons und methodologische Überlegungen von Aristoteles zurück.
Euklid formuliert ein System, in dem jede Erkenntnis auf bereits hergeleitetem, gesichertem Vorwissen aufbaut. Er setzt an den Anfang beschreibende Definitionen von Grundbegriffen wie »Punkt« (»Ein Punkt ist, was keine Teile hat.«) oder »Linie« (»Eine Linie ist eine breitenlose Länge.«), bevor er fünf Postulate formuliert, die geometrischen Festlegungen gleichkommen, wie die, dass alle rechten Winkel einander gleich seien. Darauf folgen mehrere logische Axiome, also eine Reihe von Aussagen, von denen auszugehen ist, dass sie jedermann aufgrund eigener Anschauung unmittelbar einleuchten und deren Richtigkeit nicht bewiesen werden muss (etwa: »Wenn Gleichem Gleiches hinzugefügt wird, sind die Ganzen gleich.«). Die Axiome sind das logische Fundament, auf dem ausgehend von den einführenden Beschreibungen (Definitionen) und Festlegungen (Postulaten) weitere Schlüsse gezogen werden können. Alle folgenden Sätze und Beweise verwenden nur die Definitionen, Postulate und Axiome beziehungsweise vorher Bewiesenes, alles muss deduktiv hergeleitet werden. Wie bei den Gliedern einer Kette reiht sich logische Schlussfolgerung an logische Schlussfolgerung. Damit hat Euklid ein Denkverfahren profiliert, das fortan als Vorbild für die wissenschaftliche Theoriebildung fungierte.
Der Zeitpunkt oder die Umstände der Entstehung und Niederschrift der Elemente liegen im Dunkeln. Einige meinen, Euklid müsse eher als eine Art Herausgeber denn als Verfasser betrachtet werden, andere gehen davon aus, dass es sich um Mitschriften seiner Schüler handele. Diese Unsicherheiten wundern nicht, denn auch über das Leben Euklids weiß man kaum etwas und auch das Wenige nur aus Aufzeichnungen, die Jahrhunderte nach seinem Tod angefertigt wurden. Einer Version seiner Biografie zufolge soll er um 325 v. Chr. in Athen geboren und an der Akademie Platons ausgebildet worden sein. Er sei dann von Ptolemaios I. an das Museion in Alexandria berufen worden, eine Akademie und Forschungsstätte für herausragende Denker, die oft als Vorbild der modernen Universitäten bezeichnet wird. Man geht davon aus, dass Euklid um 270 v. Chr. in Alexandria verstorben ist. Ungeachtet der dürftigen Faktenlage sind allerdings einige berühmte Anekdoten zu Euklid überliefert. Eine besagt, dass er König Ptolemaios I. auf dessen Frage, ob nicht ein einfacherer Zugang zum Verständnis der Geometrie existiere, geantwortet haben soll, dass es in diesem Falle keinen bequemen Königsweg gebe. Laut einer anderen soll Euklid von einem Schüler gefragt worden sein, was man denn mit mathematischen Einsichten einmal verdienen könne, woraufhin er diesem verächtlich ein paar Münzen habe zuwerfen lassen. Auch wenn sich diese Begebenheiten so nie zugetragen haben mögen, so sagen sie im Kern doch etwas über die Bedeutung der Mathematik im hellenistischen Denken: dass es nämlich nicht um einen anwendungsbezogenen oder gar materiellen Nutzen ging, sondern um das Streben nach reiner Erkenntnis und idealen Wahrheiten – und da musste sich dann eben ein König genauso anstrengen wie jeder andere.
Auch wenn Die Elemente über Jahrtausende hinweg erst in Handschriften und dann in Druckform für den Mathematikunterricht benutzt wurden, so sind sie doch kein Lehrwerk im engeren Sinne. Euklid verzichtet darauf, Schüler »mitzunehmen«, ihnen mit praktischen Beispielen das Verständnis zu erleichtern oder vertiefende Erläuterungen einzubauen. Damit steht die Abhandlung auch auf formaler Ebene für das ein, was vom Ansatz her das Zentrum markiert: Konzentration auf unverfälschten Erkenntnisgewinn. In seinem trockenen Stil und strengen Aufbau von Definition, Satz und Beweis steht das Werk für das zeittypische Verständnis von Mathematik. Goethe lobte Euklids Elemente »als ein unübertroffenes Muster eines guten Lehrvortrags«, das »in der größten Einfachheit und notwendigen Abstufung ihrer Probleme« vorführe, »wie Eingang und Zutritt zu allen Wissenschaften beschaffen sein sollten«. Doch auch wenn unzählige Schüler und auch vermutlich einige Lehrer an Euklid verzweifelten – seine historische Bedeutung für die Entwicklung der exakten Wissenschaften weit über die Grenzen der Mathematik hinaus ist kaum zu überschätzen.
um 400
Augustinus
Bekenntnisse
Das Individuum betritt die Weltbühne
Augustinus ist gerade seit zwei Jahren Bischof, als er mit seinen Bekenntnissen eine Art Selbsterklärungsschrift mit Vorbildcharakter vorlegt: Er grenzt sich von jenen Irrlehren ab, denen er in seinem früheren Leben anhing, und präsentiert (s)eine Bekehrungsgeschichte. Damit schuf Augustinus, einer der wichtigsten Kirchenlehrer der Geschichte, die wohl wirkmächtigste Autobiografie der Weltliteratur, die heute als einer der zentralen Texte des christlichen Abendlandes gilt.
Im Zentrum des Papstwappens von Benedikt XVI. steht eine Muschel, die an eine Legende aus dem Lebens seines Lieblingstheologen Augustinus erinnert: Dieser habe einen Jungen am Strand bei dem Versuch beobachtet, mit einer Muschel das Meer leer zu schöpfen, was ihm die Unmöglichkeit seines eigenen Bemühens vor Augen führte, die Mysterien Gottes mit seinem beschränkten Verstand zu erfassen. Dass Augustinus sich überhaupt einmal mit solcherart theologischen Fragen befassen würde, war bis zu seinem zweiunddreißigsten Lebensjahr alles andere als wahrscheinlich.
Aurelius Augustinus wurde 354 in Thagaste im heutigen Nordost-Algerien als Sohn eines heidnischen Vaters und einer christlichen Mutter geboren. Nach einem Rhetorikstudium in Karthago wirkte er lange als Rhetoriklehrer in seiner Heimatstadt und lebte ein sehr weltliches Leben. Erst 386 hatte er jenes Bekehrungserlebnis, das er an der Schlüsselstelle seiner Autobiografie beschreibt: Verzweifelt angesichts seines verpfuschten Lebens weinte er unter einem Baum, bis ihn eine Kinderstimme zu lesen aufforderte. »Da drängte ich meine Tränen zurück, stand auf und legte die gehörten Worte nicht anders, als daß ein göttlicher Befehl mir die heilige Schrift zu öffnen heiße und daß ich das erste Kapitel, auf welches mein Auge fallen würde, lesen sollte.« Nicht ohne Folgen, denn »alsbald am Ende dieser Worte kam das Licht des Friedens über mein Herz und die Nacht des Zweifels entfloh«. Fortan widmete er sein Leben Gott, ließ sich taufen und im Jahr 391 in Mailand zum Priester weihen. Vier Jahre später wurde er zum Bischof von Hippo Regius (heute Annaba im Nordosten Algeriens) ernannt, was er bis zu seinem Tod 430 blieb. In dieser Funktion schuf er ein beeindruckendes theologisches und philosophisches Werk, das die Summe der spätantiken Kirche und Grundlage der abendländischen Theologie bildet. Seinen Bekenntnissen, in der Weltsprache Latein verfasst, kommt in diesem Kontext eine herausgehobene Bedeutung zu, da sie aufgrund ihrer Anlage als Autobiografie besonders breite Rezeption fanden.
Augustinus selbst hat den Bekenntnissen eine doppelte Funktion zugesprochen: In Auseinandersetzung mit dem Schlechten und dem Guten, das man in sich selbst finde, solle Gott als gut und gerecht gelobt werden. Schuldbekenntnis und Lobpreisung Gottes gehen hier Hand in Hand, die Lektüre solle die Leser zu Gott führen. Sein autobiografischer Ansatz erlaubt eine weitgehend chronologische Darstellung des ganzen bisherigen Lebens in allen Einzelheiten des äußeren Geschehens und der inneren Entwicklung. Dabei legt Augustinus sein Augenmerk vor allem auf die Wendepunkte in seinem Leben und die Momente, in denen er Gottes Führung besonders gut veranschaulichen zu können meint. Der Text wird als Zwiegespräch mit Gott inszeniert: Durch die dauernde Ansprache Gottes wird der Rahmen der Vorsehung stets präsent gehalten, was dem Text ungeachtet aller Irrwege und Verfehlungen des Protagonisten eine besondere Geschlossenheit verleiht.
Mit den Bekenntnissen tritt die selbstreflexive Funktion der Autobiografie erstmals nachhaltig in den Vordergrund: Die individuelle Geschichte einer Bekehrung zum Christentum wird als exemplarisches Erfolgsmodell inszeniert. Die Bekenntnisse werden zum Gründungstext der Gattung Autobiografie, an dem man sich noch viele Jahrhunderte später orientiert – so auch der paradigmatische Text der modernen Autobiografie: Rousseaus Confessions (posthum 1782 veröffentlicht). Bei Rousseau wird das Ich dann zur alleinigen Richtgröße des autobiografischen Unternehmens (er verzichtet auf jegliche religiöse Rechtfertigung). Schonungslose Aufrichtigkeit ist sein Versprechen, womit die Subjektivität der Darstellung besonderes Gewicht bekommt, die nach einer der eigenen Wahrheit angemessenen sprachlichen Repräsentation verlangt – ein Anspruch, den Goethes Autobiografie dann bekanntlich offensiv im Titel trägt: Dichtung und Wahrheit (1811–1814, 1833). Und auch Goethe charakterisiert in Anspielung auf Augustinus seine Autobiografie als »Bruchstücke einer großen Konfession«.
Ab dem 14. Jahrhundert finden Augustinus’ Gedanken in Deutschland weite Verbreitung. Für Luther sind dessen Lehren von kaum zu überschätzender Bedeutung – schließlich erwarb er seine theologische Bildung als Augustinermönch. Im 17. Jahrhundert erscheinen dann erste Übersetzungen ins Deutsche. Neben der theologischen Relevanz war es die philosophische Dimension von Augustinus’ Bekenntnissen, waren es besonders seine Überlegungen zum Konzept der Zeit und zur Erinnerung, die großen Widerhall in der deutschsprachigen Rezeption fanden: bei Leibniz, Schopenhauer, Husserl, Wittgenstein oder Heidegger – Hannah Arendt promovierte bei Karl Jaspers über Augustinus. Vor diesem Hintergrund ist dem deutschen Augustinus-Kenner Benedikt XVI. zuzustimmen, wenn er sagt: »Einige Schriften des Augustinus sind von grundlegender Bedeutung, und dies nicht nur für die Geschichte des Christentums, sondern für die Entwicklung der gesamten abendländischen Kultur: das deutlichste Beispiel sind die Confessiones.« Denn Augustinus’ Bekenntnisse rückten das über sich selbst reflektierende Ich erstmals ins Zentrum der Aufmerksamkeit, von wo es heute nicht mehr wegzudenken ist.
um 530
Corpus Iuris Civilis
Vom späten Siegeszug des Römischen Rechts
Mit der Wiederentdeckung einer antiken Abschrift des Corpus Iuris Civilis begann im 11. Jahrhundert die Rezeption des Römischen Rechts. Ausgehend von der Universität Bologna breitete es sich als »Gemeines Recht« mithilfe neu gegründeter Rechtsfakultäten und einer Professionalisierung des Rechtswesens in ganz Europa aus. Obwohl es in Deutschland nie formal als Rechtsquelle eingesetzt wurde, prägte es die Rechtspraxis über Jahrhunderte. Bis heute folgt das zivilrechtliche Studium jener Systematik, die der Jurist Tribonian im Auftrag Kaiser Justinians um 530 entwarf.
Mitte des 11. Jahrhunderts wurde in Pisa ein Pergament von mehr als neunhundert Blättern wiederentdeckt, das später nach Florenz gelangte (Littera Florentina). Es enthielt eine zeitgenössische Abschrift der Gesetzessammlung, die der oströmische Kaiser Justinian 528 in Auftrag gegeben hatte. Mit aller Macht stemmte dieser sich gegen den drohenden Zerfall des Reiches. Der Codex Justiniani sollte die Rechts- und Verwaltungseinheit stärken und an die frühere Größe des Imperium Romanum erinnern. Die Ära Justinians erwies sich als letzte Blütezeit Roms. Seine Siege über die Goten und Vandalen waren nicht von Dauer; schon bald würde Westrom wieder an die Germanen fallen, Nordafrika an die Araber. In den eroberten Gebieten konnte sich der Codex nicht lange halten, und in Ostrom geriet er in Vergessenheit, als dort im 7. Jahrhundert Griechisch Amtssprache wurde.
Der Codex Justiniani wurde in kürzester Zeit unter Leitung des kaiserlichen Quaestors Tribonian erstellt und zwischen 529 und 534 veröffentlicht. Er bestand aus drei Teilen: den Institutionen, einer Art Lehrbuch zur Einführung; den Digesten oder Pandekten (lateinisch: geordnete bzw. griechisch: umfassende Darstellung), welche das geltende Zivilrecht in Auszügen aus Schriften klassischer Juristen präsentierten; dem Codex, einer Sammlung der noch gültigen kaiserlichen Gesetze seit Hadrian. Später wurde ein vierter Teil angefügt, die Novellen, der die Gesetze Justinians nach 534 versammelte. Mit der Wiederentdeckung jenes Corpus Iuris Civilis – die Bezeichnung stammt aus der Frühen Neuzeit – im 11. Jahrhundert begann das geradezu spektakuläre Phänomen der Rezeption des Römischen Rechts in Europa.
Der Überlieferung zufolge war es Irnerius von Bologna (um 1050 – 1130), der den Codex Justiniani wegen der Schönheit seiner Sprache und der Klarheit seiner Gedanken für den Rhetorikunterricht heranzog. Hieraus entwickelte sich die berühmte Rechtsschule von Bologna, an der das Römische Recht als wissenschaftliches System untersucht wurde. In exegetischen Übungen wurden die altrömischen Texte mit Kommentaren (Glossen, daher: Glossatoren) versehen und mit Problemen der Gegenwart verknüpft. Aus allen Ländern kamen Studenten nach Bologna, um dort das Römische Recht zu studieren. Nach und nach wurden überall in Europa Universitäten gegründet, an denen das Corpus Iuris Civilis gelehrt wurde, im Heiligen Römischen Reich zuerst in Prag (1347), Wien (1365), Erfurt (1379) und Heidelberg (1385).
Die Absolventen der mittelalterlichen Rechtsfakultäten sorgten für die weitere Verbreitung; eine zunehmende Professionalisierung des Rechtswesens führte dazu, dass mehr und mehr nach Römischem Recht entschieden wurde. Die fortschreitende Rechtsangleichung kam auch den Bedürfnissen des sich ausdehnenden Handels entgegen. Dieser profitierte von der größeren Berechenbarkeit, die das sogenannte Gemeine Recht bot. Dabei behielt das Römische Recht im Heiligen Römischen Reich den Status einer informellen Rechtsquelle. Formal gingen ihm Reichsrecht, Landesrecht und das lokale Gewohnheitsrecht vor. Es war aber eben im doppelten Sinne »gelehrtes Recht«, nämlich das Recht, das die Beamten und Richter studiert hatten und dem sie wegen seiner schriftlichen Fixierung oft den Vorzug gaben. Volksausgaben in deutscher Sprache, wie der Klagspiegel des Conrad Heyden (um 1436) oder Ulrich Tenglers Laienspiegel (1509), förderten die Verbreitung auch in der Bevölkerung und bei Laienrichtern.
Nach der ersten Phase der Rezeption des Römischen Rechts im Mittelalter gab es zwei weitere Phasen der vertieften Befassung mit dem Corpus Iuris Civilis in Deutschland. Im 17. Jahrhundert hatte das Nebeneinander verschiedener Rechtsquellen zu Unübersichtlichkeit geführt, was die Harmonisierung des Römischen Rechts mit lokalem Recht und Rechtspraxis nötig machte. Hieraus erwuchs eine wissenschaftliche Schule, die als usus modernus (moderner Gebrauch) in die Rechtsgeschichte eingegangen ist. Bei den Aufklärern des 18. Jahrhunderts sollte das Römische Recht allerdings schon bald in Misskredit geraten. Auch sie wollten eine systematische Ordnung des Rechts, aber auf Grundlage der Menschenrechte. Einer solchen Reform stand die römisch-rechtliche Traditionspflege entgegen.
Um 1800 stand die Pflege dieser Tradition wieder hoch im Kurs. Vor dem Hintergrund der aufziehenden Romantik begründete Friedrich Carl von Savigny die sogenannte Historische Rechtsschule, die nicht »aufgeklärte« Gesetzgebung, sondern das historisch (»organisch«) gewachsene Recht ins Zentrum rückte. Welche Rechtsquellen dem »Volksgeist« entsprächen – das deutsche Recht der Vor-Rezeptionszeit oder das rezipierte Römische Recht –, darum stritten sich innerhalb dieser Schule Germanisten (wie Jacob Grimm) und Romanisten. Letztere läuteten durch intensive Studien zum Corpus Iuris Civilis die dritte Phase der Rezeption ein. Die hieraus erwachsene Pandektenwissenschaft sollte nachhaltigen Einfluss auf die Gestaltung des Bürgerlichen Gesetzbuchs haben, das am 1. Januar 1900 in Kraft trat und in seiner Einteilung den Büchern der Digesten folgt (Schuldrecht, Sachenrecht, Familien- und Erbrecht). Auf diese Weise prägt das System, das Tribonian im Konstantinopel des 6. Jahrhunderts entwarf, das zivilrechtliche Studium in Deutschland bis in die Gegenwart.
um 1205
Wolfram von Eschenbach
Parzival
Sittenbild und Utopie – der Suchende als Erlöser
Der unbedarfte Parzival kommt aus dem Nichts und macht eine ritterliche Blitzkarriere am Artushof, die er gleich wieder aufgibt. Er wendet sich von Gott ab und begibt sich auf eine Suche, die am Ende mit dem Größten belohnt wird: dem Gralskönigtum. Das Versepos Parzival des Wolfram von Eschenbach wirkte, obwohl es die bekannte Artus- und Gralssage zum Stoff hatte, auf die Zeitgenossen revolutionär, weil es mit so vielen Konventionen brach und so viele Gewissheiten hinterfragte. In den politisch unruhigen Zeiten des deutschen Thronstreits zwischen Staufern und Welfen und vor dem Hintergrund der Glaubenskriege und Kreuzzüge präsentiert es ein utopisches Gesellschaftsmodell, das bis heute künstlerisch nachwirkt.
Der Titelheld muss warten. Zu Beginn steht erst einmal das Leben seines Vaters Gahmuret im Mittelpunkt, der aus königlicher Familie stammt. Dieser bereist den Orient und nimmt dort eine heidnische, dunkelhäutige Königin zur Frau, die er aber aus Abenteuerlust verlässt, bevor sie einen schwarz-weiß gefleckten Sohn mit Namen Feirefiz zur Welt bringt. Auch Parzivals Mutter Herzeloyde, die Gahmuret nach seiner Rückkehr in die Heimat geheiratet hat, muss sich um ihren Sohn allein kümmern, weil Gahmuret schon wieder zu einem Abenteuer aufgebrochen ist, in dem er umkommt. Parzival selbst, so erfahren wir nach dieser Vorgeschichte, wird von seiner Mutter im Wald aufgezogen, weil sie nicht auch noch ihn an die ritterliche Welt des Vaters verlieren will. Nach einer Begegnung mit durchreitenden Rittern bricht Parzival aber begeistert zum Artushof auf und stürzt sich ahnungslos in eine Welt, deren Regeln er nicht kennt, ja, deren Ordnung selbst in Auflösung begriffen zu sein scheint (so herrschen am Artushof Streit und Missgunst). Er bekommt bei dem alten Ritter Gurnemanz einen Schnellkurs in höfischem Benehmen und befreit auf der Suche nach Bewährungsabenteuern eine belagerte Königin. Sie heiratet Parzival, und obwohl er seine Frau liebt, zieht auch er noch vor der Geburt seines Stammhalters wieder los. Er gerät ein erstes Mal auf die Gralsburg, wo er wundersamen Vorgängen beiwohnt, die entscheidende Frage nach dem Grund des Leidens des Gralskönigs Anfortas aber nicht stellt. In seiner Irritation klammert er sich an Gurnemanz’ Rat, nicht zu viele Fragen zu stellen. Wo die ritterliche Etikette Zurückhaltung und Distanz vorgibt, wäre hier eine Grenzüberschreitung aus menschlichem Interesse gefragt gewesen. Als am nächsten Morgen die Gralsgesellschaft verschwunden ist, ahnt Parzival, dass er eine Chance verpasst hat.
Er kommt zum zweiten Mal zum Artuslager, wo er mit allen Ehren empfangen und zum Mitglied der Tafelrunde geschlagen wird. Er hat damit das erreicht, was man als Ritter erreichen kann. Eine Gralsbotin zerstört jedoch die feierliche Stimmung und verflucht Parzival wegen der ausgebliebenen Frage auf der Gralsburg. Parzival gibt Gott die Schuld an seinem Versagen, denn dieser habe ihm die notwendige Unterstützung verweigert. Er sagt sich von Gott los und bricht zur Suche nach dem Gral auf, den er in Abenteuern erringen zu können glaubt. Nach vier Jahren – hier sind im Epos die Erlebnisse des Ritters Gawan zwischengeschaltet – kommt Parzival zu einem Einsiedler, der sich als sein Onkel herausstellt. In den folgenden erzieherischen Gesprächen erkennt Parzival die Missverständnisse, die seine Lage bestimmen: Weder lasse sich Gott zu etwas zwingen noch der Gral erobern. Parzival erfährt, dass er schuld am Tod seiner Mutter sei, die anlässlich seines Aufbruchs zum Artushof vor Verzweiflung starb, er bei seinem ersten Besuch am Artushof einen Verwandten getötet und Anfortas nicht erlöst habe, obwohl er dazu ausersehen sei. Von diesen drei Sünden ist er aber am Ende der Episode erlöst – ohne Zutun eines Priesters, was das Spannungsverhältnis des Textes zur kirchlichen Dogmatik andeutet –, worauf im Epos wieder die Abenteuer Gawans folgen. Anschließend begegnet Parzival zunächst Feirefiz, mit dem er hart und ebenbürtig kämpft, bis durch göttliches Eingreifen Parzivals Schwert zerspringt. Feirefiz bricht den Kampf daraufhin ab, und die beiden erkennen sich als Brüder. Der Halbbruder aus dem Orient, ein »Ungläubiger« zudem, wird in die Tafelrunde aufgenommen. Parzival reitet noch einmal zur Gralsburg und stellt Anfortas endlich die simple, aber entscheidende Frage: »Was tut dir weh?« Anfortas ist daraufhin sofort geheilt und die Gesellschaft von all ihren Leiden erlöst. Parzival wird zum Gralskönig ernannt. Das Mitleid wird zum Dreh- und Angelpunkt des ganzen Epos, und die Erlösung – bis dahin undenkbar im Ritterepos – erfolgt durch Worte, nicht durch Kampf.
Eine Gralsburg in Bayern
Es gibt noch heute in Deutschland einen Ort, an dem Millionen Menschen jedes Jahr Parzival begegnen. In Neuschwanstein hat Ludwig II. den zentralen Prunksaal mit Wandbildern verzieren lassen, die Szenen aus dem Mittelalter-Epos darstellen. Denn er identifizierte sich mit dem Gralskönig und sah in seiner Person die geschichtliche Erfüllung des Mythos. Dass die meisten Touristen in der Rückschau ihren Schlossbesuch eher im Bildprogramm von Disneyfilmen als dem der mittelalterlichen Sage verorten, hätte dem Parzival aus dem Hause Wittelsbach sicher nicht gefallen.
Der Parzival wurde in mittelhochdeutscher Sprache wohl zwischen 1200 und 1210 verfasst. Wolfram, der vermutlich zwischen 1170 und 1220 in Franken lebte, griff dabei als Hauptquelle auf das unvollendet gebliebene altfranzösische Epos Perceval von Chrétien de Troyes zurück, das zwischen 1180 und 1190 entstanden war, von Wolfram allerdings um das Dreifache erweitert und umgearbeitet wurde. Der Parzival gehört zu den am meisten rezipierten Texten des Mittelalters und ist in fast neunzig Handschriften überliefert, was für einen beeindruckenden Erfolg und eine enorme Popularität unter den Zeitgenossen spricht: »Der Parzival«, so der Germanist Joachim Bumke, »muss eine literarische Sensation gewesen sein. Im 13. Jh. ist keine andere Dichtung so oft zitiert und so häufig kopiert worden.« Eine Sensation war das Epos – mit über vierundzwanzigtausend Versen der längste Erzähltext seiner Zeit – zweifellos in verschiedener Hinsicht: aufgrund der Vielzahl der beschriebenen (auch exotischen) geografischen Räume, der Komplexität der Handlungsstruktur und nicht zuletzt aufgrund der Themenvielfalt und besonderen Akzentuierung.
Schon im sogenannten Elsterngleichnis des Prologs macht Wolfram deutlich, dass ihn der nur gute oder nur böse Mensch kaum interessiert, sondern im Wechselspiel, im Miteinander von Schwarz und Weiß (wie im Gefieder einer Elster) der Reiz liege. Entsprechend macht Parzival als gemischter Charakter verschiedene Krisen und Entwicklungen durch, lädt aus Unerfahrenheit oder aufgrund von Missverständnissen immer wieder Schuld auf sich. Dennoch oder gerade deswegen ist er es, der zum Gralskönig erwählt wird. Parzival und Feirefiz, dessen Haut »wie ein beschriebenes Stück Pergament, weiß und schwarz durcheinander« aussieht, sind letztlich zwei Teile eines Ganzen; »Rasse« oder Religion spielen am Ende keine Rolle – eine unerhörte Aussage im zeitgenössischen Kontext.
Artushof und Gralsgesellschaft stehen für unterschiedliche Konzeptionen von Gemeinschaft. Während die Tafelrunde politisch agiert und auf die höfischen Werte von Kampf, Minne und Ehre fokussiert ist, stellt die Gralsgesellschaft Spiritualität und Geistlichkeit ins Zentrum (Minne ist sogar weitgehend verboten). Parzival als Suchender, als Scheiternder, als Erkennender findet im Mitleid schließlich den Weg, die weltliche und die spirituelle Sphäre in idealer Weise zu verbinden. Angesichts all des Elends, in das rücksichtslose Machtkämpfe und Religionskriege die Gesellschaften des frühen 13. Jahrhunderts gestürzt hatten, konnten die Zeitgenossen in Parzival damit leicht den utopischen Entwurf eines vorbildhaften Herrschers erkennen. Während Gawan als Abbild des perfekten Ritters darum bemüht ist, die ritterliche Ordnung zu (re-)stabilisieren, lässt Parzival auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Artusritter diese Ordnung hinter sich. Erst die anspruchsvolle Erzählstruktur, die die Abenteuer von Gawan und Parzival immer wieder einander gegenüberstellt, lässt diese Unterschiede besonders deutlich hervortreten.
Bereits 1477 erschien der Parzival in Druckform, was für seine Bedeutung noch im 15. Jahrhundert spricht, doch dann wird die Wirkungsgeschichte für einige Jahrhunderte unterbrochen. Erst Johann Jacob Bodmer entdeckt den Parzival in der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder und legt eine neue Übersetzung vor. Den eigentlichen Durchbruch bewirkt dann die von Karl Lachmann verantwortete kritische Neuausgabe 1833. Seitdem ist der Parzival eines der am intensivsten erforschten und diskutierten Bücher des deutschen Mittelalters. Es verarbeitet die theologischen, politischen und gesellschaftlichen Probleme seiner Zeit, ermöglicht Einblicke in die ritterliche Welt und stellt einen Spiegel mittelalterlicher Bildung dar. Dabei ist es so vielschichtig, dass sich bei jeder neuen Lektüre neue Deutungsansätze ergeben. Der Gral und Parzival scheinen ferner prädestiniert dafür zu sein, losgelöst von der Entstehungszeit Ideologien zu transportieren. So präsentiert Richard Wagner in seiner 1882 uraufgeführten Oper Parsifal eine Art christlichen Erlösermythos, der sich in vielen Aspekten von der Vorlage entfernt, für die Rezeption des Mythos aber eine entscheidende Rolle spielte. Insbesondere an der Wende zum 20. Jahrhundert werden Motive aus dem Parzival dann im Sinne der aktuellen antirationalistischen Strömungen instrumentalisiert – Parzival erschien wahlweise als Übermensch, Verfechter eines deutschen Christentums oder entmythologisiertes Abbild eines Jedermanns. Thomas Mann legt den Helden seines 1924 erschienenen Epochenromans Der Zauberberg als eine Art Nachfolger Parzivals an: Wie dieser bricht Hans Castorp als naiver junger Mensch in eine neue Welt auf, scheitert, wächst und erkennt schließlich, dass der Mensch der »Herr der Gegensätze« ist. Ende des 20. Jahrhunderts erlebt Parzival eine neuerliche Renaissance in Werken Tankred Dorsts, Peter Handkes oder Adolf Muschgs, was die andauernde Aktualität des Stoffes und der Themen belegt. Fest steht: Wolframs Epos hat den Spielraum der Literatur erweitert und der Kulturgeschichte eine Reihe universeller Typen und Handlungsmuster eingeprägt. Es präsentiert die Summe der literarischen und kulturellen Bildung seiner Zeit und weist gleichzeitig weit darüber hinaus.
um 1210
Das Nibelungenlied
Der Mythos der Nation
Das anonym in knapp zweitausendvierhundert vierzeiligen singbaren Strophen auf Mittelhochdeutsch verfasste Versepos zählt zu den wichtigsten Werken der deutschen Literatur des Hochmittelalters. Es verarbeitet in großer Kunstfertigkeit einen bis ins 5. Jahrhundert zurückgehenden, mündlich überlieferten germanisch-skandinavischen Sagenstoff, der historische Ereignisse aufgreift und mit mythischen Elementen verknüpft. Ende des 18. Jahrhunderts wiederentdeckt, stieg das Nibelungenlied im 19. Jahrhundert zum identitätsstiftenden Nationalepos der Deutschen auf und wurde vielfach ideologisch instrumentalisiert.
Der Aufklärer Friedrich der Große konnte mit dem Nibelungenlied nichts anfangen. In einem Brief an Christoph Heinrich Myller am 22. Februar 1784 bezeichnete es der Monarch als »elendes Zeug«, das nicht verdient hätte, »aus dem Staube der Vergessenheit gezogen zu werden«. Doch schon Jahrzehnte später war es im Rahmen der nationalen Selbstvergewisserung zum Manifest des deutschen Wesens geworden. Eine erstaunliche Karriere, wenn man bedenkt, wovon der Text in seinen neununddreißig »Aventüren« eigentlich handelt.
Siegfried, Königssohn aus Xanten, tötete einst einen Drachen, badete in dessen Blut, was ihn – mit Ausnahme einer kleinen Stelle am Rücken – unverwundbar machte, raubte den Schatz des Königs Nibelung und nahm dessen Wächter Alberich eine Tarnkappe ab, die unsichtbar machen kann. Er reitet nach Worms, um Kriemhild, die Schwester des Burgunderkönigs Gunther, zu heiraten. Gunther will der Ehe zustimmen, wenn Siegfried ihm dabei hilft, die übernatürlich starke isländische Königin Brünhild zu ehelichen. Nur durch Lüge und Betrug kommt Gunther ans Ziel: Um keinen Verdacht zu erwecken, gibt sich Siegfried als Untertan aus, und er ist es auch, der unter der Tarnkappe Brünhild besiegt. Brünhild willigt in der Annahme, von Gunther bezwungen worden zu sein, in die Ehe ein, doch nach der königlichen Doppelhochzeit, die Brünhild irritiert, da sie Siegfried als Vasallen sieht, verweigert sie sich Gunther, der sie nicht über Siegfrieds Stellung aufklären will. Nur der wieder getarnte Siegfried kann gewaltsam ihren Widerstand brechen und Gunther den Vollzug der Ehe ermöglichen. Täuschung und Betrug entfalten im Folgenden eine unheilvolle Eigendynamik, als es Jahre später zum Streit über die Rangfolge zwischen den beiden Königinnen kommt: Brünhild wirft Kriemhild daraufhin vor, mit einem Vasallen verheiratet zu sein, woraufhin Kriemhild sie mit Siegfrieds Rolle in der Hochzeitsnacht konfrontiert. Hagen von Tronje, Verwandter und Vertrauter Gunthers, will diese Beleidigung Brünhilds rächen und Siegfried ermorden. Unter dem Vorwand, Siegfrieds verwundbare Stelle besonders schützen zu wollen, erfährt Hagen deren genaue Position. Bei einem Jagdausflug tötet Hagen vor den Augen Gunthers Siegfried mit einem Speer in den Rücken. Kriemhild schenkt der Erklärung für den Tod ihres Mannes, dieser sei von Räubern ermordet worden, keinen Glauben, weshalb Hagen ihr aus Angst vor Racheplänen, die sie damit finanzieren könnte, den Nibelungenschatz raubt und im Rhein versenkt.
Dreizehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes heiratet Kriemhild den mächtigen Hunnenkönig Etzel, den sie nach weiteren dreizehn Jahren davon überzeugen kann, die Burgunder zu einem Fest einzuladen. Kriemhilds Stunde der Rache ist damit gekommen: Sie provoziert einen Streit, dem ein wahres Gemetzel folgt. Am Schluss des Blutrauschs sind auf Seiten der Burgunder nur noch Gunther und Hagen übrig. Als Hagen ihr das Versteck des Nibelungenschatzes nicht verraten will, lässt Kriemhild zunächst ihren Bruder enthaupten und schlägt anschließend eigenhändig Hagen den Kopf ab. Daraufhin wird Kriemhild von Hildebrand, dem Waffenmeister des auf Etzels Seite kämpfenden Dietrich, geköpft. Die verbleibenden Ritter stehen schließlich fassungslos weinend am Ort der Gräueltat. »Die Raserei ist zu einem Ende gekommen, das darum eines ist, weil es nichts mehr zu erschlagen gibt« (Jan Philipp Reemtsma).
Das Nibelungenlied muss zu seiner Entstehungszeit ein großer Publikumserfolg gewesen sein – dafür spricht zumindest die Tatsache, dass es in siebenunddreißig (Teil-)Abschriften überliefert ist. Auch wenn heute weitgehend Einigkeit darüber herrscht, dass es sich beim Nibelungenlied um das in sich geschlossene Werk eines Einzelautors handelt, so kann man über die konkrete Person des Verfassers nur ausgehend von Hinweisen aus dem Text spekulieren. Vermutlich wurde das Originalmanuskript in der bairischen Variante des Mittelhochdeutschen verfasst. Der Autor besaß außerdem auffallend detaillierte Kenntnisse der Region zwischen Passau und Wien und erwähnte den Passauer Bischof in besonders positiver Weise. Aufgrund von Querbezügen auf andere literarische Werke sowie der Erwähnung bestimmter politischer Ämter und Namen wird die Entstehung des Originalmanuskripts auf das erste Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts datiert. Bis 1204 hatte den Passauer Bischofsstuhl Wolfger von Erla inne, der bekannt für sein Mäzenatentum war. Ob man allerdings aus der Tatsache, dass Wolfger dem berühmtesten deutschsprachigen Minnesänger des Mittelalters, Walther von der Vogelweide, einen größeren Geldbetrag zukommen ließ, folgern kann, dass Walther selbst der Dichter des Nibelungenliedes ist, bleibt zweifelhaft. Sicher sind sich die meisten Forscher nur, dass der Verfasser des Nibelungenliedes ein gebildeter, belesener Mann war (der z.B. auf vorgängige schriftliche Texte Bezug nahm) und aus dem Umfeld des Passauer Bischofshofs stammte.
Ab dem Spätmittelalter war das Nibelungenlied in Vergessenheit geraten. 1755 wurde in der Bibliothek von Schloss Hohenems eine Niederschrift davon wiederentdeckt, doch erst nach dem Fund zweier weiterer Handschriften veröffentlichte Christoph Heinrich Myller 1782 eine vollständige Version des Nibelungenliedes, das in der mittelhochdeutschen Originalfassung aber kaum Beachtung fand. Letztlich konnte erst die 1807 von Friedrich Heinrich von der Hagen besorgte Ausgabe, die eine Art Übersetzung präsentiert und deren Vorwort die Rezeption des Textes im Sinne eines Nationalepos vorwegnehmen sollte, den Stoff popularisieren, der gerade Anfang des 19. Jahrhunderts auf fruchtbaren Boden fiel.
Im Grabe umgedreht …
1924 kam das Stummfilm-Epos Die Nibelungen als bis dahin teuerste deutsche Filmproduktion in die Kinos. Zum Filmstart überlegte man sich eine bemerkenswerte PR-Aktion: Am Grab Friedrichs des Großen wurde ein Kranz mit der Aufschrift »Zur Premiere des Nibelungenfilms. Fritz Lang« niedergelegt. Diese vorgebliche Verneigung des Regisseurs vor dem Preußenkönig markierte eigentlich dessen Indienstnahme, nutzte man die deutsche Identifikationsfigur Friedrich doch dazu, die Bedeutung des Films für das deutsche Nationalbewusstsein zu beglaubigen. Man mag sich vorstellen, was der nie um deutliche Worte verlegene König dazu gesagt hätte.
Denn als sich 1806 Preußen den napoleonischen Truppen geschlagen geben musste, sich sechzehn deutsche Fürsten mit Frankreich im Rheinbund zusammenschlossen und damit das Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation besiegelten, gewann die Frage nach einer nationalen Identität jenseits der deutschen Kleinstaaterei für viele eine besondere Relevanz. Der Literatur kam in diesem Zusammenhang als gemeinschaftsstiftendem Fundament eine herausgehobene Bedeutung zu, denn »mitten unter den zerreißendsten Stürmen« der Gegenwart, so formuliert es von der Hagen, könne »einem Deutschen Gemüte wohl nichts mehr zum Trost und zur wahrhaften Erbauung vorgestellt« werden »als der unsterbliche alte Heldengesang«. Das Nibelungenlied, »eins der größten und wunderwürdigsten Werke aller Zeiten und Völker«, stelle »das erhabenste und vollkommenste Denkmal einer so lange verdunkelten Nationalpoesie« dar – und zwar in einem doppelten Sinne: Zum einen sei es »aus Deutschem Leben und Sinne erwachsen«. Zum anderen – und hier wird der Argumentationsaufwand deutlich, der nötig war, um eine Geschichte aus grauer Vorzeit, die vor allem an den Höfen der Burgunder und Hunnen spielte, zu einer originär deutschen zu machen – veranschauliche das Nibelungenlied die »herrlichsten männlichen Tugenden«, die hier eben als typisch deutsch gedeutet werden. Dazu zählen neben »Biederkeit, Redlichkeit, Treue und Freundschaft bis in den Tod« vor allem »Heldensinn, unerschütterlicher Standmut, übermenschliche Tapferkeit, Kühnheit, und willige Opferung für Ehre, Pflicht und Recht«. Das Beispiel dieser Tugenden, so Heinrich von der Hagen weiter, müsse den Leser »mit Stolz und Vertrauen auf Vaterland und Volk, mit Hoffnung auf dereinstige Wiederkehr Deutscher Glorie und Weltherrlichkeit« erfüllen. Aktuelle militärische und politische Niederlagen erscheinen in dieser Deutung als kleinere Stolpersteine auf Deutschlands Weg zum Platz an der Spitze.
Eine so ideologische Lesart war zwangsläufig einseitig, sah in Hagen von Tronje den hinterlistigen Meuchelmörder und in Siegfried den strahlenden Helden, der verraten wird. Dabei entwirft der Text differenziertere Figuren: Hagen ist eben auch der politisch denkende Ratgeber, der treu und rational handelt und bereit ist, für die Ehre seiner Königin das eigene Leben zu geben. Siegfried hingegen ist auch eitel und aggressiv, aufbrausend und gefährlich, denn seine Überlegenheit nutzt er, um seinen Willen egoistisch durchzusetzen. Seine Mischung aus Naivität und Selbstüberschätzung kostet ihn, der nicht strategisch denkt, das Leben. Auch das ist nämlich eine Moral der Geschichte: Kraft allein nützt wenig, wenn sie nicht mit Klugheit einhergeht. Doch solche interpretatorischen Feinheiten spielten allenfalls am Rande eine Rolle, galt das Nibelungenlied fortan doch als »deutsche Ilias« und »lebendige Urkunde des unvertilgbaren Deutschen Charakters« (von der Hagen). Es hatte enormen künstlerischen Einfluss, wurde vielfach bearbeitet und je nach den Zeiterfordernissen gedeutet – wahlweise wurden die heroischen Qualitäten des Stoffes betont oder die vermeintlich bürgerlichen Werte (Treue und Loyalität) akzentuiert. Besonders die Dramen- und Opernversionen des Nibelungenstoffes von Friedrich de la Motte Fouqué (Der Held des Nordens, 1808–1810) und Richard Wagner (Der Ring des Nibelungen, 1848–1874) oder auch Friedrich Hebbel (der 1862 sein Werk Die Nibelungen als eine christliche Opfergeschichte präsentiert) trugen erheblich zur Popularisierung bei.
Nie indes war es ein gutes Omen, wenn sich Politiker dezidiert auf das Nibelungenlied beriefen, wie 1909 Reichskanzler von Bülow, als er die unverbrüchliche Treue im Sinne einer vermeintlich urdeutschen Eigenschaft auf dem politischen Parkett etablierte und versprach: »Aber die Nibelungentreue wollen wir aus unserem Verhältnis zu Österreich-Ungarn nicht ausschalten.« Man weiß, wohin das führte: zum Blankoscheck von 1914 und in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Es liegt auf der Hand, dass Deutschland in diesem Denkzusammenhang 1918 allein durch Verrat um den Sieg gebracht worden sein konnte: Im Felde unbesiegt sei das deutsche Militär aus der Heimat hinterrücks gemeuchelt worden. Hindenburg, prominenter Vertreter dieser Verschwörungstheorie, fabulierte in seinen Memoiren davon, dass die »ermattete Front« gestürzt sei »wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf des grimmigen Hagen«, und auch Hitler behauptete in Mein Kampf, dass »der kämpfende Siegfried dem hinterhältigen Dolchstoß erlag«. In einer besonders abstoßenden politischen Instrumentalisierung versuchte Göring 1943 die deutschen Soldaten in Stalingrad mit einem Verweis auf das Nibelungenlied zum Durchhalten zu motivieren.
Ungeachtet dieser Ideologisierungen gilt das Nibelungenlied heute als ein herausragendes Kunstwerk des Mittelalters, das mit bewundernswerter Detailfülle atmosphärische Einblicke in die höfische Gesellschaft seiner Zeit erlaubt und deutlich macht, wohin Lüge, Verrat und Hass führen können. Als Zeugnisse eines Meisterwerks der menschlichen Kreativität fanden die drei wichtigsten Handschriften, in denen das Nibelungenlied überliefert ist, im Jahr 2009 Aufnahme in das UNESCO-Weltkulturerbe. Damit wurde dem Text, der vom Stoff und seiner Überlieferung her schon immer international war, auch offiziell der Status zugewiesen, der ihm eigentlich gebührt: jenseits nationalistischer Vereinnahmungen Teil des »Gedächtnisses der Menschheit« zu sein.
um 1270
Thomas von Aquin
Summa Theologica
Eine Kathedrale von Lehrbuch
Die Summa Theologica des heiligen Thomas von Aquin gilt als das wichtigste theologisch-philosophische Werk des christlichen Abendlandes. Durch Versöhnung der kirchlichen Lehren mit der Philosophie Aristoteles’ führt Thomas die menschliche Vernunft als Weg zur Erkenntnis in die Theologie ein. Er verändert dadurch die Denkgewohnheiten seiner Zeitgenossen und wird zu einem Wegbereiter des Humanismus. Ob Theologie, Philosophie, Rechts- oder Politikwissenschaft: Die Summa Theologica ist für sie alle bis heute einer der wegweisenden Klassikertexte.
Was verbindet Thomas von Aquin mit dem Kölner Dom? Zunächst, dass er höchstwahrscheinlich der Grundsteinlegung am 15. August 1248 beiwohnte. Wir wissen, dass Albertus Magnus zugegen war, und Thomas war gerade als sein Assistent mit ihm an die Kölner Klosterschule gekommen. Es gibt aber auch eine tiefere Verbindung. In seinem Buch Gotische Architektur und Scholastik deutet der große Kunsthistoriker Erwin Panofsky die Kathedralen der Gotik als Ausdruck der scholastischen Theologie ihrer Zeit. Ein »Ursache-Wirkung-Zusammenhang«, der sich aus »Denkgewohnheiten« speist, die über die Schule, die Kanzel, den Besuch öffentlicher Disputationen – die damals Eventcharakter besaßen – und über vielfältige andere Kontakte vermittelt wurden.
Die Scholastiker betrieben aus heutiger Sicht die Verwissenschaftlichung der Theologie. Sie wollten Widersprüche zwischen den kanonischen Schriften aufklären, anfangs nur jener der Kirchenväter und der Bibel; später, in der Hochscholastik, ging es auch um die Harmonisierung