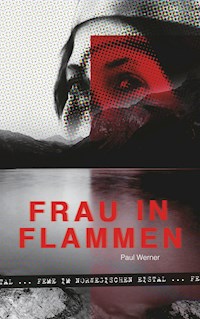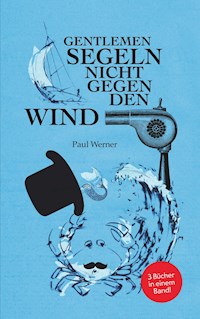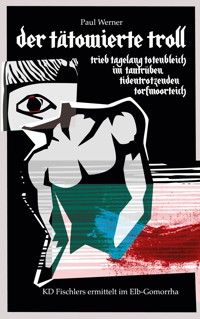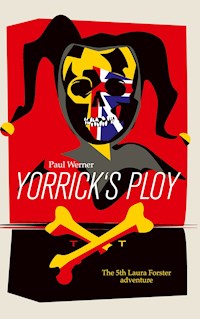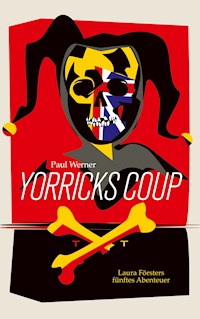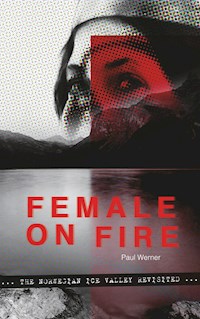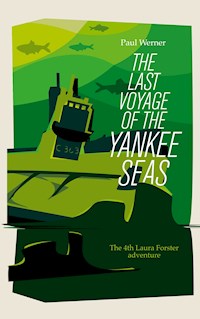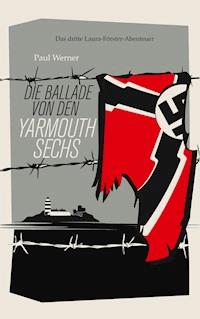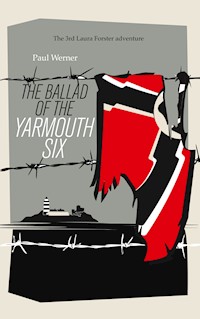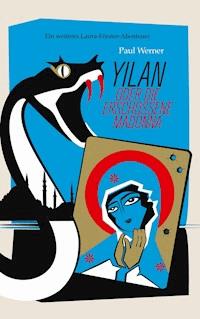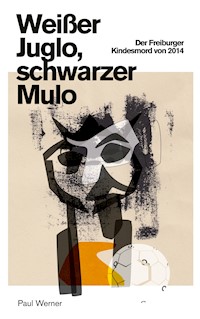
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Weißer Juglo und schwarzer Mulo" widmet sich einem heiklen, im Milieu von Sinti und Roma verorteten Cold Case, dem Mord am achtjährigen Armani R., dessen Leiche am 21.7.2014 im Mühlbach des Freiburger Stadtteils Betzenhusen aufgefunden wurde. Die detaillierte, minutiöse "Rekonstruktion" des Verbrechens nimmt der Autor zum Anlass, den Bogen weiter zu spannen und die gesetzliche Regelung von Mord und Totschlag zu hinterfragen, die Zweckdienlichkeit und Effizienz überkommener polizeilicher Ermittlungsmethoden auf die Waagschale zu legen und gängige Klischees in der Fremd- und Eigendarstellung von Sinti und Roma unvoreingenommen kritisch unter die Lupe zu nehmen. Sein verbindlicher Plauderton, seine häufigen Volten vom Konkreten zum Grundsätzlichen, seine aufschlussreichen "time warps", sein harter Umschnitt vom Erhabenen aufs Triviale und umgekehrt - das alles bei laufendem Wechsel von Tonart und Stilebene sorgen für eine anspruchsvolle und spannende Lektüre, die ganz nebenbei auch noch gezielte Ausflüge in die Kulturkritik unternimmt: ein echter Werner eben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Djangos Verdikt
Der rasende Roland
Schlaglöcher
Am helllichten Tag
Lokaltermin
Die Angefassten
... denn sie säen nicht
Schwarmintelligenz
Heil´ ges Bächle
Die Nagelprobe
Der weiße Juglo
Der Verrat
Der Hinterhalt
Nacht der Tränen
Trau, schau, wem
Der gestohlene Brief
Alles auf die Sieben
Tasavel
Der schwarze Mulo
Die Überblendung
Epilog
„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?"
„Siehst Vater du den Erlkönig nicht?
Den Erlkönig mit Kron und Schweif?"
„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif."
(J.W. von Goethe, Der Erlkönig.)
„One, two, three, four, five, six, seven,
All good children go to Heaven."
(Lennon / McCartney)
1. DJANGOS VERDIKT
Eine der wenigen Rollen des amerikanischen Schauspielers Bruce Willis, die nicht vor schweinebackenmäßigem Macho-Gehabe nur so triefen, ist die des Kinderpsychiaters Malcolm Crowe in dem Psychothriller The Sixth Sense („Der sechste Sinn") des indischen Regisseurs M. Night Schwamalan aus dem Jahre 1999. Der sonst eher grobmotorige Willis spielt hier einen einfühlsamen Arzt, der mit seiner Frau in Philadelphia eine bislang kinderlose Ehe führt. Ausgerechnet nach der Rückkehr des Ehepaares von einer feierlichen öffentlichen Würdigung der bisherigen Verdienste Crowes um die Diagnose und Therapie von pathologischen Entwicklungen der kindlichen Psyche, lauert den beiden in deren Haus ein inzwischen erwachsener und offensichtlich schwer traumatisierter ehemaliger Patient auf, der den Psychiater mit einer Pistole bedroht und ihn in wirrer Rede dafür verantwortlich zu machen scheint, dass seine Therapie ihn nicht von seinen schrecklichen Alpträumen und Angstschüben befreit habe. Schließlich feuert er auf Crowe und richtet sich danach selbst.
Auf diese dramatische Eröffnungsepisode folgt ein narrativer Time Warp, der uns in das dem Zwischenfall folgende Jahr katapultiert. Hier stößt der offenbar von seinen Schussverletzungen genesene Willis zufällig auf den neunjährigen Jungen Cole, der über jenen „sechsten Sinn" verfügt, dem der Film seinen Titel verdankt. Hinsichtlich der Anzahl und Zählweise menschlicher Sinne herrschen bekanntlich unterschiedliche Auffassungen. Mit dem „sechsten" ist in diesem Zusammenhang jedenfalls die Gabe gemeint, unsichtbar unter uns stumpfen Normalos weilende bleiche, blutüberströmte oder entstellte „Untote" oder „Wiedergänger" sowohl optisch wahrnehmen als auch mit ihnen kommunizieren zu können.
Kommunizieren zu müssen wäre wahrscheinlich die korrekte Formulierung, handelt es sich doch um eine übersinnliche Fähigkeit, auf die der kleine Cole gern verzichten würde, da sie ihm nur Scherereien bereitet und ihn zum introvertierten Außenseiter stempelt, der sich in seiner Not niemandem anvertrauen zu können glaubt, weil er wohl zu Recht fürchtet, von den Erwachsenen nicht ernst genommen zu werden.
Für die „Untoten" hingegen macht ihn sein sechster Sinn zum privilegierten, wenn auch widerwilligen Ansprechpartner. Den benötigen sie vor allem deshalb, weil sie ohne fremde Hilfe ihre Mission in eigener Sache nicht erfüllen können. Jene Mission, heißt das, die sie umtreibt und ohne deren zufriedenstellende Erledigung es für sie keine Totenruhe geben kann. Sie sind in ihrer Mehrheit nämlich durch Drittverschulden gewaltsam aus dem Leben gerissen worden und drängen nun wie die murrenden Märtyrer der Apokalypse darauf, dass ihnen Gerechtigkeit widerfahre und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Als Anwalt solcher „Wiedergänger" offenbar von übergeordneter Stelle ausersehen, wird der von seiner Rolle in jeder Hinsicht überforderte Cole von seinen Mandanten regelmäßig heimgesucht und wie ein Schweißhund auf die Fährte der Schuldigen angesetzt. Um ihm die Beweiserhebung zu erleichtern, statten einige der Untoten den Jungen immerhin mit wichtigen Indizien aus, die der Aufmerksamkeit der Ermittlungsbehörden bislang erstaunlicherweise entgingen.
Im Laufe seiner therapeutischen Gespräche mit dem Jungen erfährt der verständnisvollen Willis von Cole unter anderem, dass die Gegenwart eines „Wiedergängers" auch für unsereinen, die wir offenbar gerade außer Hause waren, als der Allmächtige den sechsten Sinn verteilte, am plötzlichen, scheinbar anlasslosen Absinken der ambienten oder Zimmertemperatur zu erkennen sei, über die sich die Leute dann zwar oft wunderten, sie dann aber falschen Ursachen wie einer noch unbezahlten Gasrechnung zuzuordnen pflegten.
Der Psychiater ist von dem Jungen und dessen ungeliebter Begabung fasziniert und sucht beharrlich seine Nähe, um ihm zu helfen, sich von seinen unheimlichen Stalkern zu lösen. Dies, obwohl er ja gerade mit seinen diesbezüglichen Therapiemaßnahmen etwa ein Jahr zuvor so dramatisch Schiffbruch erlitt. Hat ihm die Attacke des verzweifelten Psychopathen einen partiellen Gedächtnisverlust zugefügt?
Die Wahrheit, wir ahnten es bereits, ist noch um Einiges schockierender. Der Junge ist nämlich nicht sein Patient, sondern er, Willis, gehört unwissentlich zum Kreis von dessen Mandanten. Der gewalttätige Eindringlich hatte Willis mit anderen Worten zu Beginn nicht lediglich angeschossen, sondern getötet. Da der Mann sich, wie gesagt, unmittelbar darauf selbst erschossen hatte und es an seiner Täterschaft keinen Zweifel geben kann, gebricht es Willis streng genommen am Leitmotiv der anderen Untoten. Eigentlich hat er im Rahmen der dem Plot zugrundeliegenden Logik also keinen triftigen Grund, sich noch auf Erden herumzutreiben und Cole lästig tz fallen. Eine von mehreren strukturellen Schwächen des Drehbuches, die dem Faszinosum des Films aber auch dank der ungewöhnlich zurückgenommenen Darstellungsweise Willis' kaum Abbruch tut.
Dass ausgerechnet er, zu diesem Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren als hartgesottener NYPD die-hard Cop unterwegs und insofern sicher kein Schnäppchen für die Produzenten, den Zuschlag für eine Rolle erhielt, die nach Ansicht Mancher einen etwas filigraneren Akteur verdient hätte, ist vermutlich dem Umstand geschuldet, dass er ein Jahr zuvor in Mercury Rising (dt. „Das Mercury Puzzle") als FBI-Agent und Schutzengel des autistischen, durch die Ermordung seiner Eltern traumatisierten zehnjährigen Simon bewiesen hatte, dass er es mit Jungs diesen Alters kann. Außerdem mag das Kalkül mitgeschwungen haben, dass die meisten von uns arglosen Zuschauer*Innen diese jähe und in seinem Fall auch selbstironisch anmutenden Wendung der dramaturgischen Matrix vom notorisch „Unkaputtbaren" wohl am allerwenigsten erwartet hatten. Spötter behaupteten damals, dass Willis als noch spärlich behaarter Untoter mit Abstand die beste Figur mache.
An sich kein Liebhaber angeblich übernatürlicher Phänomene oder verstörender Verschwörungstheorien, versuche ich, mich abergläubischer Anwandlungen jedweder Art vor allem deshalb zu enthalten, weil die letzten Endes nachweislich doch nur Unglück bringen.
Insofern dachte ich an nichts Böses, als ich mir wie gewöhnlich gegen Mitte der Woche mein Abendessen beim örtlichen indischen Takeaway abholte. Da ich allein lebe und wenn, dann in der Regel nur mich selbst bekoche, erlahmen meine kulinarischen Ambitionen regelmäßig spätestens um die Wochenmitte und weichen der behaglichen Bequemlichkeit von Convenience Food wie Pizza, Pasta, Burger, Chicken Wings, Entenstreifen, Sushi und Co. Alles nicht sehr gesund und wenig nachhaltig, aber... yummi.
„Indisch" ist im Gastrogewerbe längst zum begrifflichen Generikum geworden und meint weniger die Herkunft des Kochs oder Imbissbetreibers als die im Merchandise-Stil umgesetzte stereotype Rezeptur der Speisen, wie sie weltweit von Angehörigen aller nur denkbaren mittel- und fernöstlichen Nationalitäten zubereitet und in metallenen Gastronorm-Behältern warmgehalten, auf Feuerschlucker wie mich warten. „Mein" Inder um die Ecke kommt zum Beispiel aus Afghanistan, kocht vermutlich nach Zahlen und passt die originale Schärfe einiger der toxischeren Rezepturen der anatomischen Grundausstattung von uns mitteleuropäischen Warmduschern an. Da der Afghane und ich längst aufeinander eingespielt sind und ich als leicht hörgeschädigter ehemaliger Dolmetscher eine gewisse Einsilbigkeit meiner Mitmenschen zu schätzen weiß, kann ich mir die Mühe einer durch die Mund-Nasen-Maske buchstabierten Bestellung sparen und dennoch sicher sein, dass er meinen Portionen Chicken Vindaloo unaufgefordert eine zusätzliche Prise Chili unterhebt, bevor er sie mir im kleinen Alu-verstärkten Pappsarg behutsam über die Theke reicht.
Als ich draußen vor dem Laden im Begriff war, mein rattenscharfes Hühnchen so vorsichtig im hinteren Fahrradkorb zu verstauen, als handele es sich um einen Karton voll transpirierender Dynamitstangen, wuchs plötzlich dieser kleine Rotzlöffel vor mir regelrecht aus dem Boden und blinzelte in etwa so prüfend zu mir auf wie ich verwundert auf ihn herabschaute. Mit welcher Wunderlampe war ich versehentlich in Berührung gekommen, dass er so unvermittelt lautlos auftauchen konnte? Seine sympathisch offene, dunkle Physiognomie verriet mir, dass sein Vorname sehr wahrscheinlich nicht „Detlev" oder „Herber", sondern eher „Mario" oder „Django" lautete und dass seine Vorfahren aus einer jener, noch weiter östlich als Afghanistan gelegenen Regionen stammen mussten, in denen man sich mit der Handhabung von explosiven Gewürzen bestens auszukennen pflegt.
Er strich seine pechschwarzen Haare zurück, stellte sich auf die Zehenspitzen, hob seinen rechten Arm wie zu einem zackigen Hitlergruß, wies mit dem Zeigefinger auf mich und sprach dann die drei bedeutungsschwangeren Worte, die mir noch jetzt in den Ohren klingen: „Du bist alt".
Ich zuckte leicht zusammen und rang nach Fassung. Das hatte gesessen wie der unerwartete Leberhaken eines unorthodoxen Rechtsauslegers. Als Verdikt etwas arg stumpf vorgetragen, ja, aber irgendwie auch erfrischend aufrichtiger als die von heuchlerischer Verbindlichkeit getragenen Versicherungen der wenigen verbliebenen Mitglieder meines in jüngeren Jahren rasch schrumpfenden Freundeskreises.
Gemäß dem in -zig Ehejahren verinnerlichten Grundsatz, nie mehr einzuräumen, als das Gegenüber offenbar bereits weiß und vielleicht sogar mit Fotos und Anhörprotokollen belegen kann, tat ich zerknirscht: schuldig im Sinne der Anklage, Euer Ehren, und harrte der Verkündung des Strafmaßes.
Wobei ich meine Hoffnung insgeheim auf den Umstand setzte, dass dem Alter in jenem Kulturkreis, dem der Knirps offensichtlich entstammte, für gewöhnlich mehr Respekt entgegengebracht wird als bei uns, wo man Rentner gern mal, bildlich gesprochen, über die Klippe schubst. Der dortige Respekt manifestiert sich unter anderem in jener orientalischen Sitte, die zögerlich ausgestreckte zittrige und von Alters- und Nikotinflecken verunzierte Seniorenhand erst leicht an die Lippen und dann an die Stirn zu drücken. Eine Demutsgeste, auf die ich in diesen Corona-Zeiten allerdings großzügig zu verzichten bereit war.
Sich blind auf die Einhaltung solcher Rituale verlassen zu wollen, wäre freilich gewagt. Zumal Alter und Tod in wieder anderen Kulturkreisen einen ausgesprochen durchwachsenen Ruf genießen. Ich persönlich wäre, wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch ganz gut ohne solch lästige physische Begleiterscheinungen des nahenden Lebensendes ausgekommen. „Altern ist nichts für Feiglinge" lautet der leicht anmaßende Titel eines Buches von Blacky Fuchsberger, der mehr dümmliche deutsche Schlagertexte inszeniert hat als Klaus Kinski Nervenzusammenbrüche. Nichts für Feiglinge ist meines Erachtens schon die Geburt. Das Dumme: man hat im einen wie im anderen Falle nur sehr bedingt die Wahl.
An diesem Abend jedenfalls hatte mich der kleine Bengel doch tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt. Altern ist eine gleichsam schleichend, um nicht zu sagen sanft verübte Straftat wie langsames Vergiften, weswegen Frauen sich nach meinem Eindruck mit beidem irgendwie leichter tun. Hatte ich mich beim Altern weitgehend unbeobachtet gewähnt, wurde ich mm brutal eines Besseren belehrt.
Ich dankte dem Knirps also dafür, dass er mich auf den Boden der Tatsachen zurückgebeamt hatte. Ein Memento wie dieses zur rechten Zeit aus berufenem Munde war nur zu begrüßen. Wenngleich ich eine etwas geschmeidigere Formulierung sehr wohl auch zu schätzen gewusst hätte. Aber so zynisch das Alter, so mitleidlos die Jugend. Gezahlt wird sowieso immer erst am Ende der Jause.
Als ich den Knirps im Gegenzug bat, mir nun im Gegenzug auch sein Alter zu verraten, ging gleichsam ein Ruck durch den Kleinen. Erneut stellte er sich auf die Zehenspitzen und zeichnete anstelle der erwarteten verbalen Antwort mit Anlauf und demselben Zeigefinger, der eben noch anklagend auf mich gerichtet gewesen war, eine Zahl in die Luft, die als eine „Acht" zu entziffern mir keine große Mühe bereitete.
Ich fand den Gestus zwar anrührend, aber auch irgendwie befremdlich. Zumindest die Grundzahlen gehören schließlich zum eisernen Bestand eines ansonsten embryonalen Wortschatzes in einer vorerst noch mangelhaft beherrschten Fremdsprache. Wer möchte auf der Terrasse des angesagtesten Cafés von Ibiza nicht den erfahrenen Globetrotter raushängen lassen, der die handwarmen dos cervesas lässig lispelnd auf Spanisch bestellt. War diese Luftnummer der Reflex eines Tabus, das es ihm untersagten, Zahlen laut auszusprechen? Oder bewegte er sich regelmäßig im Kreis von Leuten, deren Sprachen er nicht verstand? Und selbst wenn, wieso zeigte er mir die Zahl nicht wie die meisten Menschen, egal, ob Kinder oder Erwachsene, mit den Fingern beider Hände an?
Ich ließ das Mysterium vorerst auf sich beruhen, wollte mich aber nicht von „Django", wie ich ihn insgeheim taufte, so ohne weiteres trennen, ohne mich für seinen Anflug von Impertinenz gebührend revanchiert zu haben. Deshalb tat ich erneut zutiefst betroffen: „Vierundzwanzig? Echt jetzt? Ich hätte dich für jünger gehalten."
Das fand er zwar nur mäßig komisch, aber die Chemie zwischen uns beiden schien zu stimmen, so dass wir im Gehen noch ein wenig über die Dinge des Lebens plauderten wie Sokrates und Phaidon in der schattenspendenden Stoa unterhalb der in abendliches Blutrot getauchten Akropolis und er mich und das längst wieder von der Totenstarre befreite Hühnchen bis zur Tankstelle gegenüber begleitete. Dort pflege ich im herrlich benebelnden bleiernen Dunst von Motorenöl, hoch-oktanigem Benzin und fettigem Diesel den Rest meiner kleineren Einkäufe zu tätigen. Das versetzt mich jedes Mal olfaktorisch in das laut pulsierende Herz größerer Schiffe zurück, nach denen ich geradezu süchtig bin und befreit mich außerdem von der Mühe, wegen ein paar lächerlichen Com Flakes oder Ravioli den weitläufigen, an der Peripherie gelegenen Hangar einer bekannten Einzelhandelskette im Slalom zwischen turmhoch mit Toilettenpapier oder Milchtüten vollgestapelten Paletten durchqueren und mich anschließend an der Kasse in die Schlange quengelnder Kinder und ihrer mit zwei Taschen und drei Portemonnaies gleichzeitig jonglierender Mütter einreihen zu müssen.
Ich spendierte Django ein Eis am Stiel seiner Wahl aus der TK-Truhe zwischen den Frostschutzmitteln und den Enteisungssprays und er trollte sich nach meinem Eindruck zufrieden mit sich und der Welt von dannen.
Dass ich ihn danach nie wieder sah, hätte mir vielleicht zu denken geben müssen. Aber mein persönliches Pandämonium, sowohl fiktiv als auch real, ist so reich bestückt, dass ich mit dem Rechnung-Tragen beim besten Willen nicht immer nachkomme.
Umso größer mein Schock, als ich Wochen später beim Abendessen einen kurzen TV-Beitrag des Senders, mit dem man angeblich besser sieht, mäßig interessiert verfolgte. Es ging in dem Spot vom Schlage „XY ungelöst" um den bislang unaufgeklärten Mord an einem achtjährigen Freiburger Sinto mit Namen Armani. Die Tat hatte sich in der Nacht vom 20. zum 21. Juli 2014 ereignet und die Polizei tappte augenscheinlich immer noch völlig im Dunklen. Mir fiel fast der letzte erschlaffende Raviolo von der Gabel und meine schütteren grauen Haare standen für einen Moment zu Berge, als hätte ich, stark kurzsichtig, wie ich nun einmal bin, versehentlich in eine Steckdose gefasst. Schlagartig wurde mir eiskalt und eine dünne Reifwolke hüllte meinen halblauten Ausruf der Überraschung in nasskalten Nebel. War mir im Alter der sechste Sinn zugewachsen, quasi als Ausgleich dafür, dass der Verfall der anderen fünf merklich eingesetzt hatte? Konnte es sein, dass mir mit Django der Wiedergänger dieses unglücklichen Sinti-Jungen beim Inder beziehungsweise Afghanen begegnet war? Und wenn ja, zu welchem Zweck hätte er mir dort auflauern sollen?
Um nicht allzu neugierig zu erscheinen oder mir gar pädophile Neigungen nachsagen zu lassen, war ich im Gespräch mit dem Knirps innerlich wie äußerlich auf Abstand geblieben und hatte ihn absichtlich nicht nach seinem Vornamen gefragt. Den hätte er mir dann womöglich noch vorgetanzt und damit erst recht die Aufmerksamkeit der Nachbarschaft auf uns gelenkt. Außerdem erfüllen Namen, bei uns bekanntlich eher Schall und Rauch, in manchen Kulturkreisen die Funktion regelrechter Zauberformeln, um die entsprechend viel Geheimniskrämerei gemacht wird und deren Nennung zur Unzeit angeblich größeres Unheil über die Träger heraufbeschwören kann. Und Namen in Verbindung mit Zahlen geht schon gar nicht.
Strenggenommen hatte ich ja auch nicht das Geringste damit zu schaffen. Als älterer Mann im angeregten Gespräch mit einem Minderjährigen auf Berührungsabstand landet man heutzutage, wenn's dumm läuft und militante „Me too"-Aktivist*Innen an der Zapfsäule lauern, schnell mal auf der falschen YouTube-Seite und kriegt die kompromittierende Sequenz dann die nächsten zweihundert Jahre auch nicht mehr gelöscht.
Die Frage war ohnehin nicht, was ich von Django wollte, sondern warum die Rotznase sich so völlig unvermittelt an mich herangemacht hatte. Dass auf meiner Stirn ein in roten Lettern eingebranntes „K" für „Krimiautor" prangen würde, kann man rechtens wahrlich nicht behaupten. Meine Affinität zu Krimis im herkömmlichen Sinne ist so peripher wie der Lebensmittelhangar. Es mag snobistisch klingen, aber mir sind seine zweidimensionalen Charaktere, die im Film oft nicht einmal ihre Kleidung wechseln, geschweige denn irgendeine Entwicklung durchmachen, einfach zu seicht und die stereotypen Mechanismen zu vorhersehbar. Gar so schlicht kommt das Leben selten daher. Aber vielleicht liegt in dieser krassen Vorhersehbarkeit ja das Geheimnis ihrer Popularität.
Durchaus ernst zu nehmende Komiker sehen das anders. Der amerikanische Humorist James Thurber zum Beispiel, den ich sehr schätze, berichtet in einer seiner zweifelsfrei erfundenen Anekdoten von einer krimibesessenen älteren Landsmännin, die ihn beim Verlassen des Londoner Theaters nach einer Vorstellung von Shakespeares Macbeth erkannt und sich ihm auf Hörweite genähert hatte, um ihm im Flüsterton einer Schwerhörigen anzuvertrauen, dass sie persönlich den ehrgeizigen schottischen Clanchef Macbeth für ebenso unschuldig an der Ermordung seines Gastes, des Königs Duncan halte wie Dr. Richard Kimble an derjenigen seiner Frau Helen.
Die Verkuppelung von Krimi und Tragödie, die scheinbar offenkundige Mésalliance von Ödipus Rex und Miss Marple, die Thurber hier satirisch anbahnt, ist bei näherer Betrachtung nicht halb so unziemlich, wie man zunächst meinen könnte. Im Gegenteil. Das erzählende und das dramatische Genre teilen auf den zweiten Blick so viele formal-inhaltliche Strukturelemente, dass man sie in der Tat für Verwandte zweiten oder dritten Grades halten könnte. Aber das ist Stoff für ein anderes Buch.
Wenn schon Kapitalverbrechen, warum sich dann mit lendenlahmen fiktiven Konstrukten zufriedengeben, die sowieso nie die Originalität realer Straftaten erreichen? Meine leicht morbide Faszination für unaufgeklärte Morde, die berühmt-berüchtigten Cold Cases, führte mich vor Jahren unversehens auf die Spur der „Frau in Flammen", der ich eine Monografie gleichen Titels widmete. Es handelt sich dabei um den Fall einer mysteriösen Touristin oder Handelsreisenden, deren halb verkohlte Leiche am ersten Advent des Jahres 1970 auf einer Waldlichtung nahe der norwegischen Hafenstadt Bergen von einheimischen Wanderern entdeckt wurde. Die Aufklärung des Verbrechens war damals im Grunde bereits daran gescheitert, dass die Identität dieser „Jane Doe" nicht zu eruieren war. Ihren richtigen Namen, den bis heute, wenn überhaupt jemand, dann vermutlich nur der norwegische Geheimdienst kennt, aber nicht preisgibt, verbarg die Frau wie einen Baum im Wald, sprich, inmitten eines guten Dutzend verschiedener „Alias" und gab sich auch sonst derart große Mühe, ihre tatsächliche Identität zu verschleiern, dass ich mich unwillkürlich fragte, ob sie wenigstens selbst noch wusste, wer und was sie war, woher sie kam und wohin sie ging.
Nicht zuletzt anhand des von einer norwegischen Journalistin gesammelten und ins Internet gestellten Liste von Asservaten, Aufzeichnungen und Indizien war es mir gelungen, den Fall, wenn schon nicht in allen Einzelheiten gerichtsfest zu entwirren, dann doch einer plausiblen Lösung entscheidend näher zu bringen. Die Fremde war auf der Flucht vor ihrer eigenen Untat durch halb Europa geirrt und an diesem völlig unwahrscheinlichen, Eistal genannten öden bis unheimlichen Ort, der damals, im Dezember 1970, genauso unwirtlich gewesen sein muss, wie sein Name suggeriert, von ihren Häschern eingeholt und ihrer mutmaßlichen Schuld gemäß wie eine Hexe im Spätmittelalter durch Feuer vom Leben zum Tode befördert worden.
Die Rückbesinnung auf die Grundlagen, die sich damals als Ausgangspunkt bewährte, empfiehlt sich auch hier und jetzt, und sei es auch nur, um ganz sicher zu sein, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Diese Gefahr ist immer dann am größten, wenn es um scheinbar „geläufige" Begrifflichkeiten geht. Daher meine sokratisch naive Frage: was ist eigentlich „Mord" und wie unterscheidet er sich nach dem Willen des Gesetzgebers von anderen Körperverletzungsdelikten? Der alte, meist halb scherzhaft zitierte juristische Lehrsatz, demzufolge ein Blick auf das Gesetz die Rechtsfindung erleichtere, hat, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, schon seine Berechtigung.
2. DER RASENDE ROLAND
Auf einem Bein, sagt der Volksmund, kann man nicht stehen. Um als „vollständig" gelten zu dürfen, muss jede Rechtsnorm, egal, welchem Teilbereich privaten oder öffentlichen Rechts sie zuzuordnen ist, grundsätzlich auf zwei Säulen ruhen: dem Tatbestand und der sich an dessen Verwirklichung knüpfenden Rechtsfolge. Letztere, die zivilrechtlich beispielsweise in der Nichtigerklärung eines Geschäftsvertrages bestehen kann und im Verwaltungsrecht oft als Widerruf eines begünstigenden oder belastenden Verwaltungsaktes auftritt, nimmt im Strafrecht die Gestalt einer Pönalisierung im strengen Sinne an.
Fehlt die Rechtsfolge als Spielbein beispielsweise dort, wo es nur um die gerichtliche Feststellung des Bestehens oder Nicht-Bestehens eines Vertragsverhältnisses geht, balanciert das Gesetz ausnahmsweise allein auf dem Standbein. Was nicht heißt, dass die Entscheidung, zu der das Gericht hier gelangt, für die Beteiligten ohne praktische oder rechtliche Konsequenzen bliebe. Wäre dem so, hätte man sich die Mühe ja auch gleich sparen können. Im Zweifel sind die Folgen recht weitreichend und berühren unter Umständen sogar die Interessen Dritter. Doch sind sie, und nur darauf kommt es hier an, nicht Gegenstand dieses selbigen „einbeinigen" Gesetzes, sondern entspringen anderen Rechtsnormen, die das Vorhandensein oder Fehlen beispielsweise eines Vertragsverhältnisses zur Grundlage ihrer eigenen Verfügungen nehmen.
Auf gar keinen Fall fehlen darf hingegen das Standbein, sprich, die möglichst präzise Definition der sogenannten Tatbestandsmerkmale. Dies gilt ganz allgemein für alle Rechtsbereiche, ist aber von ganz besonderer Bedeutung im Strafrecht, wo der Grundsatz nulla poena sine lege („keine Strafe ohne Gesetz") so genau zu nehmen ist, dass aus ihm beispielsweise das Rückwirkungsverbot von Strafgesetzen folgert. Diese charakteristische „Pingeligkeit" des Strafrechts, die sich in einer gewissen Starrheit des Verfahrens fortsetzt, erklärt sich aus dem Umstand, dass es für die Be- und Angeklagten in der Regel um weitreichende, oft freiheitsentziehende Konsequenzen geht, die nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind.
Das gilt vor allem natürlich bei Kapitalverbrechen wie Totschlag oder Mord, den in ihren Auswirkungen für die Betroffenen - Opfer wie Täter - gravierendsten Straftaten. Gerade hier würde man als Laie folglich erwarten, dass sich der Gesetzgeber einer besonders präzisen und vor allem unmissverständlichen Formulierung der einschlägigen Gesetze befleißigt.
Betrachtet man daraufhin Aufbau und Wortlaut des im Folgenden zitierten sogenannten „Mordparagrafen" 211 Strafgesetzbuch (StGB) in ihrer heutigen Gestalt, kommt man auch als Laie aus dem ungläubigen Staunen kaum noch heraus.
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken einen Menschen tötet.
Denn zunächst einmal stellt dieser § 211 StGB die übliche, von der allgemeinen Logik diktierte Reihenfolge der beiden klassischen Teile eines Gesetzes um, indem er mit der Sanktion für einen noch nicht definierten Tatbestand beginnt, den er damit quasi als allgemein bekannt voraussetzt. Das ist eine relativ sinnfreie wie systemwidrige Vorgehensweise und wohl nur damit zu erklären, dass der frühere Text dieser Ziffer 1 lapidarer und zugleich apodiktischer gelautet haben dürfte: „Der Mörder wird mit dem Tode bestraft."
Das ändert zwar nichts an der verqueren Systematik, macht aber schon etwas verständlicher, weshalb dem Gesetzgeber diese Umstellung angebracht erschien. Wie der kleine Django seinen Finger, erhebt hier Justitia ihr Schwert und weist gleich mal auf den Emst der Lage hin: Angeklagten, Staatsanwälten, Verteidigern, Richtern, Geschworenen, Schöffen, Zeugen oder Sachverständigen soll noch einmal in aller wünschenswerten Deutlichkeit bewusst gemacht werden, dass ab hier in doppelter Weise Schluss mit Lustig ist. Denn nicht genug damit, dass dem überführten und rechtskräftig verurteilten Mörder die Todesstrafe drohte, hatte der Richter, darin liegt die Bedeutung des „juristischen Präsens", gar keine andere Wahl, als diese zu verhängen.
Sicher ist auch die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe, die 1949 die Todesstrafe in der Bundesrepublik - nicht aber in der DDR - ablöste, kein Strafmaß, das Angeklagte ungerührt ließe. Dennoch wirkt die ihres Knalleffektes beraubte Ziffer 1 des § 211 StGB nun eher wie ein kastrierter Bullterrier und klingt durch die Wiederholung von „ ...strafe bestraft" auch stilistisch eher kakophonisch. Natürlich müssen Rechtstexte nicht den ästhetischen Erfordernissen der Belletristik genügen, aber der Grundsatz: alles, was gesagt werden kann, kann auch wohlformuliert gesagt werden, ist von universaler Geltung.
Damit plädiere ich, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, nicht etwa für die Wiedereinführung der Todesstrafe, sondern setze mich nachdrücklich für eine Überarbeitung des § 211 StGB ein.
Wer nun darauf vertraut hatte, dass der Absatz 2 des Gesetzes mm endlich auch den Tatbestand definieren würde, sieht sich erneut enttäuscht. Denn anstelle des Tatbestandes präsentiert uns die Ziffer 2 den diesen verwirklichenden Täter. Auch das ist unsystematisch und macht auf mich den Eindruck, als wäre dem Gesetzgeber eine beim abendlichen Opembesuch gehörte Strauß'sehe Mazurka zum Ohrwurm geraten: „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.".
Es folgt eine kasuistische Aufzählung von „gängigen" Mordmotiven. Auch dies eine dem gern abstrahierenden deutschen Recht eher fremde Technik, die den Nachteil in sich birgt, nie erschöpfend sein zu können. Weshalb sich prompt eine Art Auffangtatbestand in Gestalt sonstiger „niedriger Beweggründe" anschließt. Dem ist deshalb nicht über den Weg zu trauen, weil er erstens für Strafrechtszwecke eigentlich zu vage und zweitens auch noch moralisierend daherkommt.
Unbestimmte Rechtsbegriffe wie dieser gelten dem deutschen Juristen zwar durchaus als nützliche Hilfsmittel, die immer dann greifen, wenn sozusagen „sperrige" gesetzliche Vorschriften auf die besonders gelagerten Umstände von Einzelfällen nur schwer anwendbar erscheinen. Schließlich kann der fehlbare Gesetzgeber beim besten Willen nicht alle „schmalen Bretter" im Vorhinein vor Augen haben, auf die schlitzohrige Täter*Innen zu verfallen wissen. Doch sollte die Handhabung dehnbarer Begriffe, wie sie im Zivilrecht gang und gäbe ist, im Strafrecht und zumal in Verbindung mit Kapitalverbrechen tunlichst unterbleiben.
Dies schon deshalb, weil solche Sollbruchstellen im Gefüge strafrechtlicher Normen leicht zum Einfallstor nicht nur für moralische, sondern auch für ideologische Strömungen verkommen und der Etablierung von Gesinnungstatbeständen den Boden bereiten können. Man wird den Urhebern deshalb kein allzu großes Unrecht mit der Annahme zufügen, dass bei dieser Formulierung der Wunsch Pate stand, genau diese Art von Bresche zu schlagen, durch die linientreue Richter in der Folge „Vaterlandsverräter", „Volksverhetzer" oder „Wehrkraftzersetzer" als von „niedrigen Beweggründen" angetriebene „Parasiten" in den Geltungsbereich des Mordparagrafen 211 würden einschleusen können.
Wer da im Hintergrund die hündisch aufheulende und sich wutschnaubend überschlagende Stimme eines Roland Freister zu vernehmen glaubt, darf sich bestätigt fühlen: „Was sagen Sie da? Juden.. .ermordet?! Er-mor-det? Sie sind ja wohl der größte Lump..." und so weiter. Wir haben das alle noch von den Dokumentarfilmen im Ohr, die die Nazis selbst über den Ablauf der sogenannten Verschwörer-Prozesse des 20. Juli durch ein Loch in der Hakenkreuzfahne hinter der Richterbank drehen ließen, um aller Welt demonstrieren zu können, wie absolut korrekt und rechtsstaatskonform die Verfahren nach ihrem Verständnis abliefen.
Vor seiner Richtertätigkeit diente der rasende, notorisch unter dem falschen Baum bellende Roland als Staatssekretär im Reichsjustizministerium und dürfte in dieser Eigenschaft und Rolle auch an der Formulierung des Mordparagrafen 211 StGB mitgewirkt haben. Dass dessen Text trotz der ausgewiesenen Schwächen und Inkonsequenzen auch nach mehrmaligen Anläufen vom deutschen Bundestag immer noch nicht radikal überarbeitet wurde, verwundert nicht nur den juristischen Laien. Offenbar auch für die Zwecke der heutigen Rechtsprechung immer noch zu gebrauchen, ist er sicher keine Zierde gesetzgeberischen Wirkens, sondern eine peinliche Altlast.
Immer noch im Rahmen desselben Bandwurmsatzes der Ziffer 2 folgen auf die Motive das, was man die besonderen „Begehungsarten" der Tat nennen könnte. Deren Nützlichkeit erschöpft sich bei kritischer Würdigung ebenfalls schnell. Irgendwie „grausam" ist so gut wie jedes Tötungsdelikt und für die Begründung der Heimtücke genügt, dass das Opfer in jenem Moment, da es auf den Täter traf, nicht unbedingt mit einem tätlichen Angriff rechnen konnte oder musste. Auch das lässt sich in so gut wie allen Fällen unterstellen und ist jedenfalls beim tödlichen Angriff eines Erwachsenen auf Kinder ohne weiteres anzunehmen, so dass die Tötung Armanis auch ohne die Kenntnis der Beweggründe des oder der Täter(s) unzweifelhaft als Mord zu qualifizieren ist.
Abschließend schiebt der Gesetzgeber noch das Motiv der Verdunkelung nach, als sei ihm dieser wichtige Aspekt erst kurz vor Redaktionsschluss gerade noch rechtzeitig eingefallen. Kurzum, sorgfältige systematische gesetzgeberische Arbeit, wie sie ein „Mordparagraf" eigentlich verdient hätte, sieht anders aus.
Die unabänderliche Rechtsfolge des Absatzes 1 ist lebenslängliche Freiheitsstrafe. Was heißt das eigentlich? Wie ernst darf man das als Zeitmaß nehmen, wenn der putzmuntere fünfundzwanzigjährige Mörder eine Lebenserwartung von, sagen wir, fünfzig Jahren hat, während ein 55jähriger herzkranker Killer wahrscheinlich nur noch maximal zehn Jahre zu leben hat und die restlichen fünf schuldig bleibt? Ist das noch mit der postulierten Gleichheit aller vor dem Gesetz vereinbar?
Den Gesetzgeber auch für die biologischen Gegebenheiten hienieden verantwortlich machen zu wollen, verbietet sich von selbst. Und wer als juristisch interessierter Laie die Vollzugspraxis in der Bundesrepublik ein wenig verfolgt, kann leicht den Eindruck gewinnen, „lebenslänglich" sei nur so eine Art blumiger Metapher, ein irgendwie überkommener alter Ausdruck für die volle Dröhnung von 15 Jahren Gefängnis. Abgesehen davon, dass sich auch „nur" 15 Jahre Knast wahrscheinlich wie ein Leben anfühlen können, trifft dieser Eindruck nicht wirklich ins Schwarze.
Tatsächlich handelt es sich bei dem formelhaften „lebenslänglich" um ein mit dem strengen systematischen Anspruch des Strafrechts eigentlich erneut schwer vereinbares „schwebendes" Konstrukt insofern, als die verhängte Strafe grundsätzlich unbefristet ist. Jemanden bis an sein „natürliches" Lebensende wegzusperren, verträgt sich jedoch nicht mit dem humanistischen Gedanken der „zweiten Chance" und Gelegenheit zur Resozialisierung und sei es auch eines Mörders. In praxi läuft „lebenslänglich" deshalb zunächst auf jene Mindesthaftdauer von 15 Jahren hinaus, nach deren Verbüßung geprüft wird, ob die „Reststrafe" für eine Frist von, im Regelfall, fünf Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Die Beantwortung dieser Frage richtet sich nach der ehr oder minder guten Führung des Strafgefangenen während der Haft sowie nach seiner von Fachleuten zu erstellenden Sozialprognose. Garantiert ist die Aussetzung zur Bewährung mit anderen Worten also schon mal nicht.
Zu der Bereitschaft des Staates, den Lebensländlichen nach 15 Jahren wieder freizulassen, muss sich dessen Einwilligung gesellen. Kein Witz: das deutsche Strafvollzugsrecht sieht im Gegensatz etwa zum amerikanischen vor, dass zur Entlassung solch lang einsitzender Häftlinge deren Einverständnis einzuholen ist. Wird diese in, wenn auch seltenen Fällen wider Erwarten vom Häftling verweigert, kann der Gefängnisdirektor nicht mal mit Hilfe einer Räumungsklage dessen Rausschmiss erwirken.
Die Ratio dieser auf den ersten Blick unsinnigen Vorschrift ist letzten Endes auch gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Es genügt, sich einmal kurz auszumalen, was zum Beispiel einen Häftling Mitte fünfzig, dessen Ex-Frau sich in der Zwischenzeit mit seinem besten Freund Richtung Malle abgesetzt hat, dessen erwachsene Kinder ihn nicht zu kennen vorgeben und dessen früherer Beruf sich längst so gewandelt hat, dass er ihn nicht wiedererkennen würde, nach seiner Entlassung in die Freiheit da draußen erwartet. Niemand gibt darauf eine passendere Antwort als Kris Kristoffersen im bittersüßen Refrain seines Songs Me and Bobby McGee: „Freiheit ist nur ein anderes Wort für nichts mehr zu verlieren. Nichts wird nicht zu mehr, nur weil's gratis ist."
Sorry, Kris, im Original klingt das ungleich besser. Sei's drum: in der Routine des Knastalltags kennt der „Lebenslängliche" sich aus, wird vielleicht sogar von Mithäftlingen wie Wärtern in Maßen respektiert und geschätzt und weiß jedenfalls, wie der Hase läuft und wo der Frosch die Locken hat. Gewisse Freiräume wird er sich auch dort hinter Gittern nach und nach erarbeitet haben. Warum sich dann dort draußen Arbeits-, Obdach- und Hoffnungslosigkeit aussetzen, wenn absehbar ist, dass man in Ermangelung legaler Erwerbsquellen bald wieder straffällig werden und erneut einfahren wird? Dann kann man sich den Umweh sparen und gleich drinbleiben.
In manchen Bundesstaaten der USA hält man für lang einsitzende und um, sagen wir, 30 Jahre Knast „gewarpte" Strafgefangene Zimmer und Apartments in sogenannten Halfway Houses als erste Auffangstationen vor, damit die Betreffenden erst mal ein Dach über dem Kopf haben und nicht gleich durch die in den USA besonders weit geknüpften Maschen des sozialen Netzes fallen. In der Bundesrepublik übernehmen da und dort gemeinnützige Vereine wie der Hamburger „Ankerplatz" solche Aufgaben. Denn ohne festen Wohnsitz kein Job, ohne Job kein legales Einkommen und so weiter. Nicht jeder verfügt über die Chuzpe des Hauptmanns von Köpenick.
Eine gut gemeinte Maßnahme, das Angebot solcher Auffangstationen, die aber auch nicht immer den erhofften Erfolg zeitigt. Im 1994 erschienenen US-Streifen The Hudsucker Proxy („Hudsucker - Der große Sprung") begeht ein älterer, frisch entlassener Langzeit-Häftling nur Stunden nach seiner Ankunft im Halfway House Selbstmord. Ihn im Knast behalten, wie er es sich sehnlichst gewünscht hatte, konnte man aufgrund der geltenden Rechtslage nicht.
In der Regel ist ein Verbleib im Gefängnis über die 15 Jahre hinaus bei uns trotz allem eher unfreiwilliger Natur und dem Umstand geschuldet, dass das Gericht seinem Urteil den Stempel der „besonderen Schwere der Schuld" aufgedrückt hat. Erneut ein moralinsaurer Begriff, dessen Anwendung in das Ermessen des Gerichts gestellt, zugleich aber der Kontrolle einer sogenannten Strafvollzugskammer unterworfen ist. Die entscheidet nach etwa 13 verbüßten Jahren erstmals darüber, wie lang der „überschießende" Zeitraum bemessen sein soll, den der Häftling nach Verbüßung der 15 Jahre im Gefängnis verbringen muss, weil er etwa bei der Tötung seines Opfers ausgesprochen brutal oder sadistisch vorgegangen ist und insofern eine besonders schwere Schuld auf sich geladen hat.
Noch gravierender für die Betroffenen und von allen Straftätern entsprechend gefürchtet ist die gerichtliche Anordnung der sich an die Verbüßung der Mindestdauer von 15 Jahren anschließenden sogenannten „Sicherungsverwahrung".
Dies ist keine bloße befristete Strafverlängerung mit absehbarem Ende, sondern eine unbefristete „Maßnahme zur Besserung und Sicherung", die eigentlich in den Räumlichkeiten einer speziell auf diese Zwecke zugeschnittenen geschlossenen Institution durchgeführt werden sollte, in der Praxis aber aufgrund des chronischen Platzmangels der wenigen existierenden Einrichtungen in den normalen Strafvollzugsanstalten stattfindet und dann von „normalem" Knast kaum zu unterscheiden ist.
Ausschlaggebend für die Anordnung der Sicherungsverwahrung ist nicht die Schwere der Schuld des überführten Straftäters, sondern dessen demonstrierte oder diagnostizierte Gemeingefährlichkeit, angesichts derer es unverantwortlich wäre, ihn nach der Verbüßung seiner Strafe mir nichts, dir nichts wieder auf die Menschheit loszulassen. Die fortgesetzte Aufrechterhaltung der Maßnahme unterliegt einer jährlichen Überprüfungspflicht.
„Lebenslänglich" kann sich also bei genauerem Hinsehen auch in unseren Breiten unter Umständen ganz schön hinziehen.
Windet sich der Gesetzgeber bei seiner Definition des Mörders verbal noch wie eine Frau in den Geburtswehen, macht er es sich bei derjenigen des Totschlägers umso leichter, indem er diesen in § 212 StGB als jemanden verstanden wissen will, der tötet, ohne Mörder zu sein. Ein Objekt gleich welcher Art durch Eigenschaften definieren zu wollen, die demselben gerade nicht eignen, widerspricht den Grundsätzen der Logik und ist insofern mit einer zoologisch-taxonomischen Einstufung der Fledermaus als „alles, was fliegt, ohne ein Gefieder zu haben" vergleichbar.
Damit nicht genug der Merkwürdigkeiten. Knauserte der Gesetzgeber im § 211 doch recht arg mit der richterlichen Ermessensfreiheit, teilt er sie im § 212 fast wie Karnevalssträußchen mit beiden Händen aus, indem er das bei fünf Jahren Gefängnis beginnende „Mindest-Höchst"-Strafmaß, auch so ein sinnwidriger Begriff, nach oben hin offen gestaltet, so dass für die arglosen Täter*Innen im schlimmsten Fall auch schon mal „lebenslänglich" dabei herausspringen kann.
Gut und schön, könnte man sagen, wenn nur die Dauer der dehnbaren Verjährungsfrist von zwischen 10 und 30 Jahren nicht an das zu erwartende Strafmaß geknüpft wäre. Dabei handelt es sich nämlich insofern um einen klassischen Zirkelschluss, als das Strafmaß sich zwangsläufig immer nur an den besonderen Umständen des Einzelfalles auszurichten hat, die ihrerseits grundsätzlich immer nur in einem ordnungsgemäßen Prozess eruiert werden können. Damit würde ein Verfahren erforderlich, an dessen Ende dann die Erkenntnis stehen könnte, dass es eigentlich gar nicht hätte angestrengt werden dürfen, weil das für diese Straftat im Raum stehende Strafmaß diesem Delikt eine Dauer der Verjährungsfrist zuordnet, die bereits abgelaufen war, als der Täter dingfest gemacht wurde. Alles muss man ja als Laie auch nicht verstehen...
Die Strafverfolgungsverjährung wird im deutschen juristischen Sprachgebrauch nicht ohne Grund mit dem altertümlich gestelzt anmutenden Begriff der „Rechtswohltat" bezeichnet. Eine Wohltat wird einem nach landläufigem Verständnis ohne eigenes Zutun zuteil. Nicht so diese. Der Eintritt der Verjährung wird vom Gericht nicht ex officio festgestellt und die Akte mit einem vorwurfsvollen Seitenblick auf den Staatsanwalt geräuschvoll zugeklappt, sondern sie muss von den Parteien beziehungsweise den Angeklagten oder deren Rechtsbeiständen im Wege der sogenannten prozessualen Einrede geltend gemacht werden, um Berücksichtigung zu finden. Sie beruht allgemein auf dem gesellschaftlichen Konsens, dass hienieden kein Anspruch, egal welcher Art, in alle Ewigkeit Bestand haben kann, sondern irgendwann im Interesse der Wiederherstellung des Rechtsfriedens erlischt wie eine lange flackernde und schließlich konsumierte Kerze.
Das ist im Zivilrecht, wo sich die Kläger beim Versuch der Durchsetzung einer Forderung oft fahrlässig viel Zeit lassen, durchaus nachvollziehbar. Die am Urteilsspruch interessierte Partei hätte sich eben etwas früher kümmern müssen.
Strafrecht hingegen ist öffentliches Recht, was unter anderem bedeutet, dass die Möglichkeiten der Einflussnahme Privater auf das Verfahren stark eingeschränkt sind. Der Vorwurf der Saumseligkeit Betroffener kann allenfalls bei sogenannten Antragsdelikten wie zum Beispiel irgendeiner Form der Ehrabschneidung zur Sprache kommen. Bei den sogenannten Offizialdelikten, die durch die Staatsanwaltschaften „von Amts wegen", sprich, ohne weitere Aufforderung oder Anzeige zu verfolgen sind, sofern und sobald sie von der Tat Kenntnis erlangen, bleie ich als Privater außen vor. Gelingt es der Staatsanwaltschaft nicht, hinreichend gerichtsfestes Beweismaterial für das Erwirken einer Verfahrenseröffnung beizubringen, erlischt auch mein abstrakter Anspruch als Geschädigter auf Gerechtigkeitserlangung mit dem Ablauf der für die betreffende Straftat geltenden Verjährungsfrist. Ab sofort bin ich auf die zivilrechtlichen Möglichkeiten der Klage auf Schadensersatz beispielsweise aus dem sogenannten Recht der unerlaubten Handlung zurückgeworfen.
Auch Mörder gelangten bei uns lange Zeit in den Genuss dieser Rechtswohltat. Erst, als sich gegen Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts am Horizont die auch in ihrer Außenwirkung hochnotpeinliche Gefahr abzeichnete, dass überlebende, aber noch nicht überführte oder „unbekannt verzogene" ehemalige NS-Schergen und KZ-Wächter*Innen demnächst für immer „aus dem Schneider" sein würden, hatte es der sonst eher für seine Trägheit bekannte Gesetzgeber plötzlich sehr eilig, Mord generell für unverjährbar zu erklären. Von der Glocke vor dem Knock-Out gerettet, könnte man sagen.
Insofern, als er den Totschlag definitionsmäßig aufs engste mit dem Mord verknüpft hatte und ersterer bei entsprechender Beweisnot oft quasi subsidiär für den letzteren eintritt, wäre der Gesetzgeber meines Erachtens gut beraten gewesen, die Unverjährbarkeit des Mordes auch auf den Totschlag zu erstrecken, zumal es weder für das Opfer, noch für dessen trauernde Nächste den geringsten Unterschied macht, ob es durch Mord oder Totschlag ums Leben kam. Der Schmerz der untröstlichen Hinterbliebenen ist in beiden Fällen derselbe und die oft gehörte „Rechtfertigung", das Gericht könne das Opfer auch nicht mehr ins Leben zurückbringen, völlig absurd. Mit dem Argument könnte man auf die Rechtsverfolgung von Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit gleich ganz verzichten.
Da der Gesetzgeber die Verjährbarkeit des Totschlags nicht aufhob, kann es beispielsweise geschehen, dass ein mutmaßlicher Mörder, dem es gelingt, die Leiche seines Opfers so lange versteckt zu halten, dass sich an den bloßen Skelettteilen, wenn sie dann endlich gefunden werden, keine eindeutigen Mord-Anzeichen mehr ausmachen lassen, von der Justiz für diese außerordentliche Leistung nach dem Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten" auch noch mit der Rechtswohltat der Verjährung belohnt wird und das Gerichtsgebäude als unbestrafter Totschläger / Mörder und freier Mann zum Entsetzen der Hinterbliebenen des Opfers fröhlich „I've got the power" summend durch den Haupteingang verlässt.
Wir alle haben gelernt, dass Recht und Gerechtigkeit nicht unbedingt deckungsgleich sind. Doch wie immer ein Rechtssystem strukturiert sein mag, sollte es derart grob unbillige Resultate nicht produzieren dürfen.
3. SCHLAGLÖCHER
Von den Schlupf- zu den Schlaglöchern. Warum hatte ich mich an jenem Sonntagnachmittag von allen indischen Takeaways dieser Stadt, dieses Landes, dieses Planeten, ausgerechnet für den afghanischen Laden gegenüber der Tankstelle entschieden? Einfach, lieber Watson: weil er für mich am nächsten liegt und der weitere Weg bis fast zum Bahnhof nicht mit höherer Qualität der Gerichte belohnt wird. Außerdem hat der dortige Inder, der meines Wissens aus Pakistan stammt, den Show Room eines Leichenbestatter zum Nachbarn. Man muss es mit den Mementos ja auch nicht gleich übertreiben.
Trägheit oder Müßiggang als eine der sieben „kanonischen" Todsünden ist eines der wenigen Laster, denen man im Alter rein physisch betrachtet noch ohne Reue frönen kann und das man in dieser atemlos auf der Stelle tretenden Zeit umso lieber pflegt, solange man wenigstens dazu körperlich in der Lage ist.
Weshalb aber hätte sich der kleine Wiedergänger des Sinto Armani ausgerechnet an mich wenden sollen, wo er mich doch sowieso als „alt", und das heißt wohl aus seiner Sicht eher „grottig" apostrophierte? Hatte sein Berater mich ihm ausdrücklich als erschwinglich empfohlen und meinem Namen eine schamlos schmeichelhafte Personenbeschreibung beigefügt, die mich jünger und kompetenter hatte erscheinen lassen als ich es bei nüchterner Selbsteinschätzung von mir selbst behaupten würde?