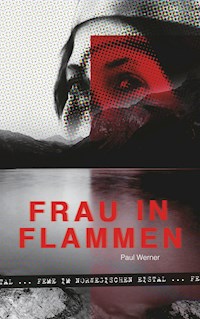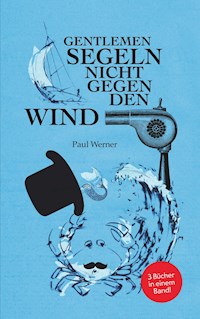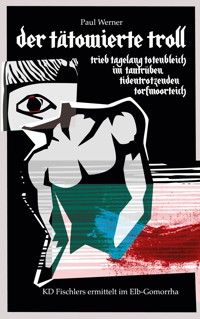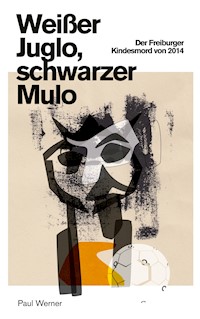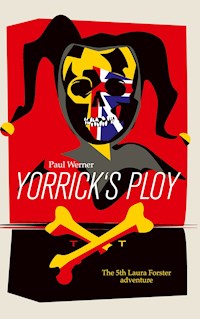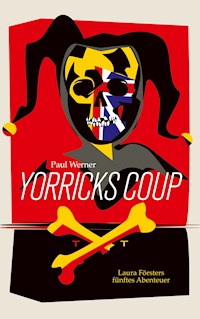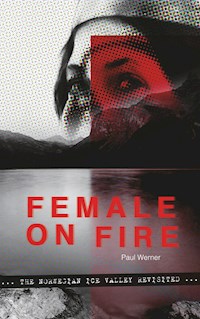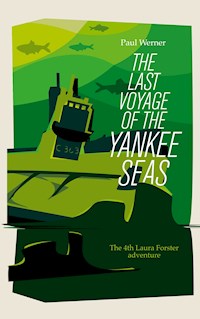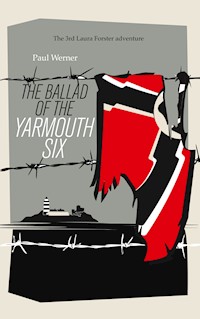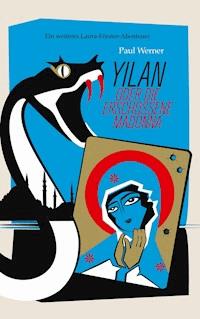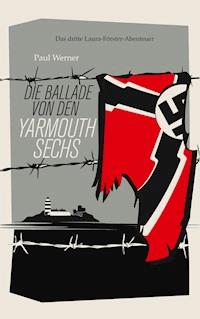
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Laura Förster kann es nicht lassen. Im dritten Band verschlägt es sie auf die Kanalinseln in der Bucht von St. Malo. Hier ist sie einem dunklen Geheimnis aus der Zeit der deutschen Besatzung auf der Spur, das untrennbar mit der Geschichte der legendären Yarmouth Sechs verbunden ist. Sechs junge Burschen, aus einem berüchtigten Jugendknast rekrutiert, sollen unter der Leitung eines unerfahrenen jungen Leutnants einen "Nadelstich"-Überfall auf das von den Deutschen engmaschig verminte und waffenstarrende Inselchen Sark verüben. Ein Selbstmord-Kommando, bei dem nicht viel nach Plan geht. Die Gruppe wird gestellt, ein Rekrut ertrinkt, andere werden angeschossen, und schließlich muss jeder sehen, wie er allein auf sich gestellt wieder von der Insel kommt. Das gibt Anlass zu mancherlei schockierenden, bisweilen aber auch urkomischen Irrungen und Wirrungen. Nach Kriegsende beschließen die sechs Überlebenden, ihre Talente und Erfahrungen als Gangster zum eigenen Nutzen einzusetzen. Unter ihrem Spitznamen gelangt die Bande zu nationaler Berühmtheit. Nun, fast ein halbes Jahrhundert später, schien all dies eigentlich Geschichte. Wie kann es also sein, dass sich eine blutige Brücke von den Yarmouth Sechs zu einem mysteriösen Killer unserer Tage spannt, der auf seinem Rachefeldzug den Spuren der Yarmouth Sechs folgt und dabei unter anderem die Norwegerin Solveig erschießt: ein verhängnisvoller Fehler, war Solveig doch die erste große Jugendliebe von Lauras Ziehsohn Ignace. Das kann ein Förster nicht auf sich sitzen lassen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Das Gerissene Luder
Zweites Kapitel
Ein Kommissar geht um
Der musikalische Zug
Bei den Malvins
Drittes Kapitel
Rumpelstilzchen
Die Zitadelle
Der Schatz
Viertes Kapitel
Die Höhle
Das Verzeichnis
Für eine Handvoll Murmeln
Fünftes Kapitel
Der linke Arm Gittes
Der Mantel
Gaston de Lyon
Sechstes Kapitel
Soldaten des Heils
Gefillte Fisch
Die Kröte
Siebtes Kapitel
Betty Boop
Das Totenschiff
Der Fuchs und das Frettchen
Achtes Kapitel
Der Deal
Fundsache Calypso
Jedem das Seine
Neuntes Kapitel
Das siebte Negerlein
Die Rose von Saek
Bar Mitzwa
Zehntes Kapitel
Gilbert und Sullivan
Daphnes Heim
Der Springteufel
Elftes Kapitel
Plutos Monde
Hinkepinke
Crawl
ERSTES KAPITEL
1. Das Gerissene Luder
Das winzige silbrig glänzende Fischerboot tanzt wie ein am Haken hängender, verzweifelt um sein Leben kämpfender Schwertfisch auf den Schaumkronen der atlantischen Kreuzseen. Bis zur Insel, deren verwüstete Oberfläche wie eine klaffende Wunde inmitten des Ozeans prangt, ist es kaum mehr als eine halbe Meile. Erste Brandungswellen zerschellen an den weitest vorgelagerten, kaum aus dem Wasser ragenden Klippen, deren Schutzschild unlängst vor der Urgewalt des jüngsten Hurrikans überrollt wurde.
Die beiden hoch aufgeschossenen, mageren und hohlwangigen dunkelhäutigen Gestalten an Bord des Bootes scheinen direkt aus dem Herzen Schwarzafrikas hierher in die Karibik geraten. Nun haben sie alle Mühe, sich in der kochenden See auf den Beinen zu halten. Das aber sollten sie unbedingt, denn sitzend würden sie schnell den Überblick verlieren und ihr Boot blindlings in den Klippengürtel rammen. Der ablandige, nach Tod und Verwesung riechende Wind zerrt an ihren abgerissenen, von der Sonne versengten und scheinbar nur noch durch eine weiße Salzkruste zusammengehaltenen Lumpen. Sollte der übellaunige Poseidon ihnen selbst noch diese armseligen Fetzen neiden? Mit blutunterlaufenen Augen mühen sich die beiden, den dichten Schleier zu durchdringen, den die laut knallend am Bug detonierenden Wellen immer aufs Neue wie ein fein geknüpftes feuchtes Netz über Boot und Besatzung werfen.
Die Männer suchen nach einer Bresche zwischen den Gischt-Säulen, die wie verspielte Geysire mal hier, mal dort vor ihren salzig tränenden Augen emporschießen. Der eine steht zwischen Bug und primitivem Steuerstand und klammert sich an einem kurzen, dünnen Tampen, dessen Ende bereits tief in das Fleisch seiner rechten Hand geschnitten hat. Der andere umklammert am Steuerstand das winzige metallene Ruder, dessen hervorstehende Speichenenden ihm mit ihren heftigen schroffen Ausschlägen die Handgelenke zu brechen drohen. Beide wissen, sie haben nur einen einzigen Versuch. Drehen und umkehren ist in dieser Konstellation nicht möglich.
Umso größer ist ihre Erleichterung, als sie es endlich geschafft haben und mit mehr Glück als Verstand durch Skylla und Charybdis geschlüpft sind und die aufgewühlte See erst einmal hinter sich lassen. Ihr brettartiges, beinahe kielloses Boot gleitet auf dem Surf bis fast an den Strand, wo der Mann am Ruder es durch eine jähe Wende in den Wind aufschießen lässt. Ein leichtes Kopfnicken ist das Zeichen an seinen Kumpanen, das rostige, an einem langen Tampen befestigte Knäuel Schrott, das den beiden als provisorischer Anker dient, über Bord zu stoßen. Dann greifen sie nach ihren von der salzigen Luft korrodierten Macheten und klemmen sich zwei in Plastikbeutel gewickelte Stablampen unter den Arm. Schließlich werfen sie sich noch je einen aus verschiedenfarbigen Teilen zusammengeflickten Rucksack über die Schulter, klettern über Bord und waten steifbeinig wie auf Stelzen an Land.
Eine Weile sitzen sie nach Atem ringend auf dem feinen weißen Sand des Stückchen Strandes, das sich links und rechts von ihrem Ankerplatz etwa fünfzig Meter weit erstreckt. Die eilends dem Horizont zustrebende Sonne verzaubert den Strand für einen magischen Moment mit dem sanften letzten Licht dieses Tages. Die beiden Gestalten blicken aufs Meer und stärken sich ohne Hast mit etwas steinhartem Brot, Resten gegrillter Fische und lauwarmem Trinkwasser aus Plastikflaschen, die sie in ihren Rucksäcken mitführen. Dann stehen sie langsam auf, klopfen den Sand vom Hosenboden und wenden sich fast zögerlich der Insel zu, deren Anblick sie bislang peinlichst zu vermeiden schienen.
Das kleine flache, kaum höher als ein Walbuckel aus dem Wasser ragende Eiland, das sich ihnen im rötlichen Dämmerlicht wie ein Stück blutig rohen Fleisches präsentiert, gehörte noch nie zu den schönsten Perlen der Kette sogenannter Kleiner Antillen. Wer die Insel besuchte, den verlangte es vor allem nach Ruhe und Abgeschiedenheit fern der karibischen Touristenströme. Heute jedoch gleicht sie einer geplatzten und ihr eiterndes Innere nach außen kehrenden Pestbeule. Lange kann es noch nicht her sein, dass eine mörderische Springflut die wehrlose Insel überspült hat, während das unermüdlich wirbelnde Schwungrad eines vernichtenden Zyklons alles, was hier mehr als einen halben Meter emporragte, abrasiert und so die Insel dem Erdboden gleichgemacht hat. Palmen, Büsche, Kakteen, die ganze zähe und vielerlei Widrigkeiten trotzende Flora wurde systematisch abgeknickt, gefällt oder entwurzelt. Hütten, Lebkuchenhäuschen, Bungalows, kleine Hotels, bunt bemalte Kapellen dieser oder jener esoterischen Glaubensgemeinschaft wurden in ihre Einzelteile zerlegt. Die in alle Himmelsrichtungen fliegenden Trümmer landeten irgendwann krachend und berstend wir Bomben auf den Ruinen, die sich bis dahin mit letzter Kraft gegen den Sturm gestemmt hatten. Verkehrs-, Reklame- oder Straßenschilder rissen aus ihren Verankerungen und wurden wie morsche Segel zerfetzt oder wie in einer Schrottpresse aufgefaltet. Die einzige Ortschaft der Insel wurde ausradiert, von der Landkarte getilgt. Allein das Fehlen von Bombenkratern lässt halbwegs glaubhaft erscheinen, dass es sich bei diesem Werk totaler Vernichtung um das zerstörerische Walten der Natur und nicht etwa die Folgen eines Luftangriffes oder Granatenbeschusses handelt.
Zerzauste Kronen entwurzelter Palmen breiten ihre Blätter wie riesige Staubwedel über weite Teile des gewaltigen Trümmerfeldes, als wollten sie das volle Ausmaß der Katastrophe schamvoll verhehlen. Selbst aus der Internationalen Raumstation dürfte unschwer zu erkennen sein, wie gnadenlos dieser Hurrikan der Kategorie vier die Insel verwüstet hat. Was zuvor als grünlich schimmerndes Blatt auf dem Kobaltblau der See zu tanzen schien, ist jetzt zur verwelkten Seerose verkommen.
Nicht bis zur Raumstation hinauf dringt der penetrante Geruch faulender Fischleichen. Die Springflut hat Tausende von Fischen an Land gespült, wo sie dann zappelnd und mit verwrungenen Leibern hüpfend verendeten. Jetzt dienen sie Katzen und Ratten zur Nahrung.
Dass hier keine Menschen zu Schaden kamen, liegt an den aus bitterer Erfahrung erwachsenen Vorsorgemaßnahmen. Tage bevor der Hurrikan auf seinem schwer berechenbaren Taumelkurs die Insel erreichte, ordneten die Behörden deren Zwangsevakuierung an. Alle Bewohner wurden auf Schiffe verfrachtet und auf dem etwas weiter südlich gelegenen Schwester-Eiland abgesetzt. Das wird zwar in schöner Regelmäßigkeit ebenfalls von Zyklonen heimgesucht, verfügt aber wenigstens über eine Reihe solider Betonbauten und Hurrikan-erprobter, unterkellerter Schulen und massiver Kirchenschiffe, die sich als Unterstände schon bei früheren Gelegenheiten leidlich bewährt haben.
Behördlicher Zwang ist deshalb unumgänglich, weil längst nicht jeder Inselbewohner bereit ist, der Stimme der Vernunft zu folgen. Niemand überlässt sein Hab und Gut gern sich selbst, und sei es auch nur für wenige Tage oder Wochen. Wer weiß denn, was man bei der Rückkehr von alldem noch vorfinden wird. Geld, Schmuck und andere Wertsachen von geringem Umfang und Gewicht konnten die kurzzeitig aus ihrem Paradies Vertriebenen natürlich mitnehmen. Den Rest ihres Besitzes einschließlich vieler verstörter Haustiere mussten sie jedoch zurücklassen und gegen alle bisherige Erfahrung darauf hoffen, dass die wütenden Elemente ihr Häuschen oder ihren Bungalow diesmal verschonen würden.
Die dergestalt widerwillig zurückgelassene Habe wird Plünderern wie diesen beiden schwarzen Gestalten zur leichten Beute. Doch bei aller Gier, die ihre Sinne vernebelt, können selbst sie sich dem Schrecken dieser gruseligen Szenerie nicht ganz entziehen. Immer wieder misstrauisch um sich blickend, nähern sie sich nun dem Epizentrum der Verwüstung. Inzwischen hat auch die Sonne schamvoll ihr Gesicht verhüllt. Myriaden wie Eiskristalle glitzernder Sterne blinzeln ungerührt auf Gerechte wie Ungerechte hernieder, so als müssten sie die absolute Empathielosigkeit des Alls bestätigen. Dichte, unstet dahinjagende Wolken kommen so überfallartig auf, als hätte sie wie Sendboten der Unterwelt den lieben langen Tag auf Abruf gewartet, bei Anbruch der Dunkelheit endlich losschlagen zu dürfen. Im Süden zucken erste Blitze wie Zeugen einer fernen Schlacht über den Horizont.
Die beiden Plünderer haben ihre Stablampen angeknipst, ohne sie aus dem transparenten Plastik zu wickeln. Matte Lichtkegel gleiten über die Trümmer, die den beiden alsbald den Weg verstellen. Wo in diesem Inferno die einzige größere Straße des Orts endet und die privaten Grundstücke ihren Anfang nehmen, können die beiden bestenfalls ahnen. Da und dort stochern sie mit ihren primitiven Macheten in geborstenem Holz, zersplittertem Glas und verstreutem, bereits von allerlei Getier zerwühltem, übelriechendem Müll. Ab und zu bücken sie sich nach scheinbar lohnender Beute, die sie auflesen, um sie nach kurzer oberflächlicher Prüfung wieder zu verwerfen. Ihre Rucksäcke sind klein, ihr Boot schmächtig. Deshalb werden sie sich nicht mit Dingen belasten können, deren Umfang oder Gewicht sie bereits disqualifizieren.
Ausgesetzt und sich selbst und ihren Artgenossen ausgeliefert, werfen Hunde auf dem kurzen Weg zur Verwilderung ihre Erziehung ähnlich schnell über Bord wie ihre Besitzer. Anstatt weiter zu bellen, wie es dem menschlichen Ohr, jedenfalls in Maßen, ein Wohlgefallen ist, gehen sie alsbald wieder zum Wölfsgeheul über, das in ihrer tierischen DNA ebenso verankert ist wie die Furcht davor in derjenigen des Menschen. Während sie solchen melancholischen Arien des Hungers wenig Bedeutung beimessen, reagieren die Plünderer auf andere, nicht sogleich zuzuordnende Geräusche durchaus heftig und unmittelbar. Immer mal wieder verharren sie und lauschen wie zu Salzsäulen erstarrt angestrengt in die Nacht.
Dass sich ein Inselbewohner der Evakuierung entzogen haben könnte, um eventuellen Plünderern wie diesen das Handwerk zu legen oder sich gar selbst an anderer Leute Hab und Gut zu bedienen, ist unwahrscheinlich. Aber vor allerlei verrückten Zufällen ist man im Leben ja nie sicher. Noch heute erzählt man sich zum Beispiel die Geschichte vom notorischen Taugenichts, Trunkenbold und Dieb, nennen wir ihn Marcel, der auf Martinique als damals einziger Insasse des winzigen örtlichen Gefängnisses einen vernichtenden Vulkanausbruch überlebte. Während draußen die Hölle ihr Feuer ausspie, schlief Marcel in seiner Zelle, in der man ihn schlicht vergessen hatte, seinen Rausch aus. Als er aufwachte, war die Ortschaft mitsamt Einwohnern im Staub und Magma versunken. Was immer Marcel getrunken haben mochte – diesen halluzinogenen Stoff wird er nie mehr angerührt haben.
Der eine oder andere Junkie ohne nennenswerten Anhang hätte sich, völlig stramm und zugedröhnt, während der Evakuierung in irgendein Loch verkrochen haben, in dem keiner nach ihm suchte. Konkurrierende Plünderer könnten sich auf der Insel herumtreiben. Draußen auf See haben die beiden zwar keine anderen Fahrzeuge gesichtet, aber was heißt das schon. Kleine Boote mit niedrigem Freibord sind zwischen den atlantischen Wellenbergen kaum auszumachen. Vorerst kommt Konkurrenz jedoch nur von Möwen, Ratten, Katzen und Hunden. Winzige leuchtende Punkte blinken im Lichtstrahl der Lampen kurz auf wie Quarzkristalle in einer Diamantenmine.
Ab und zu erschrecken die Plünderer über das schleifende Geräusch eines von Böen erfassten Stücks Pappe oder Sperrholz. Schief in ihren quietschenden Angeln hängende, aufgeregt im Wind hin und her schlagende Türen täuschen gleichsam alltägliche Geschäftigkeit vor. Leise grollender Donner begleitet das Zucken der Blitze des sich träge nähernden Hitzegewitters.
Da und dort stoßen die beiden auf Tierkadaver. Einige Hunde und Katzen ertranken, wurden von Trümmern erschlagen oder von ihren Besitzern in banger Vorahnung erschossen: besser ein schneller Tod durch die Kugel, als das quälende Martyrium langsamen Ertrinkens. Verrottende Fische, darunter viele Exocoetidae, die von der Sturmflut auf die Insel gespült wurden oder verwirrt angeflattert kamen und wie orientierungslose Zugvögel auf allerlei Hindernisse prallten und verendeten, steuern ihr Schärflein zum allgemeinen Verwesungsgestank bei.
Endlich hat das subtropische Nachtgewitter die Insel erreicht und öffnet die himmlischen Schleusen. Gnadenlos entlädt es seine Regenmassen auf alles, wes noch kreucht und fleucht, also auch und erst recht auf die beiden Plünderer. Mit ihren so gut wie nackten Oberkörpern sind sie den prasselnden Tropfen schutzlos preisgegeben und gleichen bald zweibeinigen, übergroßen schwarzen Pudeln, die gerade von der halbjährlichen Schur kommen. Vielfach verästelte Blitze durchzucken den Nachthimmel und lassen die ohnehin unheimliche Szenerie dramatisch aufleuchten. Salven „feuchten", wie mit riesigen Blechen erzeugten Theaterdonners rollen durch die schmalen Canyons zwischen den Müllbergen.
Gewissensbisse darüber, dass sie im Begriff sind, sich am Besitz ohnehin vom Schicksal hart getroffener Menschen zu bereichern, scheinen die beiden nicht zu plagen. Warum auch? Selbst wenn's ausnehmend gut läuft, holen sie sich aus ihrer Sicht allenfalls einen verschwindenden Teil dessen wieder, was ihre versklavten afrikanischen Vorfahren einst an Blut, Schweiß und Tränen hier zurückließen.
Zwei Weiße, die gottesfürchtigen Brüder John und Christopher Codrington waren es, die der Insel als deren erste Pächter ihren Stempel aufdrückten. Dem von ihnen gegründeten und bis heute einzigen Ort vermachten sie ihren seltsam sperrigen Namen, der zur blumigen Toponymik der Karibik in etwa so verhält, wie mit gehackten Innereien gefüllter Schafsdarm zum rattenscharfen Cajun Gumbo. Das allzeit geschäftstüchtige britische Königshaus ließ damals wohl die Champagnerkorken knallen, als feststand, dass dieses scheinbar einfältige Brüderpaar bereit war, jenes kleine, augenscheinlich völlig nutzlose sumpfige Eiland gegen stattliches Entgelt in langfristige Pacht zu nehmen. Das war verwunderlich, denn für das Anlegen von Zuckerrohr-, Baumwoll- oder Bananenplantagen eigneten sich die Böden Barbudas damals so wenig wie heute.
Doch schon bald sollte sich zeigen, dass die Codringtons keineswegs auf den Kopf gefallen waren, sondern mit Barbuda etwas Besonderes vorhatten. Was die Insel nämlich in Hülle und Fülle bot, war freier Raum. Mochten die anderen, bildlich gesprochen, gern jede Menge Autos besitzen, die Codringtons saßen sozusagen auf den Parkplätzen. Bei Lichte besehen, verfügten sie über genau den Raum, der sich für die Gewinnung eines Rohstoffes nutzen ließ, ohne den zwischen Trinidad und Charleston oder zwischen Martinique und Philadelphia ein rentabler Betrieb von Plantagen undenkbar war – spottbillige Arbeitskräfte.
Ob die ausgeschlafenen Codringtons „ihre" Neger regelrecht züchteten, wie von manchen Historikern behauptet, oder ob sie lediglich jene, nun ja, optimalen Voraussetzungen schufen, unter denen Schwarze sich auch ohne weiteres Zutun im gewünscht raschen Rhythmus vermehrten, mögen die Archäologen des Frühkapitalismus unter sich ausmachen. Gesichert ist, dass die beiden Britenbrüder nicht nur Antigua, die unmittelbare Nachbarin Barbudas in Süden, sondern nach und nach auch die anderen Inseln über und unter dem Wind regelmäßig mit menschlichem „Nachschub" versorgten.
Die von den Codringtons vermittelten Sklaven waren in den Augen der Plantagenbetreiber umso wertvoller, als sie, auf Barbuda geboren und aufgewachsen, gegen das feuchtwarme, Regenwäldern und Sümpfen verpflichtete karibische Klima bereits bestens gefeit waren. Direkt in der afrikanischen Savanne gefangene und nach quälend langer Überfahrt in Eisenringen und Ketten in die Neue Welt beförderte Sklaven pflegte dieses Klima alsbald zu Hunderten dahinzuraffen. Verlängerung der Lebensarbeitszeit, nutritive Genügsamkeit und erworbene Resistenz gegen endemische Seuchen sprachen allesamt für das insgesamt konkurrenzlose Angebot der Codringtons.
Negersklaven haben für gewöhnlich keine Stammbäume. Doch dass die beiden Halbwüchsigen zu den Nachfahren dieser bedauernswerten Spezies gehören und sich der düsteren Vergangenheit der Insel auf Schritt und Tritt bewusst sein dürften, ist ohne weiteres anzunehmen. Warum also hinderliche Skrupel hegen?
Als die Plünderer sich gerade anschicken, unter einem auf dem Boden gelandeten und dort schräg eingekeilten Stück Wellblech Schutz vor dem Regen zu suchen, hält der eine der beiden mit einem Male erneut inne und zupft den anderen am Arm. Wie feucht glänzende Skulpturen, an denen das Regenwassern in dünnen Bächen herabperlt, stehen sie einen Augenblick lang und lauschen bewegungslos, während das Wasser schnell wachsende Pfützen um ihre nackten Füße bildet.
Als das Prasseln des Regens kurz nachlässt, hört auch der andere, was seinen Partner offenbar irritiert hat. Ein leises wimmerndes Stöhnen wie von einer in den letzten Zügen liegenden Kreatur, irgendwo im heillosen Gewirr links von ihnen. Das aber ist die Richtung, aus der sie eben erst gekommen sind. Wenn dort jemand im Sterben liegt, müssten sie ihn übersehen haben, was ihnen trotz der Dunkelheit und des Regens schwer vorstellbar erscheint. Vorsichtig, ihre Macheten erhoben und bereit zum tödlichen Hieb, schleichen sie langsam und geduckt zurück.
Dann bleiben sie plötzlich erschrocken stehen und nehmen blitzschnell, Rücken an Rücken, eine kauernde Abwehrhaltung ein, die wie die instinktive Bewegung von im Kampf geübten eingeborenen Kriegern wirkt. Der Lichtkegel des einen hat das blutüberströmte Gesicht einer weißen Frau erfasst, die sich, offenbar schwer verletzt, in die höhlenartige Nische verkrochen hat, die zwischen zwei völlig zerstörten, regelrecht ineinander gefalteten Bungalows entstanden ist. Kein Wunder, dass die beiden Plünderer sie eben nicht bemerkt haben. Möglicherweise war sie da auch noch bewusstlos und ist jetzt durch den Lärm des Donners und des prasselnden Regens über ihr aus ihrer Ohnmacht erwacht.
Die Plünderer leuchten die unmittelbare Umgebung ab, um sicher zu gehen, dass nicht noch weitere Verletzte oder Tote hier herumliegen. Erleichtert stellen sie fest, dass dem nicht so ist. Auf die Frau ist mindestens einmal geschossen worden. Blut sickert dünn, aber unaufhörlich aus einer kreisrunden Eintrittswunde über dem linken Auge und rinnt über Nase, Mund und Kinn, von wo aus es auf das blutdurchtränkte T-Shirt tropft. Wo sie herkommt und wie sie sich trotz ihrer vermutlich tödlichen Verletzung bis hierher hat schleppen können, bleibt ihr Geheimnis. Bisweilen ist der sonst so zerbrechliche menschliche Körper zu unglaublichen Leistungen fähig. Der eine Schwarze beugt sich zu ihr herab und spricht sie auf Englisch an. Ihr Gesichtsausdruck lässt vermuten, dass sie ihn zwar hört, aber vielleicht nicht versteht und jedenfalls zum Antworten zu schwach ist. Alles, was sie hervorbringt, ist dieses durch Mark und Bein gehende Stöhnen, das langsam in Röcheln übergeht. Sie scheint mühsam ein Wort bilden zu wollen, das die beiden ihrerseits nicht verstehen.
Die Plünderer halten kurz Zwiesprache. Sie sind zwar nicht in weiblicher Anatomie bewandert, wissen aber trotz ihrer jungen Jahre bereits aus Erfahrung, wie ein Mensch aussieht, der nur noch Minuten zu leben hat. So oder so haben sie kein Interesse daran, eine Zeugin ihres verachtungswürdigen Tuns am Leben zu erhalten, selbst wenn sie es denn könnten. Der eine, der sich kurz zu ihr herabgebeugt hat, blickt fragend auf seinen Partner und deutet auf seine Machete. Sein Kumpan schüttelt den Kopf. Er weiß, dieses traurige Geschäft wird ihnen die Natur abnehmen. Wichtiger wäre es, zu erfahren, woher die Frau kommt und was ihr widerfahren ist. Wie eine Plünderin sieht sie nicht aus. Wie eine Einwohnerin Codringtons aber auch nicht. Eine Katastrophentouristin vielleicht? Wurde sie hier überfallen, worauf alles deutet, könnte ihr Angreifer noch auf der Insel sein und auch den beiden gefährlich werden. So gut sie sich in der Handhabung ihrer Macheten auskennen, gegen Schusswaffen kommen sie mit denen nicht an.
Als hätte die Frau die leise Zwiesprache der beiden durch Lippenlesen verfolgt, hebt sie ihren rechten Arm bis auf Brusthöhe und weist nach links in Richtung Westen. Der eine Plünderer, der seinen auch nicht gerade kleinen Komplizen noch um etwa einen halben Kopf überragt, springt auf einen der Dachreste und erklimmt mit wenigen Sprüngen den an dieser Stelle höchsten Punkt des Trümmerfeldes. Dort oben angelangt, legt er seine Hand zum Schutz gegen den pausenlos strömenden Regen an die Stirn und hält Ausschau nach dem, was die Frau ihnen mit ihrer Geste möglicherweise andeuten wollte: ein Fahrzeug, ein Boot, irgendetwas, das Licht auf diese mysteriöse Angelegenheit werfen kann.
Und er scheint in der Tat fündig zu werden. Als er wieder herunterklettert, sieht er, dass die Frau ihrer Verletzung erlegen ist. Sein Kumpan schließt ihr die weit geöffneten, ausdruckslosen Augen.
Sie lassen den Leichnam in seiner sitzenden Position zurück. Für eine Bestattung ist weder Platz, noch Zeit. Sie sind mit der einsetzenden Ebbe gekommen und sollten mit dem nächsten Hochwasser wieder abfahren, sonst drohen sie, im Klippengürtel hängenzubleiben. Bei Niedrigwasser und schummrigem Licht durch die scharfkantigen, spitzen Felsen zu steuern, ist selbst für Ortskundige, zu denen diese beiden nicht gehören, äußerst riskant.
Sie kehren dem Trümmerfeld den Rücken und waten durch eine etwa bauchnabeltiefe Lagune auf die See zu, die nur durch eine etwa zwanzig, dreißig Meter breite Sandbank von der Lagune getrennt wird. Dann stehen sie schließlich am Strand. Es hat aufgehört zu regnen. Aus dem Gewitter ist ein in den letzten Zuckungen liegendes Wetterleuchten geworden, das in nördlicher Richtung abzieht. Zwar nimmt die verschwenderische Fülle funkelnder Sterne zum Horizont hin ab, weil sich so dicht über der Kimm die Luftschichten merklich verdichten. Doch es bleiben noch genug übrig, um die dunklen Umrisse einer unbeleuchteten Segelyacht deutlich vor dem Hintergrund abzuzeichnen. Dicht unter der Küste verankert, tanzt sie im nie ganz ruhenden Schwell des Ozeans auf und nieder.
Die Plünderer richten ihre Lampen auf die Yacht. Der Lichtschein reicht gerade weit genug, um erkennen zu lassen, dass ihr Rumpf weiß ist. Jetzt ahnen die beiden, woher die Frau gekommen sein dürfte, nicht aber, von wem sie erschossen wurde und warum. Die Yacht muss einige Zeit nach dem Durchzug des Hurrikans angekommen sein. Schutzlos, wie sie da auf Reede liegt, hätte sie den Zyklon nicht überstanden und ein Hurrikan-Schutzloch, in dem sie sich bis vor kurzem hätte verbergen können, hat dieses Eiland nicht zu bieten.
Dass die Yacht unbeleuchtet ist, muss nichts heißen. Segler auf Langfahrt tun stets alles, jedwede Form von unnützem Energieaufwand zu vermeiden. Da sich die Insel außerhalb aller eingefahrenen Routen befindet und den wenigen Fischerbooten der Region kaum Schutz bietet, besteht für eine hier vorübergehend geparkte Yacht so gut wie keine Kollisionsgefahr, selbst wenn sie während der Nacht regelwidrig unbeleuchtet bleibt.
Dass auch unter Deck kein Licht zu sehen ist, mutet da schon merkwürdiger an. Hinzu kommt, dass das Schothorn der nicht sauber fixierten und daher um etwa ein Fünftel ausgerollten Genua in Wind und Schwell laut vernehmlich gegen den Aluminiummast schlägt. Zwar dring der Lärm wegen des ablandigen Windes kaum bis über den Strand hinaus, aber an Bord man muss schon sehr tief und fest schlafen, um vom hellen, glockengleichen Klang des Schothorns nicht über kurz oder lang irritiert zu werden. Ein Rumpf aus Glasfaser-Kohlenstoff bildet einen hochwirksamen Klangkörper, der jedes noch so diskrete Geräusch an oder unter Deck grotesk verstärkt. Mit dieser Yacht, das spüren die beiden Plünderer instinktiv, stimmt etwas ganz und gar nicht.
Sie beraten sich. Wenn sie der Sache auf den Grund gehen wollen, müssen sie hinüberschwimmen und an Bord klettern. Das könnte riskant sein. Ein Schwarm fliegender Fische, die in diesem Augenblick panikartig aus dem Wasser springen und mit ihren Stummelflügeln flatternd das Weite suchen, erinnert die beiden daran, dass die Nacht den Raubfischen wie Barracudas und Haien gehört. Außerdem: wer immer sich auf dem Segler befindet, ist möglicherweise für den Mord an der Frau verantwortlich und so wenig an Zeugen interessiert, wie die beiden Schwarzen. Vielleicht handelt es sich bei der Toten aber auch um eine Einhandseglerin, die kurz vor dem Eintreffen der Plünderer von Piraten überfallen und als tot oder sterbend zurückgelassen wurde. Dann dürften diese mit ihrer Beute längst über alle Berge und die Yacht mithin herrenlos sein. Die beiden glauben zu wissen, dass in diesem Falle ein üppiger Bergelohn winkt, der eine Versicherung immer noch billiger kommt, als der Ersatz des Wiederbeschaffungswertes.
Die Aussicht auf eine sehr viel reichere Beute, als die erhoffte, lässt sie ihre anfänglichen Bedenken in den feuchten Nachtwind schlagen. Alles ist besser, als die Aasgeier zu spielen und an Land mit Ratten und Hunden um die Wette in Dreck und Müll zu wühlen. Sie legen ihre Rucksäcke in den Sand, hängen ihre Macheten um den Hals und gleiten nach wenigen Metern des Watens durch den Surf kopfüber ins tiefere, ruhigere Wasser.
Besonders geübte Schwimmer scheinen sie zwar nicht zu sein, aber das ist auch nicht erforderlich. Nach ein paar Dutzend ungeschickten Paddelbewegungen haben sie die Ankerkette erreicht, an der sie sich erst einmal prustend und Wasser speiend festklammern. Von ihrer kurzen Schwimmeinlage erholt, nehmen sie den Einstieg in Angriff. Sie atmen ein paar Mal tief durch und tasten sich dann am Rumpf entlang nach achtern. Die Yacht hat eine Länge von gut und gern fünfzehn Metern zwischen den Loten. In vielen vor allem nordeuropäischen Marinas würde sie damit durchaus respektvolle bis neidische Blicke ernten. In Mittelmeer oder Karibik hingegen zählt eine Yacht mit solchen Dimensionen bestenfalls als Einstiegsdroge. In exklusiven Häfen wie Falmouth Harbour, Antigua, liegen regelmäßig riesige Segelyachten vertäut, deren bei Anbruch der Dunkelheit angeknipsten Saling- oder Toplaternen nicht nach gemein-maritimen Gepflogenheiten weiß, sondern luftfahrtrot leuchten – getreu dem Motto der Himmel ist die Grenze.
Am Heck empfängt die beiden Schwimmer ein diskret summender Windrotor für zusätzliche Stromerzeugung. Über der Reling hängen aufklappbare Solarpaneele. Entweder wurden sie heute nicht gebraucht, oder jemand hat sie bei Sonnenuntergang beigeklappt. Kontinuierliche Stromerzeugung ist jedenfalls kein Thema an Bord. Pech allerdings für die Plünderer, dass keine einladende Badeleiter vom Spiegelheck hängt, die ihnen das An-Bord-Gehen wesentlich erleichtern würde.
The Wily Minx, buchstabiert der eine der beiden stockend den englischen Namen der Yacht. Das Gerissene Luder? Wer gibt einer offenbar nagelneuen, sündhaft teuren Yacht wie dieser einen solch dubiosen Namen? Als Heimathafen der Yacht nennt das Heck einen Ort namens Sark. Klingt für die beiden fast wie shark, also Hai, und sagt ihnen so wenig wie der Name der Yacht selbst. Die Fahne erlaubt ihnen auch keine wesentlichen Rückschlüsse: ein rotes Andreaskreuz auf weißem Grund, das linke obere Feld rot mit zwei goldenen Löwinnen, deren Schwänze sich über die ganze Länge der eher asketisch wirkenden Körper peitschenartig wölben. Nicht ganz so farbenreich und formverspielt wie manch stolze karibische Kreation, und dennoch fast so weit wie diese von allen klassischen europäischen oder überseeischen Designs entfernt, die die Plünderer bislang etwa bei der alljährlichen Antigua Week bewundern konnten.
Nach Lage der Dinge muss einer von beiden über die Ankerkette an Deck klettern, was nicht ganz leicht ist und voraussichtlich alles andere als geräuschlos vonstattengehen dürfte. Kaum etwas an Bord verursacht ein größeres Spektakel, als die in einer stählernen Lippe am Bug hin und her rutschenden Glieder einer galvanisierten Ankerkette. Glatter Stahl rutscht besser, bricht aber erfahrungsgemäß auch leichter. Rumpeln und Schaben sind geeignet, Tote zum Leben zu erwecken. Schalldämpfende Maßnahmen wären denkbar, werden aber oft vermieden, weil die schabenden und klopfenden Geräusche, so irritierend sie vor allem für die in der Bugkabine liegende Crew sind, dem meist achtem schlafenden Eigner das gefährliche Vertreiben der Yacht bei ausgebrochenem Anker signalisiert. Falls wirklich mal der ans Echolot oder ans GPS_gekoppelte elektronische Alarm ausfallen sollte, wäre das verräterische Kettengeräusch eine sozusagen analoge zusätzliche Hilfe.
Der etwas kleinere Plünderer ergreift die Initiative und hangelt sich behände und relativ geräuschlos nach oben. Dann kriecht er wie ein Schlangenmensch unter der Reling hindurch an Deck. Hier presst er sich erst einmal flach auf das feuchte Teakholz und wartet auf etwaige Reaktionen. Während das Meerwasser von seinem hageren Körper tropft und ein dünnes Rinnsal bildet, das durch das Speigatt am Rumpf entlang ins Meer abläuft, lauscht der Mann angestrengt nach unten. Wie ein Metronom klopft das Genua-Schothorn weiter seinen langsam-eindringlichen Rhythmus. Unter Deck hingegen scheint sich nichts zu rühren. Nach einer Weile steht er auf und schleicht nach achtern, wo er am Heck die metallene Badeleiter aus ihrer Befestigung löst und aufklappt, so dass sein Komplize auf diesem, wesentlich weniger mühevollen Weg an Deck gelangen kann.
Die Macheten in ihrer Rechten und die immer noch in Plastik gewickelten Stablampen in ihrer Linken, schleichen sie zum Niedergang. Selbst im Dunklen sieht die Yacht nagelneu aus, riecht nur irgendwie ganz und gar nicht so. Als sie das Einstiegsschott, dessen einer Flügel leise quietschend im Takt mit dem Seegang hin und her pendelt, fast erreicht haben, schlägt ihren empfindlichen Nasen ein Wölkchen süßlichen Verwesungsgeruchs entgegen.
Schaudernd stecken sie die Köpfe in den Niedergang und leuchten in den Salon. Auf den ersten Blick scheint dort alles zum Besten: ein Mann in Shorts und T-Shirt, vermutlich der Eigner oder Skipper, sitzt auf der gepolsterten Bank am entfernten Ende des Tisches. Sein in den Nacken gefallener Kopf ruht auf dem oberen Rand der Rückenlehne, so als sei er gerade mal eingenickt und ruhe sich von den Strapazen einer längeren Überfahrt aus. Was diesen Eindruck nachhaltig stört, ist das Einschussloch mitten auf seiner Stirn, aus dem schon längst kein Blut mehr sickert. Stattdessen ist das wenige ausgetretene Blut koaguliert und hat sich in seinem dichten Schnurrbart verkrustet. Es bedarf keiner ausgiebigen forensischen Untersuchung um festzustellen, dass der Man, im Gegensatz zur Frau draußen, sofort tot war.
Als sie über den Niedergang vorsichtig nach unten schleichen und sich in den Kabinen umsehen, finden sie zwei weitere Leichen, die eines Mannes und die einer Frau. Auch sie wurden durch einen einzigen präzisen Schuss in die Stirn getötet.
Was immer hier passiert ist, kann so lange noch nicht her sein, sonst würden die Leichen nicht nur müffeln, sondern auch schon einen ausgeprägten Madenbefall aufweisen. Im Aufspüren faulenden Fleisches kann der gemeinen Schmeißfliege niemand das Wasser reichen.
Nicht lange her? Nun, lange genug, um dem Mörder ausreichend Gelegenheit zum Verschwinden zu geben. Vielleicht haben die Plünderer den Killer durch ihre Ankunft auf der Insel vertrieben. Dafür spricht, dass er der zweiten Frau, die irgendwie an Land gelangen konnte, gar nicht erst gefolgt ist. Wo sollte die in den letzten Minuten ihres Lebens auch hin? Dass die Plünderer kein anderes Boot gesehen haben, ist nicht weiter verwunderlich. Zum einen waren sie zunächst völlig darauf konzentriert, nicht irgendwo im Klippengürtel aufzulaufen. Später beschäftigten sie sich damit, in Trümmern und Abfall zu wühlen.
Die Plünderer stehen nun vor einem Dilemma. Entweder nehmen sie von der Yacht und ihrem schockierenden Inhalt Abstand, oder sie erheben Anspruch auf den Bergelohn. Im letzteren Falle müssen sie die Wily Minx nach Antigua fahren oder ins Schlepp nehmen, je nachdem, in welchem Zustand sich die Maschine der Yacht befindet. Segeln haben sie nicht gelernt.
Und sie müssen in Antigua den Behörden glaubhaft erläutern, wo und unter welchen Umständen sie in den Besitz der Yacht gelangt sein wollen. Mit einem Schuss gesunden Realismus' versehen, erkennen sie schnell, dass ihnen nicht nur ihr unerlaubter Aufenthalt auf der Insel, sondern auch das Massaker an Bord angekreidet werden könnte. Sie brauchen eine möglichst wasserdichte Story. Die könnte so lauten, dass sie die Yacht führerlos auf hoher See treibend angetroffen und von ihr kurzerhand Besitz ergriffen haben. Diese Geschichte setzt allerdings voraus, dass sie die Leichen der Crew entsorgen. Was ohnehin nicht die schlechteste Idee ist, denn mit von Hitze und Feuchtigkeit aufgedunsenen und von hungrigen Maden angeknabberten Leichen durch die Gegend zu schippern, würde weniger zum Himmel schreien als stinken. Immerhin gibt es so gut wie keine mühsam zu beseitigenden Spuren eines Kampfes. Das Quartett muss blitzschnell überwältigt worden sein. Keines der Opfer war gefesselt, alle wurden in natürlichen Posen sitzend oder liegend erschossen, was die Vermutung nahelegte, dass sie ihren Mörder kannten. Das immer gleiche kleine Kaliber, das nur Steckschüsse produziert hat sowie die Exekutionsweise vermittels einer erstaunlich präzisen Schussleistung spricht eher für einen Einzeltäter, der vermutlich einen Schalldämpfer benutzte. Der Killer wusste, dass auch beim Morden viele Köche den Brei eher verderben.
Die beiden gehen zur Beratung wieder nach oben, an die frische Luft. Lange müssen sie nicht diskutieren. Während der eine seufzend nach unten steigt und die drei Leichen eine nach der anderen ins Wasser gleiten lässt, als wolle er ihnen einen schmerzhaften Aufprall ersparen, begibt sich der andere noch einmal an Land, wo die vierte Leiche schon eine Beute der Ratten geworden ist.
Als er wieder an Bord zurückkehrt, hat sein Komplize das Genua-Ende um das Vorstag gerollt und den Segel-Ausholer belegt. Dann versuchen sie mehrmals, den Motor der Wily Minx zu starten, was ihnen erst nach vier, fünf vergeblichen Anläufen gelingt. Die Motorisierung der Yacht ist unverhältnismäßig stärker, als die ihres eigenen Bootes. Treibstoff scheint genug vorhanden, falls sie der Anzeige trauen dürfen. Also werden sie die Yacht nicht schleppen, sondern umgekehrt das eigene Fischerboot an einer langen Leine hinter der Yacht herziehen.
Als sie freilich mit dem ersten Tageslicht auf der Höhe der Flut aufbrechen, stellen sie zu ihrer Verwunderung fest, dass ihr eigenes Boot nicht mehr da ist. Sollte es sich von seinem primitiven Anker losgerissen haben oder könnte die Ankerleine gebrochen sein? Sie blicken einander fragend an und zucken dann beide die Schultern. Was soll's - das Boot hat seine Schuldigkeit getan, mag es fortan als Dinghy des Fliegenden Holländers führerlos über den Atlantik driften, wen kümmert das. Von dem zu erwartenden Bergelohn werden sie sich ein angenehmes Leben machen und der Fischerei für immer entsagen können.
2. Am Ende des Fjords
„Der Name ist Kurtz, Oberst Kurtz." Der Mann am Steuer seines silbergrauen Cherokee Longitude dreht den Rückspiegel so zurecht, dass er sich selbst darin betrachten kann und gähnt einmal herzhaft. Mit dem Porträt des Mannes um die sechzig, das ihn kritisch aus dem Spiegel mustert, scheint er leidlich zufrieden. Beherrschende Kennzeichen seiner Physiognomie sind seine unangenehm stechenden grau-blauen Husky-Augen sowie die fast etwas knollig wirkende Nase. Beides würde einem Schlittenhund vermutlich gut zu Gesicht stehen. Menschen neigen dazu, den scheinbar bohrenden Blick und die Schnüffler-Nase zu meiden.
„Kurtz" dreht den Spiegel wieder zurück und checkt die Uhrzeit. Es bleiben ihm noch gut hundert Kilometer auf der spektakulären, vielfach gewundenen und wie eine Achterbahn von zahllosen steilen Serpentinen und atemberaubenden Abfahrten gekennzeichneten Panorama-Uferstraße entlang eines der längsten und schönsten norwegischen Fjorde. Er rechnet die Entfernung überschlagsmäßig in Zeit um und schüttelt ungläubig den Kopf. Auf dieser Straße zwei bis zweieinhalb Stunden Fahrt, wohlgemerkt ohne weitere Pausen wie die vor etwa einer Stunde eingelegte, im Laufe derer er sich die erste Zigarette des Tages gegönnt hat.
Zu seiner Rechten mühen sich die Strahlen der Mittagssonne redlich, die grüne Erbsensuppe des Fjordwassers zu durchdringen. Dabei müssen sie sich beeilen. In weniger als einer Stunde werden wieder die ersten Schatten der den Fjord zu beiden Seiten säumenden Gebirgszüge auf die Wasseroberfläche fallen und für schlagartig einsetzende Kühle sorgen.
Zu seiner Linken begleiten „Kurtz" abwechselnd tiefgrüne, nach frischer Heumahd duftende Wiesen von der Größe von Fußballfeldern, kleine pittoresk bemalte Gehöfte sowie die eine oder andere verschlafene Ortschaft zu Füßen steil aufragender Felswände. Fast ganzjährig schneebedeckte Gipfel schicken ihr Schmelzwasser in Form von schäumenden Katarakten hunderte, ja tausende von Metern tosend zu Tal. Eingepfercht zwischen unnachgiebigen Mauern aus Granit und Gneis, gäbe es für die Menschen hier im Falle eines gigantischen, die Fjorde der Westküste heimsuchenden Tsunamis kein Entrinnen.
Was wäre notwendig, eine solche Katastrophe auszulösen? Nicht viel, im Grunde. Ein kleineres Erdbeben würde vermutlich schon ausreichen. Ein paar Erdstöße, die einen Bergrutsch gewaltigen Ausmaßes dieser auf ewig unverrückbar wirkenden, tatsächlich jedoch unaufhörlich „wandernden" Gesteinsmassen verursachen würde. Die daraus resultierende Flutwelle könnte alle Ortschaften des Fjords von der Landkarte tilgen.
Nüchtern betrachtet, eigentlich erstaunlich, dass ein derartiges Schicksal bislang wohl noch keinen der norwegischen Fjorde ereilt zu haben scheint. Gut, die Wikinger hatten es offenbar nicht so mit dem Schreiben und Lesen, waren mit Morden, Vergewaltigen und Brandschatzen offenbar voll ausgelastet. Dennoch, eine so einschneidende Katastrophe wie ein Fjord-Tsunami hätte vermutlich in die eine oder andere, in den Fels gemeißelte Edda, Hedda oder Abba Eingang gefunden.
„Kurtz" grinst verächtlich, schiebt eine Paul Simon-CD in sein Old-School Autoradio und wiegt sich im Takt der Musik auf seinem schalenförmigen Fahrersitz: Wenn du mein Leibwächter werden willst, könnte ich Dein lange verschollener Kumpel sein. Der tiefere Sinn mancher Songtexte bleibt dem nicht bekifften Sterblichen verborgen. Gelangweilt greift „Kurtz" ins Handschuhfach, entnimmt ihm sein iPad und beginnt, mit seiner freien Rechten wie auf Aladdins Öllampe daran herum zu wischen, während er mit der Linken das Steuer hält. Der wenig befahrenen Straße schenkt er nur so viel Aufmerksamkeit, wie ihr seiner Ansicht nach zukommt. Dass er sich dabei immer mal wieder auf die linke Seite der Fahrbahn verirrt, mag seiner Unachtsamkeit geschuldet sein. Könnte allerdings auch darauf deuten, dass er aus einem Land stammt, in dem Linksverkehr angesagt ist. So oder so scheint ihm nicht bewusst, dass er hier stets mit Überlandbussen rechnen muss, die in Norwegen das Gros der landgebundenen öffentlichen Personenbeförderung bestreiten, sündhaft teuer sind und Gegenverkehr nicht wohlgesonnen sind.
Die Fjorde sind ein beliebtes Reiseziel vor allem deutscher Touristen, unter denen wiederum die passionierten Wohnmobil Nomaden den Löwenanteil ausmachen. Gut Betuchte meiden die drangvolle Enge solch fahrbarerer Heimstätten und begeben sich stattdessen in die drangvolle Enge von Kabinen sündhaft teurer angeblicher Postdampfer, die Emails wohl noch persönlich in den Funklöchern der Fjorde abliefern.
Weiß der Himmel, was die Leute hier zu finden hoffen, denkt sich „Kurtz" und schüttelt missbilligend den Kopf. Das Land ist so schroff wie seine Bevölkerung, deren provinzielle Selbstgenügsamkeit, Hamsuneske Schwermut und weit verbreitete Xenophobie von Edvard Munchs Schrei angemessen symbolisiert werden.
Die alte Frage von Henne und Ei: wird die Mentalität der Hiesigen von der Klaustrophobie fördernden Topographie ihrer verwunschenen Fjordtäler geprägt oder üben diese wassergefüllten Erdspalten auf ohnehin depressiv veranlagte Menschen eine so unwiderstehliche Anziehungskraft aus, dass man schon von Landschaften der Seele sprechen kann?
Mit ihren weitgehend stagnierenden Gewässern und dem einseitigen Anschluss an den Ozean bilden die Fjorde im Gegensatz zu den für gewöhnlich an beiden Enden offenen Sunden ein Mittelding zwischen Flüssen und Bergseen. Wie Flüsse dienten sie dem Transport von Waren und Menschen, wie Seen vermitteln sie, je nach Wetterlage, mal ein Gefühl transzendentaler Ruhe und Geborgenheit, mal eines bedrückender Weltabgeschiedenheit.
Flüsse? Sagten Sie Flüsse? „Kurtz" lacht auf. Fjorde sind keine pulsierenden Lebensadern wie die großen Ströme dieser Erde, die ganze Landstriche formten und in Krieg und Frieden zu Schicksalsgrenzen wurden. Dazu fehlten den Fjorden vor allem ein für den kommerziellen wie kulturellen Austausch geeignetes Hinterland. Ein gravierender Mangel, der sie zu natürlichen Sackgassen machte und die Wikinger zwang, ihr Glück als Nomaden der Meere stets aufs Neue in der Fremde zu suchen und weit entfernte Völker als prekäre Partner an sich zu binden. Immerhin verhalfen sie dabei im Osten den Slawen zu den Anfängen strukturierter Staatlichkeit und begründeten im Westen die erfolgreiche Dynastie der Nord-Mannen.
„Kurtz" schnauft und blickt wieder auf seine Uhr, wischt zum x-ten Male über sein iPad, bis ihm dieses schließlich zu Willen ist und das Porträt eines Mannes Mitte zwanzig zeigt, dessen selbstzufriedene Mine unter der Matte strohblonden Haars einen durchaus ambivalenten Eindruck hinterlässt.
„Hi Olaf, wie geht's?" fragt „Kurtz", als skype er mit dem semmelblonden, blauäugigen und sommersprossigen Wikinger, der dem gängigen Klischee des skandinavischen Beaus so radikal entspricht, dass man ihn schon wieder für eine Parodie seines Typus' halten könnte.
„Kurtz" legt das iPad mit dem Foto nach oben neben sich auf den Beifahrersitz und wirft immer mal wieder einen hastigen Blick darauf, so als wolle oder müsse er sich die Züge des jungen Mannes genauestens einprägen. Wenige, hierfür besonders begabte Leute können sich selbst noch ein nur im Vorübergehen flüchtig wahrgenommene Gesicht eines Mitmenschen dauerhaft merken und mit größerer Zuverlässigkeit wiedererkennen, als jede einschlägige Software, die schon an einer das Gesicht teilweise verdeckenden Schirmmütze kläglich scheitert. „Kurtz" gehört offenbar nicht zu dieser Spezies.
Im nächsten Augenblick tritt er so hart in die Eisen, dass der Cherokee mit kreischenden Bremsen und qualmenden Reifen zum Stehen kommt. In einer Talsenke direkt vor ihm scheint sich seine Zielortschaft wohlig in der Nachmittagssonne zu aalen. Das ist sie, die typische Ortschaft am Ende des Fjords, angesichts von deren nichtssagendem Charakter die Frage erlaubt sein muss, warum man sich der Mühe, der Straße bis hierher zu folgen, überhaupt unterzogen hat. „Kurtz" jedenfalls dürfte sein Ziel etwas früher erreicht haben, als zu befürchten war. Er manövriert seinen Cherokee auf einen Wohnmobil-Stellplatz auf der Anhöhe. Dort platziert er ihn so, dass er sich zwischen zwei offensichtlich verwaisten Wohnwagen neugierigen Blicken entzieht, seinerseits aber dem Fahrer die Möglichkeit bietet, den größten Teil des Ortes zu überschauen und sofort wieder abfahrbereit zu sein, ohne erst ein Wendemanöver einleiten zu müssen. Offenbar möchte „Kurtz" die Szenerie auf sich wirken lassen, bevor er selbst ein Teil von ihr wird.
Jenseits der Straße schwappt das schmutzig grüne Wasser dieses am weitesten ins Land ragenden Fjordarmes über ein Stück grauen, steinigen Ufers. Die größeren Felsbrocken dieser Endmoräne sind von schleimigem grünlichem Tang überzogen. So weit von der offenen See entfernt, verliert die Tide jede Kraft und macht sich gleichsam nur noch der Form halber bemerkbar.
Die vor ihm liegende Ortschaft namens Svartdalen ist offensichtlich keine organisch gewachsene, traditionsreiche Gemeinde mit Holzhäusern wie jenen, die an klinkerbeplankte Langboote erinnern. Das hier ist auch nicht Bryggen mit seinen Magazinen und Werkstätten, in denen Leder zu festen Bergschuhen verarbeitet, Eisen geschmiedet oder Stuhlbeine und Bettpfosten gedrechselt wurden. Eher schon ein, alpenländischen Vorbildern abgekupfertes Disneyland mit kitschigen Souvenirläden, billigen Burger-Schuppen, Allerwelts-Restaurants und grotesk aufgeplusterten Hotels. Irgendwie hat „Kurtz" bei dem Anblick das Gefühl, die ganze falsche Pracht werde wahrscheinlich Punkt neunzehn Uhr von einem fliegenden Bautrupp abgerissen und ans Ende des nächsten Fjordarms weitergereicht werden.
Besondere Eile scheint „Kurtz" nicht zu haben. Wieder greift er ins Handschuhfach und fördert diesmal ein kleines Fernglas zutage, mit dem er aufmerksam die Schar der Touristen mustert, die gerade wie ein Trupp ältlicher Gebirgsjäger in Wanderkleidung mit Rucksack, Regenschutz und Skistöcken durch die Hauptstraße trecken. Als er sich sattgesehen hat, legt er das Fernglas wieder zurück, verstaut auch das iPad im Handschuhfach und sieht auf seine Uhr.
Der vereinbarte Zeitpunkt seines Rendezvous scheint gekommen. Er steigt aus dem Cherokee, streckt und reckt sich und verschließt die satt einrastende Tür im Weggehen mit einem Druck auf seine Fernbedienung. Dann zieht er seine halblange Lederjacke aus, unter der ein roter Jersey-Pullover mit Rollkragen zum Vorschein kommt. Er prüft mit einem Blick in die Runde, ob und wie lange er den Longitude hier unbeanstandet stehenlassen kann. Nichts deutet auf irgendwelche knappen Befristungen. Der Ort lebt von Bussen und Schiffen. Mit dem eigenen Wagen verirren sich nur wenige Touristen hierher. Halblaut vor sich hin summend spaziert er, die Lederjacke leger über die Schulter geworfen und auf dem rechten Bein leicht hinkend in die Ortschaft. Da und dort stoppt er, um die Auslagen dieses oder jenes Geschäfts zu betrachten. Dann betritt er die Terrasse eines Cafés und sieht sich nach einem freien Platz um.
Er hat Glück. Ein Pärchen, das sich schon seit einiger Zeit an seinem Tisch direkt neben der Tür vor leeren Tassen langweilt, steht auf und verlässt die Terrasse. „Kurtz" nimmt rasch den Tisch in Besitz und bestellt einen schwarzen Kaffee. Seinen Stuhl dreht er ein wenig, so dass er die Straße und den Eingang des genau gegenüberliegenden Hotels im Auge behält, ohne selbst als neugieriger Gaffer aufzufallen.
Kaum hat die blutjunge Aushilfskellnerin die Tasse Kaffee mit obligatorischem „Fußbad" vor ihm auf dem Tisch abgestellt, als ein Reisebus am Hotel zum Stehen kommt und seine rund zwei Dutzend zumeist älteren, sichtlich von Rheuma, Gicht und allerlei orthopädischen Malaisen geplagten Fahrgäste aussteigen lässt.
„Sieht so aus, als würde man bei Ihnen schneller altern," sagt er zu der Bedienung, die zeigt, dass auch sie nicht auf den Mund gefallen ist.
„Ja, da könnten Sie recht haben. Heute Morgen beim Einsteigen waren die alle taufrisch und um die dreißig. Deshalb: Vorsicht, unbedingt diesseits der Baumgrenze bleiben."
„Kurtz" lacht. Er wirkt entspannt, obwohl ihm für die Dauer dieser zeitraubenden Operation der Blick auf den Hoteleingang versperrt ist. Trotzdem entgeht ihm nicht, dass, noch bevor auch der letzte Wandergreis den Bus verlassen hat, ein strohblonder jüngerer Mann mit Schwung hinter dem Bus hervorspringt und zügig in Richtung des entgegengesetzten Ortsausgangs geht. Kein Zweifel, es handelt sich um das sommersprossige Exemplar vom iPad, vielleicht das eine oder andere Jahr älter als auf dem Foto, aber unverkennbar Olaf, der Semmelblonde.
Für die augenblicklichen Temperaturen vielleicht etwas zu sommerlich allein mit einem weißen Baumwollhemd und hellblauen Jeans sowie nagelneuen bunten Sneakers bekleidet, wird er in diesem Aufzug und zu dieser vergleichsweise späten Stunde schwerlich auf Wandertour gehen wollen. Vermutlich sucht er nur die relative Einsamkeit einer Bank im lichten Nadelgehölz, dessen erste verkrüppelte Kiefern den Ortsausgang zieren. Kein schlechter Ort für ein Rendezvous jedenfalls, so viel steht fest. In seiner Rechten hält Olaf eine leinene Einkaufstasche an ihren langen Henkeln, so dass die Tasche im Takt mit seinem festen Schritt hin und her baumelt.
„Kurtz" gibt sich dem Mann nicht zu erkennen, sondern lässt ihn passieren, verfolgt Olaf aber mit aufmerksamem Blick, bis dieser die letzten Häuser der Ortschaft erreicht hat. Dann legt er einen Zehn-Kronenschein unter seine inzwischen leere Tasse, nimmt seine über die Lehne gehängte Lederjacke wieder auf und schlendert ebenfalls in Richtung auf das Gehölz, in dem Olaf inzwischen verschwunden ist.
Lange muss „Kurtz" nicht suchen, bis er Olaf wieder auf dem Radar hat. Er ist ein ganzes Stück vom Weg abgewichen und hat sich am Rande des Fjords auf einen eben noch von der Sonne beschienenen warmen Felsbrocken gesetzt. Ein bemooster Hügel schirmt ihn vom ohnehin mäßigen Durchgangsverkehr der Straße ab, versperrt ihm aber auch die Sicht auf jeden, der sich ihm aus dieser Richtung nähert. Seine von den Sneakers befreiten nackten Füße lässt er im Wasser baumeln, während er wie geistesabwesend in einer Art Kladde blättert, deren halb zerfledderte Seiten erkennen lassen, dass das Heft schon längere Zeit mit ihm durch dick und dünn geht. Vieles spricht dafür, dass er hier bereits andere Nachmittage verbracht und sich möglicherweise mit anderen Partnern getroffen hat. Smultronstället, so nennen die benachbarten Schweden das – ein privater kleiner Rückzugsraum, ein winziges Fleckchen Erde, das uns nach dem Sündenfall vom Garten Eden geblieben ist.
„Kurtz" verlässt nun leicht hinkend ebenfalls den Weg, sieht aufmerksam nach links und rechts und pirscht durch das Unterholz auf den bemoosten Hügel zu. Offenbar will er Olaf überraschen. Vielleicht erwartet der ihn ja auch gar nicht, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. So geschickt „Kurtz" sich trotz seiner Behinderung durch das Gehölz windet, könnte er selbst einen aufmerksamen Jäger oder erfahrenen Waldläufer täuschen. Olaf ist ohnehin in seine Lektüre vertieft, beißt ab und zu in den Apfel, den er aus seiner Tasche geklaubt hat und hört vermutlich nur das Plätschern der sich kräuselnden Wellen vor ihm und das gelegentliche Rauschen vorüberfahrender Autos weiter hinten.
Als „Kurtz" für seine Zwecke offenbar nahe genug herangekommen ist, greift er hinter seinem Rücken unter den Pullover in den Hosengürtel und zieht eine kurzläufige Pistole hervor, die in seiner Faust fast verschwindet. Die Waffe in der Linken, macht er einen Ladegriff mit der Rechten. Das schleifende Schaben von Metall auf Metall und das schnappende Zurückschnellen des Schlittens schrecken Olaf auf. Er lässt seine Kladde sinken und wendet sich nervös um. „Kurtz" steht nur wenige Schritte hinter ihm, die Pistole im Anschlag.
„Olaf Bergström?"
Olaf antwortet nicht, lässt seine Kladde fallen, springt vom Felsblock und macht Anstalten, loszulaufen und das Gehölz zu erreichen. Aber das ist nach Lage der Dinge ein aussichtsloses Unterfangen. Mit einem raschen Schwenk seiner Rechten folgt „Kurtz" der Bewegung seines Opfers und feuert ein einziges Projektil, das Olaf an der linken Schläfe trifft und ihn ein, zwei Meter nach rechts schleudert wo er zusammenbricht und reglos liegen bleibt. Blut quillt aus seinem semmelblonden Haarschopf, als wachse Klatschmohn aus einem sommerlichen Rapsfeld.
„Kurtz" muss sich seiner Sache sehr sicher sein. Er hat keinen Schalldämpfer benutzt, doch das relativ kleine Kaliber seiner Waffe verursacht auch keinen sehr lauten Knall. Und sollte wirklich jemand dessen Echo gehört haben, sorgt die Fülle von Jägern, die hier zu allen Tages- und Nachtzeiten auf Elchpirsch gehen, für eine scheinbar offenkundige Erklärung.
„Kurtz" steckt seine Pistole wieder in den Gürtel, ohne zu überprüfen, ob Olaf wirklich tot ist. Kopfschüttelnd hebt er dessen Kladde aus dem Wasser, wirft einen kurzen Blick darauf und legt sie neben die Leiche, so als wolle er sicherstellen, dass Olaf bei seiner Reise in den Hades nicht auf vertraute Lektüre verzichten muss. Ohne sich weiter um Spurenbeseitigung zu bemühen, geht „Kurtz" gemessenen Schrittes zur Straße zurück und schlendert leicht hinkend und leise summend in Richtung Svartdalen.
3. Inseln im Strom
Der Mann im Cockpit seiner offensichtlich schon betagten kleinen Westerly mit den patriotischen blau-weiß-roten Streifen um den von der Sonne gegilbten GFK-Rumpf gibt das Steuerrad kurz frei und trinkt einen Schluck heißen Tee aus der zu seinen Füßen stehenden Thermosflasche. Die Yacht kommt aus Richtung St. Peter Port, dem Haupthafen der Kanalinsel Guernsey, von dem aus sie vermutlich vor etwas mehr als einer Stunde gestartet ist.
Das genau östlich des Hafens beginnende Fahrwasser gilt wegen der unleidlichen Strömungen und zahlreicher lauernder Granitfelsen als „schwierig". Doch entweder kennt der Mann sich hier bestens aus oder er vertraut blindlings seinem Glück. Für die erstere Hypothese spricht, dass er genau den richtigen Zeitpunkt für seinen Törn gewählt hat und vom dubiosen Karma dieser Gegend nicht sonderlich beeindruckt scheint.
Mit der untergehenden Sonne im Rücken profitiert er von deren warmen, weichen, fast horizontal einfallenden Strahlen, ohne von irrlichternden Reflexen auf der unruhigen Wasseroberfläche geblendet zu werden. Und optimale Sichtverhältnisse sind unverzichtbar, wenn man, wie dieser Skipper, ehrgeizig genug ist, das Nadelöhr zwischen der kleinen Insel Jethou und der noch viel kleineren Crevichon passieren zu wollen. Gute Sicht und eine zuverlässige Gezeitentafel auf dem jüngsten Stand. Die weist für den heutigen Tag aus, dass die Westerly sich bei auflaufendem Wasser momentan genau in der Mitte der Tidenphase befindet.
Zeit und Gezeit, sagt der Volksmund, warten auf keinen Sterblichen. Ein ehrlicher Blick in den Spiegel lehrt uns, dass er mit dem ersten Teil dieser Sentenz schon mal nicht so falsch liegt. Wer sich vom Wahrheitsgehalt des zweiten Teils überzeugen zu müssen glaubt, findet hier, in der weitläufigen Bucht von St. Malo, die sich in Nord-Süd-Richtung von der Pickelhaube des Mont St. Michel bis zum Cap de la Hague erstreckt, die allerbesten Voraussetzungen für interessante bis beängstigende Beobachtungen.
Geschuldet ist dies vor allem den topographischen Gegebenheiten dieser Nahtstelle zwischen Normandie und Bretagne im wilden Westen Europas. Jedes Mal, wenn die Flut gewaltige Wassermassen aus der Biscaya in diese wannenartige Bucht einströmen lässt, prallen sie unvermittelt auf die natürliche Barriere der langgezogenen, weit nach Norden ragenden Cotentin-Halbinsel und stauen sich dort erst einmal auf. Der daraus resultierende mittlere Tidenhub, definiert als arithmetisches Mittel der verzeichneten Unterschiede zwischen täglichen Hoch- und Niedrigwasserständen, erreicht Spitzen von rund zwölf Metern.
Für das halbe Dutzend bewohnter und die vielfache Anzahl unbewohnter Eilande, Inselchen und Mini-Archipele, die sich unregelmäßig über die Bucht verteilen wie von einem verkaterten Bauer blind ausgestreutes Saatgut birgt das nicht nur Vorteile.
Die unvorstellbar riesigen Mengen rüde ausgebremsten Atlantikwassers gurgeln, klatschen und rumoren vor Ungeduld, denn schließlich stehen ihnen für den weiteren langen Weg nach Nordosten nur lächerliche sechs Stunden zur Verfügung. Und ein beträchtlicher Teil dieses unablässig dem Erdtrabanten hinterherhechelnden Schwalls muss sich auch noch durch den engen Schlauch pressen, der bei uns nicht grundlos Ärmelkanal heißt.
So kann es nicht erstaunen, dass in der Bucht von St. Malo regelmäßig nicht nur beeindruckende Tidenhübe, sondern auch machtvolle Tidenströme registriert werden, die an Stromschnellen oder reißende Gebirgsbäche erinnern. Wie diese beeindrucken sie nicht nur durch ihre reine Geschwindigkeit, sondern auch durch allerlei Nebenwirkungen wie Neerströme, Strudel und tiefe „Löcher". In einigen Schluchten des Meeresbodens wird der ohnehin flott dahinrauschende Strom noch einmal zusätzlich auf zehn, elf Seemeilen pro Stunde und mehr beschleunigt. Setzt dann ein der Strömung entgegenwirkender Starkwind ein, kocht die Bucht.
Haben schon Fähren und Motorschiffe mit derlei widrigen Umständen ihre liebe Mühe und Not, sind relativ schwach motorisierte Segelyachten wie die Westerly erst recht darauf angewiesen, eine für sie günstige Konstellation abzuwarten und sich mit kürzeren Törns zufriedenzugeben – solchen, die auf den Schwingen eines einzigen mitlaufenden Tidenstroms zu bewältigen sind. Besonders kritische Passagen werden dabei von Kennern vorzugsweise während jener Phasen in Angriff genommen, die der Einheimische als mittlere Tide kennt und schätzt.
Etwa drei Stunden nach ihrem jeweiligen, praktisch übergangslosen Kentern kommt die Tide selbst in diesem ewig rumorenden Kessel einen Moment zur Ruhe, so als überlege der Atlantik kurz, ob er sich dieses unsägliche Theater ein weiteres Mal zumuten soll. Das ist der Augenblick, in dem die Gefahr der Stromversetzung am geringsten ist und der Skipper seine vor- und achterlichen Deckpeilungen überprüfen kann. Solch grobe Peilungen ergänzen in der Bucht von St. Malo bis heute Kompass, GPS und andere elektronische Hilfsmittel.
„Hoher rot-weiß gestreifter Schornstein nördlich von St. Peter Port in Deckung mit schwarz-weiß karierter Bake auf Höhe südlichem Kap von Sark" ist zum Beispiel die Deckpeilung, mit deren Hilfe die ältliche Westerly beim augenblicklichen Tidenstand die Enge zwischen der Jethou und der Crevichon sicher passieren kann, die bei Niedrigwasser trockenen Fußes zu durchqueren ist.
Dass in unruhigen Gewässern und auf Inseln mit gemischter Vergangenheit wie diesen, böse Geister gern ihr Unwesen treiben, liegt auf der Hand. Schließlich sind Jersey, Guernsey, Alderney, Sark oder Herrn alte Piratennester, die, günstig an einer der am stärksten frequentierten Handelsschifffahrtsrouten gelegen, im Verein mit befestigten, schwer einnehmbaren Häfen des benachbarten französischen Festlandes ehemals ein nordeuropäisches Pendant zur berüchtigten barbaresken Küste Nordafrikas bildeten.
Irgendwann schlug das Pendel um und man begann, Piraten, Freibeuter und Kaperer, an deren Ausbeute man nicht schlecht mitverdiente, dann doch als lästig und dem freien Handel hinderlich zu empfinden. Um Nachahmer ebenso wie heimliche Sympathisanten abzuschrecken, geschah ihre Verfolgung und Entsorgung möglichst spektakulär. Auf der steil aus dem Wasser ragenden Anhöhe von Jethou an Steuerbord zum Beispiel ragten bis vor nicht allzu langer Zeit einige grob zusammengezimmerte Galgen in die Höhe, an denen die langsam verwesenden Leichen von hingerichteten Piraten im Wind baumelten. Das entbehrte insofern nicht der vermutlich beabsichtigten Ironie, als viele der so hingerichteten Freibeuter zu ihren Lebzeiten die gemachte Beute vorzugsweise in einer der Höhlen auf eben jener Insel Jethou zu horten pflegten und sie dergestalt zur Schatzinsel machten.
Crevichon an Backbord muss, seinem Namen nach zu urteilen, irgendwann für seine Schalentiere berühmt gewesen sein. Das war vermutlich lange, bevor man das Inselchen in einen Steinbruch verwandelte und Schicht um Schicht abtrug, bis kaum noch etwas von ihr übrig war. So viel lärmendes Gehämmer hält kein Schalentier aus. Granit, wie er hier oder auf anderen Kanalinseln gewonnen wurde, diente in ganz Europa als wertvoller, weil praktisch unzerstörbarer Baustoff, sei es für die Stufen von Westminster Abbey oder die Kantsteine in den Straßen Berlins und anderer deutscher Städte.
Die Westerly passiert noch eine Bake in Form eines groben Steinhaufens, den man auf einem gerade noch aus dem Wasser lugenden Felsen aufgeschichtet und mit einem schlichten Kreuz versehen hat – nicht zum Gedenken an den Unbekannten Matrosen, sondern zur eindeutigen Identifizierung. Wenig später dreht die Yacht in den Wind und gleitet, nur mehr vom eigenen Trägheitsmoment angetrieben, in eine schmale Spalte tieferen Wassers, die auch bei extremem Springniedrigwasser noch genügend Wassertiefe aufweist, um als Reede der kleine Insel Herrn zu taugen. Deren südwestlicher Strand erstreckt sich in geringem Abstand davon.
Der Skipper wirft die Genuaschot los, verlässt das Cockpit und geht zum Mast, wo er mit einem schnellen Griff ein stramm durchgesetztes Fall löst und das Großsegel an Mastrutschern in einen Lazy Bag gleiten lässt. Dann schreitet er, das rechte Bein fast unmerklich nachziehend und ohne jede erkennbare Hast weiter zum Bug, befreit den Anker von seiner Halterung und lässt ihn ins Wasser plumpsen. Während die Ankerkette der langsam achteraus treibenden Westerly laut rasselnd über die Lippe rauscht und dem Anker in die Tiefe von knapp sechs Metern folgt, birgt der Mann auch die Genua und zurrt sie mit einigen Gordings an Bugkorb und Reling fest.
Das Manöver hat nur wenige Minuten gedauert und erwiesen, dass der Mann sich auf die Bedienung seiner Yacht bestens versteht. . Nun setzt er sich ins Cockpit, zündet sich eine Zigarette an und wartet, bis er sicher sein kann, dass sein Anker sich eingegraben oder so verkeilt hat, dass er vorerst an Ort und Stelle bleiben wird. Er weiß offensichtlich: nicht der Anker hält ein Fahrzeug, sondern das Gewicht seiner meterlangen durchhängenden Kette oder Trosse, die ihrerseits vom Anker nur fixiert wird.
Wenig später schnippt er die Zigarettenkippe über Bord und verschwindet unter Deck. Die Tide ist inzwischen wieder sehr lebhaft geworden. Der Wasserpegel steigt seinem heutigen Höhepunkt entgegen, während drüben im Westen die sinkende Sonne die Kulisse von St. Peter Port in einen bizarren Schattenriss verwandelt.
Zwar nimmt die Dämmerung in diesen Breiten einen gemächlicheren Verlauf als in den Tropen, aber rabenschwarz wird die Neumondnacht auch hier irgendwann. Eine dichte Decke schwerfällig dahintreibender Wolken lässt nur da und dort vereinzelte, besonders erdnahe Himmelskörper durchscheinen. Der Mann hat auf der Westerly keine Lichter gesetzt. Schon bei Tage verirrt sich nur selten eine Yacht in diese scheidenartige Ankerbucht und die letzte Katamaran-Fähre von heute ist längst durch. Außerdem benutzt die normalerweise nicht die Reede, sondern den winzigen Hafen von Herrn. In dem man bei Niedrigwasser Rumpf und Kiel seiner Yacht von Seepocken befreien oder mit einer neuen Schicht Antifouling versehen, immer vorausgesetzt, man hat ein paar der hier sehr verbreiteten „Stelzen", die das trockenfallende Boot lotrecht halten. Nachteil: wann die Yacht den Hafen wieder verlässt, bestimmt nicht der ungeduldige Skipper, sondern die gleichförmige Tide.
Für derlei Wartungsarbeiten scheint die Westerly nicht hierhergekommen. Das schabende Geräusch des hölzernen Lukendeckels am Niedergang kündigt die Rückkehr des Mannes ins Cockpit an. Er hat sich in einen schwarzen Neoprenanzug gezwängt und das Gesicht geschwärzt, was ihn in der Dunkelheit so gut wie unsichtbar macht. In der Rechten trägt er einen wasserdichten, schwimmfähigen Rucksack. Einen Augenblick lang sieht er sich nach allen Seiten um. Die blitzenden und blinkenden Leuchtfeuer auf Guemsey, Sark und Jethou sind ihm augenscheinlich vertraute Erscheinungen. Bisweilen überlagern sich ihre Blinkphasen, dann streben sie schleunigst wieder auseinander wie Fremde in der Nacht, die einander kurz in die Augen blicken, ob was geht, um dann rasch wieder ihrer Wege zu gehen.
Auf Herrn zeugen nur die beleuchteten Fenster von Rosaire und Fisherman's Cottage davon, dass sich auf dem Inselchen zurzeit überhaupt jemand aufhält. Der Mann steigt über seine Badeleiter am Heck ins wahrscheinlich zu dieser Jahreszeit noch hodenstraffend kalte Wasser. Nach Tauchen oder Fischen scheint ihm nicht der Sinn zu stehen. Mit ruhigen, gleichmäßigen Zügen überbrückt er die wenigen Meter zum Strand. Als er drüben aus dem Wasser steigt, glänzt sein nasser Neoporenanzug silbrig schwarz wie die scheinbar glatte Haut eines Hais, der sich, unbeobachtet von ahnungslosen Meeresbiologen, zu einem seiner seltenen Streifzüge an Land begeben hat. Flossen sind dabei nur hinderlich. Er bückt sich und tauscht sie gegen leichte Schuhe, die er seinem Rucksack entnimmt. Dann schiebt er die Flossen unter das karge Buschwerk am Ufer und macht sich querfeldein auf den Weg.
Im Schutze der Dunkelheit geht er gebückt und das rechte Bein nachziehend wie ein Sportler, der sich beim Start einen Wadenmuskel gezerrt hat, über die Wiesen der fast baumlosen Insel auf ein Herrenhaus zu. Dabei hält er immer wieder mal wieder inne, lugt nach links und rechts und geht erst weiter, wenn er sich vergewissert hat, dass niemand in der Nähe ist. Irgendwo schlägt ein größerer Hund an. Fahrzeuge gibt es eh keine auf Herrn und die Insel umrundende nächtliche Reiter würden Gefahr laufen, ihr in ein Kaninchenloch tappendes Pferd durch Beinbruch zu verlieren. Allein einige nimmermüde Fledermäuse schwirren lautlos wie Schwalben der Nacht durch die feuchte, nach Tang und gemähtem Gras riechende und nach Salz schmeckende Luft.
Am Rosy Manor geheißenen Herrenhaus angekommen, dessen von der Dunkelheit gnädig verhüllter pinker Anstrich dem Namen nur bei Tage alle Ehre macht, atmet der am Boden kauernde Mann einige Male tief durch und nimmt den Rucksack ab. Dass er dem Rosy Manor keinen reinen Höflichkeitsbesuch abstatten möchte, wird spätestens jetzt klar, da er eine Pistole aus dem Rucksack zieht und überprüft. Er lässt das Magazin herausrutschen, checkt es auf Vollständigkeit, drückt es mit der flachen Hand bis zum Einschnappen zurück und schiebt mit entschlossenem Ladegriff eine Patrone in die Kammer.
Er bedient sich nicht des schweren bronzenen Türklopfers, um Einlass zu begehren, sondern trennt mit einem ebenfalls im Rucksack mitgeführten Glasschneider vorsichtig eine von sechs konvexen kleinen Butzenscheiben heraus, aus denen sich alle Fenster im Parterre des Hauses zusammensetzen. Dann greift er mit schlankem Arm nach innen und öffnet geräuschlos das Fenster. Er lässt den Rucksack draußen liegen und schwingt sich über das Sims. Sein lahmes rechtes Bein scheint ihn dabei nicht wesentlich zu behindern.
Das dunkle Zimmer, zu dem er sich auf diese Weise Zugang verschafft hat, entpuppt sich als die reich ausgestattete Bibliothek des Hauses, deren Folianten nach Leder und Altpapier riechen. Im Dunklen tastet sich der Mann an einem der staubigen Bücherregale entlang, das die Wand über deren ganze Breite ausfüllt. Der Eindringling benutzt keine Lampe, deren unruhiger Lichtkegel ihn verraten könnte. Dass ein neugieriger Nachbar das Haus zu diesem Zeitpunkt beobachtet, ist zwar schon deshalb unwahrscheinlich, weil es in einem größeren Umkreis um das einsam gelegene Manor keine Nachbarn gibt. Doch auf der Nachbarinsel Sark, die als Paradies für Amateurastronomen gilt, weil man auf ihr Streulichtquellen weitgehend verbannt hat, besitzt so mancher Bewohner ein potentes Fernglas oder modernes Teleskop, das nicht immer nur auf den Sternenhimmel gerichtet sein dürfte.
Als der Mann leise die Tür der Bibliothek öffnet, hört er aus dem ersten Stock laute Stimmen und gelegentliches schrilles, exaltiertes Gelächter. Ohne Eile schleicht er zum Treppenabsatz