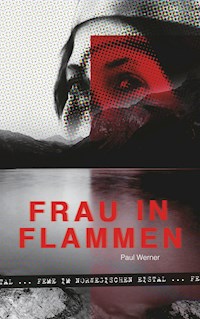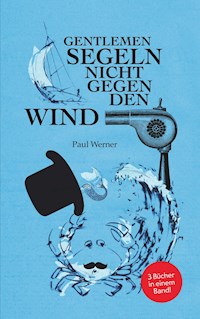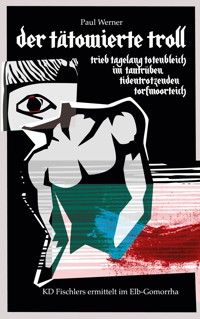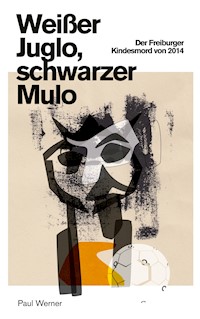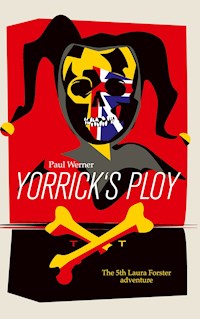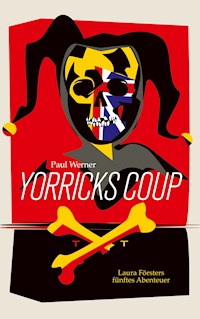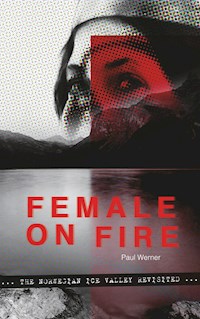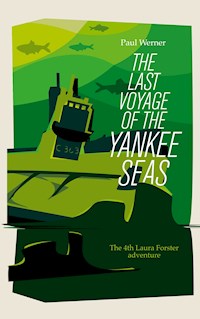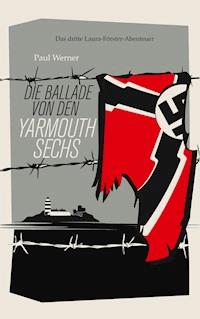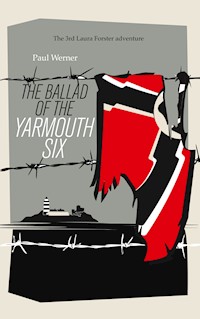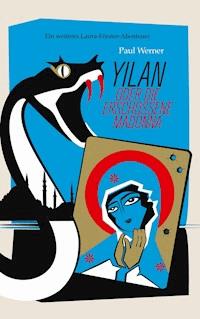Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Dolmetscher der See" ist die selbstironische Schilderung des bewegten Lebens eines Autors, der als Seemann, Laienschauspieler, Lehrer, Dolmetscher und Schriftsteller unterwegs war und ist, dabei dann und wann falsch abgebogen ist, dafür aber auch in sehr viel mehr Lebens- und Tätigkeitsbereiche Einblick erhielt, als es den meisten von uns vergönnt sein dürfte. Zugleich hält das Buch der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts mit, als Höhepunkt, dem Mauerfall und Zusammenbruch des Ostblocks, den Spiegel vor und schießt "Nahaufnahmen" von den weniger spektakulären Seiten der Arbeit für eine internationale polyglotte Organisation wie der EU. Über allem steht als Leitmotiv die Liebe zur See, den Ozeanen dieser Welt, deren Stimme der Autor nach rund 50.000 Seemeilen auf Schiffen wie der Gorch Fock und Deutschland sowie Yachten wie der Halberg-Rassy 36 Solskin verstehen gelernt zu haben glaubt. Ein "rogue´s progress" in moderner und äußerst unterhaltsamer Form.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 981
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL: MITTWOCHSKIND IST FARBENBLIND
1. Die Frau in Rot.
2. Über die Wupper.
3. Die Seifenkiste.
4. Der tote Fluss.
5. Wenn der Eismann kommt.
6. Eine runde Sache.
7. Ilse Willse …
8. Die Stunde Null.
9. Das ewige Prekariat.
10. Tranmontana.
11. Schuld und Sühne.
12. Pi mal Daumen.
13. Rue St. Denis 69.
ZWEITER TEIL: ERSTES GEBOT: SEEFAHRT IST NOT
1. Der Laubfrosch.
2. Wer hat Bock auf die Gorch Fock?
3. Von Offizieren und Gentlemen.
4. Am Grab der Piloten.
5. Das Pack von der Back.
6. Die Hinrichtung.
7. Der Süden und sein Kreuz.
8. Am Kap der Öfen.
9. Die Schlangenschlucht.
10. Blick über die Reling.
11. Die Kapitulation.
DRITTER TEIL: MIT ˋNEM HUNNI AUF DIE UNI
1. Laute Schieber.
2. Das Testament.
3. Nennen Sie mich Ishmael.
4. Und Bobby singt den Blues.
5. Willkommen in Dystopia.
6. Das Trio infernale.
7. Chucky, der Genfer Gnom.
VIERTER TEIL: IMMERFORT DAS GESPROCHˋNE WORT
1. Die Höhle des Löwen.
2. Laufmaschen.
3. Nächste Ausfahrt Kensington.
4. Das normannische Loch.
5. Der grüne Bungalow.
6. Prometheus, entfesselt.
7. Alles was Recht ist.
8. Kompetenz-Kompetenz?
9. Die sieben Schwestern.
10. Eine Margarita für den Meister.
11. Begegnung im Turm.
12. In den Gärten des Sultans.
13. Dem Herrn hat’s gemundet.
14. Drachenblut schmeckt nicht gut.
FÜNFTER TEIL: IN LUV UND LEE NUR GRÜNE SEE
1. Den Kosmos am Faden.
2. Die Pyramide.
3. Gezeitenleere.
4. Next Stop: Murmansk.
5. Die Narreninsel.
6. Der rote Fleck.
7. Die kleine Träne.
Als es Nacht wurde, schwappten die im Mondlicht gleißenden Wellen hin und her und der Wind trug die Stimme der mächtigen See zu den Männern an Land und es war ihnen, als verstünden sie sie.
(Stephen Crane, The Open Boat, m.Ü.)
ERSTER TEIL: MITTWOCHSKIND IST FARBENBLIND
1. Die Frau in Rot.
Die kleine, magere, dunkelhaarige, hochschwangere Frau im roten Kleid setzte ihr Köfferchen vorsichtig auf dem Kopfsteinpflaster ab und sah sich so verloren um, als hätte man sie auf dem Mars zurückgelassen. Ende Mai 1945 war die idyllische, sich wohlig in eine hufeisenförmige Biegung des Flüsschens Nagold schmiegende Ortschaft Altensteig so erstaunlich gut erhalten, dass man annehmen konnte, der eben erst zu Ende gegangene Weltkrieg habe einen ebenso großen Bogen um sie geschlagen wie der Fluss. Wiewohl das dörfliche Leben und Treiben zurzeit den Atem anzuhalten schien.
Die kastanienbraune Farbe des kleinen zerbeulten und abgewetzten Köfferchens, in dem die schwangere Frau wohl die letzten, ihr noch verbliebenen kümmerlichen Habseligkeiten trug, war unter einer dünnen Schicht Staub und Schmutz gerade noch zu ahnen. Welcher Wind dieses Kind der Großstadt, als das sie auch ohne Make-up, gepflegte Frisur und elegante Kleidung unschwer zu erkennen war, in diesen abgelegenen Teil des Nordschwarzwaldes geweht hatte, ließ sich nur mutmaßen. So oder so dürfte sich der lange, mühevolle Weg, den sie bis hierher zurückgelegt haben musste, unter dem Strich gelohnt haben, hätte sie es in ihrem Zustand doch noch sehr viel schlechter antreffen können.
Hitler und einige seiner treuesten Komplizen hatten sich nur Wochen zuvor feige aus der Verantwortung gestohlen, indem sie sich die Kugel gegeben oder auf Zyankalikapseln gebissen hatten. Weitere Paladine des Führers würden ihnen im Gefolge der Nürnberger und Rastatter Kriegsverbrecherprozesse sehr bald nach Helheim folgen. Wieder andere würden es auf der sogenannten Rattenlinie über die Schweiz und durch das geschundene Europa nach Südamerika schaffen und sich einstweilen wie angeschossene Tiere in den urbanen Regenwald verkriechen.
Was noch vom Herrenvolk übriggeblieben war, zog rastlos und ratlos durch ein trostloses, von alliierten Bombenteppichen auf seine Grundmauern und verschütteten Kellergeschosse reduziertes Land. So total wie der Krieg, so total die Zerstörung.
Das Gros der ihre turmhoch beladenen Wägelchen sinnlos kreuz und quer ziehenden Obdachlosen, Flüchtlinge und Vertriebenen bestand naturgemäß aus Frauen und Mädchen, Alten und Schwachen sowie viel zu früh alternden Kindern. Mindestens vier Millionen junger deutscher Männer waren an Ost- oder Westfront geblieben, weitere 12 Millionen in jahre-lange Gefangenschaft geraten. Der daraus resultierende Frauenüberschuss musste noch dem zerstreutesten Betrachter allerorten in die Augen fallen.
Wer in diesem universalen Elend überleben wollte, hatte dem Chaos der Zerstörung wenig mehr als den eigenen eisernen Willen entgegensetzen. Wer auf den aufgerissenen, von Bombentrichtern, verkohlten Trümmern und grotesk verbogenen Fahrzeugskeletten unwegsam gemachten und da und dort von Tierkadavern und Leichen gesäumten Straßen egal wohin vorankommen wollte, musste skrupellos und schamlos sich selbst der Nächste bleiben und dann und wann die letzten Reste seiner verkümmerten Menschlichkeit dem Selbsterhaltungstrieb opfern.
In einem Land, das als Mitglied der Staatengemeinschaft fürs erste von der Landkarte getilgt worden war und dessen jüngste Entwicklung in die Annalen der Geschichte aufzunehmen die Feder des Chronisten sich sträuben machte, suchte eine unbehauste Bevölkerung unter diesen Umständen oft vergeblich nach einer prekären Bleibe, nach etwas menschlicher Wärme und nach gerade noch genießbaren, meist verfaulten und verschimmelten Abfällen. Ein ob seines Verwesungsgrades bereits fluoreszierender Hering, über den man sein Stück steinharten Brotes streichen konnte, um so etwas wie Fischgeschmack zu generieren, kam da schon einem Leckerbissen gleich.
Der unablässige Bombenhagel mit seinem unheilvollen, den in Bun-kern Schutz Suchenden durch Mark und Bein fahrenden Pfeifen, seinen, die Trommelfelle sprengenden Detonationen und den alle Luft aus den Lungen pressenden Druckwellen schienen jederzeit wieder einsetzen zu können, um diesem bereits am Boden liegenden, hier und da aber immer noch zuckenden Volkskörper vollends den Garaus zu bereiten.
Während die einen, von unaufhaltsam vorrückenden sowjetischen Truppen wochenlang gnadenlos vor sich hergetrieben, aus den ehemals deutschen Ostgebieten gen Westen geflohen und dort vielfach auf Landsleute getroffen waren, die sie nur widerwillig duldeten und wie ein revierbewusstes Wolfsrudel die nomadisierenden Beutekonkurrenten auf ihrem Schleichweg durchs fremdes Territorium knurrend und zähnefletschend beäugten, zogen andere wie diese kleine schwangere Frau aus den von Ratten und menschlichem Ungeziefer verseuchten Großstädten, in denen die im Wortsinne totalitäre Gewaltherrschaft mit ihrem zügellosen Regelungswahn über Nacht absoluter Gesetzlosigkeit gewichen war, aufs Land, in die Pampa.
Kapitaldelikte waren in den ehemaligen Ballungsräumen an der Tagesordnung, zumal die Täter von einer sich berappelnden, unter Kuratel stehenden und noch schlecht organisierten, unbewaffneten Polizei wenig zu befürchten hatten. Raubmord führte paradoxerweise die inoffizielle Statistik an. Wo praktisch niemand mehr etwas besitzt, sind deshalb längst noch nicht Eigentumsdelikte ausgerottet. Vielmehr wird dann eben schon für Nichtigkeiten gemordet.
Süßes oder Saures: Kinder und Jugendliche rotteten sich zu marodierenden Banden zusammen und machten sich die Brutalität der Erwachsenen zu eigen. Mädchen lebten ihre Machtfantasien unter anderem dadurch aus, dass sie „Entnazifizierung“ spielten und dabei, gnadenlos, wie Kinder sind, vermutlich viel strenger vorgingen als die erwachsenen Besatzer.
Wem Leib und Leben lieb waren, suchte sein Heil hinkend und humpelnd in der Rückkehr ins verlassene Paradies, den zerschossenen und zerzausten Garten Eden, wo in einem halb zerfallenen Schuppen oder einer angekokelten Scheune noch ein Plätzchen im feuchten, faulig riechenden Stroh frei war und sich schon irgendetwas zu beißen finden würde – und seien es auch nur unreife, giftige, noch von klebrigem Dreck starrende und bei Verzehr grimmige Bauchschmerzen, Durchfall und Koliken verursachende Kartoffeln. Aber Vorsicht: solch Mühseligen und Beladenen drohten auf ihren erschöpfenden Gewaltmärschen allerorten tödliche Gefahren. Mutterseelenallein oder in dubioser Gesellschaft, mit dem letzten Hemd oder Kleid am Körper und durchweichtem und wie von selbst zerfallendem Schuhwerk an den Füßen menschenleere Gegenden zu durchstreifen, die plötzlich gleichsam zu Feindesland geworden waren, kam dem Verlassen der Deckung des hohen Grases in der Savanne gleich. Vor allem natürlich für das schwache Geschlecht.
Wenn in späteren zögerlichen Aufarbeitungen dieses dürftig dokumentierten „schwarzen Lochs“ der unmittelbaren Nachkriegsjahre von mehr oder minder systematischen Vergewaltigungen die Rede ging, assoziierte man damit sehr wahrscheinlich zu Recht fast automatisch Angehörige der Roten Armee als einschlägigen Täterkreis. Dessen ungeachtet, waren sexuelle Übergriffe auch in den Einflussbereichen der westlichen Alliierten durchaus nichts Unerhörtes. Die ideologische Schere im Kopf der Kalten Krieger sorgte dafür, dass diese besonders perfide Form der Machtausübung auch durch Amerikaner, Briten und Franzosen sehr viel weniger Beachtung und Erwähnung fand. Und wenn jemand so gar kein Interesse daran hatte, dergleichen Übergriffe an die große Glocke zu hängen, dann waren es die betroffenen Frauen und Mädchen, die damit leben mussten.
Kein Wunder, dass viele von ihnen, die sich auf den Weg ins Irgendwo gemacht hatten, nie dort ankamen. Noch Jahre nach der Kapitulation fand man verweste Frauenleichen und weibliche Skelette in den Wäldern um Berlin und anderenorts. Und selbst wenn sie es, wie jene schwangere brünette Frau von Altensteig, trotz aller Widrigkeiten tatsächlich schaffen, im halbwegs sicheren Irgendwo zu landen, wurden sie dort nicht unbedingt herzlich willkommen geheißen.
Das galt offenbar besonders für Deutsche jüdischen Glaubens, die, eben erst dem Horror der Konzentrationslager entronnen, nun auf der Suche nach dem eigenen verlorenen Dasein, der eigenen Identität und eventuell überlebenden Verwandten und Bekannten durch ein Land streiften, das sie für ihre Heimat gehalten hatten. Zwar trugen sie nicht mehr die weiße Armbinde oder den gelben Judenstern, waren aber jetzt, im Sommer, fast ebenso leicht an den KZ-Nummern zu erkennen, die man ihnen in die Arme gebrannt hatte.
Eine Jüdin, die sich offenbar trotz alledem ihren Mutterwitz bewahrt hatte, erklärte wissbegierigen Kindern, die sie nach der Bedeutung dieses Brandmals gefragt hatten, es handele sich um eine ihr besonders am Herzen liegende Telefonnummer …
Gerda, „genannt Gertie“
Meine Mutter Gerda, genannt Gertie, Fochem war keine Jüdin, sondern galt in der abstrusen Nomenklatur der Nazis wohl als zu 100 Prozent arische Kölnerin. Eine „kölsche Mo“, wie man sie sich vorstellt: lebenslustig, energisch, humorvoll, aber auch streitlustig und aufbrausend. Ihr Mädchenname ebenso wie ihre Physiognomie und ihr Temperament veranlassen mich zu der Vermutung, dass ihre und damit meine Vorfahren möglicherweise französischer Hugenotten waren, die irgendwann Ende des 17. / Anfang des 18. Jahrhunderts auf der Mosel Richtung Deutschland getrieben, bei Koblenz scharf links abgebogen und beim Schmelztiegel Köln, damals wohl noch ein lärmendes, stinkendes Drecknest, ans Rheinufer gehüpft waren. Niemand beschreibt dessen Werdegang über die Jahrhunderte so beredt wie Carl Zuckmayer in seinem „General des Teufels“, dessen wunderbarer und für jeden Theaterschauspieler durchaus anspruchsvoller Monolog anschaulicher und konziser als jede wissenschaftliche Abhandlung zum Ausdruck bringt, was Köln zu dem machte, was es ist.
Köln, bereits 1942 Ziel eines der fürchterlichen sogenannten „Tau-send-Bomber Angriffe“ der Royal Air Force, gehörte bekanntlich zu den am stärksten von alliierten Luftflotten heimgesuchten deutschen Städten und glich, bei Tage etwa aus dem Cockpit einer amerikanischen B-25 Mitchell betrachtet, wohl einem riesigen verwüsteten Friedhof, aus dem nur die beiden Türme des Doms wie ein ironisches „Victory“-Zeichen herausragten. Kein Ort für eine Schwangere, zumal sie das Heer der sogenannten Trümmerfrauen nicht wirksam hätte verstärken können. Sofern diese gern zitierten Heldinnen des Wiederaufbaus nicht ohnehin in die prall gefüllte Schatztruhe der Nachkriegs-Legenden gehören. Hätten wirklich nur die ganz ohne Zweifel aufopferungsvoll zupackenden Frauen ohne schweres Gerät und männliche Hilfe für die Beseitigung der materiellen Kriegsschäden sorgen müssen, dann hätten die Aufräumarbeiten vermutlich bis weit in die sechziger Jahre angedauert.
Zu allem Überfluss hatte sich meine Mutter von einem Mann schwängern lassen, der bereits verheiratet und derzeit in französischer Gefangenschaft vermutlich heilfroh und darüber war, dort nur der Neugier seiner Bewacher und nicht derjenigen seiner temperamentvollen Geliebten ausgesetzt zu sein.
Als Hauptfeldwebel oder „Spieß“ beim Bodenpersonal der Luftwaffe irgendwo im Kölner Umland stationiert, hatte er dort unter anderem wohl für die Fahrbereitschaft eines nicht durch sein Verschulden schnell schrumpfenden Fuhrparks zu sorgen gehabt und vermutlich mehr miefige Kasernenstuben als muffige Flugzeugrümpfe von innen zu sehen bekommen.
Meine Mutter war auf demselben Stützpunkt eines jener „Fräuleins vom Amt“ gewesen, die gegen Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts die Männer aus dem Telefondienst der Post allmählich verdrängt hatten, weil ihre weiblichen Soprane selbst auf dem Hintergrund detonierender Bomben und ratternder Flaksalven noch besser zu verstehen waren als die männlichen Bässe. Wer je versucht hat, eine Fremdsprache über ein akustisches Medium zu lernen, wird bestätigen können, dass Frauen in der Tat wesentlich besser zu verstehen sind als Männer. Ob Männer es auch geschafft hätten, angesichts schnell wachsender Telefonnetze an solchen „Klapperschränken“ bis zu 10.000 Steckverbindungen fehlerfrei herzustellen, steht dahin.
Im Leben jenseits der fernmündlichen Kommunikation muss sich meine Mutter allerdings ab und an ordentlich verstöpselt haben. Man weiß ja, wie das so geht: ein Wort ergibt das andere, auf einem Bein kann man nicht stehen und was der Redensarten mehr sind und bevor man sich’s versieht, ist man zu Dritt. Schon wegen solcher, den Zeugungsakt umhüllender Allfälligkeiten mieden es die meisten von uns wohlweislich, Nachforschungen zu den näheren Umständen ihrer Entstehung anzustellen. Niemand möchte wirklich wissen, dass er seine Existenz dem schlüpfrigen Ende eines feucht-fröhlichen Betriebsausfluges verdankt. In meinem spezifischen Fall bedarf es dazu auch keiner aufwändigen Ermittlungsarbeit zu konstatieren, dass sich Weihnachten 1944/45 geradezu von selbst als schicksalhaftes Datum meiner Zeugung aufdrängt. Liebe unterm Weihnachtsbaum, kitschig, ja, aber allemal besser als der Kirmesbesuch oder die Jubiläumsfeier. Könnte es auch daran liegen, dass ich im späteren Leben einen regelrechten Horror vor den alljährlichen Weihnachtsritualen mit aufgebügeltem Lametta vom Vorjahr und erbarmungslosem Plätzchenkrieg zwischen Gattin und Mutter entwickelte?
Da zu diesem Zeitpunkt außer der deutschen Niederlage so gut wie gar nichts vorhersehbar war und meine Eltern auch nicht sicher sein konnten, einander je wiederzusehen, war ich wohl so etwas wie ein embryonaler Wechsel auf die Zukunft. Dass ich mich in der Folge auch oft so und gefühlt habe, tut hier weiter nichts zur Sache. Um den Sachverhalt nach außen unmissverständlich zu dokumentieren, gab meine Mutter mir vorab schon mal den Vornamen meines Vaters – danke dafür. Dass dies in späteren Jahren zu mancherlei bisweilen komischen Missverständnissen führen würde, hätte sie eigentlich ahnen müssen.
Ich denke da zum Beispiel an den 1978 auf einem großen, landschaftlich schön gelegenen Wuppertaler Friedhof am Kopfende des Grabes meines Vaters errichteten Marmorstein, fast schon eine Stele, mit der Inschrift „Paul Werner“. Bei Spaziergängen über den Friedhof, wie auch ich sie gern zu machen pflegte, solange ich den Tod als eher abstrakte Größe betrachtete, die mit meinem eigenen Leben nicht viel zu tun hatte, war einer meiner früheren Klassenkameraden auf den Stein gestoßen und hatte mich zunächst in dem Grab liegen gewähnt. Ein prüfender Blick auf das kleingedruckte Geburtsjahr 1902 hätte selbst den wie ich an mittelschwerer Dyskalkulie leidenden Kollegen stutzig machen sollen. Schließlich wäre bei diesem Stand der Dinge der Tag meiner Einschu-lung mit dem Eintritt in die Frührente zusammengefallen, was selbst im damals noch straffgespannten sozialen Schutznetz der Bundesrepublik die krasse Ausnahme dargestellt hätte.
Wenn mein Vater aber gegen Kriegsende tatsächlich auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Köln stationiert gewesen war, wofür vieles zu sprechen scheint, hätte er sich im Mai 1945 wohl eigentlich in britischer Gefangenschaft befinden müssen. Wie hatte er es bewerkstelligt, stattdessen bei den Franzosen zu landen?
An der Sprache kann es nicht gelegen haben, stand mein Vater doch zeitlebens schon mit Hochdeutsch auf Kriegsfuß. Aber bei genauerem Hinsehen stellt man fest, dass die französische Besatzungszone bereits irgendwo hinter Bad Godesberg begann. Außerdem waren die rechtsrheinischen Stadtteile Kölns von den Belgiern besetzt, obwohl wir gegen die ja den Krieg beim besten Willen nicht verloren hatten.
Vielleicht hatte sich mein Vater schlicht verlaufen oder gehofft, bei den Franzosen besser wegzukommen als bei den Briten. Oder er gehörte zu dem Kontingent von rund einer Million deutscher PoW’s, die den Franzosen von Amerikanern und Briten zum Zwecke der Wiederaufbauhilfe quasi als Leiharbeiter großzügig zur Verfügung gestellt worden waren. Allein auf sich gestellt, kriegten die „Froschfresser“, wie mein Vater sie später liebevoll zu nennen pflegte, offenbar nichts auf die Kette.
Da er trotz des drei- bis vierjährigen, mehr oder minder engen Kontaktes buchstäblich kein Wort Französisch gelernt hatte, wozu jetzt auch für einen fremdsprachlich wenig begabten Menschen schon ausgeprägter Vorsatz gehört, nehme ich zu seinen Gunsten an, dass er kaum je Gelegenheit hatte, sich mit seinen Bewachern oder Teilen der einheimischen französischen Bevölkerung auszutauschen. Was dafür zu spre-chen scheint, dass er irgendwo im Elsass gestrandet war, wo man vielleicht das eine oder andere örtliche KZ in ein Kriegsgefangenenlager umgewandelt hatte. Hier war man ja des Deutschen noch hinreichend mächtig, um sich im gelegentlichen oberflächlichen Plausch mit außerhalb des Lagers arbeitenden Gefangenen in deren Muttersprache unterhalten zu können, sofern man dazu bereit war oder das Gespräch sonst zum reinen Monolog degeneriert wäre.
Auf einem solchen Hintergrund erscheint die Entscheidung meiner Mutter, sich in einen Ort nahe der deutsch-französischen Grenze an der Schwelle zum Elsass zu begeben, absolut plausibel. Hätte ich die beiden irgendwann einmal um nähere Auskunft gebeten, wüsste ich es heute vermutlich ganz genau, aber das ist eine andere Baustelle, die ich hier nicht aufmachen möchte.
Das bereits im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnte und lange Zeit überwiegend von der Holzwirtschaft und Flößerei lebende Altensteig war als militärisch-strategisches Leichtgewicht offenbar keiner Bombenangriffe würdig gewesen, so dass hier wohl noch eine, wenn auch rudimentäre, aber halbwegs intakte zivile Infrastruktur zur Verfügung stand. Im Deutschland jener Tage ein ausgesprochener Glücksfall.
Einer noch dazu, der meiner Mutter auch aus anderen Gründen in die Karten spielte. Denn im Sommer 1945 zählte sie immerhin schon gestandene neununddreißig Lenze. Und nach allem, was ich später aus einer ihren seltenen diesbezüglichen Einlassungen herauszuhören glaubte, war ich auch nicht der erste Braten, den sie im Laufe ihres Lebens in der Röhre gehabt hatte.
Für ihre sich offenbar in häufigen Liebschaften bahnbrechende Leidenschaft hatte sie mehr als einmal den Preis entrichtet, den die nüchtern wie eine erfahrene Kellnerin kalkulierende Natur dafür bereithält. Wie und wo man damals in und um Köln zu einem Abort kam, war der „schnellen Gerda“ bekannt, und wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, hätte auch ich gar nicht erst auf die Welt kommen, sondern als abgetriebener Fötus im Wald oder auf der Heide enden müssen. Kein unmittelbar aufbauender Gedanke, gewiss, zumal es Tage gab – wenige zwar, doch es gab sie – an denen ich fast wünschte, es wäre damals so gekommen.
Was hatte sie bewogen, ausgerechnet in meinem Falle eine Ausnahme zu machen? Sollte sie wirklich gespürt haben, dass sie drauf und dran war, einem unglaublich vielseitig talentierten Bürschchen das Leben zu schenken, auf das die Welt nur ungern verzichten würde? Bei etwas unvoreingenommenerer Betrachtungsweise, kommt man an der Erkenntnis nicht vorbei, dass die mit Riesenschritten herannahende Menopause und die damit verbundene Torschlusspanik meiner Mutter eine herausragende Rolle gespielt haben dürften. Vielleicht schwebte ihr auch vor, sie könne sich dieses Druckmittels im Sinne einer Entscheidungshilfe für meinen Vater bedienen. Eine etwas gewagte „linksrheinische Eröffnung“, von der ich ihr selbst als mittelprächtiger Schachspieler abgeraten hätte. Jedenfalls, solange sich der „König“ noch jederzeit durch eine simple Rochade des drohenden Matts entziehen konnte.
Sie hat sich dazu nie geäußert und mich ritten auch nicht genug Teufel, an dieser Stelle unbedingt nachzubohren. Viel hatte jedenfalls nicht gefehlt und ich hätte meinen Fuß gar nicht erst auf diesen verstrahlten Planeten Erde gesetzt.
Paul d.Ä
Mein Vater hatte zum Zeitpunkt meiner Geburt mit seinen 43 Jahren die Lebensleiter auch schon an das gelehnt, was man in gewissen Kreisen leicht euphemistisch als „reifes Mannes-alter“ zu bezeichnen pflegt. Der zoophile chinesische Kalender kennt es wahrscheinlich auch als die Ära des Geilen Bocks. Heutzutage ein Lebensabschnitt, in dem viele Männer Sportlichkeit und Sexualität gerade erst neu entdecken und, schwer keuchend nach Luft ringend, das eine mit dem anderen verwechseln.
Damals stand den ohnehin physisch wie psychisch geschlauchten, vom Schicksal gebeutelten und total ausgepowerten Männern verständlicherweise nicht unbedingt der Sinn danach. Hinzu kam eine durch jahrzehntelange einseitige ideologische Indoktrinierung geförderte geistige Verkümmerung und intellektuelle Trägheit, die viele Menschen entmündigten. Beides im Verein mit dem natürlichen Stress der Kriegsjahre ließ Männer vorzeitig altern. Nur so wird verständlich, dass mir als Kind zum Beispiel die abgekämpften „Helden von Bern“ auf den Schwarz-Weiß-Fotos der Zeit wie eine Altherrenmannschaft erschienen, die sich zurückhaltend über den Gewinn eines von Kukident gestifteten Wanderpokals freuen. Um von dem kaum einmal lächelnden, chronisch miesepetrigen und irgendwie völlig aus der Zeit gefallenen Sepp Herberger gar nicht erst zu reden.
Kein Vorwurf, wohlgemerkt. Immer dann, wenn ich versuche, mich auch nur mal für einen Augenblick in die Lage von Menschen zu versetzen, die, wie mein Vater, um 1900 geboren, über weite Strecken des Jahrhunderts immer entweder ein wenig zu früh oder ein Geringes zu spät dran waren, scheitere ich trotz meines an sich recht leistungsfähigen Vorstellungsvermögens angesichts der Monstrosität der Aufgabe kläglich. Für eine Teilnahme als Kombattant am Ersten Weltkrieg war mein Vater einen Tick zu jung gewesen. In der Blüte seiner Jahre hatte er sein ohnehin überschaubares produktives Potenzial dank der Weltwirtschaftskrise und anschließender jahrelangen Massenarbeitslosigkeit nicht einmal im Ansatz ausschöpfen können. Und für ein energisches Durchstarten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war er dann schon wieder ein paar Jährchen zu alt. Ist es verwunderlich, dass man sich dann vorm Leben regelrecht veralbert fühlt?
Trotz dieses permanenten Gegenwindes, der, wie Segler wissen, auf Dauer demoralisiert, hatte er es in den zwanziger Jahren bereits einmal in den Hafen der Ehe geschafft. Vermutlich, weil auch damals schon ein Kind, meine spätere Stiefschwester Marion, unterwegs gewesen war. Was dem Mann keine besonders gute Kopfnote „Lernfähigkeit“ ausstellt. Kein dummer, aber ein abgrundtief ignoranter Mann, dessen passables Äußeres und gutmütiges, joviales Wesen die meisten Frauen zumindest nicht per se abgestoßen haben dürfte. Ein Pfund, mit dem er leider nicht richtig zu wuchern verstand. Obwohl ich mir beim kritischen Blick in den Spiegel den Vorwurf nicht ersparen kann, als Topf den Kessel an dieser Stelle zu Unrecht „schwarz“ zu schelten, wie die Briten sagen.
Zwanzig Jahre älter als ich und von meiner Mutter ähnlich systematisch geschnitten wie fast die gesamte übrige Verwandtschaft meines Vaters, spielte Marion in meinem späteren Leben nicht wirklich eine Rolle und ließ insofern meinen sorgsam gehegten Einzelkind-Status mit all seinen Vor- und Nachteilen unangetastet.
Wie für die anderen „Rekruten“ im riesigen Heer der Arbeitslosen der zwanziger und dreißiger Jahre, war der Umschwung für meinen Vater im Kielwasser der scheinbar unaufhaltsam ihrer Machtergreifung entgegensteuernden Nationalsozialisten gekommen, denen er sich möglicherweise just zu dem Zeitpunkt als einfaches Parteimitglied angeschlossen hatte, da es die rheinische Frohnatur Joseph Goebbels vorübergehend nach Elberfeld verschlagen hatte, wo er seine propagandistische Rhetorik am für tauglich gehaltenen Objekt der Provinz erproben konnte. Das Wort „Ideologie“ hätte mein Vater, dessen bin ich mir ziemlich sicher, damals nicht einmal fehlerfrei zu buchstabieren gewusst. Um irgendeine nennenswerte politische Überzeugung zu entwickeln, hätte er mehr wissen und politisch interessierter sein müssen, als dies auch später der Fall war. Aber da sich in seiner Heimatstadt Elberfeld Nazis und Sozis lange Zeit zahlenmäßig in etwa die Waage hielten und einander umso erbitterter bekämpften, tat man als relativ Unbeteiligter wahrscheinlich gut daran, sich beizeiten für eine Seite zu entscheiden, um nicht mal von der einen, mal von der anderen Fraktion bei den häufigen blutigen Straßenkämpfen verprügelt zu werden. Und Goebbels war in seinen Brandstifterreden wahrscheinlich eine Spur überzeugender als seine kommunistischen Widersacher.
Vielleicht hatte mein Vater angesichts solch regelmäßiger Scharmützel und Handgreiflichkeiten auch mit dem Ringen begonnen, einer der ganz wenigen Sportarten, für die ich mich meinerseits lebenslang so ganz und gar nicht erwärmen konnte. Hätte er wie der bekannte Elber-felder Schwergewichtler und Olympiasieger Runge den Weg ins Vier-eck der paradoxerweise „Ring“ genannten Boxarena gefunden, wäre ich dort vielleicht sogar in seine Fußstapfen getreten. Boxen war jedenfalls eine Zeitlang durchaus mein Ding. Freistil-Ringen mit seinen obszönen Griffen an alle möglichen empfindlichen Körperteile hingegen fand ich auf peinliche Weise schwul. Da ging es mir eher wie jenem jugendli-chen Protagonisten eines Hollywood-Streifens, dessen Titel mir leider entfallen ist. Von seinem Vater zum Ringen gedrängt, bestätigt er seinen Freunden sarkastisch, dass er die erforderliche Strumpfhose bereits erworben habe und jetzt nur noch auf die Lobotomie warte.
War mein alter Herr Rassist oder Antisemit? Ich erlebte ihn zwar stets als erzkonservativen und unerschütterlichen CDU-Wähler, vernahm aber aus seinem Munde nie irgendwelche von Rassismus oder Anti-semitismus geprägten Äußerungen. Menschen können sich verstellen, sicher, aber dass einem in der Wolle gefärbten Rassisten bei aller Zurückhaltung nicht dann und wann doch die eine oder andere verräterische Bemerkung entschlüpft wäre, halte ich für wenig wahrscheinlich.
Wenn er dumpfer rassistischer Ressentiments fähig war, dann rich-teten die sich allenfalls gegen die nordafrikanischen Bewacher in fran-zösischen Diensten, die ihn offenbar während der Gefangenschaft des Öfteren gepiesackt hatten. Vielleicht hatte auch das dazu geführt, dass er sich der französischen Sprache und Kultur so standhaft versagte.
Bei einer unvergesslichen Gelegenheit führte er mich acht-, neunjährigen Knaben dem jungen Harry Belafonte zu, dem späteren stimmgewaltigen King of Calypso, überzeugten Bürgerrechtler und Freund Martin Luther Kings. In den fünfziger Jahren noch ganz am holprigen Anfang seiner Karriere stehend, hatte Belafonte, dessen „Island in the Sun“ in der deutschen Fassung der Catarina Valente zum Lieblingslied meiner Mutter avancierte, ausgerechnet Wuppertal besucht, wo er offenbar mit einer Tankstellenbesitzerin persönlich befreundet war, die auch zu den Bekannten meines Vaters zählte.
Im Grunde beweist diese Episode natürlich gar nichts, außer vielleicht, dass der Kontakt mit Afroamerikanern meinem Vater nicht spontan schon Pickel auf die Wangen trieb. Musik spielte in seinem Leben offenbar überhaupt keine Rolle. Ganz im Gegensatz zu meiner Mutter, doch davon später.
Ob sich Gerda des Umstandes bewusst war, dass viele Ausdrücke ihres kölschen Dialekts, in den sie nur verfiel, wenn sie sich über etwas oder jemand – mich, zum Beispiel – so richtig ärgerte, dem Jiddischen entlehnt waren, möchte ich bezweifeln. Als Antisemitin aber wäre sie bei einem Screening mit diesem wenig arisch klingenden Vokabular jedenfalls nicht so leicht durchgegangen. Weder im Laufe meiner Kindheit noch während meiner Jugend habe ich meine Eltern je über Juden lästern, schimpfen oder sie als ehedem verfolgte und selten wirklich ihren Verdiensten entsprechend geschätzte Minderheit auch nur erwähnen hören. Auch das muss nichts bedeuten, hatte doch nie der geringste Anlas dazu bestanden. Falls es Mitbürger*Innen jüdischen Glaubens in unserer weiteren Bekanntschaft gegeben haben sollte, was ich bezweifele, waren sie jeden-falls nie Gegenstand irgendwelcher Erwägungen oder Diskussionen, rassistisch-antisemitisch geprägt oder nicht. Zu den vorwiegend an Juden verübten Gräueltaten der Nazis äußerte sich meine Verwandtschaft allerdings auch nie. Das Thema kam einfach nicht vor.
Meine Geburt an einem Mittwoch stand im Sternzeichen des Großen Paradoxons, in sternklaren Nächten ein paar Millionen Lichtjahre links vom Kleinen Wagen gerade noch mit dem bloßen Auge zu erkennen. So verbrachte ich die ersten drei, vier angeblich so prägenden Lebensjahre in Altensteig, das ich bis heute als meinen eigentlichen Geburtsort betrachte und zu dem ich zeitlebens eine gewisse sentimentale Bindung verspürte. Allein schon der suggestive Name, der nach Bahnsteig klingt oder das Markenzeichen eines gängigen Treppenlifts für die wenigen älteren Menschen abgeben könnte, die das Pech haben, ein mindestens zweistöckiges Einfamilienhaus bewohnen zu müssen, während der Großteil der deutschen Bevölkerung in so teuren wie engen Mietskasernen hausen darf.
Tatsächlich handelt es sich, jedenfalls in meiner Vorstellung, wohl um die süddeutsche Bezeichnung eines ausgetretenen Pfades, der sanft ansteigend auf einen Berg führt und daher vorzugsweise von Alten und Kindern benutzt wird, während junge und noch hinreichend rüstige Männlein und Weiblein den kürzeren direkten, aber eben auch steileren Aufstieg bevorzugen. Das atmet den Geist sozialer Empathie und mittelgebirgiger Rücksichtnahme. Irgendwie befinden wir uns doch alle vom Augenblick unserer Geburt an mit einem Fuß auf dem Altensteig des Lebens.
Wo genau meine Mutter dort wohnte, ob in der Altstadt oder in einem der anderen Teildörfer und Viertel, ist mir nicht bekannt und lässt sich heute wohl auch nicht mehr rekonstruieren. Soweit überhaupt noch Meldelisten der Zeit existieren, sind diese handschriftlich ausgefüllt und damit so unleserlich wie phönizische Hieroglyphen. Meine Mutter schrieb zum Beispiel noch oft Sütterlin, dessen Grundzüge ich auf diese Weise lernte und teilweise assimilierte, weil mir die normale lateinische Variante eher ungelenk erschien.
Auffällig ist, dass meine Mutter nie erzählte, wie sie nach Altensteig gelangt war und was sie tat oder tun musste, um nach meiner Geburt für unser beider Lebensunterhalt zu sorgen. Da sie im späteren Leben meines Wissens niemandem in Altensteig freundschaftlich verbunden war und meine Eltern auf unseren gemeinsamen Urlaubsreisen der fünfziger Jahre gen Süden den Ort, wenn schon nicht absichtlich mieden, so jedenfalls auch nicht um den Preis eines kleinen Umwegs aufsuchten, ziehe ich aus ihrem Verhalten den Schluss, dass meine Mutter sich hier alles in allem nicht wirklich willkommen gefühlt haben dürfte.
Wobei man für eine etwaige Feindseligkeit der Leute von Altensteig ein gewisses Maß an Verständnis hätte aufbringen können. Denn zum einen galt der Nordschwarzwald von alters her als Armenhaus, so dass man seitens der gastgebenden Familie, so es eine solche gab, über anderthalb zusätzlich zu stopfende Mäuler nicht wirklich begeistert gewesen war und meine Mutter dies wahrscheinlich auch hatte spüren lassen.
Zum anderen gehörte „Gertie“ als kölsche Katholikin im erzprotestantischen Altensteig womöglich auch dem falschen Glaubensbekenntnis an. Keine Kleinigkeit in einer Stadt, die, man höre und staune, erst im Jahre des Herrn 1927 die Errichtung eines Gotteshauses einer „verfeindeten“ Religion zugelassen hatte. Und wir reden hier, wohlgemerkt, nicht von einer Moschee, sondern von einer katholischen Kirche.
Paul d.J.
Kleinformatige Schwarz-Weiß Fotos meiner frühesten Kindheit zeigen mich mal als pausbäckige männliche Putte in einem ebenerdigen Garten bäuchlings auf einem Kissen liegen, mal in einem alten Kinder-wagen aus Korbgeflecht sitzen oder mit einem vergleichsweise riesigen Plüschbären, der mir vermutlich vom professionellen Fotografen leihweise überlassen worden war, auf einer kurzen Freitreppe sitzen. Offensichtlich gestellte Posen zwar, deren Adressat mein abwesender Vater gewesen sein wird, aber dennoch Zeugnisse dafür, dass es uns in Altensteig gar so schlecht nicht ergangen sein kann.
Die Fassade des zur Treppe gehörenden Hauses bleibt leider außerhalb des Bildausschnittes des Fotos, das nur unwesentlich größer ist als eine etwas ausgefallene Jubiläums-Briefmarke. Bei einem Besuch, den ich Altensteig vor rund zwanzig Jahren mit dem Fahrrad in der vagen Hoffnung abstattete, das Haus trotzdem anhand des Fotos identifizieren zu können, musste ich feststellen, dass so gut wie alle Gebäude der Altstadt solche Freitreppchen aufweisen, was diese als Erkennungsmerkmal natürlich entwertet.
Warum ich nicht beharrlicher in den örtlichen Annalen blätterte? Nun, solchem Bemühen stand unter anderem die Tatsache entgegen, dass als mein amtlicher Geburtsort nicht Altensteig, sondern Nagold gilt. Dies einzig und allein deshalb, weil das weitgehend heil gebliebene Städtchen Altensteig damals kein Krankenhaus besaß und wohl auch gerade keine Hebamme zur Hand oder willens war, einem katholischen Säugling auf die Welt zu helfen. Daher musste sich meine Mutter für die Zwecke der Niederkunft Anfang September 1945 auf dem „Altensteigerle“ ins rund fünfzehn Kilometer weiter flussabwärts gele-gene Nagold begeben. Obwohl seinerseits fast dem Erdboden gleichgemacht, nannte dieser Ort paradoxerweise eine noch brauchbare Klinik sein Eigen.
Immerhin blieb meiner Mutter die Fahrt auf einem wackligen Floß erspart. Andererseits – auf einem Flüsschen das Licht der Welt erblickt zu haben, hätte mich ja fast schon zu Kollegen eines Tom Sawyer oder Huckleberry Finn gemacht, die ich viel später kennenlernen durfte.
Das „Altensteigerle“ war eine 1891 in Betrieb genommene und erst 1976 wieder stillgelegte Schmalspurbahn, über die Altensteig an das Eisenbahnnetz des deutschen Reiches angeschlossen war. Schmalspurbahnen haben den Vorteil der Wirtschaftlichkeit und flexibleren Anpassungsfähigkeit an unwegsames Terrain, weshalb man sie vornehmlich an den vier Enden der Welt wie in den österreichischen Alpen oder in den menschenleeren Weiten Patagoniens antrifft. Meist dienen sie dem kombinierten Passagier- und Gütertransport und halten daher auch für zusteigende Hühner oder grunzende Schweine. Hier im Nordschwarzwald bildeten die traditionelle Flößerei zusammen mit der Gerberei lange Zeit die Hauptgewerbezweige der Altensteiger. Von anderen, schnelleren Transportträgern zunehmend unter Rentabilitätsdruck gesetzt, war die Flößerei schließlich durch die Bimmelbahn ersetzt worden.
Eine seltsame Laune des Schicksals sorgte mit anderen Worten dafür, dass mein Fahrschein für die weitere Lebensreise in Nagold gelöst wurde. In einem Ort, mit anderen Worten, zu dem ich nie auch nur die geringste innere Beziehung geschweige denn Verbundenheit empfand, während „mein“ geliebtes Altensteig, dem ich in Wahrheit meine Existenz verdanke und das mich auf mannigfaltige, wenngleich mir selbst kaum bewusste Weise geformt haben dürfte, nirgends in meinen amt-lichen Unterlagen auftaucht. So ungerecht kann’s im Leben zugehen.
Obgleich – ganz so kurz wird mein Aufenthalt im Krankenhaus von Nagold dann auch wieder nicht gewesen sein. Meine Mutter erzählte mir nämlich angesichts ihrer sonstigen Einsilbigkeit in Sachen Vergangenheitsbewältigung erstaunlich oft davon, dass ich als Neugeborenes im berüchtigten Hungerwinter zwischen Dezember 1946 und März 1947, der Hundertausenden sowieso schon ausgemergelten Deutschen das Leben kosten sollte, an Hungertyphus erkrankt sei und eine „Schwester“ es auf sich genommen habe, mir Tag wie Nacht alle paar Stunden wie einem aus dem Nest gefallenen Eichhörnchen-Jungen ein paar Löffelchen Zuckerwasser zu verabreichen, was mir damals einerseits das Leben gerettet, mir andererseits aber wohl auch eine unstillbare Leidenschaft für Süßigkeiten jedweder Art implantiert haben dürfte.
Ich weiß nicht, warum ich die Bezeichnung „Schwester“ immer im Sinne einer Ordensschwester oder Nonne verstand, bis mir bei der neuerlichen genauen Betrachtung meiner Geburtsurkunde auffiel, dass eine „Schwester Anke Dörr“ dort als Taufpatin aufgeführt ist. Auch diese absurde Neigung, immer zuerst an das weniger Naheliegende zu denken, sollte mich mein Leben lang begleiten und mir als Dolmetscher noch so manches Problem bereiten.
Nun tut der Umstand, dass es sich „nur“ um eine Krankenschwester handelte, meiner Dankbarkeit zwar keinerlei Abbruch. Andererseits nahm ich nur sehr ungern von der ungleich romantischeren Vorstellung Abschied, von einer schwarz gewandeten Nonne namens, weiß ich, Felicitas oder Innocentia umsorgt worden zu sein, die mich Tag und Nacht gefüttert und in ihre Gebete eingeschlossen hatte. Das machte irgendwie mehr her.
Als mein Vater sich zur Jahreswende 1948/49 buchstäblich „auf Französisch“ aus der auf Sicht doch etwas eintönig gewordenen Gefangenschaft verabschiedete, die für ihn nur unwesentlich kürzer ausfiel als der Krieg selbst, hätte er sich mir nichts, dir nichts nach Norden absetzen und in Wuppertal zu seiner dort vermutlich auf ihn wartenden Frau und Tochter gesellen können, ja, vielleicht müssen. Stattdessen schlug er sich zu meiner Mutter und mir nach Altensteig durch. Vielleicht fiel ihm die Entscheidung auch deshalb leichter, weil ich ein Junge war. Ein Mädchen hatte er ja bereits und ein drei- oder vierjähriges, schon laufendes und in ganzen Sätzen sprechendes Kind war für einen
Mann seines Alters sowieso leichter zu ertragen als ein, mit Verlaub, unablässig plärrender Säugling. Wie dem auch sei, lautete die alles beherrschende Frage der familiären „Stunde Null“ nun: quo vadimus?
Hier im Schwarzwälder Umfeld zu bleiben, machte wenig Sinn. Das fünfzig Kilometer entfernte Stuttgart mit Daimler als potenziellem Arbeitgeber wäre vielleicht in Frage gekommen, doch da kannten meine Eltern wohl niemanden. Glücklicherweise, wie ich heute sage, denn in Stuttgart unter pfennigfuchsenden Schwaben aufwachsen zu müssen, hätte ich irgendwann bald als unnötige Härte empfunden.
Köln war 1948 immer noch wenig mehr als ein riesiger Trümmerhaufen. Und vom verbliebenen Rest ihrer Familie wäre meine Mutter sicher auch nicht mit offenen Armen aufgenommen worden. Ein uneheliches Kind und einen Ehebrecher proletarischen Zuschnitts im Schlepptau hätten Gerda Fochems Fortkommen im erzkatholischen Umfeld Kölns unnötig schwierig gestaltet. Also begaben sich meine Eltern mit mir ins fast ebenso total zerstörte Elberfeld, das 1929 mit Barmen und weiteren umliegenden Nachbargemeinden zu einem künstlichen neuen kommunalen Konstrukt namens „Wuppertal“ fusioniert worden war.
Nicht, dass hier alles zum Besten gestanden hätte. Doch die Schei-dung von seiner ersten Frau war für meinen Vater in der Stadt Friedrich Engels‘ vermutlich leichter zu bewerkstelligen als in derjenigen des Josef Frings. Wenn auch um den Preis einer monatlichen Unterhaltszahlung von 150 der gerade erst in jenem Jahr eingeführten D-Mark. Das war damals mehr als es heute klingt, belastete den Start ins neue Leben mit einer fühlbaren Hypothek und löste immer mal wieder bitteren Streit zwischen meinen Eltern aus. Augen auf bei der Partnerwahl, kann man da nur sagen! Weshalb so viele Frauen auf verheiratete Männer herein-fallen, ist mir persönlich eines von vielen die Weiblichkeit umhüllenden Rätseln. Mich befreite der wenig später erfolgte neuerliche Eheschluss meines Vaters, diesmal mit meiner Mutter, vom Makel der Außerehelichkeit. Es mag aus heutiger Sicht schwülstig und albern anmuten, aber wie sehr die Außerehelichkeit der Geburt damals noch als Makel empfunden wurde, zeigt unter anderem die bewusste Boshaftigkeit, mit der der Christdemokrat Konrad Adenauer auf die uneheliche Abstammung seines gefährlichen politischen Kontrahenten Willy Brandt anspielte, indem er ihn bei seinem norwegischen Namen Frahm rief und damit zugleich als eine Art Vaterlandsverräter brandmarkte.
Die Annahme meines Vaters, dass er in Wuppertal die eine oder andere persönliche Verbindung wiederaufleben lassen und auf diese Weise einen Job finden könnte, sollte sich zwar nicht sogleich bewahrheiten, sich letzten Endes jedoch glücklicherweise als begründet erweisen.
So oder so glaube ich nicht, dass er als westfälischer Kaltblüter späterhin im schunkelnden und munkelnden Köln mit Karneval, Klingelbeutel und Klüngelwirtschaft seines Lebens froh geworden wäre. Obwohl er, wie gesagt, durchaus seine jovialen Seiten hatte. Was ihm jedoch völlig abging, war die rheinische Leichtigkeit selbst noch eines klumpfüßigen Joseph Goebbels sowie jene scheinheilige Hinterfotzigkeit, ohne die in Köln noch niemand auch nur einen Blumentopf hat gewinnen können. Auf der politischen Ebene verkörperte die keiner besser als der greise Konrad Adenauer, der in seiner Eigenschaft als Hobby-Erfinder nach allerlei mehr oder minder nützlichen Gerätschaften vor allem des Hausgebrauchs schließlich die CDU und sich selbst als Kanzler der „Stunde Null“ zum Patent anmeldete.
2. Über die Wupper.
Wie weit reicht unser individuelles Erinnerungsvermögen in die frühe Kindheit zurück? Gibt es darüber gesicherte Erkenntnisse, empirische Werte? Eine gute Freundin pflegte steif und fest zu behaupten, sie könne sich an Vorgänge erinnern, die sich abgespielt haben müssen, als sie gerade mal zwei Jahre alt war. Ich habe ihr das, ehrlich gesagt, nie abgenommen. Nicht, dass ich sie Lügen hätte strafen wollen, keineswegs. Ich war und bin weiterhin einfach nur felsenfest davon überzeugt, dass sie bestimmte Dinge so häufig von ihren Eltern oder anderen Dritten zu hören bekam, dass sie sich diesen Input letzten Endes unbewusst zu eigen machte. Wenn sich viele von uns in solchen assimilierten Pseudo-Erinnerungen einzurichten wissen, hat das vermutlich auch etwas mit der Illusion der Kontrolle über das eigene Leben zu tun.
Meiner persönlichen Wahrnehmung gemäß können wir die Funktionsweise unseres Gehirns nur unvollkommen steuern und die Kapriolen unseres Gedächtnisses entziehen sich erst recht unserer Kontrolle.
Unser Erinnerungs-Festplatte scheint vielmehr sehr oft selbst darüber entscheiden zu wollen, welche Dateien es wie lange speichert und ob und wann sie sie unserem Bedarf entsprechend abruft und zögerlich auswirft. Wie viele Male schon habe ich mich so krampfhaft wie zunächst vergeblich bemüht, meinem Gedächtnis eine bestimmte Information – meist übrigens Namen – jetzt und hier abzuringen. Keine Chance. Nicht genug damit, dass mir der gesuchte Name nicht einfällt, drängeln sich andere, in diesem Zusammenhang völlig irrelevante Dateien und Bilder ins Sichtfeld, schaffen dergestalt unerwünschte Nebenschauplätze und blockieren nachhaltig den Zugang zur eigentlich benötigten Info.
Wir alle kennen das hinlänglich von den leidigen Google-Mechanismen: da gibst du einen bestimmten Begriffwie „Stadtplan von Istanbul“ ein und wirst prompt mit den Anzeigen von Teppichhändlern zugemüllt. Danke dafür!
Als Schulkinder haben wir uns bisweilen eine ähnliche Technik zunutze gemacht. Wenn wir in Biologie etwas über den Buntspecht schreiben sollten, dessen Charakteristika und Lebensgewohnheiten aber leider längst wieder vergessen hatten, schufen wir eine Abzweigung. Frisst der Buntspecht Würmer? Na also! Und da wir Würmer erst am Vortag besprochen hatten, wussten wir noch so gut wie alles über sie. Besser das Thema um Haaresbreite verfehlen als ein leeres Blatt abgeben …
Minuten, manchmal auch Stunden später, wenn ich die Sache nach dem Namen längst ad acta gelegt habe und der Information keinerlei Bedeutung mehr beimesse, reicht mein Gedächtnis sie mir völlig unvermittelt nach. Als hätten ein paar hemdsärmelige und mit grünen StirnBlendschutzschirmen versehene Kleinwüchsige dort im Oberstübchen derweil das Archiv durchforstet, bis sie den gewünschten Namen im Karteikasten unter „N“ gefunden und stolz an den zuständigen Disponenten weitergereicht hätten, der sie dann nach eigehender Prüfung freigestempelt und in den „Out“-Kasten geworfen hatte.
Insofern ist der mit einsetzender Demenz assoziierte Kontrollverlust weniger grundsätzlicher als gradueller Natur. Endlich von den Fesseln gedanklicher Zusammenhänge befreit, treibt das Gedächtnis nun vollends, was es will, frischt völlig nutzlose und unerbetene Kindheitserinnerungen zur Unzeit auf, hält dafür aber schelmisch die Erinnerung daran unter Verschluss, was wir vielleicht nur fünf Minuten zuvor gemacht haben.
Ausgeliefert sind wir unserem Gedächtnis im Großen und Ganzen mithin auch jetzt schon. Relativ hilflos müssen wir mit den Brocken Vorlieb nehmen, die es uns durch die Klappe der Gefängnistür unserer Gedankengebäude anzureichen geruht. Kein Kontrollverlust im eigent-lichen Sinne, denn verlieren kann man nur, was man irgendwann besaß.
Andererseits lehrt uns die Psychologie, glaube ich, dass es auch sein Gutes hat, wenn das Gehirn mit einer Löschtaste versehen ist. Denn wäre dem nicht so, müssten wir uns an jeder Weggabelung, die uns vor eine Entscheidung stellt, wie Hardcore-Messies durch einen Wust Erinnerungsmüll wühlen und systematisch viel zu spät reagieren. Und irgendwann würde uns wie Tim Burtons hinterfotzigen Marsmännlein eines Tages die von solcherlei Trödel überlastete Birne platzen und unsere graue Gehirnmasse die pinkfarbige Raufasertapete des Arbeitszimmers verunzieren.
„Mag ja sein,“ höre ich Ihren berechtigten Einwand, „nur würden wir gerne selbst bestimmen dürfen, was gelöscht wird und was abrufbereit gespeichert bleibt.“
Genau daran aber, an unserer Unfähigkeit, uns freiwillig von Dingen zu trennen, „die man ja irgendwann noch mal gebrauchen könnte“, scheitern bekanntlich viele Versuche, Ballast abzuwerfen und ein wenig Ordnung ins Leben der Messis zu bringen, die wir insgeheim alle sind. Der Preis, den wir für die notwendig fremdgesteuerte Leerung der grauen Tonne entrichten, besteht im gelegentlichen Verlust von Dateien, an denen uns aus sentimentalen eher denn aus praktischen Gründen besonders gelegen war. Der sentimentale Wert, das werden Ihnen Trödler*Innen jeder Couleur bestätigen, fließt grundsätzlich nicht in die Preisfindung ein.
Zu den vom Gedächtnis als entbehrlich empfundenen Erinnerungen zählt die Kategorie „frühe Kindheit“ jedenfalls dann, wenn sie uns nicht durch das Schweigen der Lämmer nachhaltig traumatisiert hat. Wozu sich mit Merkposten belasten, deren Haltbarkeit so weit überschritten scheint, dass sie keine brauchbaren Parameter für die Gegenwart mehr abzugeben in der Lage sind? Wer dem mnemotischen Phantomschmerz unbedingt Stoffgeben möchte, muss ihn sich eben subsidiär aus den Erzählungen Dritter rückerschließen.
Was uns zu der alten erkenntnistheoretischen Streitfrage führt, ob ein im leeren Zimmer stehender Stuhl tatsächlich existiert. Anders gefragt und auf den Gegenstand unserer Überlegungen gemünzt: was, wenn wir an diesen Lebensabschnitt deshalb keine Erinnerung haben, weil es ihn tatsächlich nie gegeben hat?
Nachts sind alle Katzen grau und auf alten, rot- oder blaustichigen Polaroids sieht jedenfalls für mich ein Baby wie das andere aus. Und der Knabe in schulreifem Alter, der sich keck für mich ausgibt, hat doch im Grunde verblüffend wenig Ähnlichkeit mit meinen späteren Ichs. Was, wenn wir alle nur Replikanten sind, denen wie der bionischen Rachel im Blade Runner eine durch manipulierte Fotos und sentimentale Erinnerungs-Implantate scheinbar lückenlos belegte Kindheit lediglich vorgaukelt wird?
Klar, dass ich mich unter solch dubiosen Prämissen meinen eigenen ersten schemenhaften Kindheitserinnerungen mit allergrößten Vorbehalten nähere. Zumal diese erneut im Zeichen eines Paradoxons stehen, das mein grundsätzliches Misstrauen als gerechtfertigt erscheinen lässt.
Die auf Selbsterhaltung und Fortpflanzung geeichte Natur fremdelt mit der von uns Menschen so bewunderten ästhetische Zweckfreiheit. Selbst wenn sie uns mit ihrer Schönheit gelegentlich zu überwältigen scheint, ist das weniger ihrer Verspieltheit als unserer Hybris geschuldet, die dem kosmischen Chaos einen wie auch immer gearteten Plan unterstellt, ohne den unser in Wahrheit sehr beschränkter Geist von der Fassungslosigkeit des Universums gelähmt würde.
Das jeder Form von Selbsterhaltung und Propagation im Wege stehende Paradoxon ist der Natur erst recht verhasst. nichts anzufangen. Nicht der Tod, sondern das die Sinnfrage stellende Paradoxon ist der größte Feind unseres biologischen Fortbestandes und deutet insofern überall dort, wo es offen zutage tritt, in etwa so auf menschliche Intervention wie erratische Abweichungen in den Umlaufbahnen von entfernten Planeten auf das Vorhandensein selbst nicht sichtbarer schwarzer Löcher. Wo der Verstand an seine Grenzen stößt, helfen bisweilen Träume weiter. Ähnlich strukturiert wie Filme, benötigen sie ein Drehbuch und Regieanweisungen. Meine eigene früheste Kindheitserinne-rung könnte gut und gern als Beginn eines Streifens herhalten.
Regieanweisung: Kamera zieht auf und zeigt ein kleines, schmuck-loses, klinisch weiß gestrichenes Zimmerchen. In einem primitiven Kinderbettchen unter dem Sims eines geöffneten Fensters, das direkt auf ein Stück schmaler Landstraße blickt, sitzt ein etwa vierjähriger Junge aufrecht gegen das Kopfkissen gelehnt. Die Landstraße beschreibt just hier eine scharfe Rechtskurve und umarmt das Häuschen, zu dem das Zimmer gehört, wie die Nagold den Ort Altensteig.
Anweisung für die Tontechnik: die fast übernatürliche Stille wird ab und zu von den gequält aufkreischenden Reifen eines der damals noch seltenen zivilen Kraftfahrzeuge zerrissen, die sich meist zu schnell der überraschend scharfen Kurve nähern und auf ihren abgewetzten Firestones in den Graben zu rutschen oder gegen einen der diesen säumenden Bäume zu prallen drohen.
„Ruhe bitte! Und … Action!“
Eine Frau, die ich für meine Mutter halte, obwohl ich ihre Gesichtszüge im Profil kaum erkennen kann, steht in der Mitte des Zimmers rechts von mir an einem primitiven Bügelbrett oder Tisch, dessen Platte sie als provisorische Unterlage benutzt und bügelt große weiße Laken, offensichtlich Bettwäsche. Ob eigene oder fremde, weiß ich natürlich nicht, bilde mir aber im Nachhinein ein, dass es sich um fremde gehandelt haben muss, denn so viele Betten, wie damit zu beziehen wären, werden wir damals nicht besessen haben.
Eine erste Traumsequenz, die auch insofern ganz gut ins Gesamtbild passt, als meine Eltern nach eigener Aussage mit mir vom Schwarzwald kommend zunächst irgendwo an den westlichen Stadtrand des seltsam zerrissenen urbanen Konglomerats zogen, das erst zwanzig Jahre zuvor entstanden war und sich seitdem „Wuppertal“ nannte.
Von einem „Umzug“ zu sprechen, hieße, den Begriffüber Gebühr zu strapazieren, handelte es sich doch um den ersten gemeinsamen und buchstäblich aus dem Nichts erwachsenen Hausstand unserer dreiköpfigen Familie. Dass Ortswechsel wie dieser in jener Zeit auch nicht annähernd so banal waren wie heutzutage, hatte seine Gründe.
Längst durften die Deutschen sich ja noch nicht wieder als uneingeschränkte Herren im eigenen Hause betrachten und Freizügigkeit in Gestalt von Niederlassungsfreiheit und freier Wahl sowohl des Wohnortes als auch der beruflichen Tätigkeit waren bis auf Weiteres utopisch im abwertenden Sinne von absolut unrealistisch. Wer sich wo ansiedeln durfte, bestimmten sehr weitgehend die alliierten Besatzungsmächte. Und die sahen noch eine ganze Weile ziemlich genau hin.
Wuppertal liegt im heutigen Nordrhein-Westfalen, dem größten und bevölkerungsreichsten Bundesland, in dem nach Kriegsende zunächst die Briten das Sagen hatten und darüber entschieden, wem das Bleiberecht gewährt und wem es verwehrt wurde. Das galt im besonderen Maße für die rund 12 Millionen Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten einschließlich der damaligen sowjetischen Besatzungszone, die sich bald DDR nennen würde. Die Menschen aus dem Osten des ehemaligen Reiches waren Deutsche vom anderen Stern mit nicht sehr euphonisch klingenden Dialekten und eigenartigen Gebräu-chen. Menschen, die von einem völlig am Boden liegenden und noch dazu vom ehemaligen Feind besetzten Gebiet auf dem Wege zur Bundesrepublik Deutschland irgendwie absorbiert und assimiliert werden mussten. Wenn Personen dieser wenig beneidenswerten Kategorie, bisweilen völlig auf sich allein gestellt und wehrlos den Anfeindungen der örtlichen Landsleute wie der Willkür der Besatzungsmächte ausgesetzt, von den Alliierten aus welchen Gründen auch immer zurückgewiesen wurden, war das für sie eine ähnliche existenzielle Katastrophe wie, sagen wir, die Ablehnung eines europäischen Immigranten durch die amerikanische Einwanderungsbehörde auf Ellis Island.
Probleme solchen Ausmaßes hatten meine Eltern vermutlich nicht zu gewärtigen. Hier an der Peripherie Elberfelds gab es offenbar auch für sie inzwischen wieder knappen, primitiven, aber gerade noch erschwinglichen Wohnraum. Dass meine Mutter dort durch Bügeln zum Lebensunterhalt der dreiköpfigen Familie beitrug, kann durchaus Gegenstand späterer Erzählungen gewesen sein, obgleich mir solche nicht bewusst sind. Das Stückchen Landstraße, die Stille und das gelegentliche Aufkreischen der Autoreifen hingegen sind akustische Details, auf die in ihren Berichten einzugehen meine Eltern viel zu prosaisch waren. Und da sie mir auch sonst niemand hätte einflüstern können, dürften sie folglich auf eigenem Erleben beruhen.
Drei Jahre nach Kriegsende und kurz vor dem Abschluss der ersten Welle Nürnberger und Rastatter Prozesse erlahmten die Bemühungen um breit angelegte Entnazifizierung jedenfalls auf Seiten der West-Alliierten allmählich spürbar. Unzähligen Formulare mit Antworten auf nicht weniger als je 131 Fragen auszuwerten zu müssen, wo eine einzige Frage eigentlich ausgereicht hätte, war sicher kein Vergnügen. Wahrscheinlich hatten Amerikaner, Briten und Franzosen auch längst eingesehen, dass sie sich mit der Abschöpfung der an der Oberfläche treibenden braunen Fettaugen jedenfalls dann zufriedengeben mussten, wenn ihnen an der Funktionsfähigkeit von Wirtschaft, Verwaltung und Justiz eines demnächst neu zu gründenden westdeutschen Staates namens Bundesrepublik gelegen war. Und dass ihnen daran gelegen sein musste, dafür sorgte der kalte Krieg, der praktisch bereits begonnen hatte, bevor der „heiße“ geendet hatte. Ein funktionstüchtiger, Amerika-höriger Pufferstaat in der Mitte Europas käme einem ersten Bollwerk gegen den aggressiven, expansiven Kommunismus sowjetischer Prägung gleich und wäre als solches hochwillkommen.
Von der Nazi-Vergangenheit unbelastete Fachleute aller Sparten wuchsen nicht auf den Bäumen. Bis die jungen Generationen so weit waren, Verantwortung übernehmen zu können, musste eben die alte Garde herhalten, egal, wie sie zu Hitler und den Nazis gestanden hatte. Also besser, schon mal ein Auge zuzudrücken und der Bevölkerung eines besetzten und verwüsteten Landes, dem kriegsbedingt sowieso ganze Generationen produktiver Kräfte in der Blüte ihrer Jahre fehlten, mit dem European Recovery Programme (ERP) unter die Arme zu greifen. Das als sogenannter Marshall-Plan weithin bekannt gewordene ERP verteilte keine Almosen, sondern stellte rückzahlbare Kredite für Investitionen in die gewerbliche Wirtschaft, vor allem aber in die lebensnotwendige Energie- und Nahrungsmittelindustrie zu günstigen Konditionen zur Verfügung. Andere Hilfsformen wie die sogenannten Care-Pakete, Schulspeisung und weitere kamen nicht nur von den Amerikanern, sondern wurden beispielsweise auch von Skandinaviern geleistet. Aufs Ganze gesehen, tut man ihnen jedoch nicht Unrecht, wenn man sie im Vergleich mit dem ERP als Maßnahmen von eher symbolischer Bedeutung betrachtet.
An seiner früheren Parteimitgliedschaft wird es also nicht gelegen haben, dass mein Vater sich zunächst auch in Wuppertal schwertat, einen passenden Job zu finden. Zwar verlangte der bald allerorten hastig in Angriffgenommene Wiederaufbau nach Arbeitskräften, aber so wohltuend sich die Währungsreform in Gestalt der Einführung der D-Mark für die Wirtschaft ausgewirkt hatte, so relativ katastrophale Folgen zeitigte sie zunächst auf dem Arbeitsmarkt. Ein Phänomen, das sich nach der Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands und Einführung der D-Mark in der ehemaligen DDR in leicht abgewandelter Form wiederholen sollte. Kaum ein Unternehmer war 1949 überhaupt in der Lage, Löhne in harter Währung von einer Höhe zu zahlen, die es seinen Beschäftigten ermöglicht hätte, die jetzt plötzlich wieder in den Regalen der Geschäfte auftauchenden Waren, vor allem Lebensmittel, auf denen die Kaufleute zuvor offensichtlich abwartend „gesessen“ hatten, in erforderlicher Menge zu erstehen. Das freie Spiel der Marktkräfte kam einem Tanz auf dem Hochseil gleich, dem nicht jeder und jede gewachsen sein würde. Wer herabfiel, musste von einem Netz sozialer Grundversorgung aufgefangen werden. Das war die Quintessenz von Ludwig Erhards propagierter „sozialer Marktwirtschaft“, die der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bis weit ins 21. Jahrhundert hinein frönen würde.
Anzunehmen, dass sich mein Vater zunächst mit Gelegenheitsarbeiten zufriedengeben und sich auf diese Weise unangenehm an die zwanziger Jahre erinnert gefühlt haben musste, in deren Verlauf er bereits einmal lange auf fruchtloser Jobsuche unterwegs gewesen war. Nur, dass er nun kein junger Springer mehr war und sozusagen nur noch einen Schuss in der Trommel hatte.
Und meine Mutter bügelte währenddessen offenbar anderer Leute Bettwäsche. Gegen die Annahme, dass es sich bei der oben geschilderten Traumsequenz um ein Implantat handeln könnte, spricht vor allem auch der Umstand, dass meine Eltern jedenfalls in meiner Gegenwart nur sehr selten über die Vergangenheit sprachen. Dieses selbst auferlegte Schweigegelübde, das ähnlich für meine gesamte Verwandtschaft galt, hatte neben mancherlei Nachteilen zumindest den einen positiven Effekt, dass man mir so gut wie keine Pseudo-Erinnerungen aufgeschwätzt haben kann.
Zu dem Wenigen, das irgendwann doch durchsickerte, gehörten vor allem die Schilderungen von Misshandlungen, denen einige meiner Altersgenossen und ich in einem Wuppertaler Kindergarten ausgesetzt gewesen waren. Um sich die Arbeit zu erleichtern, band uns das fachlich wahrscheinlich in keiner Weise qualifizierte Personal beispielsweise an die Betten. Als meine Mutter davon erfuhr, schlug sie Alarm und nahm mich prompt wieder aus dem betreffenden Kindergarten, obwohl das ihre eigene Tagesgestaltung sicher nicht erleichterte.
Das eigentlich Merkwürdige an dieser Episode, die sich viele Monate nach der Bügelszene zu einem Zeitpunkt ereignet haben muss, als wir bereits in den Elberfelder Stadtteil Vohwinkel weitergezogen waren, be-stand darin, dass ich selbst nicht die geringste Erinnerung daran habe, obwohl sie theoretisch doch eine sehr viel traumatischere und nachhaltigere Wirkung hätte zeitigen müssen als das Bild meiner stumm und harmlos vor sich hinbügelnde Mutter.
Möglich, dass die schockierende Erfahrung von mitdenkenden Synapsen blockiert und auf das vegetative Nervensystem verwiesen wurde. Zu dieser Vermutung gibt mir jedenfalls meine seltsam stark ausgeprägte Klaustrophobie ebenso Anlass wie mein Horror vor dem schwefligen Höllengestank, den ich stets mit den Vohwinkler Bayerwerken und deren ungeschlachten dunklen Industrieanlagen jenseits der Wupper assoziiere. Raumangst ist im Gegensatz zu anderen Phobien offenbar eine weitere Form von Furcht vor Kontrollverlust. So kann ich noch heute zum Beispiel nicht bei vollem Bewusstsein in eine MRT-Röhre klettern. Mich beim Segeln auf kleinen Yachten in sargähnliche, innen an der Bordwand angebrachte Kojen zu quetschen, hat mir hingegen noch nie etwas ausgemacht. Das Element der spürbaren Fortbewegung spielt wohl ebenfalls eine Rolle, denn während ich es in einer fliegenden Zigarre von Flugzeug stundenlang aushalten kann, gerate ich in Panik, wenn sich am Boden nicht alsbald die Tür öffnet, um uns Passagiere aussteigen zu lassen. Ob ich mich dessen ungeachtet hinter das Steuer eines Formel-1 Boliden klemmen könnte, wage ich zu bezweifeln, obwohl hier sowohl Bewegung als auch Kontrolle gewährleistet scheinen.
Schwefelgeruch gehörte zu den Begleiterscheinungen, die mich instinktiv dazu veranlassten, das Fach Chemie schon nach einem für mich so lästigen wie unnützen „Pflichtjahr“ wieder abzuwählen. Die Chemiker werden’s verschmerzt habe ...
Und dann waren da erneut die Treppen, diesmal aber nicht die drei, vier Stufen zur Haustür, sondern die halbe Leiter zum Olymp. Ich bin sicher, dass wir irgendwo auf einem der nördlichen Hügel Vohwinkels wohnten, so dass man auf dem Weg von der Talsohle nach oben ganze Fluchten jener steinernen Treppen steigen musste, denen man im hügeligen Wuppertal praktisch nirgendwo entrinnt. Wenn mal ein Hamburger seine Heimatstadt wegen der paar durchweg hässlichen Brücken in einem Anfall von Geschmacksverirrung in Tateinheit mit Größenwahn als das „deutsche Venedig“ bezeichnete, wusste Tom Tykwer das durch seinen mindes-tens ebenso schrägen Vergleich Wuppertals mit San Francisco zu toppen. Und da die Straßenbahnen sich überwiegend im Tal aufhalten, muss man schon ganz gut zu Fuß sein, um den Wuppertaler „high ground“ zu gewinnen. Kinderwagen kann man gleich ganz zu Hause lassen.
Vohwinkel, dessen Name so ungut an den sprichwörtlichen Krähwinkel erinnert, bildet heute das westliche Streckenende der über knapp 13,5 Kilometer im Rundverkehr betriebenen Schwebebahn. Die sollte ursprünglich nur von Rittershausen in Oberbarmen, bis zum Wuppertaler Zoo fahren. Auf vielfachen Wunsch einzelner einflussreicher Vohwinkler wurde die Strecke jedoch schließlich um jenen Wurmfortsatz verlängert, der sich dadurch auszeichnet, das er als einziges Teilstück nicht über den Fluss, sondern über eine Straße führt, so dass man den Anrainern links und rechts ab etwa Etage drei während der Fahrt bequem in die Wohnungen blicken kann. Nach rund zwölf Kilometern eher langweiligen Flusspanoramas mit vielen alten, unansehnlichen Fabrikanlagen aus Ziegelsteinen zu beiden Seiten eine durchaus willkommene Abwechslung. Die vom Straßenlärm und dem Kreischen der Bahn ohnehin genervten Anwohner tun folglich gut daran, nicht nur ihre Fenster geschlossen zu halten, sondern auch noch die Gardinen und Vorhänge zuzuziehen. Damit wird’s dann in der Wohnung zwangsläufig noch düster, als es bei der engen Bebauung ohnehin wäre, aber man hat jedenfalls schon mal Ruhe vor den Gaffern, die heutzutage auch noch jederzeit Bilder mit den Handys schießen können. Der Bau der Bahn als solcher war durchaus nicht Ausdruck verspielter Ingenieurskunst oder megalomanischer Überschätzung ambitionierter Stadtväter nach dem Motto „weil wir’s können“, sondern das erstaunlich zeit- und kompromisslose Ergebnis einer leidenschaftslosen Suche nach der effektivsten, sichersten und, wie man heute sagen würde, nachhaltigsten Lösung eines offenkundigen Problems der örtli-chen Verkehrsinfrastruktur. Zwischen den beiden „Inseln“ Elberfeld und Barmen verengt sich das sie miteinander verbindende Tal der Wupper zum Teil so arg, dass großzügigem Straßenbau immer schon Grenzen gesetzt waren und die vorhersehbar schnell zunehmende Anzahl von Kraftfahrzeugen sich den knappen Platz auch noch mit Tram und Eisenbahn würde teilen müssen.
Dem Bau einer U-Bahn hätte der vermutlich relativ hohe Grundwasserspiegel im Wege gestanden. Die seichte Wupper war zwar immer noch tief genug, um den Verzweiflungssprung des wohl von klaustrophobischer Panik erfassten Elefantenbabys Tuffi aus der fahrenden Bahn während einer Zirkus-Werbeaktion im Jahre 1950 hinreichend abzufedern. Um sie jedoch quasi „schiffbar“ machen und den Verkehr damit ein wenig entlasten zu können, hätte sie auch wesentlich breiter sein müssen.
Den Fluss nach dem vom Kölner Ingenieur und Erfinder Eugen Lange ersonnenen Prinzip mit einer an Schienen hängenden Hochbahn zu überbauen, war eine eigenwillige, nicht eben billige, aber angesichts der vorgegebenen Topographie letzten Endes sowohl technisch als auch wirtschaftlich alternativlose Lösung. Verantwortlich für ihre materielle Verwirklichung war die extra zu diesem Behuf als Tochter der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft gegründete „Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen“. Die Nähe Wuppertals zu den Essener Kruppstahlwerken dürfte dabei zumindest nicht hinderlich gewesen sein. So konnte man insgesamt 10.200 Tonnen Eisen zu Schienen von fast 30 Kilometer Länge und nahezu 500 Stützen verarbeiten. 16 Millionen Gold-mark kostete der Spaß insgesamt. Ein Preis, der, wollte man ihn in etwa den heutigen Kaufkraft-Gegebenheiten anpassen, sicher die eine oder andere Null mehr aufweisen müsste.
Angesichts des Fahrgastaufkommens, das bis 1925 bereits insgesamt 20 Millionen Passagiere betrug, wäre es unverantwortlich gewesen, die Bahnstrecke trotz der kriegsbedingten schweren Beschädigungen nach 1945 nicht wieder instand zu setzen und die Schwebebahn weiter zu betreiben. Modernisierungsbemühungen hielten sich in Grenzen und beschränkten sich weitgehend auf das rollende Material, schloss beispielsweise die Einführung von Gelenkzügen ein, wie man sie von Straßenbahnen und Bussen kennt.
Bis 1995, als nach Reparaturarbeiten ein Zug entgleiste und fünf Passagiere beim Absturz ums Leben kamen, hatte die Bahn zudem als eines der weltweit sichersten Verkehrsmittel gegolten.
Ein Londoner, der Anspruch darauf erhebt, zum exklusiven Klub der „Cockneys“, sprich, der geborenen City-Bewohner zu gehören, muss, so wollen es die strengen britischen Gebräuche, in Hörweite der Glocken der St. Mary-le-Bow-Kirche das Licht der Welt erblickt haben.
Als echter Wuppertaler gilt angeblich nur, wer in Hörweite des schrillen Kreischens von Schwebebahn-Rädern auf stählernen Schienen geboren wurde, was die Vohwinkler natürlich als privilegiert erscheinen lässt und Zugewanderte wie mich automatisch ausschließt.
Enttäuschend, wenn ich zum Ausgleich nicht eine andere wichtige, die Aufnahme erleichternde Voraussetzung zur erfüllen würde. Und die hat mit meinem Familiennamen zu tun.
„Werner“ gehört zur großen Gruppe von urdeutschen Namen, die gewissermaßen palindromisch als Vor- und Nachnamen Verwendung finden: Martin, Klaus, Heinz, Paul – nicht aber zum Beispiel Wolfgang oder Isidor. Warum nicht auch die, welche Kräfte und Regeln hier am Werk sind, ist mir nicht bekannt. Ich glaube nur zu wissen, dass ich noch nie einem „Herbert Wolfgang“, aber durchaus schon mehreren „Wolfgang Herberts“ begegnet bin. Derlei Namen in Doppelfunktion sind über ganz Deutschland ähnlich weithin verbreitet wie ehemalige Berufsbezeichnungen der Sorte Müller oder Meier. Das eigentliche „Nest“ der Werners aber ist Wuppertal, wo bis vor kurzem gefühlt mindestens jeder zweite Einwohner Träger dieses Namens war. Sicher ein Zeichen für ehemals im Tal und auf den Höhen grassierende Inzucht, die dafür sorgte, dass die Werners hier so zahlreich anzutreffen sind wie die Jensens und Hansens in Kopenhagen oder die Özdemirs, Cans und Gündoǧans in Istanbul oder Kreuzberg.
So gesehen schwer nachzuvollziehen, warum Else Lasker-Schüler den beiden sozial kontrapunktisch-antipodisch angeordneten Familien ihres Dramas Die Wupper relativ ausgefallene Namen wie „Sonntag“ oder „Pius“ gab, wo die „Werners“ sich doch regelrecht aufgedrängt haben müssen.
Vielleicht kannte sie Lessings Minna von Barnhelm, ganz sicher sogar, und wollte dem dort auftretenden Wachtmeister Paul Werner aus dem Wege gehen, um nicht in die Nähe des Plagiats zu geraten. Als Primaner leistete ich mir mal den skurrilen Gag, diesen an und für sich weder interessanten noch ergiebigen Wachtmeister zum Gegenstand einer Klassenarbeit zu machen: was tut man nicht alles, um für einen Tag, eine Woche Gesprächsthema zu sein.