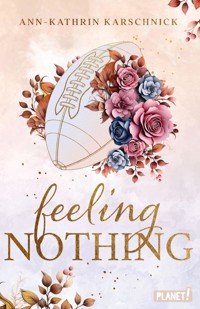4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ann-Kathrin Karschnick
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Weltenreisen, Magie, Götter. All das liegt jenseits von Melissas Vorstellungskraft, bis sie an ihrem siebzehnten Geburtstag ein außergewöhnliches Amulett findet. Sie tritt damit ein dunkles Familienerbe an, das sie in die fremde Welt Traveste führt. Als der Königsberater Cerumak ihr eine scheinbar unlösbare Aufgabe stellt, gibt ihr der Gedanke in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Mutter zu treten Kraft. Aber nicht jeder ist ihr gut gesinnt. Arionas, der geheimnisvolle Sohn eines Attentäters, entführt sie aus dem Palast und weckt Zweifel in ihr. Kann sie ihm vertrauen oder ist sie im Kampf um das Schicksal von Traveste auf sich allein gestellt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
WELTENAMULETT
Das Erbe der Trägerin
Ann-Kathrin Karschnick
Copyright © 2018 Ann-Kathrin Karschnick
www.ann-kathrinkarschnick.de
Cover: Alexander Kopainski
Unter der Verwendung von Bildmaterial von Shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 3981957204
13-stellige ISBN: 978-1-9809208-3-0
Für Carsten, ohne den die Mittagspause
weit weniger phantastisch gewesen wäre.
Inhalt
Prolog
Das Geräusch
Der Dachboden
Elf Jahre zuvor
Das Amulett
Die Höhle
Die Reise
Der erste Auftrag
Die Bibliothek
Der König
Der Pfeil
Flucht
Schuld
Absturz
Geständnisse
Fremde Macht
Tiefpunkt
Erwachen
Die Insel
Vermeintlicher Verrat
Die Barriere
Rache
Rückkehr
Epilog
Der Allmacht entsprungen …
Prolog
Einst glaubten wir, die Erde wäre eine Scheibe. Wir glaubten, sie wäre das Zentrum des Universums.
In Wirklichkeit sind wir winzig. So winzig, dass selbst die Götter unsere Welt verlassen haben. Sie zogen aus, andere Völker zu regieren, zu erobern und kennenzulernen. Die Erde haben sie jedoch nie vergessen.
Wie könnten sie auch? Jeder Gott, jedes Lebewesen im Universum – egal wie sehr er sich von uns Menschen unterscheidet – kennt sie: Die Legende der Frau, die versucht hatte einen Gott zu töten.
Um dieser Anmaßung ein gerechtes Urteil zukommen zu lassen, schmiedeten die Götter vor hunderten von Jahren ein Amulett, in dem sie ihre Kräfte bündelten. Dieses Amulett legten sie der Verräterin an. Fortan musste sie den Befehlen der Götter Folge leisten. Sie führte kein eigenes Leben mehr, konnte nicht frei über ihr Dasein bestimmen und nicht vor ihrer Zeit sterben. Als Dienerin der Götter half sie den Welten, in denen die Götter nicht helfen durften.
Doch die Götter waren grausam. Sie übertrugen diese Bürde nicht nur ihr, sondern jeder ihr nachfolgenden Generation. Ein Entkommen war unmöglich.
Bis eines Tages eine Trägerin kam, die nichts von dieser Bürde ahnte. Sie wusste nicht, dass das Amulett eine Bestrafung war, hatte keine Ahnung, wofür es einst geschmiedet worden war. Und mit ihren unbedachten Handlungen würde sie das jahrtausendealte Gefüge der Welten aufbrechen.
Das Geräusch
50 Generationen später
Heute wollte Melissa nicht an ihre Mutter denken. Nein! In den letzten Jahren hatte es genug Tage gegeben, an denen sie in einer Ecke gesessen und den Kopf in die Hände gestützt hatte. In denen sie sich von dem Verlust hatte herunterziehen lassen.
„Platz da!“ Eine Fahrradklingel ertönte hinter ihr.
Melissa sprang hastig zur Seite, als eine blonde Haarmähne an ihr vorbeiraste und das Fahrrad schlitternd auf der laubbedeckten Einfahrt zum Stehen kam. Der Holzzaun bremste Melissas Sprung schmerzhaft ab. Er war rissig, Farbe blätterte ab, und wenn man ihm zu nahe kam, hakten sich Farbstückchen in der Jacke fest. Ohne einen neuen Anstrich würde er den kommenden Winter nicht überstehen.
„Na, Alte“, rief Eva ihr lachend zu, „wie fühlt man sich mit siebzehn?“ Eva lehnte ihr Fahrrad gegen den hohen Lamellenzaun, der die etwa zwanzig Meter lange Auffahrt vom Garten trennte. „Lass mal sehen, was dein Dad für heute geplant hat!“, sagte sie.
Manchmal glaubte Melissa, dass Eva nur vorgab, gelassen zu sein. Dass sie es tat, um Melissas Gedanken davon abzuhalten, wegzudriften. Obwohl sie so verschieden wie Wind und Wasser waren, war Eva ihre beste Freundin.
In den ersten Wochen nach dem Unfall hatte Eva bei ihr geschlafen. Nacht für Nacht war Melissa damals aus schrecklichen Träumen hochgeschreckt, Träume, die mit einem grellen Scheinwerferlicht im Augenwinkel begannen. Ohne Eva, die ihr jedes Mal besänftigend aus der Dunkelheit zugemurmelt oder sie in den Arm genommen hatte, hätte sie aufgegeben. Ihre Freundin kannte ihre Gefühlswelt besser als jeder andere. Besser als ihr Vater.
Ein Lächeln schlich sich auf Melissas Lippen und war die wortlose Beruhigung, dass alles in Ordnung war. Sie, Melissa, würde den Tag überstehen. An der Art, wie Eva ihren Blick erwiderte, wusste Melissa, dass sie verstand. Dennoch hatte Eva einen Moment zu lang gezögert, ehe sie zurücklächelte.
Melissa wusste, woran es lag. Ihr rechtes Auge war dunkelbraun, das linke hellblau. Ein kleiner Unterschied sollte man meinen, es war nur eine andere Farbe. Aber auf viele Menschen wirkte es irritierend, so dass sie einen zweiten Blick riskierten. Selbst Eva tat es ab und an noch, wenn sie glaubte, dass Melissa es nicht bemerkte.
An manchen Tagen, wenn das Licht in einem bestimmten Winkel das blaue Auge traf, schien es aus sich heraus zu leuchten. Warm, beinahe zärtlich. Das braune Auge hingegen schmälerte diese Wirkung und brachte etwas Diffuses in ihr Gesicht. In letzter Zeit hatten Eva und Melissa öfter darüber geredet. Vor allem, da Melissa überlegte, sich für ihr linkes Auge eine farbige Kontaktlinse zuzulegen, um endlich den irritierten Blicken zu entgehen. Bisher hatte Eva ihr das mit Erfolg ausreden können. Sie hatte ihr erklärt, dass es ihr Markenzeichen war. Die Augen wären nur der Ausdruck für etwas Besonderes, die Spitze des Eisbergs, während neunzig Prozent unter ihrer Haut lagen. In Melissas Innerem.
Melissa ging am Auto ihres Vaters vorbei zur Haustür und wühlte in ihrem Rucksack nach dem Schlüssel.
Alles, was sie nicht brauchte, bekam sie zu fassen: Schulbücher und Hefte, den iPod und diverse herumfliegende Stifte. Ihre Finger wühlten weiter, glitten über die kühle Oberfläche der Heizspirale. Ihre neueste Errungenschaft, die sie dem Hausmeister der Schule abgeschwatzt hatte, und endlich, der Schlüssel!
„Mach schon! Ich bin ganz aufgeregt.“ Eva stieß ihr den Ellenbogen in die Seite.
„Immer mit der Ruhe“, sagte Melissa und zog den Schlüssel betont langsam aus der Tasche. „Wer von uns beiden ist das Geburtstagskind?“
Als sie den Schlüssel ins Schloss steckte, regte sich ihre Neugier ebenfalls. Kaum hatte Melissa die Tür aufgeschoben, hörte sie sofort die Geräusche, mit denen sie aufgewachsen war: ein leises Surren und Heulen. Ein Schnarren und Ratschen. Ohne ihre Jacken auszuziehen, folgten Melissa und Eva den Klängen in die Küche. Dort saß Melissas Vater wie üblich über einem seiner Radios gebeugt. Die Teller vom Vortag stapelten sich in der Spüle. Melissa rümpfte die Nase. Den Müll hatte er auch nicht raus gebracht. Sie schüttelte den Kopf. Er vergaß einfach alles, wenn er an einem der Geräte arbeitete, sogar zu essen. Am Lasagnegeruch, der sich durch die Küche zog, erkannte sie, dass er zumindest die Reste des gestrigen Abendessens zu sich genommen haben musste.
Ihr Vater hatte ein Faible für Technik. In jedem Zimmer befanden sich ein NAS, ein Radio, ein Fernseher und ein BluRay-Player. Die Kabelschächte an den Wänden, selbst hier in der Küche, waren für Melissa ein alltägliches Bild. Im gesamten Haus sind mindestens zwei Kilometer Kabel verlegt, dachte sie.
„Hi, Dad“, sagte Melissa.
Wenngleich sie bewusst leise gesprochen hatte, zuckte sein Arm. Das Gerät unter seinen Händen gab ein letztes erschrockenes Fiepen von sich, ehe es nur noch still vor sich hin blinkte.
Ihr Vater hob den Kopf und sagte: „Ich habe euch nicht kommen hören.“ Er lächelte. „Was gibt es Neues in der Schule?“, fragte er, schaltete den Fernseher aus und ließ die hundertste Wiederholung von Hör mal, wer da hämmert im Dunkeln verschwinden.
„Schule war wie immer, Herr Neumann“, antwortete Eva.
„Wie bitte?“
„Verzeihung, Phillip.“
„Das klingt besser“, sagte er. „Bei Herr Neumann fühle ich mich wie ein ausgestorbenes Tier der Kreidezeit.“
Eva schmunzelte und er lächelte zurück. Eine sympathisch schiefe Zahnreihe kam zum Vorschein.
Ihr Vater hatte eine höllische Angst vor Zahnärzten und riskierte lieber ein paar schiefe Zähne, statt sich dieser Furcht zu stellen. Sein Oberlippenbart verhinderte ohnehin einen zu genauen Blick auf seine Zähne. Den Bart hatte er sich vor etwa drei Jahren wachsen lassen. Es war zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter. Damals schien er endgültig die Lust auf alles verloren zu haben, auch aufs Rasieren. Nach einer Weile entstand aus dieser Protesthaltung ein Bart.
„Komm her, Kleine.“ Bevor Melissa sich wehren konnte, hatte er sie hochgehoben. Seine Hände verfingen sich in ihren schulterlangen Haaren.
Sie zappelte und rief: „Dad, ich bin siebzehn geworden, nicht sieben. Lass mich runter!“ Da setzte er sie ab und wischte sich verlegen über den Hinterkopf, als würde ihm erst jetzt bewusst werden, dass kein kleines Mädchen mehr vor ihm stand. „Sag lieber, was wir heute machen!“, sagte sie. „Eva platzt gleich.“
„Also“, sagte er, „was haltet ihr davon: zuerst den Italiener stürmen und im Anschluss Kart fahren?“
Obwohl er genau wusste, dass Melissa Kart fahren liebte und Eva eine Schwäche für Essen in jeglicher Form hatte, begann er unsicher mit seinem Schraubenzieher zu spielen. Als fragte er sich, ob sie beide zu alt für diese Art von Spaß waren und er sich mit seinem Vorschlag blamierte. Aber Melissa und Eva zwinkerten sich zu und grinsten.
„Klasse, wann geht’s los?“, rief Eva.
„Der Tisch ist erst in einer Stunde reserviert. Ihr habt genug Zeit, euch zu präparieren“, sagte Melissas Vater und lächelte.
Die Mädchen liefen die Treppe hinauf. Ein kurzer Flur brachte sie zu Melissas Zimmer. Die anderen beiden Türen auf dem Gang führten zum Gästebad und zur Abstellkammer.
„Na, was hast du umgeräumt?“, fragte Eva und versuchte. an ihrer Schulter vorbei zu spähen.
„Guckst du!“, erwiderte Melissa mit einer ausladenden Geste.
Seit Melissa vor vier Jahren ihre Möbel umgestellt hatte, war sie nicht mehr von dem Gedanken losgekommen, immer noch ein wenig mehr zu verändern. Erst hatte sie begonnen, alte Elektroteile, die ihr Vater weggeworfen hatte, aus dem Müll zu fischen und sie an ihre Wand zu hängen. Nachdem ihre Mutter gestorben war, hatte es sich mit einem Mal unheimlich angefühlt, in einem Zimmer mit glatten Wänden leben zu müssen, an denen alles abprallte. Die Gedanken. Die Erinnerungen. Sie wollte sich selbst in dem Zimmer finden und haften bleiben. Geschichten zu jedem Teil des Raums erzählen können.
Nach einer Weile waren es nicht mehr nur die Wände, die sie mit diversen Metallteilen, Stangen, Kabeln und LEDs ausstattete - auch ihre Möbel blieben nicht verschont. Einzig ihr Bett ließ sie unangetastet. Sie wollte sich nachts in Ruhe von einem Ende zum anderen wühlen können, ohne von einem ihrer Dekorationsstücke aufgespießt zu werden. Eva hatte ihr Zimmer Maschinenraum getauft. Der Maschinenraum eines abgestürzten Raumschiffs.
Vor einem Jahr war sie auf die Idee gekommen, den Schrottplatz im Nachbarort aufzusuchen. Dieser hatte sich ihr als Quell neuer Einrichtungsmöglichkeiten eröffnet. Dort hatte sie unter anderem die schwarze Motorhaube gefunden, die über ihrem Schreibtisch hing und als Magnettafel diente. Sie glänzte, so dass sich Melissas Gesicht darin spiegelte. Seither fuhr sie einmal im Monat dorthin, um nach Schätzen für ihre Sammlung zu suchen.
Melissa verwandelte jeden Besuch von Eva zu einem Spiel. Bevor Eva sich setzen durfte, musste sie herausfinden, was im Maschinenraum neu hinzugekommen war. Inzwischen hatten sie einen Highscore für die schnellste Rate-Zeit eingerichtet.
„Okay, bin bereit!“
Melissa hörte Evas tiefen Atemzug und sah amüsiert, wie sie den Kopf von links nach rechts warf und wie ein Boxer mit ihren Füßen tänzelte.
„Los!“ Melissa startete die Stoppuhr.
Wie ein Pfeil schoss Eva an ihr vorbei, drehte sich in der Mitte des Zimmers wie ein Derwisch und scannte akribisch alle Gegenstände.
„Okay … die Kabeltrommelsteckdosen am Schreibtisch sind es nicht … die sind von letzter Woche. Warte, ich hab's gleich. Da, die Tastaturbuchstaben auf deinem Kleiderschrank! Ach nein. Da, da, da! Die Mixerschneebesen an der Decke“, rief ihre beste Freundin und zeigte auf die Quirle, die von der Lampe hingen. „Ha, ich bin gut“, brummte sie und tat so, als klappe sie einen Hemdkragen hoch.
„12,54 Sekunden. Nicht schlecht.“ Melissa las auf der Pinnwand über ihrem Nachttisch nach. „Das sind 1,27 Sekunden über der persönlichen Bestleistung“, sagte sie, nachdem sie kurz im Kopf nachgerechnet hatte.
Auf dem Nachttisch stand eine Fotocollage, die Eva ihr vor zwei Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie war froh, dass sie wenigstens eine künstlerisch begabte Person kannte. Sie war in dieser Hinsicht eine absolute Niete.
Neben einem schmalen Computertisch am Ende des Zimmers standen dickbäuchige, dunkelbraune Korbmöbel. Die weißen Auflagen wirkten an ihnen wie die Schürzen eines übergewichtigen Kochs. Ein ovaler Glastisch ergänzte die Sitzecke.
„Was meinst du? Kann ich das anbehalten?“, fragte Eva und deutete an sich herab, während sich Melissa aufs Bett warf. Eva trug Jeans und die verwaschene Kopie eines Ed-Hardy-Shirts.
„Na klar. Warum nicht? Nach dem Kart fahren siehst du eh aus wie ein Löwe, dem die Haare toupiert wurden. Da hilft ein gutes Outfit wenig.“
Das Kissen erwischte Melissa nicht unerwartet. Hastig riss sie ihre blaue Steppdecke hoch und fing den Wurf ab. Als sie die Decke herunterließ, um nach einem Kissen zu greifen, traf sie das zweite mitten ins Gesicht. Lachend bewarfen sich die Zwei mit allem, was Melissas Zimmer hergab. Kuscheltiere, die eben noch auf dem Schrank zwischen der Pylone und der Membran einer Musikbox gesessen hatten, flogen durch die Luft. Die ausgestopfte Katze von Oma Lina auf dem Regal neben dem Schreibtisch blieb als einzige verschont.
Plötzlich hielt Melissa abrupt inne.
„Pssst, sei still“, flüsterte sie. „Hörst du das?“
„Was?“
„Warte!“
Beide knieten einen Meter voneinander entfernt und hielten jeweils ein Kissen angriffsbereit in Kopfhöhe. Da ließ Melissa ihre Arme langsam sinken und lauschte angestrengt. Sie hatte den Kopf schräg gelegt, um besser hören zu können, aber da war nichts. Einfach nichts. Nur ihr Blut, das in den Schläfen pulsierte.
„Was meinst du?“, fragte Eva nach einer Weile.
„Pssst! – Da, da war es wieder! Dieses Pochen! Hörst du´s auch?“
Eva schüttelte den Kopf.
„Moment!“, rief Melissa, schmiss das Kissen aufs Bett und rannte zum Fenster. Sie riss es auf und lehnte sich weit hinaus.
„Du spinnst doch“, sagte Eva. „Hörst du jetzt Stimmen oder was? – Hua-ahh … ich bin die Stimme des Kissens, ich rufe dich … lass mich frei-ei-ei…“, ließ Eva ihre Stimme gespenstisch hallen und warf das Kissen zielsicher gegen Melissas Hintern.
Melissa achtete nicht auf sie. Sie wandte sich um, stürzte zur Tür. Sie lauschte. Ein, zwei Atemzüge lang. Dann lief sie auf den Korridor und polterte die Treppe hinunter.
„Hast du mich gerufen, Dad?“, fragte sie, als sie den Flur im Erdgeschoss durchquerte und in die Küche stürmte.
Aber da war niemand. Ihr Vater stand im Garten und harkte Laub zusammen. Er trug Kopfhörer im Ohr und tanzte mit der Laubharke. Wahrscheinlich hörte er Queen oder AC/DC.
Während ihr Vater eine schwungvolle Runde drehte, fiel es ihr plötzlich ein. Radios! Ihr Vater, der keinen Tag ohne Musik überleben konnte, hatte sicher vergessen, eines auszumachen. Natürlich!
Sie ging von Raum zu Raum, erst im Erdgeschoss, dann in der ersten Etage, wo Eva sie mit fragendem Gesicht erwartete. Alle Zimmer klapperte sie ab, ließ nicht einmal die Gästetoilette aus. Aber überall waren die Radios ausgeschaltet.
„Hallo? Was ist los?“, fragte Eva, die langsam sauer wirkte.
Melissa untersuchte noch ein letztes Mal die Wäschekammer, die still und schläfrig in der Mittagssonne lag. Das Bügelbrett sah aus wie ein mageres, gutmütiges Tier, das reglos die Sonnenstrahlen auf seinem Pelz genoss. Nichts. Totenstille. Melissa schloss die Tür.
„Nichts“, sagte sie und drehte sich endlich zu Eva um. „Ich dachte, ich hätte was gehört. Seltsam. Kennst du das? Du hörst ein Geräusch, und wenn du nachguckst, ist da nichts?“
„Was meinst du?“, fragte Eva verständnislos.
„Na, sowas wie ein Knistern und Pochen in den Wänden oder dieses ewige Knacken im Dachstuhl. In den letzten Tagen höre ich ab und an ein Knabbern, als würde jemand das Haus auffressen. Ergibt das irgendeinen Sinn?“
Eva kniff die Augen zusammen, rückte verschwörerisch näher, blickte wie der Buchstabenverkäufer aus der Sesamstraße über die Schulter und flüsterte: „Jemand nagt am Haus!“ Ihre Hand formte die Titelzeile eines Kinofilms. „Ein Fall für die Winchester-Brüder.“
„Haha. Verarschen kann ich mich alleine“, sagte Melissa beleidigt.
„Hey … sei nicht sauer“, erwiderte Eva besänftigend. „Hör zu, wenn du was gehört hast, war da auch was, aber bestimmt nichts, was dir Angst machen sollte. Vielleicht habt ihr einfach einen Marder auf dem Dach.“
„Das kann's sein!“, rief Melissa dankbar. „Herr Schmitt von nebenan meinte vor zwei Wochen, dass ein Nagetier seinen Benzinschlauch angeknabbert hätte. Ich werde Dad Bescheid sagen. Der soll das Vieh einsammeln. Ich hoffe, es war nicht in meinem Zimmer und hat da Geschenke hinterlassen.“ Bei dem Gedanken daran schüttelte es sie. Melissa ließ Eva den Vortritt, als sie erneut in ihr Zimmer gingen und sich auf den Ausflug mit ihrem Vater vorbereiteten.
Der Dachboden
Melissa schreckte hoch und schnappte nach Luft. Einen Moment lang wusste sie nicht, wo sie sich befand. Jetzt oder fünf Jahre zuvor? Sie tastete ihr Gesicht ab, aber alles war heil. Keine Splitter, die in ihrer Haut steckten. Kein Blut, das ihre Fingerspitzen entlang rann. Es war nicht jetzt passiert. Es war vorbei … schon lange. Sie lag zuhause im Bett, alles war gut. Alles war … gut. Sie atmete tief durch.
Melissa hatte den Unfall nicht miterlebt. Auf dem Beifahrersitz neben ihrer Mutter hatte niemand gesessen. Ihre Mutter war wie jeden Mittwoch zum Einkaufen gewesen, als ein roter Mazda ihr die Vorfahrt genommen hatte. Seit der Polizist vor fünf Jahren an der Tür geklingelt und ihrem Vater die Nachricht von dem Unfall überbracht hatte, waren diese Bilder da. Wie in einem albtraumhaften Kurzfilm spulte ihr Gehirn sie immer wieder ab. Doch es war nicht wie im Kino, wo man hinterher aufsteht und über die gelungenen Stunts und Special Effects redete. Nein, es fühlte sich real an. So real, dass sie noch Sekunden danach glaubte, den metallischen Geschmack von Blut in ihrem Mund zu schmecken.
Melissa erinnerte sich an den Tag. Als der Polizist mit ihrem Vater geredet und nicht auf das 12-jährige Mädchen geachtet hatte, das neben ihm stand. Dieser Hass in ihrem Herzen. Ja, wie sehr sie diesen Mann gehasst hatte! Sie hatte sich auf ihn geworfen und auf jede Stelle seines Körpers eingeschlagen, die sie erreichen konnte. Er versuchte, sie abzuwehren, aber sie fand immer wieder eine ungeschützte Stelle, die sie mit Füßen und Fäusten malträtieren konnte. Sie wollte ihn verletzen. Genau das hatte sie damals gefühlt: Eine rasende, hilflose, eine abgrundtief schreckliche Wut auf diesen Menschen, der die Nachricht vom Tod ihrer Mutter gebracht hatte. Erst als ihr Vater aus seiner Starre erwacht war, sich über sie beugte, auf sie eingeredet und ihren Kopf in seine Hände genommen hatte, ließ sie los. Einen Moment lang hatte sie in die Hand ihres Vaters beißen wollen. Sie war zusammengebrochen, hatte sich an ihn geklammert und geweint.
An manchen Tagen vergaß Melissa, dass ihre Mutter tot war. Sie erwartete ihre leichte, helle Stimme, die sie morgens weckte. Manchmal glaubte sie, ihre Schritte auf der Treppe zu hören und blieb absichtlich länger liegen. Doch je mehr Jahre vergangen waren, je mehr Zeit zwischen dem Polizisten und ihrem fortlaufenden Leben gelegen hatte, desto seltener waren diese Augenblicke geworden. Ganz aufgehört hatten sie jedoch nie. Manchmal verfolgten sie sie sogar bis in ihre Träume.
Melissa lag wie eine Mumie eingewickelt in ihrem Bett. Ihr Blick wanderte die Zimmerdecke entlang und folgte dem Verlauf der ineinander greifenden Zahnräder. Kurz darauf schaltete sie das Licht an und tastete nach ihrem Mathebuch, um sich in den Schlaf zu langweilen. Da hörte sie ein Geräusch.
Es war dasselbe wie am Nachmittag. Sie erstarrte, und die Hand, die nach dem Buch hatte greifen wollen, hing reglos in der Luft. Nach wenigen Sekunden hörte sie es erneut. Das seltsame Trappeln. Verdammt, sie hatte vergessen, ihrem Vater von dem Marder zu erzählen! Kurzentschlossen warf sie die Decke zur Seite und stand auf. Sie musste es ihm sagen, jetzt. Sie würde die ganze Nacht kein Auge zu tun, wenn dieses Vieh im Haus sein Unwesen trieb. Sie öffnete ihre Tür und huschte auf den Flur. Der Teppich dämpfte ihre Schritte.
Das Erdgeschoss lag im Dunkeln. Kein Geräusch war zu hören. War ihr Vater etwa schon schlafen gegangen? Sie knipste das Flurlicht an und entdeckte sofort den Zettel auf dem Telefontisch. Bin auf ein Bierchen bei Schmitt. Die kauzige Standuhr im Flur schlug Zwölf. Es war also nicht bei einem Bierchen geblieben. Wahrscheinlich waren sie über die neuesten technischen Errungenschaften auf dem Radiomarkt ins Schwärmen geraten. Dass zwei solche Technikfreaks in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen konnten, ohne alle paar Tagen einen Stromausfall zu verursachen, grenzte an ein Wunder.
Na super, jetzt kann ich nicht schlafen, bis er nach Hause kommt. Es rumorte in ihr, während sie die Stufen nach oben nahm.
Als ihre Finger die Türklinke zu ihrem Zimmer berührten, hörte sie das Geräusch ganz nah. Ein Klopfen, nein, ein Tappen. Da waren Schritte. Genau über ihr! Auf dem Dachboden. Winzige Schritte, schon fast ein Schaben. Als würden Zehen mit langen Krallen über den Holzboden jagen. Nein, dabei konnte sie auf keinen Fall schlafen! Dieser Marder musste weg, und zwar sofort.
Zielstrebig ging sie in ihr Zimmer, grub ein uraltes Bettlaken aus und wappnete sich sicherheitshalber mit der erstbesten Waffe, die sie finden konnte: Der Katze von Oma Lina. Marder hatten Angst vor Katzen, glaubte sie gelesen zu haben. Sollte das Vieh ruhig versuchen, sie anzugreifen. Mit Miezi, dem ausgestopften Äquivalent einer flohverseuchten Kanalratte, war sie vorbereitet. Ihre Großmutter hatte diese hässliche Katze so sehr geliebt, dass sie sie hatte ausstopfen lassen. Melissas Mutter hatte sie aus Sentimentalität nach Oma Linas Tod behalten. Dabei erinnerte Melissa sich genau, wie Vanessa über Miezi und ihre Anwesenheit beim Essen gemeckert hatte. Ihre Großmutter hatte darauf bestanden, dass dieses herrische, schwarzrot getigerte Vieh einen eigenen Teller und Stuhl bekam. ‚Miezi gehört zur Familie‘, pflegte Oma Lina zu sagen.
Melissa warf sich das Bettlaken über die Schulter und stapfte die Treppe hinauf. Normalerweise durfte sie das oberste Geschoss nur betreten, wenn ihr Vater sie beim Tragen der Weihnachtsdeko brauchte. Aber er war nicht da. Er konnte sie nicht abhalten. Ein Grinsen breitete sich auf ihrem Mund aus.
„Daaaad“, zog sie das Wort in die Länge, „ich gehe jetzt auf den Dachboden.“ Sie lauschte einen Moment, aber niemand hielt sie auf.
Eine zwergenhafte Lampe neben der Tür erhellte den Aufstieg. Die Treppe benötigte kein Geländer. Links und rechts neben den Stufen verhinderten die Mauern des Hauses, dass man zur Seite stürzte. Ab der Hälfte der Stufen waren die Wände nicht mehr tapeziert, sondern zeigten nackte Backsteine. Eines dieser Projekte, das ihr Dad immer angehen wollte und es dann doch wieder aufschob.
Sie packte den Knauf, streckte entschlossen den Rücken durch und öffnete die Tür einen Spalt. Melissa schlüpfte hinein und zog sie sofort hinter sich zu, damit das Vieh nicht noch in die unteren Geschosse flüchtete.
Sie drückte auf den Lichtschalter, aber nichts tat sich. Na super, dachte sie und wartete einen Moment. Sie gewöhnte sich langsam an das Dämmerlicht. Möbel schälten sich aus den Schatten, zeigten ihr nach und nach ihre Gesichter. Nichts hatte sich seit dem letzten Besuch verändert. Die uralte Kommode stand neben den nicht viel jünger wirkenden Stühlen und einem Berg aus Sperrmüll – gebrochene Jalousien, eine Lampe mit zerschlagenem Schirm, zersplitterte Tischbeine. Benny, ihr alter, kaputter Stoffhase mit dem kratzigen Fell, den sie nie hatte leiden können, thronte auf dem Schutthaufen wie ein König. Schrecklich, ihr Vater konnte sich einfach von nichts trennen! Hier und da ragten die Kartons der Weihnachtsdeko wie Türme einer Festung heraus.Sie suchte rechts und links, bückte sich, um unter die hochbeinigen Stühle zu sehen. Na toll! Das Vieh war nirgends zu finden. Es hatte sich verkrochen. Im Grunde konnte es überall stecken. Sie beschloss, mit der Katze ein wenig Lärm zu machen. Eventuell geriet es in Panik und stürmte aus seinem Versteck.
Ein Luftzug lenkte ihre Aufmerksamkeit nach rechts. Dort wehte ein weißes Tuch hinter dem Vorsprung hervor. Sie wurde neugierig. Immerhin konnte sie jetzt die Möglichkeit nutzen, endlich herauszufinden, was dahinter lag. Seit siebzehn Jahren wohnte sie in diesem Haus und genauso lange war der Dachboden Sperrzone für sie. Vor allem der hintere Teil. Angeblich, weil die Bohlen an manchen Stellen morsch waren und man durch die Decke brechen konnte. Aber Melissa vermutete, dass etwas anderes hinter dem Verbot steckte. Womöglich hatte ihr Vater irgendetwas hier oben aufbewahrt, was sie nicht sehen sollte. Etwas … Peinliches? Bei dem Gedanken, dass ihr Vater ein delikates Geheimnis haben könnte, kicherte sie nervös.
Eine weitere Frage, die in ihr aufblitzte, beschäftigte sie: Warum war ausgerechnet an ihrem Geburtstag die Tür zum Dachboden unverschlossen gewesen?
Sie hielt den Arm schützend vor ihre Augen. Vielleicht attackierten Marder, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlten, direkt das Gesicht? Als ob das weiße Laken ihre Vorstellung gehört hätte, flatterte es erneut auf, und Melissa sprang erschrocken zurück.
Nach einigen Sekunden hatte sie sich gefangen. Verdammt, sagte sie sich, ich werde mich von so einem Pelzheini nicht in die Flucht schlagen lassen! Sie gab sich einen Ruck und marschierte weiter, die steife Katze wie ein Gewehr gegen ihre Schulter gelehnt.
Hinter dem Vorsprung musste eine der Dachgauben sein, an denen ihre Mutter früher Meisenknödel für die an den Seiten brütenden Vögel aufgehängt hatte. Mondlicht drang in den Raum und erhellte eine Truhe. Sie trug dieselben Rosenschnitzereien wie die uralte Kommode vorne auf dem Dachboden und wirkte wie ein ausgedienter Koffer, der viel in der Welt herumgekommen war. Splitterig, abgenutzt und vollgestopft mit Erinnerungen. Das Schloss glänzte im Mondlicht. Offensichtlich war es erst vor Kurzem angebracht worden. Mit einem letzten Blick auf die verschlossene Truhe wandte Melissa sich ab und ging einen weiteren Schritt in den hinteren Teil des Dachbodens hinein.
Dort hing ein Windspiel von der Decke herab. Direkt unter dem Windspiel stand ein Lesepult. Mit dem Finger grub sie eine tiefe Spur in die Staubschicht. Das Pult schien seit langer, langer Zeit an dieser Stelle zu stehen. Über den Ständer des Pultes zogen sich dünne Risse. Oder waren es Kerben? Ja, etwa fünfzig Kerben, offenbar mit einem scharfen Messer in das schöne Holz geschnitten. Sie sahen aus wie winzige Wunden. Unter dem Lesepult lag ein karierter Teppich. Die roten und grünen Karos auf dem Stoff brachten Unruhe in das Möbelsammelsurium und ließen die einzelnen Stücke wie kleine Kinder wirken, die gerade erst lernten, still zu sitzen.
Ein Zimmer für Marder und Mäuse, dachte Melissa und kicherte angespannt. Sie wusste nicht, warum sie so nervös war, wie sonst nur auf dem Schrottplatz. Wenn sie zwischen alten Felgen und rostzerfressenen Autoteilen ein neues Stück für den Maschinenraum suchte, fühlte sie sich ebenso aufgedreht.
Jetzt fehlte noch ein Schritt und sie konnte um die Ecke sehen. Ihre Fingerspitzen kribbelten, als sie kurz innehielt. Warum zögerte sie? Immerhin wollte sie wissen, was ihr Vater vor ihr verbarg. Melissa war sich nicht mehr sicher, das Richtige zu tun. Aus irgendeinem Grund hatte sie das Gefühl, eine Grenze zu übertreten. Ein Schritt, der nicht rückgängig zu machen wäre.
Wahrscheinlich sollte ich umkehren, dachte sie und grub ihre Finger in das borstige Fell von Miezi. Sie wäre ebenfalls sauer, wenn ihr Vater in ihrem Zimmer herumwühlen würde. Sie könnte umdrehen und zurück in ihr Bett gehen. Sie könnte so tun, als hätte sie den Marder zwar gehört, aber wäre nicht hier oben gewesen. Sie könnte die Bodentür hinter sich schließen und ihren Vater bei Schmitt anrufen. Er würde kommen und den Marder beseitigen. Dann konnte sie in Ruhe einschlafen. Doch noch während sie darüber nachdachte, wusste sie, dass sie genau das nicht tun würde. Ihr Fuß entschied schneller als ihr Kopf. Er war den nächsten Schritt bereits gegangen.
Als sie um den Vorsprung herum war, flatterte das weiße Laken erneut. Es legte sich an die Wand und hing vom Dachstuhl bis zum Boden.
Das Mondlicht tauchte den Stoff in ein knochenweißes Licht und erhellte den Dachboden. Als sie Schritt für Schritt näher kam, spürte sie, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Sie hob die Hand und tastete vorsichtig nach dem Stoff. Kaum berührten ihre Fingerspitzen die Oberfläche, löste sich das Laken aus seiner Halterung.
Nach vereinzelten Backsteinen wurde ein goldgelber Rahmen sichtbar, der fast die komplette Breite der Wand einnahm. Er umrahmte ein Bild, das größer als sie war. Am Rand war das Gemälde ebenso golden, doch je weiter sie zur Mitte vordrang, desto blauer wurde der Hintergrund. Blau in seinen verschiedensten Schattierungen und Tönen. Melissa trat einen Schritt zurück.
Fünf Frauen standen in einer Reihe. Ihre Gesichter waren so realistisch gemalt, dass Melissa zusammenzuckte. Sie konnte alles erkennen, jede Winzigkeit! Die feinen braunen Härchen, die an den Augenbrauen überstanden. Sogar die Poren in der Gesichtshaut – alles wirkte echt, beunruhigend echt, als würde das Bild atmen!
Die Frau auf der linken Seite des Gemäldes trug ein Kleid aus dem neunzehnten Jahrhundert. Es besaß einen hellroten, beinahe orangefarbenen Ton. Die vielen Rüschen über ihrem Reifrock waren mit feinen Pinselstrichen so sorgfältig aufgetragen, dass Melissa einen Moment lang das Gefühl hatte, sie könnte den Stoff rascheln hören. Die Frau war wunderschön, doch ihre zarten Schultern hingen herunter, in ihren Mundwinkeln hatte sich der Kummer eingehakt und zog sie herab. Melissa erschrak, so viel Einsamkeit und Trauer lagen in diesem Blick. Diese Einsamkeit schien den gesamten Dachboden zu füllen und nahm Melissa die Luft zum Atmen. Erst als sie sich abwandte, konnte sie wieder tief einatmen.
Die zweite Frau ähnelte der vorherigen – ihre Ohren und die Nase hatten dieselben markanten Züge. Auch sie strahlte Traurigkeit aus, doch da war noch etwas anderes in ihrem Gesicht. Zorn? Wissen? Etwas jedenfalls, das Melissa nicht genau deuten konnte.
Einen Augenblick lang blieb sie bei der dritten Frau hängen, die vorsichtige Ansätze eines Lächelns zeigte. Es reichte jedoch nicht bis in ihre Augen. Eine lachsfarbene Bluse umspielte ihre schmalen Hüften und ging in einen zartgrünen Rock über. Die vierte Frau stemmte die Hände in die Hüften und hielt ihren Kopf aufrecht. Winzige Lachfältchen schlichen um ihre Augen, als trauten sie sich nicht, ihre volle Wirkung zu zeigen. Sie schien wie jemand, der Schreckliches im Leben erlebt, aber nie den Mut verloren hatte. Blassroter Lippenstift betonte ihre Lippen. Sie lächelte. Dann fiel Melissas Blick auf die letzte Frau und sie erschrak. Dort stand ihre Großmutter.
Oma strahlt eine Kraft aus, vor der selbst das Meer weichen würde, dachte Melissa. Sie war die Einzige auf dem Bild, deren Haar gräulich schimmerte.
Wer waren die Frauen an ihrer Seite? Ihre Mutter hatte nicht erzählt, dass ihre Großmutter Geschwister gehabt hatte. Sie war ein Einzelkind gewesen, ebenso wie ihre Mutter und sie.
Es mussten Freundinnen auf dem Bild sein. Aber warum trugen sie alle verschiedene Kleidungsstile? Sie betrachtete ihre Großmutter eingehend. Oma Lina.
Fünf Jahre alt war sie gewesen, als ihre Großmutter gestorben war. Aber sie erinnerte sich noch genau an ihr Lachen und die Art, in der sie stolz ihr Kinn gehoben und sich eine ergraute Locke voller Elan aus dem Gesicht gestrichen hatte. Oder wenn sie eingeschlafen war und Miezi wie eine hässliche Version der Sphinx auf ihrem Bauch gethront hatte. Oma Lina war eine fröhliche Frau gewesen, und das spiegelte das Bild wider. Ihre gesamte Haltung war fast schon majestätisch.
Vorsichtig ging Melissa näher an die Leinwand heran. Sommersprossen auf den Wangen ihrer Großmutter und dieser winzige, braune Fleck in ihrem rechten Auge, der Melissa als Kind so gefallen hatte. Ihre Großmutter auf dem Dachboden. Es kam ihr bekannt vor. Wie eine Erinnerung, die tief im Morast ihrer Gedanken feststeckte. Sie schloss die Augen, tauchte ab. Dann erinnerte sie sich.
Elf Jahre zuvor
Noch bevor Melissa ihre Mutter sah, hörte sie ihre Stimme. Sie flüsterte mit einer anderen Frau. Melissa kannte die Stimme, vermochte sie jedoch nicht einzuordnen. Sie war ihrer Mutter hinterher geschlichen, nachdem diese sich heimlich von Melissas Geburtstagsfeier entfernt hatte und zum Dachboden hochgestiegen war.
Einige Minuten hatte Melissa vor der Dachbodentür gestanden und gewartet, dass ihre Mutter wiederkam. Als das nicht passiert war, hatte sie zur Türklinke gegriffen, die auf Höhe ihres Kopfes war.
Trotz ihrer sechs Jahre, war sie klein, aber das störte sie nicht. Ihre Mutter sagte immer: ,Irgendwann wirst du jemand Großes sein.‘ Verstanden hatte sie den Satz noch nie, aber sie fand ihn schön. Vorsichtig zog sie an der Klinke und hoffte, dass die Tür beim Öffnen keine verräterischen Geräusche von sich gab. Sie hatte Glück. Lautlos schwang sie auf. Sofort wurden die Stimmen lauter.
„Ich hab dir mehrfach gesagt, dass du nicht in diesem vorwurfsvollen Ton mit mir reden sollst!“, hörte sie ihre Mutter sagen. Es entstand eine kurze Pause, und Melissa huschte hinter ein paar Kisten mit Weihnachtsschmuck. Sie stieß mit dem Kopf gegen die Pappkartons ganz oben und feine Staubflocken rieselten auf sie nieder. Erschrocken hielt sie den Atem an. Sie durfte auf keinen Fall niesen! Sie musste aufpassen, dass sie nirgendwo hängen blieb und die Glasengelchen und Silberkugeln auf den Boden warf. Bedächtig hockte sie sich hin und spähte über den Rand der obersten Kiste.
„Du hast ja Recht, Vanessa. Entschuldige“, sagte die andere Stimme. Eine schöne Stimme. Leicht und weich. Sie klang wie das kleine Mobile mit den Glasdelfinen an Melissas Fenster, wenn der Nachtwind hindurch strich und die Delfine zum Tanzen brachte.
„Aber du weißt genau, wie ich zu der Sache stehe. Als du damals die Aufgabe übernommen hast, kanntest du die Regeln. Stell dir vor, du würdest jemandem zu Hilfe eilen, ohne zu wissen, wie das Amulett funktioniert! Es ist an der Zeit, dass sie es erfährt. Je eher sie es weiß, desto intensiver kannst du sie vorbereiten.“
„Hör auf, Mutter!“
Oma Linas Stimme. Natürlich!
„Es ist meine Entscheidung. Weißt du nicht mehr: Von dem Moment an, in dem du mir das Geheimnis anvertraut hast, war meine Kindheit schlagartig vorbei. Es gab nur noch das Amulett. Allein darauf sollte und musste ich mich konzentrieren. Keine Freunde, keine Zeit für mich. Ich konnte nichts mehr tun, das mir Spaß machte, nicht im Park spielen und keine Blüten für mein Herbarium sammeln. Sie ist sechs, Mutter! Glaubst du, ich will ihr dasselbe antun, wie du mir?“
Melissa horchte auf. Es ging um sie! Sie lehnte ihren Kopf an die Kiste, hielt den Atem an, schlang die Arme um die Knie und lauschte so intensiv, dass sie ihr Blut in den Schläfen spürte.
„Vanessa, Schatz …“
„Nein! Fang nicht so an. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Melissa soll ihre Kindheit so lange ausleben, wie ich es ihr ermöglichen kann“, sagte ihre Mutter laut.
Melissa erschrak. Noch nie hatte sie ihre Mutter so reden gehört. Mit dieser Härte in der Stimme. Nicht mal, wenn sie – Melissa – zum zehnten Mal durch das Blumenbeet im Garten lief. Was war es, was sie nicht erfahren sollte?
„Hör mir zu, Kind“, entgegnete ihre Großmutter ebenso hart. Melissa konnte sich genau vorstellen, wie sie ihre Arme in die Hüften stemmte.
„Du weißt, was mit mir passiert ist, wie schrecklich es dir ergangen ist. Du kannst sie nicht ewig davor bewahren. Sie wird nicht wissen, was sie erwartet. Sie wird nicht vorbereitet sein. Willst du das?“ Wieder entstand eine Pause.
Hinter Melissa ertönte ein leises Kratzen. Sie fuhr erschrocken herum und starrte angestrengt in die dunkle Ecke. Ein winziger Schatten huschte an ihr vorbei und streifte ihr Handgelenk. Hastig riss sie ihre Hand hoch. Nur eine Maus. Sie schlüpfte aus der angelehnten Dachbodentür.
Als sie sich beruhigte, wurde ihr bewusst, dass sie sich auf dem Dachboden befand. Dem einzigen Ort im ganzen Haus, der ihr verboten war. Sie hatte so oft versucht, hier hochzugehen, aber die Tür war immer verschlossen gewesen. Jetzt konnte sie sich endlich umsehen. Wer wusste schon, wann sie erneut die Gelegenheit bekam?
Der Raum erschien ihr nicht besonders groß. Überall versperrten alte Möbel den Weg. Zu ihrer linken stand eine Kommode, die mit Rosen verziert war. Drei Schubladen zählte sie. Unter der Letzten war noch Platz zum Boden. Melissa fragte sich, ob sie darunter passen, dort ein besseres Versteck finden würde.
Gleich daneben standen ein Sessel und drei Stühle. Der Sessel hatte zwei Beine verloren. Er stand so schief, als trüge er die Last der Welt auf seinen Lehnen und sein Bezug hing wie alt gewordene, rissige Haut an ihm herab. Überhaupt wirkte er so gebrechlich, dass sie Angst hatte, ihm zu nahe zu kommen.
Hinter dem Sessel begann die Wand, an der einige Kisten mit einer schnörkeligen Aufschrift gestapelt waren, doch Melissa konnte noch nicht lesen. Direkt neben ihr räkelte sich ein Sofa, das ihr förmlich anbot, sich hinein zu kuscheln. Mit den Fingerspitzen strich sie über das rote Polster und fasste mitten in ein Spinnennetz. Igitt! Ruckartig zog sie ihre Hand zurück und rutschte gleichzeitig auf den Knien über den Boden ein Stück nach hinten. Weg von dem ekeligen Netz. Sie trug keine Strumpfhose und spürte sofort ein Brennen, wo das rissige Holz ihre Haut aufgeschabt hatte. Sie durfte nicht weinen. Nicht jetzt! Gedämpft sprach ihre Mutter weiter. Melissa war dankbar für die Ablenkung und konzentrierte sich auf das Gespräch.
„Trotzdem Mutter! Ich will und werde es riskieren! Melissa soll mit echter Sonne im Herzen aufwachsen und nicht wie eine Orchidee im Treibhaus sie nur durch ein milchiges Dach spüren.“
Melissa war so gebannt von der Unterhaltung, dass der heftige Schmerz, der jäh ihren Oberschenkel erfasste, überraschend kam. Oh nein! Ein Krampf! Nicht schon wieder! Das konnte sie nicht gebrauchen.
Immer passierte ihr das in den unmöglichsten Situationen. Beim Baden in der Wanne oder wenn sie am Einschlafen war. Dann, wenn sie lange still sein musste. Und sie bekam diese Krämpfe an den blödesten Stellen: im Fuß, in der Wade, in der Hand. Und jetzt: im Oberschenkel. So ein Mist! Melissa biss die Zähne zusammen, aber es nützte nichts. Je mehr sie den Schmerz zu ignorieren versuchte, umso wütender schien er zu werden. Melissa wusste, sie musste aufstehen, sich strecken, damit er nachließ, aber das durfte sie nicht.
„Sie ist nicht nur deine Tochter, sondern auch meine Enkelin. Versprich mir zumindest, dass du darüber nachdenkst. Wenn sie nicht erfährt, dass sie …“
„Still“, flüsterte Melissas Mutter. „Hast du das auch gehört? - Da war was!“
Melissa saß mucksmäuschenstill hinter den Kisten. Sie hielt sogar die Luft an. Ihr Bein hatte so geschmerzt, dass sie es ausgestreckt hatte, obwohl es keinen Platz gab. Jetzt ließ das zornige Krampfen endlich nach, aber sie war dummerweise mit dem Fuß gegen einen Karton gestoßen. Es mussten Tassen darin sein, denn es hatte laut gescheppert.
„Hier oben ist jemand!“, flüsterte ihre Mutter.
Melissa spürte, wie sich Tropfen von kaltem Schweiß auf ihrer Stirn sammelten. Sie hatte sich verraten. So ein Mist! Bitte glaub, dass es eine Maus war, flehte sie innerlich. Es war sinnlos. Ihre Mutter stürmte zielsicher auf Melissas Versteck zu, griff über die Kisten und packte sie am Arm.
„Au“, sagte Melissa und rieb sich die Stelle.
„Hab ich doch richtig gehört“, rief ihre Mutter und packte Melissa.
Melissa versuchte, eine Unschuldsmiene aufzusetzen.
„Melissa Isabell Neumann! Was machst du hier oben?“
„Ich … ich … ähm.“ Melissa suchte nach einer Ausrede. „Ich wollte schauen, wo du hingehst. Mit wem hast du da gesprochen?“
„Wovon sprichst du?“ Ihre Mutter fuhr sich durch die Haar. „Ich habe mit niemandem geredet oder siehst du da etwa jemanden?“ Sie wies auf den Ort, an dem zuvor Melissas Großmutter gestanden haben musste, aber die Stelle war leer.
„Komm mit runter“, sagte ihre Mutter. Ihre Stimme klang jetzt wieder sanft. „Du verpasst sonst die Geschenke.“
Melissa fühlte, wie die Hand ihrer Mutter sich um ihre eigene schloss und sie wegzog, raus aus dem Dachboden, dem Ausgang entgegen. Bevor die Bodentür hinter ihnen zufiel, wandte sie sich schnell um. Aber da war niemand. Kaum standen sie draußen, drehte ihre Mutter den Schlüssel zweimal im Schloss und steckte ihn in ihre Rocktasche.
Als sie die knarrenden Stufen hinab stiegen, warf Melissa ihrer Mutter einen verstohlenen Blick zu. Sie wirkte seltsam abwesend. Ihr Körper war eindeutig da, aber ihre Gedanken schienen woanders zu sein. Es war nicht das erste Mal. Manchmal fragte Melissa sich, woran sie in solchen Momenten dachte.
„Mama!“, rief sie mit bebender Stimme. „Da war jemand! Ich habe es deutlich gehört!“
„Du hast die Balken knarren hören! Das Holz arbeitet. Schau, ich hab da oben nach diesem Holzlöffel fürs Eierlaufen gesucht.“ Sie zog einen Löffel aus ihrer Rocktasche und hielt ihn Melissa hin. Melissa spürte, wie ihr die Tränen in die Augen steigen wollten. Tränen der Wut. „Da war niemand“, fuhr ihre Mutter fort. „Auf was für Ideen du kommst …“ Sie sah Melissa besorgt an. Dann lächelte sie und sagte: „Wer soll da gewesen sein? Eine sprechende Fledermaus etwa?“
„Großmutter …“, flüsterte Melissa und die ersten Tropfen kullerten aus ihren Augen. „Ich hab … ich habe Großmutter gehört.“
Der Gesichtsausdruck ihrer Mutter veränderte sich nicht. Sie beugte sich zu Melissa, wischte die Tränen weg und streichelte ihr die Wange. Dennoch hatte Melissa das kurze Stocken ihres Atems bemerkt. Ein zarter Duft ging von ihrer Hand aus. Melissa wollte sich hinein schmiegen.
„Erinnerst du dich noch an unsere Unterhaltung vor einem Jahr, Melissa? Das Gespräch über Oma?“, fragte ihre Mutter behutsam.
Zögernd nickte Melissa. Sie konnte sich gut an den Tag erinnern. Es war ein perfekter Tag gewesen. Ihre Kindergärtnerin hatte ihr Bild gelobt. Das Bild, das sie vom Himmel gemalt hatte. An jenem Tag war er so blau wie Melissas Lieblingsschuhe gewesen.
Sie war eher als sonst aus dem Kindergarten abgeholt worden. Mit ernster Miene und ohne ein Wort zu sagen, hatten ihr Vater und ihre Mutter sie an die Hand genommen und zum Auto geführt.
„Und was haben wir dir damals erklärt?“, fragte ihre Mutter sie aufmunternd.
Melissa senkte den Kopf. Sie spürte die Tränen, die ihr über die Wangen liefen. Sie sagte schluchzend: „Dass Oma Lina zu den Engeln gegangen ist, und dass sie von dort nicht mehr zurückkommen kann.“
Das Amulett
Ein Windhauch streifte ihren Rücken und holte sie zurück. Je länger sie das Gemälde betrachtete, desto unwohler fühlte sich Melissa. Jetzt wusste sie warum. Der Dachboden verheimlichte mehr als das Gemälde. Erinnerungen lagen hier verborgen. Sie begann zu zittern. Sie konnte sich nicht erklären, wieso sie sich ausgerechnet jetzt an diese Begebenheit aus ihrer Kindheit erinnert hatte. Im Grunde hatte sie den Moment auf dem Dachboden … vergessen.
Melissa erhoffte sich von dem Bild ihrer Großmutter eine Antwort. Deren Blick ging jedoch an ihr vorbei, auf die Katze in ihrer Hand. Automatisch folgte sie ihr, aber Miezi hing steif wie ein Brett in ihren Fingern.
„Öffne die Katze“, hörte Melissa eine Stimme hinter sich.
Melissa fuhr herum. Ihr Puls schoss in die Höhe. Vergessen war das Misstrauen gegenüber dem Dachboden. Hastig wandte sie sich in alle Richtungen, wollte wissen, woher die Stimme kam. In der Finsternis konnte sie nichts erkennen.
„Wer ist da? Papa, komm raus“, rief sie und hoffte, selbstsicher zu klingen. Ihre Gefühle machten ihr einen Strich durch die Rechnung und ließen ihre Stimme unkontrolliert zittern. Sie klammerte sich an die Katze.
Ihr Atem ging stoßweise. Eine Weile lauschte sie, hoffte, dass ihr Vater hinter einer Ecke hervorsprang und loslachte, oder Eva, die ihren Schlüssel nutzte, um bei ihr zu übernachten. Doch da war niemand.
„Das ist nicht witzig“, rief Melissa erneut.
Stille.
„Dreh ich jetzt durch? Nein, das war vermutlich der Marder“, beruhigte sie sich nach einigen Minuten des Schweigens. „Wer sollte sonst von mir verlangen, dass ich die Katze öffne?“, versuchte sie, ihre Angst mit Ironie zu überspielen. Normalerweise funktionierte das.
Melissa schüttelte den Kopf. Sie wurde hier oben noch wahnsinnig. Deshalb schulterte sie Miezi und ging entschlossen auf den Ausgang zu.
„Öffne die Katze!“, flüsterte diese unheimliche Stimme erneut.
Melissa nahm ihre Beine in die Hand und warf die Tür hinter sich zu. Irgendjemand war hier oben und sie wollte nicht länger auf dem Dachboden sein. Ihr wurde das alles zu gruselig. In ihrem Zimmer angekommen, schloss sie die Tür ab.
Sicher war sicher. Wenn jemand im Haus war, wollte sie zumindest nichts riskieren.
Sie stand in ihrem Zimmer und starrte die Tür an. Jeden Augenblick würde jemand mit einer Hollywood-Klischee-Axt diese niederreißen und auf sie losgehen.
Melissa wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sie hatte eindeutig zu viele Horrorfilme in letzter Zeit gesehen. Eilig zog sie ihre Strickjacke aus, hängte sie auf den Schreibtischstuhl und legte sich mit Miezi in der Hand aufs Bett. Es dauerte eine Weile, ehe sie und ihr Puls sich beruhigt hatten.
Stirnrunzelnd drehte sie die ausgestopfte Katze über ihrem Kopf. Miezi war schwer, schwerer als sie gedacht hatte. Als Kind war sie ihr leichter vorgekommen, dabei war sie damals schwächer gewesen. Sie warf Miezi ans Ende des Bettes.
Ein dumpfes Klappern ertönte. Sie runzelte die Stirn. War Miezi gegen das Metallgitter am Ende des Bettes gefallen? Melissa richtete sich auf. Nein, sie lag auf dem Stapel Kissen, den Eva und sie am Nachmittag sortiert hatten.
Melissa krabbelte ans Ende des Bettes, griff sich Miezi und schüttelte das ausgestopfte Vieh.
„Ist da was in dir drin?“
Melissa lehnte sich gegen die Wand und untersuchte Miezi. Sie versuchte sich daran zu erinnern, ob Oma Lina jemals von einem Geheimfach in Miezi erzählt hatte. Doch Melissa erinnerte sich nur an die Zeit, in der das Vieh ausgestopft gewesen war. Vanessa hatte Miezi als Dekorationsgegenstand genutzt. Melissa hatte zwar als Kind mit der hässlichen Katze ab und an gespielt, aber ihr war nichts aufgefallen. Sie zögerte. Sollte sie jetzt ernsthaft in das Innere eines ausgestopften Tieres gucken, wie es ihr die Stimme gesagt hatte? Wenn Eva ihr diesen Vorschlag gemacht hätte, hätte sie sie für verrückt erklärt.
Sie strich über das borstige Fell der getigerten Katze. Sie war allein. Niemand beobachtete sie.
Melissa seufzte und warf sich in ihre Kissen und ihre Bedenken über Bord. Heute ist so ein Tag, wo man auch mal im Innern einer ausgestopften Katze herumwühlen konnte, dachte sie.
Melissa tastete die gesamte Oberfläche des Tieres ab. Erst den Kopf. Der ließ sich weder schrauben, noch war er aufgesteckt. Melissa schüttelte sich, fühlte bereits, wie der Wahnsinn sich schleichend in ihrem Gehirn absetzte. Ein Geheimversteck in einer ausgestopften Katze. Wie konnte sie das nur glauben? Sie fuhr mit den Fingern erst über den Rücken, über den Bauch.
Wie Staub sammelte sich der Wahnsinn in den Ecken, verband sich zu kleinen Wollmäusen, die an ihrem Verstand zu knabbern begannen. Etwas im Innern einer Katze? Wie war sie nur …
Klick.
Abrupt hielt Melissa inne. Auf der Unterseite hatte sich eine Klappe geöffnet. Melissa hob Miezi über ihr Gesicht. Im Innern schimmerte etwas im Licht der Nachttischlampe.
Melissa zögerte einen Moment, bevor sie hinein fasste. Ekel überkam sie, als sie daran dachte, dass ihre Hand jetzt dort war, wo früher die Organe der Katze gearbeitet hatten. Sofort ertastete sie ein Objekt und holte es heraus. Melissa starrte den runden Gegenstand an, der in ihrer Hand lag. Damit hatte sie nicht gerechnet.
Ein etwa zehn Zentimeter breites, rundes Amulett, das an den Außenkanten dünn zusammenlief. In der Mitte befand sich ein Loch. Sechs hauchdünne Streben verbanden den äußeren Ring mit einer silbergrauen Kugel. Diese schimmerte, als ob sich das Mondlicht darauf sammelte, um auf der Oberfläche zu tanzen. Nicht ein Kratzer oder eine Delle waren zu fühlen, als Melissa mit dem Daumen über die Kugel fuhr. Ganz im Gegenteil: Sie war makellos. Melissa stutzte. Wie konnte es so unbeschädigt geblieben sein?
Dünne Linien schlängelten sich an Punkten vorbei, ohne sie zu berühren. Symbole schmiegten sich an diese Linien, wie Miezi an Oma in einer kalten Winternacht. Sämtliche Punkte und Linien waren mit einer Präzision in das Metall gearbeitet worden, die, ebenso wie bei dem Gemälde, viel Zeit und Mühe in Anspruch genommen haben mussten. Für einen kurzen Moment glaubte Melissa, ihre Familie wäre reich und sie wüsste nichts davon. Erst das Gemälde, das nicht sonderlich kostengünstig gewesen sein konnte und nun ein nahezu makelloses Amulett, das scheinbar unbenutzt in einer Katze aufbewahrt wurde. Sie suchte nach dem Aufdruck Made in China, fand aber nichts. Ihr Vater schuldete ihr definitiv Antworten.
Sie drehte das Amulett, um es von der Rückseite zu betrachten. Doch die war das exakte Ebenbild zur Vorderseite. Melissa fuhr mit dem rechten Daumen über die Oberfläche und spürte die sanften Vertiefungen der Zeichen.
Sie stand da, das Amulett in der Hand. Erst nach einigen Augenblicken blinzelte sie, als ein Symbol an einer anderen Position auftauchte als noch kurz zuvor. Sie drehte das Amulett herum. Dort war ebenfalls ein Dreieck, das von einem spitz zulaufenden Oval durchkreuzt wurde. Auch auf der Rückseite war das Symbol an dieselbe Stelle wie auf der Vorderseite gewandert.
Ich bin müde. Jetzt halluziniere ich, dachte sie und schüttelte den Kopf. Ich sollte lieber ins Bett gehen. Dad muss den Marder halt morgen fangen.
Sie wollte die Katze am Boden abstellen, da bewegte sich wieder etwas auf dem Amulett.
Drei winzige Punkte tauschten die Plätze untereinander, als spielten sie ein Spiel. Jagten einander und stoben in unterschiedliche Richtungen davon. Melissa stieß einen spitzen Schrei aus, warf das Amulett auf den Teppich und entfernte sich einige Schritte. Ihr Herz stolperte über ihre Angst und geriet aus dem Takt. Erst als sie die Wand neben dem Kleiderschrank im Rücken spürte, kam sie zum Stehen. Nachdem sie tief durchgeatmet hatte, wandte sie sich erneut dem Schmuckstück zu.
„Was bist du?“, flüsterte sie.
Wie erwartet kam keine Antwort. Stattdessen stoppten die Bewegungen auf der Oberfläche ebenso abrupt, wie sie begonnen hatten. Argwohn breitete sich in Melissa aus und ließ sie zweifeln. Spielt mir jemand einen Streich, fragte sie sich. Minutenlang konzentrierte sich Melissa auf das Amulett. Kein Symbol wechselte den Platz, kein Punkt flog über die silberne Fläche. Sie ließ es nicht aus den Augen, blinzelte nicht, bis sie zu dem Entschluss kam, dass alles nur Einbildung gewesen war.
„Na klasse! Jetzt höre ich nicht nur Geräusche, die zu Stimmen in meinem müden Hirn werden, sondern sehe noch Dinge, die nicht passieren. Ich bin echt reif für die Klapse.“
Sie griff nach dem Amulett. Ihre Fingerspitzen berührten kaum den Außenring, da begannen die Punkte und Symbole kreuz und quer darüber zu tanzen.
Drucksensoren, dachte sie. Der Mechanismus muss durch Drucksensoren aktiviert werden.
Sie überprüfte ihre Theorie, legte das Amulett auf den Teppich und wartete. Als die Bewegungen erneut stoppten, stieß sie ihren Atem erleichtert aus.
In ihre Gedanken schlichen sich Mutmaßungen. Erst dachte sie an einen Scherzartikel, doch dafür war die Verarbeitung zu edel. Niemand würde so viel Geld für einen Scherzartikel ausgeben und ihn im Anschluss in einer ausgestopften Katze verstecken. Kurzfristig hielt sie sich an die These eines außerirdischen Artefakts, was sie aber mit einem zweifelnden Hochziehen der Augenbrauen verwarf. Schließlich einigten sich ihre Gedankengänge darauf, dass es eine dieser Allzweckfernbedienungen mit modernem Touchscreen sein musste. Richtig programmiert konnte man damit die Kaffeemaschine genauso bedienen wie den Fernseher. Wenn sie bedachte, dass sie Stimmen zu hören glaubte und ein Symbol in Form eines Schädels auf einer festen Oberfläche willkürliche Bewegungen vollzog, erschien ihr diese Lösung als die harmloseste. Als sie das Amulett erneut berührte, tauchte neben dem Schädel und dem Dreieck ein anderes Symbol auf. Es waren zwei verschlungene Linien, die am oberen Ende weit auseinanderliefen.
Als die drei Symbole nebeneinanderstanden, spürte Melissa ein Kribbeln in ihren Fingern.
- Ende der Buchvorschau -
Impressum
Texte © Copyright by Ann-Kathrin Karschnick Schün-Rieden, 1 21483 Dalldorf [email protected]
Bildmaterialien © Copyright by Ann-Kathrin Karschnick
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-7394-4837-4