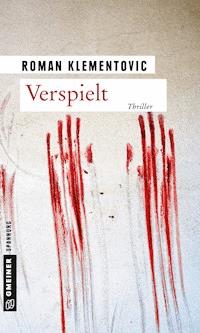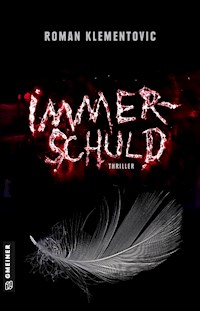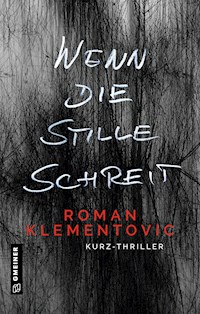9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriller im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Seit 40 Jahren schon ist Elisabeth mit Friedrich verheiratet - glücklich, trotz einiger Schicksalsschläge. Auch seine Alzheimererkrankung kann ihre Liebe nicht erschüttern. Doch eines Abends ist er besonders verwirrt. Während eines TV-Beitrags über den seit 22 Jahren ungeklärten Mord an der besten Freundin ihrer Tochter gibt er Verstörendes von sich. Er erwähnt Details, die er gar nicht kennen dürfte. In Elisabeth regt sich ein schlimmer Verdacht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Roman Klementovic
Wenn das Licht gefriert
Thriller
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Gedicht auf Seite 6 entnommen aus: Herausgegeben von Alexander Gorkow. Lindemann, Till: In stillen Nächten. Gedichte. Mit Illustrationen von Matthias Matthies. © 2013 Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG. 2013, Köln.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © jaedo976 / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6558-1
Widmung
Für Elea.
Schön, dich bei uns zu haben!
Zitat
In stillen Nächten weint ein Mann
weil er sich erinnern kann
»Liebe« von Till Lindemann
Prolog
Sonntag, 7. September 1997
Im ersten Moment begriff Monika nicht, weshalb sie aufgewacht war. Letzte Fetzen eines absurden Fiebertraums hingen noch an ihrem Verstand fest. Es fiel ihr schwer, einen klaren Gedanken zu fassen.
Einen Augenblick lang lag sie einfach nur da und starrte an die finstere Decke. Bis ihr der fahle Geschmack in ihrem Mund bewusst wurde. Sie versuchte zu schlucken, doch die Schmerzen in Rachen und Mundhöhle waren zu heftig. Die Medikamente, die sie einige Stunden zuvor genommen hatte, hatten längst ihre schmerzlindernde Wirkung verloren. Zudem schien die Entzündung über Nacht schlimmer geworden zu sein. Jetzt fühlte es sich an, als hätte sie ein Knäuel Stahlwolle hinuntergewürgt.
Blind tastete sie nach dem Glas auf ihrem Nachtkästchen. Sie sehnte sich nach einem Schluck Wasser. Doch als sie es anhob, stellte sie fest, dass es leer war.
Mist!
Sie machte die Nachttischlampe an und sah nach links. Sie erwartete, Thomas dort auf dem Bauch liegen zu sehen. Den Kopf im Kissen vergraben. Arme und Beine ausgestreckt und seltsam in die Decke verheddert. Sie erwartete, dass alles so sein würde wie immer.
Doch das war es nicht.
Thomas war nicht da.
Erst jetzt fiel es ihr wieder ein. Und mit einem Schlag war die Angst zurück. Wie eine Schicht Raureif, die sich blitzartig über ihren ganzen Körper gelegt hatte.
Sie fuhr im Bett hoch. Wie lange hatte sie geschlafen?
Thomas hatte offensichtlich mitbekommen, dass sie aufgewacht war. Sie hörte ihn aus dem Flur. Im nächsten Moment erschien er im Türrahmen.
Der Ausdruck auf seinem Gesicht ging ihr durch Mark und Bein.
»Und?«, fragte Monika. Selbst dieses eine Wort bescherte ihr Schmerzen.
Er schüttelte stumm den Kopf.
»Hast du in ihrem Zimmer nachgesehen?«
Noch so eine unnötige Frage. Natürlich hatte er das.
»Sie ist nicht da.«
Monika blickte zum Fenster. Weil sie die Lampe angemacht hatte, konnte sie nicht mit Sicherheit sagen, ob bereits ein Hauch von Licht durch die feinen Rillen der Jalousie fiel.
»Wie spät ist es?«
»Kurz nach fünf.«
Monika rang nach Luft.
Am Vorabend hatte Thomas sie noch zu beruhigen versucht. »Du kennst doch Anna. Du weißt, was für eine Träumerin sie ist. Sicher hat sie bei einer Freundin geschlafen und die Zeit aus den Augen verloren. Das ist ihr doch schon öfter passiert.«
Das stimmte nicht. Nur ein einziges Mal war so etwas vorgekommen. Damals hatte zum Glück ein Anruf bei den Sommers genügt. Anna hatte bei Valerie, ihrer besten Freundin, übernachtet und vergessen, ihnen Bescheid zu geben. Danach hatte Monika ihrer Tochter eine gehörige Standpauke gehalten. Sie war sich eigentlich sicher gewesen, dass Anna sie nie wieder derart im Ungewissen lassen würde. Ihre Tochter hatte es ihr doch hoch und heilig versprochen.
Natürlich hatten sie es auch dieses Mal gleich bei den Sommers versucht. Aber Valerie hatte Anna seit Freitagnacht nicht mehr gesehen. Und sie hatte auch nicht sagen können, wo Anna war oder mit wem sie mitgegangen sein konnte, weil sie schon vor ihr, kurz nach 1 Uhr, das Lokal verlassen hatte, in dem die beiden sich mit Freunden getroffen hatten, um Annas 18. Geburtstag vorzufeiern. Anscheinend war es zu einer Pöbelei zwischen Valeries Exfreund und einem anderen Jungen gekommen, und dem Mädchen war die Lust zu feiern vergangen.
Auch Annas übrige Freundinnen hatten keinen Hinweis zu ihrem Aufenthaltsort geben können. Angeblich war Anna keine Viertelstunde nach Valerie verschwunden gewesen – ohne sich zuvor von irgendjemandem verabschiedet zu haben. Ob Anna alleine oder in Begleitung das Lokal verlassen hatte, konnte scheinbar niemand sagen. Was seltsam war. Weil angeblich eine Unmenge an Menschen dort gewesen war. Da musste doch irgendjemand etwas gesehen haben.
Als es gestern dunkel geworden war, hatte Thomas noch den Gelassenen gegeben. »Schatz, glaube mir, Anna geht es gut. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du solltest dich besser ausruhen und ein wenig schlafen. Ich bleibe wach und warte auf sie. Du wirst sehen, sie kommt sicher bald nach Hause.«
Erst hatte Monika sich geweigert. Aber als gegen halb zwölf ihr Fieber höher geworden war und es anfing, ihr richtig dreckig zu gehen, gab sie schließlich nach.
»Aber nur eine Stunde«, hatte sie gesagt. »Bitte weck mich dann.«
»Ich weck dich, sobald Anna heimgekommen ist.«
»Aber …«
»Vertrau mir«, hatte Thomas sie unterbrochen. »Alles ist gut. Morgen früh ist sie wieder da. Es ist ihr 18. Geburtstag. Denkst du ernsthaft, Anna lässt sich die Geschenke entgehen?«
Er hatte sich in einem Lächeln versucht, was ihm gründlich misslang, und sie auf die schweißnasse Stirn geküsst.
Doch jetzt war es morgen früh. Und nichts war gut. Anna war immer noch nicht da. Und nun konnte auch Thomas seine Nervosität nicht länger verbergen.
Einen Moment lang schien er zu hadern. Dann trat er ins Schlafzimmer und setzte sich mit einem tiefen Seufzer zu ihr an die Bettkante. Jetzt, da sie ihn aus der Nähe sah, war sich Monika sicher, dass er die ganze Nacht kein Auge zugemacht hatte.
Er nahm ihre Hand, drückte sie. Öffnete seinen Mund, schloss ihn wieder, ohne etwas gesagt zu haben. Stattdessen begann er, an seiner Unterlippe zu kauen.
Sekunden verstrichen. Sie schwiegen einander an. Es war nicht mehr als ein letztes Hinauszögern.
Schließlich atmete er tief durch, rieb sich mit beiden Händen das Gesicht und erhob sich schwerfällig. »Ich rufe jetzt die Polizei.«
*
Montag, 8. September 1997
Für einen Septemberabend war es ungewöhnlich heiß. Am Himmel war kaum eine Wolke zu sehen, und obwohl die Sonne schon tief stand, brannte sie immer noch mit einer ungeheuren Kraft auf sie hinab. Viel zu spät waren Sonnencremen durchgereicht worden. Allen stand der Schweiß im glühend roten Nacken. Die Kleidung klebte unangenehm auf der Haut. Nicht die leiseste Brise brachte Erleichterung. Die Blätter an den Bäumen hingen starr. Die ganze Gegend schien den Atem anzuhalten.
Das Schicksal ihrer Tochter war immer noch ungewiss. Anna war seit fast drei Tagen wie vom Erdboden verschluckt. Und das, obwohl die örtliche Polizei Verstärkung angefordert hatte, eine Suchhundestaffel und sogar ein Hubschrauber im Einsatz waren. Das tiefe Rattern hoch über ihnen unterstrich den Ernst der Lage. Jedes Bellen ließ selbst gestandene Männer zusammenzucken.
Im lokalen Radiosender wurde laufend über Annas Verschwinden berichtet und ihre Personenbeschreibung durchgegeben:
Gesucht wird die 18-jährige Anna Venz. Sie ist schlank und etwa 1,65 Meter groß. Anna hat braunes schulterlanges Haar, das sie zumeist offen trägt, und grün-braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie Bluejeans, ein schwarzes T-Shirt mit der weißen Aufschrift »ZERO«, einen schwarzen Pullover und schwarz-weiße Turnschuhe der Marke Converse. Außerdem hatte sie ihre schwarze Lederhandtasche bei sich. Zuletzt wurde Anna in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht in dem Tanzlokal »Tanzhöhle« gesehen. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu Annas Aufenthalt geben können, wenden Sie sich bitte direkt an die nächste Polizeidienststelle.
Stets endete der Moderator, indem er sich direkt an Anna wandte: Anna, wenn du das hier hörst: Bitte melde dich. Deine Familie sucht dich und macht sich Sorgen.
Irgendjemand, Thomas konnte nicht mehr sagen, wer es gewesen war, hatte ihm mitgeteilt, dass nun sogar einige landesweite Medien aufgesprungen waren. Man hatte ihm einreden wollen, dass dies eine große Hilfe wäre. Er zweifelte daran. Und dennoch versuchte er, Monika dasselbe weiszumachen.
Die Hilfsbereitschaft war enorm. Im Laufe des Vortages hatten sich immer mehr Freiwillige der Suche angeschlossen. Viele von ihnen hatten sich spontan von der Arbeit freigenommen, um weiterhin mithelfen zu können. Einige hatte Thomas noch nie zuvor gesehen. Er erwischte sich bei dem Gedanken, dass jemand unter ihnen war, der wusste, wo Anna steckte und was mit ihr geschehen war. Aber er verdrängte ihn gleich wieder.
Anna ist nichts passiert! Ihr geht es gut! Es gibt eine logische, völlig harmlose Erklärung für ihr Verschwinden! Ganz bestimmt sogar!
Doch trotz der großen Unterstützung blieb es eine gewaltige Herausforderung. Die ganze Stadt musste abgesucht werden. Der Wald, der sie umschloss, war riesig. Es hätte wohl einer ganzen Armee bedurft, um auch nur annähernd eine realistische Chance zu haben, jeden Flecken darin zu durchkämmen. Und dann war da natürlich noch das unwegsame Moor – alleine das erstreckte sich über eine Fläche von mehr als 50 Hektar. Die zahlreichen Tümpel und die kleinen Seen darin wurden von professionellen Tauchern abgesucht. Als Thomas sie zum ersten Mal in ihren schwarzen Neoprenanzügen gesehen hatte, war ihm fast das Herz stehen geblieben. Für ein paar Sekunden hatte er alle Hoffnung verloren. Hatte eine Leere verspürt wie noch nie zuvor in seinem Leben. Als wäre da plötzlich ein Loch in seiner Brust, klebrig und schwarz. Das alles anzog, verschluckte und vernichtete.
Aber schnell hatte Thomas sich gefangen.
Die Taucher werden nichts finden! Anna geht es gut!
Generell erlebte Thomas alles in einem ständigen Wechselbad der Gefühle. Er war dankbar für die Hilfe. Stolz, dass sein kleines Mädchen so beliebt war und ihre Freunde sich so unermüdlich an der Suche nach ihr beteiligten. Er empfand Liebe. Hegte Hoffnung.
»Mach dir keine Sorgen, Thomas«, hatte Valeries Mutter Elisabeth ihn mit wässrigen Augen zu beschwören versucht. »Wir werden Anna schon finden. Alles wird gut, du wirst sehen.« Dann hatte sie ihn umarmt.
»Ja, das werden wir«, hatte er geantwortet und war über die Leere in seiner Stimme erschrocken.
Ein Teil von ihm wollte ja daran glauben.
Aber die Angst war das alles überschattende Gefühl in ihm. Wie eine eiskalte knöcherne Hand mit langen Krallen hatte sie sein Herz gepackt. Und mit jeder Minute, die ohne ein Lebenszeichen seiner Tochter verstrich, wurde ihr Griff fester. Der Gedanke, dass Anna etwas passiert sein könnte, brachte ihn fast um den Verstand.
In den letzten Stunden hatte sich aber auch zunehmend Wut in ihm breitgemacht. Darüber, dass die Polizei nicht ehrlich zu sein schien. Dass sie Monika und ihn für dumm verkaufen wollten. Aber das waren sie nicht. Thomas war klar, was es bedeutete, dass sich die Polizei bei ihrer Suche zunehmend auf den Wald und das Moor konzentrierte. Und weshalb sie Taucher hinzugezogen hatten. Anna war hier aufgewachsen, sie kannte die Gegend wie ihre Westentasche. Dass sie sich verirrt hatte, schien Thomas ausgeschlossen. Und freiwillig wäre sie nachts doch niemals in den Wald oder ins Moor gegangen. Wozu auch? Das Lokal, das Anna mit ihren Freunden Freitagnacht besucht hatte, lag weder in der Nähe des Waldes noch des Moores. Und auch um nach Hause zu kommen, hätte sie nicht einmal in deren Nähe müssen. Wieso hätte Anna also dort hingehen sollen?
Nein, das alles ergab doch keinen Sinn. Wenn Anna tatsächlich im Wald oder im Moor war, dann … Thomas wagte es nicht, diesen Gedanken zu Ende zu denken.
*
Dienstag, 9. September 1997
Die Stimmung war gekippt. Bei allen. Spätestens, als mit Einbruch der Dunkelheit die Suche erneut hatte unterbrochen werden müssen, glaubte niemand mehr ernsthaft daran, Anna noch wohlauf zu finden. Nicht nach vier Tagen ohne Lebenszeichen.
Am wenigsten Monika. Sie hatte immer eine innige Beziehung zu ihrer Tochter gehabt. Eine Art Seelenverwandtschaft, wie sie nur zwischen Mutter und Tochter möglich ist, verband sie. Monika hatte stets gespürt, wenn Anna etwas auf dem Herzen lag. Sie wusste, wann sie Ansprache oder jemanden zum Zuhören brauchte. Wann sie in den Arm genommen oder schlichtweg in Ruhe gelassen werden wollte.
Doch jetzt spürte Monika gar nichts mehr. Als wäre die Verbindung zwischen Anna und ihr gekappt worden. Als wäre ihr kleiner Engel nicht mehr hier.
Deshalb hatte sie auch die Geburtstagsgeschenke in den Keller gebracht. Monika hatte deren Anblick nicht länger ertragen. Vor allem jenen des knallroten Pakets, in dem die Westerngitarre steckte, die sich Anna so sehr gewünscht hatte. Sie würde wohl für immer darin verpackt bleiben. Niemals würden deren Saiten durchs Haus klingen. Der Gedanke daran schnürte Monika die Kehle zu.
Seit einer gefühlten Ewigkeit saß sie am Küchentisch und starrte ins Leere. Eine beklemmende Stille schrie durchs Haus.
Monika konnte nicht sagen, ob sie noch krank war. Sie hatte seit Samstag kaum geschlafen und war so sehr mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln vollgestopft, dass sie ihre Umgebung nur noch dumpf wahrnahm. Als wäre sie selbst und alles um sie herum mit einer dicken Schicht Watte umwickelt worden.
Irgendwann tauchte Thomas vor ihr auf. Viel zu nah. Die Haut in seinem Gesicht wirkte zerfurcht, die Bartstoppeln ungewohnt. Seine Augen waren gerötet, darunter lagen dunkle Schatten. Er sah so furchtbar aus, wie sie sich fühlte.
Endlich, dachte Monika, und verspürte eine absurde Genugtuung. Denn Thomas’ gespielter Optimismus und diese absolut unbegründete Zuversicht hatten sie zunehmend wütend gemacht und waren ihr bald unerträglich geworden.
»Hast du mich verstanden?«, wollte er wissen.
Offensichtlich hatte er zuvor schon etwas gesagt.
Monika sah ihn bloß an. Ihr fehlte die Kraft zu sprechen. Oder irgendetwas anderes zu unternehmen, damit er aus ihrem Blickfeld verschwand.
»Du sollst trinken!« Er zeigte auf die Tasse vor ihr auf dem Küchentisch.
Monika hatte gar nicht mitbekommen, dass er sie dorthin gestellt hatte.
»Nimm wenigstens einen Schluck.«
Sie rührte sich nicht. Es schien ihr schlichtweg undenkbar, die Kraft aufzubringen, um nach der Tasse zu greifen, sie hochzuheben und zu ihrem Mund zu führen. Oder dies Thomas zu erklären.
Ihr Blick verlor sich wieder im Nichts. Fast war es, als konnte sie durch Thomas hindurchschauen.
»Monika, du musst …«
Er hielt mitten im Satz inne. Seine Augen wurden plötzlich größer. Sein Blick schoss zum Fenster.
Thomas’ Verhalten riss Monika aus ihrer Lethargie. Erst begriff sie nicht. Doch ihre Sinne schärften sich. Und im nächsten Augenblick hörte auch sie es.
Es kam jemand.
Anna?
*
Thomas hatte es gespürt, bevor er die Reifen über den Kies der Auffahrt knirschen hörte und das Licht der Scheinwerfer durch das Küchenfenster fiel.
War zuvor zumindest noch ein letzter Funke Hoffnung in ihm gewesen, so war auch dieser nun von einer Sekunde auf die andere erloschen. Mit einer ungeheuren Wucht hatte ihn die Erkenntnis getroffen. Darüber, dass es vorbei war. Dass es ihre Familie nicht mehr gab. Und er Anna niemals wiedersehen würde. Nie mehr würde er sie in den Arm nehmen können, ihre Stimme hören. Er würde sich nie wieder über ihre viel zu laute Musik beschweren können, nicht mehr über ihre Schuhe im Vorzimmer stolpern. Sie würden niemals auf ihre bestandene Führerscheinprüfung anstoßen können, er würde sie nie mit ihrem ersten kleinen Auto überraschen können. Er würde nicht erfahren, ob sie tatsächlich einmal Physik studiert hätte, wie sie zuletzt behauptet hatte. Oder welchen Beruf sie ergriffen hätte. Wer einmal ihr Herz erobert hätte. Ob sie diesen Menschen geheiratet und Kinder mit ihm bekommen hätte. Wie sie in 20 oder 30 Jahren ausgesehen hätte. Ob sie die gleichen Lachfältchen um ihre Augen wie Monika bekommen hätte. Ob sie so früh wie er ergraut wäre. All diese Fragen und noch so viele mehr würden für immer unbeantwortet bleiben. Und Thomas war sich sicher, den Schmerz darüber niemals überwinden zu können.
Jahre später würde er seiner Therapeutin diesen Moment der Erkenntnis als väterlichen Instinkt zu erklären versuchen. Damit, dass ihm klar war, dass die Polizei sie zu so später Zeit nicht wegen einer Banalität aufsuchen würde. Schon gar nicht an Tagen wie diesen. Aber woher haben Sie zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, dass es die Polizei war?, würde die Therapeutin fragen. Und er würde ihr keine Antwort geben können.
Jetzt ging Thomas mit flatterndem Puls zum Fenster hinüber. Schirmte seine Augen mit den Händen ab, drückte sie ans Glas. Und erkannte, dass seine Vermutung stimmte und es sich tatsächlich um einen Polizeiwagen handelte, der vor ihrem Haus gehalten hatte. Die Lichter gingen aus, der Motor erstarb.
Er wandte sich Monika zu. Für einen Sekundenbruchteil glaubte er, Hoffnung in ihrem Gesicht zu erkennen. Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an, der Mund stand ihr leicht offen. Ihre Handflächen lagen auf der Tischplatte, als wollte sie sich tatsächlich hochstemmen. Doch dann begriff auch sie. Und von einem Augenblick auf den anderen wurde sie leichenblass.
»Wer … wer ist das?«, fragte sie dennoch.
Er schluckte schwer.
»Thomas …«, flehte sie. Ihre Augen wurden glasig, ihr Kinn begann zu beben.
Er konnte spüren, wie etwas auf seine Brust zu drücken begann. Wie der Druck rasend schnell stärker und stärker wurde. Und ihm das Atmen zunehmend schwerer fiel.
Einen quälend langen Augenblick passierte nichts.
Dann waren wieder Geräusche von draußen zu hören. Zwei Türen wurden geöffnet und zugeschlagen. Der Kies knirschte, Schritte näherten sich dem Haus.
»Thomas, bitte, was … was …?«, stammelte Monika. Die erste Träne lief ihr über die Wange. Gleich drauf die zweite. Und noch eine. Es wurden immer mehr. »Was … ist los? Wer ist das?«
Er hätte sie so gerne in den Arm genommen. Ihr über den Rücken gestreichelt. Ihr gesagt, dass alles gut werden würde. Aber was hätte das genützt?
Wie paralysiert ging er an ihr vorbei.
»Thomas?« Es war kaum mehr als ein Flüstern gewesen, das Monika über die Lippen gekommen war. »Bitte …«
Er verließ die Küche. Ging den dunklen Flur entlang. Und blieb im Vorzimmer stehen. Während er die verschlossene Tür anstarrte, begann seine Umgebung, sich zu drehen. Das Blut rauschte wie verrückt in seinen Ohren.
Der Bewegungsmelder reagierte, das Licht vor dem Haus sprang an. Zwei Silhouetten zeichneten sich durch das Milchglas der Eingangstür ab. An einer glaubte Thomas, die Kappe einer Uniform zu erahnen.
Monika war ihm gefolgt. Sie faselte Unverständliches in seinem Rücken. Weil er nicht reagierte, griff sie seinen Oberarm, zerrte dran. Aber er schaffte es einfach nicht, sich zu ihr umzudrehen. Er hätte ihre Trauer nicht ertragen. Stattdessen starrte er weiter auf diese verfluchte Eingangstür und fragte sich, weshalb die beiden Ankömmlinge nicht endlich läuteten.
Worauf warten sie?
Monika schlug mit der Faust auf sein Schulterblatt ein. »Thomas! Rede mit mir!«
Aber er sagte nichts.
Monika stieß einen markerschütternden Schrei aus. Sie schlug noch einmal auf ihn ein, doch ihre Kraft hatte sie verlassen.
Dann läutete es.
Und plötzlich war da kein anderes Geräusch mehr.
Für Thomas war es von diesem Moment an, als wäre er nicht länger er selbst. Als stünde er neben sich und beobachtete lediglich, wie er einen letzten Schritt auf die Tür zumachte, sie entriegelte, ein letztes Mal tief durchatmete und schließlich öffnete. Wie er die betretenen Mienen der Polizisten wahrnahm. Wie er versteinert dastand, als einer der beiden zu Boden blickte und dabei an seinem Ärmel zupfte. Und der andere »Es … es tut uns leid« sagte. Wie er daraufhin den Krach in seinem Rücken hörte. Wie er herumfuhr. Und Monika zusammengebrochen auf dem Boden liegen sah.
22 Jahre später
Elisabeth hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Einen Fuß vor den anderen zu setzen. Sich weiter durch den Regen zu schleppen, weiterzukämpfen. Hinaus aus diesem verdammten Moor. Sie musste es schaffen. Irgendwie. Aber ihre Umgebung drehte sich immer heftiger. Ihre Kräfte schwanden. Zudem fühlte es sich an, als hafteten Bleigewichte an ihren Schuhen. Schwerer Matsch war daran kleben geblieben. Und mit jedem Schritt wurde es mehr.
Sie schaute an sich hinab. Auf das Messer, das in ihrem Bauch steckte. Und konnte es nicht fassen. Sie tastete danach, zuckte zurück, schrie vor Schmerz.
Sie stützte sich an einem Baumstamm ab.
Nur ganz kurz!
Um den Schwindelanfall zu überstehen. Um Kraft zu sammeln. Und sich zu orientieren. Aber sie hatte keine Ahnung, aus welcher Richtung sie gekommen war. Wo die Stadt lag. Alles sah gleich aus. Da war kein Geräusch, an das sie sich hätte halten können. Nur ohrenbetäubendes Prasseln. Und die grelle Stimme in ihrem Kopf, die immerzu dieselbe Frage brüllte: Wie konntest du nur so blind sein?
Plötzlich glaubte sie, doch noch etwas anderes gehört zu haben. Ein tiefes Platschen. Zu tief, als dass es vom Regen gekommen sein konnte. Schritte?
Hinter dir!
Panik. Sie fuhr herum. Riss instinktiv die Arme zur Verteidigung hoch.
Doch da war niemand.
Sie drehte sich um die eigene Achse.
Niemand zu sehen.
Konnte sie sich getäuscht haben?
Sie kniff die Augen zusammen, suchte ihre Umgebung ab. All das nasse Gestrüpp, das teils hüfthohe Gras, die Bäume. Sie suchte nach einem Schatten, der da nicht hingehörte. Aber alles war verschwommen. In Bewegung. Drehte sich. Es war zwecklos.
Los, weiter!
Sie machte einen ersten wackeligen Schritt. Dann den nächsten. Beim dritten wollte sie einer tiefen Pfütze ausweichen und verlor dabei fast das Gleichgewicht. Nur mit Mühe gelang es ihr, sich auf den Beinen zu halten.
Sie würde es niemals hier rausschaffen. Würde hier sterben. In diesem verfluchten Moor.
Plötzlich war da wieder ein tiefes Platschen. Direkt hinter ihr. Sie spürte eine Bewegung. Schnellte herum. Riss erneut die Arme hoch. Doch da war es schon zu spät.
Der Schatten stürzte sich auf sie. Packte sie, verkrallte sich in ihren Haaren, riss sie herum und ihren Kopf heftig zurück. Ihr Blick war gen Baumkronen gerichtet, ihr Hals zurückgebogen. Ein Arm schlang sich darum. Drückte zu. Immer fester. Elisabeths Kehlkopf brannte vor Schmerz. Sie zerrte an dem Arm, war aber zu schwach. Bekam kaum Luft. Ihre Umgebung verschwamm. Sie schloss die Augen. War kurz davor aufzugeben. Ihren Tod zu akzeptieren.
Doch da packte sie plötzlich die Wut. Darüber, all die Jahre hintergangen worden zu sein. Belogen, betrogen. Letzte, ungeahnte Kräfte flammten in ihr auf. Sie zerrte fester an dem Arm um ihren Hals. Plötzlich ließ der Druck nach. Elisabeth rang nach Luft. Spürte gleichzeitig einen Schmerzblitz durch ihren Bauch schießen. Weil das Messer herausgezogen wurde. Im nächsten Moment wurde sie zu Boden gerissen. Alles ging so schnell. Sie hatte keine Chance. Ihr Kopf knallte gegen etwas Hartes. Dann war er auf einmal unter Wasser. Wieder trat sie aus, schlug um sich. Versuchte, gegen den neuerlichen Druck um ihren Hals anzukämpfen. Zurück an die Oberfläche zu gelangen. Verschluckte sich, bekam Wasser in die Lungen. Musste husten, schluckte noch mehr Wasser.
Und dann erfasste sie erneut Eiseskälte. Weil die Klinge in sie eindrang. Dabei Haut und Fleisch zerschnitt. An ihren Knochen kratzte.
Schmerz explodierte in ihr.
Ihr Kopf war wieder aus dem Wasser. Aber das hatte keine Bedeutung mehr. Der Schrei blieb ihr in der Kehle stecken. Es war bloß ein nasses Röcheln, das ihr entkam.
»Es ist alles deine Schuld!«
Zwei Abende zuvor Montag
1
Während es im Wasserkocher allmählich zu brodeln begann, stand Elisabeth gedankenverloren am Küchenfenster. Im Glas spiegelte sich schwach ihre Silhouette, in der Welt dahinter ihr Gemütszustand.
Die Sonne war längst untergegangen, ein düsteres Licht hing über dem Land. Eine Stunde zuvor war es völlig windstill gewesen. Jetzt fegten kräftige Böen die letzten rotbraunen Blätter von den Bäumen im Vorgarten und trieben sie über den Rasen. Das Windrad am Gartenzaun ratterte und drehte sich wie verrückt. Der Wald dahinter schien in Aufruhr, alles darin in Bewegung. Über den wankenden Fichten- und Tannenwipfeln rückte eine massive dunkle Wolkenschicht näher.
Das angekündigte Unwetter war im Anmarsch.
Einst hatte Elisabeth die Ruhe und Abgeschiedenheit der Gegend genossen. Die Tatsache, dass sie keine Nachbarn hatten. Die Stadt gut einen Kilometer entfernt lag. Und fast ihr gesamtes Grundstück von dem Wald, der sich kilometerweit in alle Richtungen ausbreitete und nur einen schmalen Korridor entlang der Straße bis zur Stadt freiließ, umschlossen war.
Aber das war lange her. Seitdem war viel passiert. Mittlerweile machte ihr der Gedanke daran Angst.
Der Angriff lag nun schon Jahre zurück. Und dennoch hatte sie immer noch Albträume. Ständig glaubte sie, irgendwo einen verdächtigen Schatten vorbeihuschen zu sehen. Ein seltsames Knarzen zu hören. Schritte. Oder ein Flüstern. Sie fühlte sich beobachtet. Konnte den fremden Blick auf ihrer Haut brennen spüren.
Besonders an diesem Abend.
Seit zwei Monaten fieberte Elisabeth ihm schon mit diesem unguten Gefühl im Bauch entgegen. Seit sie den ersten Anruf bekommen hatte.
Sie hatte sich damals gerade mit dem verstopften Abfluss in der Küche abgemüht und versucht, ihn mit einer beißend riechenden Flüssigkeit, deren Dämpfe ihr in den Augen brannten, frei zu bekommen. Da hatte das Telefon geklingelt.
»Kannst du bitte rangehen?«, rief sie Friedrich, weil ihre verschwitzten Hände in Einwegplastikhandschuhen steckten.
Sie bekam keine Antwort.
»Friedrich?«
Wieder nichts.
Das Telefon klingelte immer noch.
Genervt schnalzte sie mit der Zunge gegen die Vorderzähne. Streifte sich die Handschuhe ab, wischte sich die Hände an ihrer Schürze trocken und eilte zum Telefon.
Im Vorbeilaufen warf sie einen Blick ins Wohnzimmer. Friedrich saß dort in seinem Fauteuil vor dem laufenden Fernseher, wie er das mittlerweile die meiste Zeit des Tages tat. Er hatte die Rückenlehne leicht zurückgestellt und die Beine auf der Fußstütze überkreuzt. Seine Hände umschlossen die Fernbedienung und ruhten auf seinem Bauch. Sein Kinn auf der Brust. Er war eingeschlafen.
Elisabeth erreichte das Telefon und nahm ab.
»Sommer.«
»Frau Elisabeth Sommer?«
Die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung klang besonders nasal und war Elisabeth auf Anhieb unsympathisch.
»Ja?«
»Grüße Sie, Klaus Königsberger mein Name.«
Der Mann legte eine Pause ein. Als sollte sein Name irgendeine Erkenntnis bei ihr hervorrufen oder gar als Erklärung für seinen Anruf ausreichen.
»Ja bitte?«
»Ich nehme an, Sie kennen die Sendung ›Mörder im Visier‹?«
Elisabeth kannte sie nicht. Dennoch spürte sie, wie sich schlagartig ihr Puls erhöhte. Wie eine dunkle Vorahnung sie überkam.
»Nein.«
»›Mörder im Visier‹«, wiederholte Königsberger deutlich langsamer.
»Kenne ich nicht.«
»Oh. Nun, …«, setzte er an und schien ein wenig aus dem Konzept geraten. »Ich bin der leitende Redakteur der Sendung. Wir behandeln darin ungeklärte Mordfälle und andere schwerwiegende Verbrechen. Dabei ist es uns ein Anliegen, dass …«
»Darf ich fragen, was Sie von mir wollen?«
Elisabeth glaubte, die Antwort bereits zu kennen. Sie versuchte, dem Drang, sofort aufzulegen, zu widerstehen.
»Wir beabsichtigen, einen Beitrag über den Mordfall Anna Venz zu gestalten und …«
»Kein Interesse.«
Elisabeths Puls hatte sich weiter in die Höhe geschraubt.
»Bitte lassen Sie mich erst mal erklären. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie als Mutter der besten Freundin …«
»Nein.«
»Aber Sie könnten Ihre Sicht der Dinge …«
»Tut mir leid.«
Elisabeth hatte aufgelegt. Sie zitterte am ganzen Körper. Starrte das Telefon an, als hätte es eben nach ihr geschnappt. Minutenlang. Den Rest des Tages war sie zu nichts mehr zu gebrauchen.
Doch Königsberger ließ nicht locker. Er versuchte es schon am darauffolgenden Tag erneut.
»Hören Sie, Frau Sommer, es wird sich dabei um einen äußerst seriösen Beitrag handeln, das kann ich Ihnen versichern. Unser oberstes Ziel ist es, Annas Mörder zu finden und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Der Moorkiller muss …«
»Ich habe Nein gesagt. Und dabei bleibt es auch!«
»Aber Frau Sommer, Sie sollten wirklich …«
»Hören Sie auf, mich zu belästigen!«
Wieder legte Elisabeth auf.
Natürlich hatte sie sich inzwischen informiert und sich ältere Beiträge der Sendung im Internet angesehen. Danach war ihr klar gewesen: Königsberger und den anderen Machern ging es nicht um eine seriöse Berichterstattung, sondern vielmehr darum, den Zusehern mit makabren und möglichst grausigen Bildern Angst einzujagen.
Zwei Tage später versuchte Königsberger es schließlich ein letztes Mal, Elisabeth zu einem Interview zu bewegen. Dieses Mal bot er ihr Geld an. Sehr viel Geld. Und als sie ablehnte, verdoppelte er den Betrag sogar. Aber Elisabeth überlegte keine Sekunde, es anzunehmen. Auf keinen Fall wollte sie Teil dieser hetzerischen Sendung sein. Und um nichts auf der Welt wollte sie mit Annas Tod Geld verdienen.
»Ich will Ihr Geld nicht, hören Sie! Und wenn Sie mich noch einmal belästigen, wende ich mich an die Polizei!«
Es war naiv von ihr, zu glauben, sich dadurch der Aufregung entziehen zu können. Das war schlichtweg unmöglich. Die Sendung wurde schnell zum beherrschenden Thema in der Stadt. Annas Ermordung war wieder in aller Munde. Spekulationen wurden angeheizt, Gerüchte gestreut, alte und neue Schuldzuweisungen gemacht.
Fast war es, als hätte es die letzten 22 Jahre nicht gegeben. Als hätten die Wunden nie Zeit gehabt zu heilen. Als wäre Annas nackte Leiche erst gestern im Moor gefunden worden.
Zwei Monate war Königsbergers erster Anruf nun her. Seither hatte Elisabeth schlecht geschlafen. Die letzten beiden Nächte hatte sie kaum ein Auge zubekommen. Immerzu waren ihr die Ereignisse von damals durch den Kopf gespukt. Bilder vor ihrem geistigen Auge aufgeblitzt.
Gesichter.
Friedrichs, als das frühmorgendliche Läuten an der Tür sie beide aus dem dünnen Schlaf gerissen hatte. Valeries, als sie Sekunden später den Kopf in den Flur hinausgestreckt und ängstlich »Wer ist das, Mama?« gefragt hatte. Ihr eigenes, als sie mit einer grausamen Vorahnung am Vorzimmerspiegel vorbeigehuscht war. Jene der beiden Polizisten, die vor ihrer Tür gestanden hatten. Monikas, als der Sarg ihrer Tochter ein paar Tage später in die Erde hinabgelassen worden war. Und Thomas’, als er Monika gestützt und dabei eine unsagbare Traurigkeit ausgestrahlt hatte. Aber auch abgrundtiefen Hass.
Friedrich gegenüber hatte Elisabeth versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Wenn er schon mit der Bürde seiner Krankheit leben musste, so sollte seine Vergesslichkeit wenigstens einmal etwas Gutes haben. Sie hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, ihm die Sendung zu verschweigen. Aber das wäre nicht fair gewesen. Anna war auch ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen. Außerdem würde es gut sein, ihn gleich an ihrer Seite zu haben. Elisabeth fürchtete sich davor, was der TV-Beitrag in ihr auslösen würde.
Ein leises Pochen drang allmählich zu ihr durch und zerrte sie aus ihren trüben Gedanken. Elisabeth begriff, dass es der Türkranz war, den sie selbst aus Tannenzweigen geflochten hatte und der vom Wind durchgerüttelt wurde und gegen das massive Holz klopfte. Ihr war klar, dass sie ihn besser hätte abnehmen und ins Haus holen sollen. Aber in diesem Moment war er ihr schlichtweg egal. Sollte ihn der Wind doch tragen, wohin er wollte.
Der Wasserkocher schaltete sich mit einem Schnappen aus.
Mit leicht zittrigen Händen goss Elisabeth das brodelnde Wasser in die Kanne, in die sie bereits einen Beutel mit selbst gemachtem Hagebuttentee gehängt hatte. Die Gläser ihrer Brille liefen dabei an.
»Schatz?«
Es war Friedrich gewesen, der sie über den lärmenden Fernseher hinweg aus dem Wohnzimmer gerufen hatte.
»Ja?«
»Kommst du?«
Sie stellte den leeren Wasserkocher zur Seite. Blickte zur Wanduhr neben dem Kühlschrank. Weil sie nichts erkennen konnte, nahm sie die Brille ab. Ohne sie fühlte Elisabeth sich blind wie ein Maulwurf. Auch jetzt konnte sie die Uhr nur verschwommen wahrnehmen und musste zwei Schritte näher rangehen.
Noch neun Minuten.
Jetzt war es also wirklich gleich so weit.
Sie schloss die Augen, rieb sie sich mit Daumen und Zeigefinger. Atmete tief durch. Versuchte, Mut zu fassen, sich zu wappnen. Und wusste dabei ganz genau, dass es zwecklos war. Es würde schlimm werden. Egal, was sie tat oder sich einzureden versuchte.
»Elisabeth?«
»Ja, ich komme schon!«
Sie setzte sich die Brille wieder auf. Warf einen letzten Blick aus dem Fenster. Die dunklen Wolken waren schon ganz nah.
2
Als Elisabeth ins Wohnzimmer kam, saß Friedrich wie immer in seinem Fauteuil. Sein schneeweißer Haarkranz war bereits eine Spur zu lang geworden und zerzaust. Er ließ ihn sich nur noch widerwillig kämmen. An Tagen, an denen sie das Haus nicht verließen, ersparte Elisabeth ihnen beiden diese leidige Prozedur.
Obwohl sie ihm ständig seine Lieblingsgerichte kochte, Pfannkuchen zum Beispiel, hatte Friedrich in den letzten Monaten stark abgenommen. Sein Wohlstandsbäuchlein, das er sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hatte, war nahezu verschwunden. Dafür schienen seine Tränensäcke und die Haut unter seinem Kinn täglich schwerer zu werden. Aber davon konnte auch Elisabeth ein Lied singen. Jeden Morgen, wenn sie in den Spiegel sah, war sie aufs Neue darüber schockiert.
Friedrich sah nicht zu ihr auf. Stattdessen glotzte er regungslos auf den Fernseher, in dem eine Kochsendung mit mehr oder weniger prominenten Menschen lief. Eine Blondine Anfang 30, die Elisabeth nicht kannte und die gekleidet war, als würde sie eine hochelegante Abendveranstaltung besuchen, kreischte hysterisch, weil das Wasser in ihrem Topf überkochte. Anstatt den Deckel anzuheben oder den Topf von der Herdplatte zu nehmen, zappelte sie auf halsbrecherisch hohen Stöckelschuhen durchs Studio. Dabei rutschte sie beinahe aus. Das Publikum lachte und klatschte.
Verrückte Welt.
Friedrichs Arme ruhten auf den breiten Lehnen seines Fauteuils. In der rechten Hand hielt er ein Glas Himbeersaft, seit einiger Zeit sein Lieblingsgetränk. Elisabeth konnte sich nicht erinnern, dass er vor seiner Erkrankung jemals Himbeersaft getrunken hatte. Leitungswasser war ihm immer am liebsten gewesen. Abends ab und zu mal ein kleines Bier. Zur Not auch ein Glas Weißwein. Aber niemals Himbeersaft. Womöglich hing diese spät entdeckte Leidenschaft ja mit einer Erinnerung aus seiner Kindheit zusammen. Jedenfalls aber an eine Zeit, in der sie sich noch nicht gekannt hatten.
Friedrich trug seinen Lieblingspyjama, den dunkelblauen mit den verschlissenen Ärmeln und dem Loch an der Schulternaht. Elisabeth konnte nicht sagen, wie oft sie dieses verdammte Ding schon genäht hatte. Aber kaum, dass Friedrich ihn einen Abend lang trug, tauchte ein neues Loch irgendwo entlang einer Naht auf. Eigentlich hätte das Teil längst in die Altkleidersammlung gehört. Aber dagegen wehrte Friedrich sich vehement.
Seine ausgelatschten rot-braun karierten Hausschlappen warteten parallel zum Fauteuil angeordnet auf ihren letzten Einsatz des Tages. Auch sie hätten längst entsorgt gehört. Vor über einem Jahr hatte sie ihm neue gekauft. Aber obwohl sie den alten zum Verwechseln ähnlich sahen, weigerte Friedrich sich, sie zu tragen. Es seien nicht seine, behauptete er, wann immer Elisabeth sie ihm unterzujubeln versuchte. Ein einziges Mal war es ihr gelungen, ihn davon zu überzeugen, ihnen zumindest eine Chance zu geben. Da hatte er schon beim Hineinschlüpfen behauptet, dass sie unbequem seien und seine Füße darin schmerzten. Elisabeth hatte ihn gebeten, sie erst einmal einzutragen, und versucht, sein Gejammer zu ignorieren. Aber schon nach einer halben Stunde gab sie sich geschlagen und brachte ihm seine alten zurück.
Manchmal war Friedrich wie ein Kind.
Und dennoch liebte Elisabeth ihn. Mit all seinen Macken und Eigenheiten. Seinen Schwächen und Fehlern. Seiner Sturheit zum Beispiel. Oder seiner meist stillen und in sich gekehrten Art, seinen einsilbigen mürrischen Antworten. Seinem Ungeschick, was handwerkliche Tätigkeiten anging. Und seiner fehlenden Selbstreflektion darüber. Seit über 40 Jahren war Friedrich der Mann an ihrer Seite. Ihre Schulter zum Anlehnen. Das wärmende Licht ihres Lebens, wie sie ihn einmal in einem Gedicht genannt hatte. Zugegeben, das war vielleicht eine Spur zu kitschig gewesen. Aber Friedrich war ganz einfach der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Und jetzt, da er auf ihre Hilfe angewiesen war, hatte sie sich geschworen, immer für ihn da zu sein.
Trotz seiner scheinbaren Teilnahmslosigkeit wusste Elisabeth, dass Friedrich sich auf ihren gemeinsamen Fernsehabend freute. Auf ihr allabendliches Ritual. Wenn sie ehrlich war, hatte Elisabeth keine große Lust, jeden Abend vor der Glotze zu verbringen. Einen guten, anspruchsvollen Film, ja, aber nicht immer diesen Müll, den Friedrich sehen wollte. Stattdessen hätte sie lieber mal wieder eine gute Oper gehört, wie früher eine Partie Schach gespielt oder ein gutes Buch gelesen. Elisabeth hatte einmal gehört, dass es im Japanischen einen Begriff dafür gab, sich Bücher zu kaufen, jedoch nicht zu lesen: Tsundoku. Sie war wohl mittlerweile zu einer Spezialistin dafür geworden, wusste schon gar nicht mehr, wohin mit all den Bücherstapeln.
Aber was blieb ihr anderes übrig? Seit seiner Erkrankung waren Friedrich solche Regelmäßigkeiten wie simple Fernsehabende wichtig geworden. Und wann immer sie versuchte, von der Routine abzuweichen, wurde er unruhig.
Jetzt wirkte er zufrieden. Er hatte keine Ahnung, dass es kein Abend wie jeder andere war. Dies war das erste Mal, dass Elisabeth ihn um seine Vergesslichkeit beneidete.
Sie stellte die Teetasse am Tisch ab und versuchte, es sich auf der Couch bequem zu machen. Doch sie war zu angespannt, fand keine angenehme Position. Schon nach wenigen Sekunden regte sich ein Schmerz in ihrem Kreuz, und in ihrem Nacken begann es zu ziehen. Sie steckte sich einen kleinen Zierpolster dahinter. Aber die neue Haltung machte es nur noch schlimmer, also legte sie ihn wieder zur Seite.
Sie warf einen Blick auf die Standuhr in der Ecke.
Noch sieben Minuten.
Friedrich sah Elisabeth zum ersten Mal an, seit sie ins Wohnzimmer gekommen war. Er hatte ihre Unruhe bemerkt, sagte jedoch nichts. Stattdessen widmete er sich wieder der Kochsendung, in der die hysterische Blondine es tatsächlich fertiggebracht hatte, einen Mixer zum Qualmen zu bringen. Das Publikum hatte einen Heidenspaß.
Noch sechseinhalb Minuten.
Auf einmal reichte es Elisabeth. Sie hatte das Gefühl, diese stumpfsinnige Sendung keinen Augenblick länger ertragen zu können. Sie nahm die Fernbedienung vom Tisch und wechselte ohne Vorwarnung den Sender.
Friedrich sah sie erneut an. Sein Gesichtsausdruck war ein einziges Fragezeichen.
»Wollen wir das ›Quizrennen‹ schauen?«, fragte er.
Er liebte diese Rateshow. Elisabeth hingegen fand sie ausgesprochen langweilig, und sie glaubte nicht, dass Friedrich ihr wirklich folgen konnte. Vielmehr vermutete sie, dass ihm bloß die Moderatorin gefiel. Und das konnte sie ihm wirklich nicht verübeln. Die junge Lateinamerikanerin hatte volle Lippen, einen ausgesprochen süßen Akzent und trug stets Kleider, die ihre körperlichen Vorzüge – und die waren nicht zu verleugnen – perfekt in Szene setzten. Garantiert hatte die Show einen überdurchschnittlich hohen Männeranteil unter den Zusehern.
»Das ›Quizrennen‹ ist immer samstags«, antwortete Elisabeth. »Heute ist Montag.«
»Montag?«
»Ja, Montag.«
»Ah.« Sein Blick wanderte zurück zum Fernseher. »Montag«, murmelte er.
Elisabeth beobachtete Friedrich aus dem Augenwinkel. Sie war sich sicher, dass er gerade gar nicht wahrnahm, was er sah. Sie konnte es der Leere in seinem Blick entnehmen.
»Was wollen wir denn schauen?«, fragte er.
»Du weißt ja«, setzte sie an und ärgerte sich sofort darüber, schon wieder diese Phrase verwendet zu haben. Denn natürlich hatte er keine Ahnung. Elisabeth verstand nicht, wieso sie ihr immer wieder über die Lippen rutschte. Wahrscheinlich war es eine Art Verdrängung. Ausdruck dafür, dass sie seinen geistigen Verfall nicht akzeptieren konnte. »Jetzt beginnt gleich eine Sendung über ungeklärte Verbrechen.«
»Mh«, machte er und schien nicht begeistert.
»Da bringen sie auch einen Beitrag über Anna«, fügte sie hinzu.
Er riss die Augen auf, wandte sich in seinem Fauteuil zu ihr um. »Über Anna?«
»Ja.«
»Über … über …?«
»Ja, Friedrich. Über Valeries Freundin.«
»Was … was ist das für eine Sendung?«
»Sie heißt ›Mörder im Visier‹.«
»Mörder …?«
»… im Visier, ja.«
Sie bereute es bereits, ihm diese verdammte Sendung nicht einfach verschwiegen zu haben.
»Aber wieso?«
»Erinnerst du dich, dass Anna …« Elisabeth holte tief Luft. Selbst nach all den Jahren fiel es ihr schwer, es auszusprechen. »… dass sie ermordet wurde?«
»Ermordet?«
Er begann, den Kopf zu schütteln. Sein Blick ging ins Leere. Er wandte sich von Elisabeth ab. Murmelte Unverständliches.
Elisabeth hatte es sich plötzlich anders überlegt. Sie wollte das Gespräch weg von dem Mord lenken. Es zumindest noch einen weiteren Moment hinauszögern. Deshalb zeigte sie, einer spontanen Eingebung folgend, auf das gerahmte Foto auf der Kommode unmittelbar neben Friedrich.
»Als Valerie letzte Weihnachten hier war, da haben wir gemeinsam das Grab besucht. Kannst du dich erinnern?«
Er beachtete das Bild nicht. Raunte stattdessen etwas, das wie »Anna ist im Moor« klang.
Das stimmte. Annas Leiche war im Moor unweit des Besucherparkplatzes gefunden worden. Dennoch ging Elisabeth nicht darauf ein. Sie ließ nicht locker.
»Schau dir das Foto an, Schatz! Kannst du dich an letzte Weihnachten erinnern? Als Valerie mit den Kleinen hier war?«
Friedrich wandte seinen Kopf um. Sah jedoch das falsche Bild an.
Neben jenem von Valerie stand das gerahmte Hochzeitsfoto ihres Sohnes Philipp und dessen Frau Sarah. Es war im Jahr nach dem Mord entstanden. Zu einer Zeit, in der ihr eigentlich noch so gar nicht nach Feiern zumute gewesen war. Und dennoch war es ein schöner Abend gewesen. Zum gefühlt ersten Mal war Elisabeth damals wieder ein Lachen entkommen.
»Nicht dieses Bild. Schau ein Stück weiter links!«
Jetzt betrachtete Friedrich das richtige Foto. Aber gleich darauf sah er Elisabeth an und schien nicht recht zu wissen, was sie von ihm wollte.
»Auf dem Foto, das ist Valerie«, erklärte sie.
Er schaute es noch einmal an, länger als zuvor. Dann wieder Elisabeth. »Das ist nicht Valerie.«
»Doch, Friedrich, sieh es dir genau an! Die Frau auf dem Bild ist Valerie.«
Das Problem mit dem Foto ihrer Tochter war, dass es eben erst letzte Weihnachten entstanden war. Valerie hatte damals eine neue Kurzhaarfrisur und ein wenig zugenommen gehabt. Das erschwerte es Friedrich noch mehr, darauf seine Tochter zu erkennen. Mit Fortschreiten der Krankheit hatte er sie zunehmend als kleines Mädchen in Erinnerung, das nur deshalb nicht hier war, weil es oben in seinem Zimmer spielte oder in der Schule war. Da passte eine 39-jährige Frau nicht in sein Denkschema. Als sie letzte Weihnachten vor der Tür gestanden hatte, hatte Friedrich sich ihr vorgestellt und ihr eine Führung durchs Haus angeboten.
»Sie ist in ihrem Zimmer, richtig?«
»Nein, Friedrich.«
»Wo ist sie?«
»Valerie ist zu Hause.«
»Valerie!«, rief er plötzlich aus voller Kehle.
»Schatz, …«
»Komm runter!«
»Valerie ist bei sich zu Hause.«
»Sie ist nicht in ihrem Zimmer?«
»Nein, sie wohnt in London. Schon viele Jahre.« Sie ist kurz nach dem Mord weggegangen.
Er runzelt die Stirn. »In London?«
»Ja, mit Tom und den Kindern.«
Das hatte ihm den Rest gegeben. Jetzt war er schwer durcheinander. Elisabeth konnte ihm förmlich ansehen, wie es in ihm ratterte. Wie er versuchte, diese Informationen zu verarbeiten.
»Welchen Kindern?« Er kratzte sich die Schläfe.
Elisabeth konnte nicht sagen, wie oft sie beide diese Erkenntnis bereits hatten durchkauen müssen.
»Unsere beiden Enkelkinder, Schatz. Lily und Alice.«
»Unsere …?«
»Ja, Friedrich. Lily und Alice sind unsere Enkelkinder. Auch sie waren letzte Weihnachten hier.«
Elisabeth streckte sich nach vorne und zeigte auf einen weiteren Bilderrahmen auf der Kommode. Friedrich hatte das Bild bisher nicht gesehen, weil es schräg hinter ihm stand.
»Sieh doch!«
»Das?«
»Ja, das sind Lily und Alice.«
Er betrachtete das Foto einen Augenblick lang. Dann sah er Elisabeth an und kurz darauf wieder das Foto. Er redete leise vor sich hin und wandte sich schließlich dem Fernseher zu, immer noch murmelnd. Er kratzte sich den Handrücken. Versuchte, das Gehörte zu verdauen. War sichtlich überfordert damit. Kratzte sich die Schläfe, dann erneut den Handrücken.
Elisabeth war froh darüber, dass ihr Ablenkungsmanöver funktioniert hatte. Gleichzeitig tat ihr Friedrich leid, und sie fühlte sich schäbig. Sie hätte ihn dieser unnötigen Belastung nicht aussetzen dürfen. Hätte sie es geschickt angelegt, würde er längst im Bett liegen und friedlich träumen. Er hätte niemals etwas von diesem Beitrag mitbekommen müssen.
Elisabeth war klar, dass es wohl das Beste gewesen wäre, Friedrich schnell ins Bett zu bringen. Aber dafür war es zu spät. »Mörder im Visier« würde in etwa fünf Minuten beginnen. Und so sehr sie sich davor fürchtete, sie wollte den Beitrag auf keinen Fall verpassen. Sie musste sich ihm stellen. Ihre Geister besiegen.
Und so saß Elisabeth einfach nur da. Voller Schuldgefühle und Anspannung.