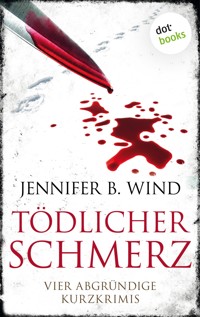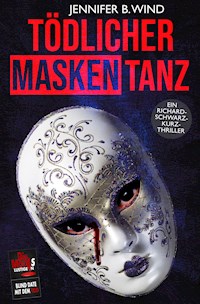5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Jutta Stern und Tom Neumann
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein Unrecht jenseits der Menschlichkeit: Der brisante Thriller »Wenn der Teufel erwacht« von Bestsellerautorin Jennifer B. Wind als eBook bei dotbooks. Denn Gnade gibt es nur für jene, die es sich leisten können … Im Kofferraum eines Autos werden zwei Leichen entdeckt – ausgemergelt, aneinandergepresst, entsorgt wie Müll, an den niemand mehr denken will. Handelt es sich bei ihnen um Flüchtlinge, die von einer Schlepperbande illegal ins Land gebracht wurden und dafür einen schrecklichen Preis bezahlen mussten? Die Ermittler Jutta Stern und Tom Neumann finden schnell eine Spur – doch als weitere Tote gefunden werden, zeigt sich, dass noch mehr dahintersteckt, als sie für möglich gehalten haben. Wer sind die Strippenzieher in diesem menschenverachtenden System, in dem ein Leben weniger wert zu sein scheint als eine Handvoll Geldscheine? »Knallhart, dramatisch, actiongeladen! Ein fesselnder Thriller, lebensnah und mitreißend erzählt.« Bestsellerautor Veit Etzold Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Bestseller »Wenn der Teufel erwacht« von Jennifer B. Wind stellt ein ebenso schockierendes wie hochaktuelles Thema in den Mittelpunkt – das Elend der Menschen, die auf der verzweifelten Suche nach einer sicheren Heimat sind. Ein Thriller, der bewegt. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Ähnliche
Über dieses Buch:
Denn Gnade gibt es nur für jene, die es sich leisten können … Im Kofferraum eines Autos werden zwei Leichen entdeckt – ausgemergelt, aneinandergepresst, entsorgt wie Müll, an den niemand mehr denken will. Handelt es sich bei ihnen um Flüchtlinge, die von einer Schlepperbande illegal ins Land gebracht wurden und dafür einen schrecklichen Preis bezahlen mussten? Die Ermittler Jutta Stern und Tom Neumann finden schnell eine Spur – doch als weitere Tote gefunden werden, zeigt sich, dass noch mehr dahintersteckt, als sie für möglich gehalten haben. Wer sind die Strippenzieher in diesem menschenverachtenden System, in dem ein Leben weniger wert zu sein scheint als eine Handvoll Geldscheine?
»Knallhart, dramatisch, actiongeladen! Ein fesselnder Thriller, lebensnah und mitreißend erzählt.« Bestsellerautor Veit Etzold
Über die Autorin:
Jennifer B. Wind, geboren in Leoben, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern südlich von Wien. Die ehemalige Flugbegleiterin mit Gesangs-, Klavier- und Schauspielausbildung schreibt heute unter anderem sehr erfolgreich Thriller, Romane und Drehbücher, für die sie mehrfach ausgezeichnet und von Kritik und Leserschaft gleichermaßen gefeiert wird. Jennifer B. Wind ist als Jurymitglied für verschiedene Literaturpreise aktiv und sorgt mit ihrer One-Woman-Krimi-Show für voll besetzte Säle. In ihrer Freizeit engagiert sie sich aktiv im Tier- und Umweltschutz, in diversen Kulturvereinen und in der Gewaltprävention gegen Kinder und Frauen.
Mehr Informationen über die Autorin finden sich auf ihrer Website www.jennifer-b-wind.com sowie bei Facebook (www.facebook.com/jennifer.wind) und Instagram (www.instagram.com/jenniferb.wind).
Bei dotbooks veröffentlichte Jennifer B. Wind bereits den Thriller »Als Gott schlief«; weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe September 2021
Dieses Buch erschien bereits 2016 unter dem Titel »Als der Teufel erwachte« bei Emons.
Copyright © der Originalausgabe Emons Verlag GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Nagib, Evas, NPvancheng, milart
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-860-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wenn der Teufel erwacht« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jennifer B. Wind
Wenn der Teufel erwacht
Thriller
dotbooks.
To whom it may concern
and to all readers who believe in a world
full of peace and love.
I do.
Do you?
Prolog
Das Boot, Mittelmeer, zwischen Libyen und Italien, nachts
Samir
Kälte zog unter seiner Hose die Beine hinauf, kroch über seine Oberschenkel. Schmiegte sich an seinen Bauch. Auf seiner Brust stellten sich die Haare auf. Er presste die Beine dichter an seinen Körper und schlang die Arme um die Knie, in der Hoffnung, das Zittern, das ihn seit zwei Stunden peinigte, würde aufhören. Obwohl sein Körper an zwei anderen rieb, wurde ihm nicht wärmer. Schweiß- und Fäulnisgeruch stieg ihm in die Nase und vermischte sich mit dem Salzgeschmack auf seinen Lippen. Dazu wirkte das stete Klatschen der Wellen an den Rand des Boots wie die Musik aus einer fremden Welt. Und irgendwie war es das ja auch, eine fremde Welt. Sein Magen knurrte, die Übelkeit wurde mit jeder Minute größer.
Das Schwarz des Himmels verkündete ein größeres Unheil als die Kälte und Enge auf dem Boot. Seit einer halben Stunde war das sanfte Blinken der Sterne Vergangenheit. Ein gleißender Lichtstrahl zerriss die Dunkelheit. Kurz konnte er die Gesichter seiner Mitreisenden sehen. Keiner wagte zu schlafen. Glasige Augen starrten in die Dunkelheit. Hoffnung lag in ihrem Blick.
Ein schwaches Grollen folgte einige Minuten später. Noch war Zeit. Vielleicht hatten sie Glück, und das Gewitter würde einen anderen Weg nehmen. Es konnte dennoch nicht schaden, vorbereitet zu sein. Mühsam hievte Samir sich hoch und zog den Rucksack unter seinem Hintern hervor.
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis er die Schnüre gelöst hatte, steif bewegten sich die Hände über den Knoten. Seine Finger strichen über die Öffnung. Ein Blick nach links, einer nach rechts, seine Nachbarn starrten in den Himmel oder auf den Boden. Rasch tastete er nach seinem Smartphone. Die Klarsichtfolie, in die er es verpackt hatte für den Fall, dass der Rucksack ins Wasser fiel, war dicht. Hoffentlich. Vorsichtig steckte er das Telefon in die innere Seitentasche, darauf bedacht, es nicht aus Versehen einzuschalten. Den letzten Schokoriegel und die halb gefüllte Wasserflasche ignorierte er, obwohl sein Magen wieder knurrte.
Zwischen Taschenmesser, Zahnputzsachen, Handtuch, Unterhosen, Socken und einer Taschenbuchausgabe des Korans fand er den auf A6-Größe gefalteten Regenschutz, den der Schlepper ihm mitgegeben hatte. Die dünne Folie riss gleich beim Auspacken an der Kapuze ein. Vorsichtig steckte er seinen Kopf durch das dafür vorgesehene Loch, zog den Rest der Kapuze über seine Locken, strich die Pelerine über seinen Knien glatt und klemmte die Enden unter seinen Po und seine Schuhe.
Einer nach dem anderen tat es ihm gleich. Das Schaukeln wurde stärker. Gegenüber kotzte jemand auf seine Schuhe, was die Reisenden neben ihm – je nach Stimmung – mit Geschrei oder Gelächter quittierten.
Die Enge führte bei einigen zu Aggressionen. Zwei Stunden zuvor waren sich drei Männer in die Haare geraten. Jeder hatte behauptet, der andere habe ihn bestohlen. Wie es ausgegangen war, wusste Samir nicht. Es war ihm auch egal. Hatten sie nicht andere Probleme? Wenn er in den schwarzen Himmel sah, graute ihm: vor den nächsten Stunden, dem Ende der Nacht, dem nächsten Morgen. Wenn sie ihn überhaupt erlebten.
Die Planken knirschten bei jeder Bewegung. Das Fischerboot hatte seine besten Tage bereits hinter sich. Die Schlepper hatten es wohl umgebaut, denn eine Führerkabine fehlte, und der Steuerstand war einfach frei mittig montiert – vermutlich um mehr Menschen unterzubringen. Es war ein alter dänischer Fischkutter der Marke Bagenkop, etwa vierzehn Meter lang und vier Meter breit. Die Farbe war überall abgesplittert. Den Resten nach zu urteilen, dürfte es früher hellblau gewesen sein mit weißen Absetzungen. Der Name des Boots war mit einem schwarzen Balken überstrichen. Am Bug und am Heck reichte die Seitenwand Samir nur bis zur Mitte der Oberschenkel. Natürlich war das für Fischer von Vorteil, wenn sie die Netze einholten, doch bei den Menschen, die hier saßen, war dadurch die Angst, über Bord zu fallen, viel größer. Zum Festhalten gab es nur ein paar Seile. Da der Kutter hoffnungslos überfüllt war, hatte er ordentlich Tiefgang. Immer wieder schwappten Wellen herein. Dass der Tank dicht war, wagte Samir zu bezweifeln, der starke Dieselgeruch war ihm schon beim Einsteigen aufgefallen.
Sein Vater war unter Deck. Die Alten, Schwachen und Kranken hatten eine Holzpritsche erhalten. Die Matratze war bereits starr vor Dreck gewesen, als er seinen Vater dorthin begleitet hatte. Wie viele Menschen mussten dort schon gelegen haben? Decken und Kissen hatte er vergebens gesucht. Ebenso Fenster, nicht einmal eine Luke war eingelassen. »Zu Ihrer Sicherheit«, hatte der Schlepper gesagt. Die Luft war staubig und zäh gewesen, wie Honig war sie Samirs Luftröhre hinuntergeflossen. Es hatte sich angefühlt, als müsste man durch einen dünnen Strohhalm atmen.
Samir hatte Vater unter den Arm genommen und wollte ihn Richtung Ausgang ziehen. Doch er hatte sich nicht gerührt, stattdessen hatte er ihn mit rot geränderten Augen angesehen und seine Hand auf Samirs Arm gelegt. »Wenigstens habe ich ein Bett.«
Samir hatte genickt, verstanden. Sie hatten beide seit Tagen nicht richtig geschlafen. Doch Samir war lieber noch eine Nacht wach geblieben, als in dieser stickigen Kammer unter Wasser zu bleiben.
Jetzt dachte er mit Schrecken an seinen Vater, der unter Deck selig schlief. Die Luke zum Abstieg war in der Mitte des Boots, dort, wo vermutlich früher die Führerkabine war. Hunderte Menschen saßen, lagen und hockten dicht an dicht auf den Holzplanken. Kein Weg führte da durch.
Zur Kälte gesellte sich jetzt die Nässe. Sanft klopfte es auf seine Kapuze. Samir legte den Kopf in den Nacken und leckte dankbar die Tropfen ab, die auf seine Lippen fielen. Mit den Händen formte er eine Tasse und wartete, bis sie gefüllt war. Gierig trank er. Formte die Hände wieder. Wartete. Trank.
Das belebende Prasseln ging in ein Peitschen über. Eisige Böen schnitten über Samirs Wange. Er drückte das Gesicht auf seine Knie. Erbarmungslos öffnete der Himmel nun seine Schleusen. Der Sturm wurde heftiger, das Boot von den Wellen durch das Meer geschleudert. Von links und rechts vernahm er Würgegeräusche. Es stank durchdringend nach Magensäure. Diesmal lachte niemand. Je lauter der Sturm blies, umso stiller wurde es auf dem Boot.
Rechts von Samir weinte ein Junge. Kaum älter als vierzehn. Ängstlich drückte er sich an die Wand des Kahns, die hier nur einen Meter hoch war. Der Körper wurde trotzdem hin und her geschleudert, denn er fand keinen Halt mit seinen Händen. Das Holz war glitschig und der Junge bis auf die Knochen abgemagert. Wie fast alle hier. Samir überlegte, wann er zuletzt eine warme Mahlzeit genossen hatte. Es musste Tage, wenn nicht Wochen, her sein.
Ein Schrei riss Samir aus seinen Gedanken. Der kleine Junge war von Bord gefallen. Irgendjemand sprang ihm nach. Samir wusste, dass nun zwei Menschen sterben würden. Es war sinnlos, bei diesem Wetter, in dieser Dunkelheit im aufgewühlten Meer zu suchen.
Vor Schreck biss sich Samir in die Unterlippe. Er kniete sich seitlich zur Wand, krallte sich mit einer Hand an der Reling fest und saugte das Blut aus seiner Lippe. Der metallene Geschmack beruhigte ihn etwas. Mit der anderen Hand schob er seinen Rucksack unter die Knie. Die Hilferufe des Jungen und des Helfers wurden vom Getöse des Sturms überlagert, bis sie schließlich ganz verstummten.
Es blitzte. Deutlich konnte Samir erkennen, dass einer der Schlepper den Kopf aus der Luke streckte und dem zweiten Mann an Deck etwas zurief. Ein Raunen ging durch die Menge derer, die in der Nähe saßen. Es waren vermutlich diejenigen, die der arabischen Sprache mächtig waren. Samir beherrschte sie.
»Sokb«, hörte er den Schlepper rufen. Ein Leck? Jetzt, hier? Mitten auf dem Ozean? Wie weit waren sie vom Festland entfernt? Das Smartphone konnte er jetzt nicht herausholen. Mit wippendem Oberkörper presste er den Rucksack an sich.
Vater!, schoss es ihm durch den Kopf, er musste seinem Vater helfen. Unter Deck würde das Wasser schnell steigen, wenn das Boot wirklich leck war. Trotz seiner Übelkeit und des Hungers krabbelte Samir auf allen vieren nach vorne, kletterte dabei über die Berge an Körpern, seine rechte Hand griff in etwas Warmes. Er roch daran. Säuerlich. Kotze. Angeekelt wischte er seine Handfläche an der Hose sauber. Bei der Luke angekommen, stand er wankend auf, um gleich wieder auf das nasse Holz zu fallen.
Der Schlepper hockte auf der Luke, im Mund klemmten Nägel, in der rechten Hand hatte er einen Hammer. Mit der anderen hielt er einen Nagel an eine Ecke der Luke und hämmerte ihn in das Holz. Sein Komplize leuchtete ihm mit der Taschenlampe. Samir begriff schnell.
»Was tust du da?«, schrie er auf Arabisch gegen den Sturm. Ohne aufzublicken, nagelte der Schlepper weiter. Samir schlug ihm den Hammer aus der Hand. »Mein Vater ist da drin! Er wird ertrinken!«
»Na, und wennschon«, schrie der Schlepper zurück und wischte sich mit dem Ärmel den Regen aus dem Gesicht. »Das werden wir vielleicht alle! So haben wir oben vielleicht noch eine Chance, uns etwas länger zu halten.«
»Ich lass das nicht zu!«
Im Lichtkegel der Taschenlampe konnte er das Grinsen im Gesicht des bulligen Mannes sehen. »Setz dich, Junge, oder ich schmeiß dich von Bord!«
Das glaubte er ihm sogar, denn vor zwei Stunden hatte er einen Säugling ins Meer geschleudert, weil er nicht aufgehört hatte zu schreien und ein Schnellboot der Küstenwache in der Nähe war, das nicht auf den Flüchtlingskutter aufmerksam werden durfte. Der geschockten Mutter hielt ein anderer dabei den Mund zu. Mittlerweile lag die Frau katatonisch auf ihren wenigen Habseligkeiten, knetete einen Strampelanzug zwischen ihren Händen und wiegte sich hin und her im Takt der Wellen.
»Nein, ich hole meinen Vater raus.«
Er warf sich auf den Schlepper und schlug auf ihn ein. Niemand half ihm. Der zweite Schlepper riss die beiden auseinander, überlegte einen Augenblick und sagte zu seinem Kumpan: »Dieser hier hat dreimal so viel bezahlt wie die anderen. Lass ihn seinen Vater raufholen, wenn er danach noch was drauflegt. Der hat doch Geld.«
Samir ging vor dem Schlepper auf die Knie und dankte ihm, verschwieg jedoch, dass er kaum mehr etwas besaß. Sie hatten ihre Ausgaben penibel geplant. Aber darüber konnte er sich nachher noch Gedanken machen. Erst musste er seinen Vater retten. Er hatte seiner Mutter versprochen, auf ihn aufzupassen. Sie hatte nicht gewollt, dass er mit ihm nach Europa floh, im Gegenteil. Vaters Lungen waren bereits krank durch den Staub im Werk, in dem er arbeitete. Weder sie noch Samir hatten ihn davon abhalten können, diese beschwerliche Reise anzutreten. Vater sah es als seine Pflicht an, seinen ältesten Sohn zu begleiten.
Der Bullige riss die zwei Nägel, die er eingeschlagen hatte, heraus und öffnete die Luke. Schnaufend wischte er sich abermals den Regen aus dem Gesicht. Ein sinnloses Unterfangen. Bevor Samir hinabstieg, flüsterte er ihm noch ins Ohr: »Kein Wort von dem Leck! Wir können nicht alle retten. Ist das klar?« Er hob die Jacke hoch und zeigte auf die Pistole an seinem Gürtel.
Samir nickte und stieg die Holzleiter hinab. Unter Deck baumelten zwei nackte Glühbirnen, die den Raum in diffus flackerndes Licht tauchten. Der Gestank nach Erbrochenem war hier noch intensiver und mischte sich mit dem Geruch nach Männerschweiß und Moder. Sein Vater kauerte auf einer der vorderen Liegen. Seine Haare klebten am Kopf, sein Hemd lag feucht an seinem Körper, seine Augen blickten stumpf an die Decke. Erst als er Samir erkannte, leuchteten sie auf. »Samir, was ist los? Hier ist schon allen übel.«
»Ich bring dich rauf.« Die Worte des Schleppers samt unterschwelliger Drohung mit der Waffe hallten in seinem Kopf. Er durfte nichts riskieren. »Da kannst du besser atmen, und es stinkt nicht so«, erklärte Samir.
Sein Vater taumelte zur Leiter und kletterte hinauf. Bevor Samir ihm nachstieg, blickte er auf die zahlreichen Menschen. Er schluckte. »Wir können nicht alle retten.« Tränen sammelten sich in seinen Augen. Er kniff die Lider rasch zusammen und blinzelte sie weg. Nein, er konnte nicht alle retten.
Von oben rief der Muskelprotz: »Hey, bist du angewachsen, oder was?«
Ohne sich noch einmal umzudrehen, erklomm Samir die Leiter. Der Schlepper klappte fluchend die Luke zu und begann erneut mit dem Zunageln. Ungläubig schaute sein Vater zu. »Was macht der Mann?«
Samir zog ihn am Ärmel in die Richtung, wo er zuvor gesessen hatte. Sein Vater hielt ihn zurück. »Was zur Hölle geht hier vor?«
»Schrei nicht so.« Samir beugte sich vor und sprach direkt in das Ohr seines Vaters. »Das Boot hat ein Leck. Wenn die Luke offen bleibt, sinken wir schneller. Das sagen zumindest die Schlepper, aber ich glaube, sie haben eher Angst, dass Panik ausbricht, sobald die Leute unten im Wasser stehen und hochkommen.«
»Aber all diese Menschen werden ertrinken.« Die Augen seines Vaters waren vor Schreck geweitet.
»Wenn die Luke offen bleibt, werden sie auch ertrinken, aber alle an Deck mit, oder das Boot kentert.«
Sein Vater sah noch einmal auf die Luke, die nun zugenagelt war. Klopfgeräusche zeigten, dass die Menschen unter Deck mitbekommen hatten, was passiert war. Man hörte das Schreien durch das Holz. Dumpf, aber eindrücklich. Dazu Kratzen, Klopfen, Weinen. Der Schlepper legte zwei Decken über die Luke und beschwerte sie mit Sandsäcken. Samir war zu müde und ängstlich, um sich darüber Gedanken zu machen, dass überhaupt Sandsäcke an Bord waren. Hatten die Schlepper mit derartigen Problemen gerechnet?
Tränen liefen Samirs Vater über die Wangen. Dann drehte er sich um, kletterte über ein Gewirr an Armen und Beinen zur Reling und erbrach sich in den Ozean. Zitternd und nach vorne gebeugt stand er da und schüttelte immer wieder den Kopf. Erneut leuchtete der Himmel auf. In der Ferne sah Samir, wie sich das Meer aufbäumte. Höher und höher. Panisch blickte er zu seinem Vater, der immer noch über der Reling hing, als die Welle das Boot erfasste und es wie eine Nussschale kippte.
Papers in the roadside tell of suffering and greed,
feared today, forgot tomorrow.
Here beside the news of holy war and holy need,
ours is just a little sorrowed talk.
Blown away.
»Ordinary World«, Duran Duran, 1993
Teil 1Auf der Flucht
Du kannst vor allem fliehen, nur nicht vor dir selbst
oder deiner Vergangenheit.
Kapitel 1
Acht Wochen später, Juli;Wien-Favoriten, Otto-Probst-Straße
Tom
Ein drittes Mal drückte er auf den schmutzigen Klingelknopf. Das Schild darüber war verblasst. »J tta St rn«, konnte man noch lesen. Das war typisch für seine Kollegin, sich nicht um solche Dinge wie ein leserliches Türschild zu kümmern.
Es schrillte hinter der Tür. Tom wartete auf die vertrauten Schritte, das Quietschen des alten Parkettbodens und den Duft von Vanille und Maiglöckchen. Vergebens. Das Einzige, was er hörte, war sein eigener Atem. Der Geruch nach Sauerkraut waberte durch das Stiegenhaus und ließ Toms Magen grummeln.
Seltsam. Er hatte Jutta extra schon von Quantico aus eine E-Mail mit seinen Ankunftszeiten geschickt und ihr mitgeteilt, er werde gleich vom Flughafen aus zu ihr fahren. Seine Hospitation beim FBI war erfolgreich zu Ende gegangen, und so war er mit einem lachenden und einem weinenden Auge wieder in Wien angekommen. Natürlich freute er sich, zurück zu Hause zu sein, andererseits waren die insgesamt sechs Monate beim FBI wunderbar gewesen für jemanden, der so wissbegierig war wie er. Schon während seines Psychologiestudiums hatte er davon geträumt, einmal in dieser Profiling-Abteilung mitzuarbeiten, weil ihn die Analyse eines Verbrechens und die Beweggründe eines Täters besonders interessierten. In kürzester Zeit hatte er beim FBI viel dazugelernt. Er war froh gewesen, dass man ihm dort die Unterbrechung nicht übel genommen hatte, denn nach vier Monaten hatte er seine Hospitation beendet, um Jutta und Georg beim Klerikerfall zu unterstützen, ohne zu wissen, ob das FBI ihn anschließend für die restlichen zwei Monate noch einmal aufnehmen würde. Aber alles war hervorragend gelaufen.
Das Team, dem er zugeteilt gewesen war, arbeitete schon sehr lange zusammen, trotzdem hatte er sich nahtlos eingefügt. Viele der Beamten dort waren Tom ähnlich. Sie waren wissbegierig, rastlos, liebten Rätsel und erforschten gern die menschliche Psyche. Mit seiner Hochbegabung und überdurchschnittlichen Intelligenz war er dort zum ersten Mal in seinem Leben kein Außenseiter. Überall in den Büros lagen Fachzeitschriften und Fachbücher herum. Ganz anders als beim LKA in Wien, wo höchstens die bunte Tageszeitung auf den Tischen zu sehen war.
Die Arbeit jenseits des Atlantiks war auch ganz anders als in Österreich, ebenso die Mentalität der Menschen. Sie kamen Tom offener, lebendiger, zugänglicher und humorvoller vor. Mit dem sprichwörtlichen Granteln der Wiener hatte Tom noch nie umgehen können. Das lag aber vermutlich auch daran, dass er sich nicht als Wiener fühlte, weil er in London als Sohn des österreichischen Botschafters geboren worden war. In seiner Kindheit hatte er mehrmals von Land zu Land umziehen müssen, sodass er sich nun eigentlich überall heimisch fühlte, oder besser: nirgendwo. Das hatte natürlich auch Vorteile, er sprach sechs Sprachen fließend, konnte sich schnell anpassen, war flexibel, und ein Gefühl wie Heimweh war ihm fremd. Durch seine Intelligenz waren die Schulwechsel ebenfalls kein Problem gewesen.
Schwierigkeiten bereiteten ihm die sozialen Kontakte, Freunde zu finden war ein Ding der Unmöglichkeit. Was nicht nur daran lag, dass er überall »der Neue« war, sondern auch daran, dass er völlig andere Interessen hatte als die Jungen in seinem Alter. Fußball, Autos, Actionfiguren, Popmusik interessierten ihn nicht. Lieber las er Nietzsche, Kant, Hesse und Freud und lauschte dazu Klavierkonzerten von Chopin.
Immer noch war es still hinter Juttas Tür. Er verfluchte sich dafür, dass er den Reserveschlüssel, den sie ihm nach Simons Tod anvertraut hatte, in seiner eigenen Wohnung zurückgelassen hatte, als er abgeflogen war. Müde entledigte er sich seines Sakkos, faltete es sorgfältig mit der Innenseite nach außen und legte es auf den Hartschalenkoffer. Er mochte es gern ordentlich und strukturiert. Das unterschied ihn von Jutta, bei der Chaos an der Tagesordnung war.
Feucht klebten seine Hemdsärmel an der Haut. Er lockerte seine Krawatte, öffnete die zwei obersten Hemdknöpfe und krempelte die Ärmel hoch. Schweißtröpfchen perlten an den feinen Härchen auf seinen Unterarmen.
Laut trommelte er mit den Fäusten gegen die Tür.
»Jutta, mach auf! Ich brauch dringend etwas zu trinken. Du willst mich doch nicht vor deiner Tür sterben lassen?«
Sein Ohr an das kühle Holz gedrückt, lauschte er, vernahm jedoch kein Geräusch aus der Wohnung. Wo zum Teufel war sie? Sie würde ihn doch nicht vergessen haben und ins Schwimmbad gepilgert sein? Bei der Hitze wäre das allerdings verständlich. Er blickte auf sein Handy. Keine SMS und keine WhatsApp-Nachricht von Jutta, und das seit zwei Monaten schon. Dreimal hatte er angerufen, war aber immer nur an die Sprachbox geraten. Mist.
Er pochte noch einmal an die Tür.
»Jutta!«
Im Schlüsselloch der Nachbartür klickte es, dann klickte es noch ein zweites Mal. Kurz darauf streckte eine Rothaarige den Kopf heraus und musterte ihn.
»Also, ich würde dich garantiert nicht vor der Tür stehen lassen.« Ein herausforderndes Lächeln folgte. Ihre Nase, die mit zahlreichen Sommersprossen übersät war, kräuselte sich dabei. Irgendwie hübsch. Tom schätzte die Frau auf Mitte zwanzig.
»Und ich hab auch was zu trinken«, säuselte sie weiter.
Er lehnte sich mit dem Rücken an Juttas Tür, schloss die Augen und verschränkte die Arme. »Danke, aber ich warte.«
Die Rothaarige lachte. Es klang ein bisschen wie das Scheppern der Dosen, die frisch Verheiratete an ihren Autos über den Asphalt zogen, um die bösen Geister zu vertreiben. Aber vielleicht spielten ihm seine Ohren einen Streich. Die Müdigkeit, die Hitze und der Durst machten ihn wirr.
»Da wirst du dann aber wirklich vor der Tür sterben«, drang es blechern an sein Ohr.
Die Frau hatte recht. Vermutlich war er schon im Delirium. Aber halt! Was hatte sie eben gesagt? Tom öffnete die Augen und beugte sich vor. »Wie meinen Sie das genau?«
Die Rothaarige strahlte, sichtlich erfreut, endlich seine ganze Aufmerksamkeit zu haben. »Ich hab Jutta schon zwei Monate lang nicht mehr gesehen. Ich gieße ihre Blumen ›auf unbestimmte Zeit‹, wie sie gesagt hat.«
Irritiert starrte er sie an. »Zwei Monate? Wo ist sie denn?«
»Weiß der Geier.« Die Rothaarige zuckte mit den Schultern. »Vor drei Wochen kam eine E-Mail, da war sie in Mumbai.«
»Mumbai?« Was zur Hölle wollte Jutta in Indien?
Das scheppernde Lachen stach in seinen Ohren. »Genauso wie du jetzt hab ich damals wohl auch geguckt.« Sie lachte erneut und blies in ihre Bluse.
Erschöpft nahm Tom sein Sakko vom Koffer, setzte sich auf den Samsonite und legte das Sakko über die Knie. »Wieso ist Jutta bloß nach Mumbai geflogen?«
Die Rothaarige kaute amüsiert, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Sie steckte die Zunge zwischen die Lippen und blies in die rosafarbene Kaugummihaut, bis die Blase zerplatzte – klank –, noch eine – klank –, die Rückstände leckte sie sich von den Lippen. »Ich glaube, deine Freundin ist auf einer Art Selbstfindungstrip. Kann gut sein, dass du keine Freundin mehr hast, wenn sie zurück ist.« Sie ließ erneut eine Kaugummiblase platzen – klank. Mit Daumen und Zeigefinger zog sie den Kaugummi von den Lippen und zwirbelte ihn darüber. »Jeder weiß doch, was auf solchen Selbstfindungstrips passiert. Man trifft einen Guru, einen Wahrsager, der mit Stückchen wirft, dann später einen einsamen Witwer, und schon ist es passiert.«
»Wir kennen alle ›Eat Pray Love‹.« Tom seufzte und vergrub sein verschwitztes Gesicht im Sakko. Das war ihm zu viel.
»Echt? Du auch? Ganz ehrlich, du bist der erste Typ, der den Film gesehen hat.« Umständlich knabberte sie den Kaugummi von ihren Fingern.
»Ich habe das Buch gelesen.«
Sie hob die Augenbrauen. »Witzig. Auch noch gelesen. Also ich kenn keinen anderen Mann, der die Geschichte kennt.«
»Jedenfalls ist Jutta nicht so eine Esoteriktussi.« Und den Kaugummi würde sie auch nicht so ekelhaft essen, fügte er in Gedanken hinzu. »Glauben Sie mir, wenn sie weg ist, dann muss das andere und vor allem triftige Gründe haben. Jutta weiß genau, wer sie ist, was sie will und was nicht.«
Beim Wort »Esoteriktussi« war die Rothaarige zusammengezuckt. »Bist du sicher? Wieso hat sie dir dann nichts davon gesagt? Was führt ihr für eine Beziehung? Und wo warst du die ganzen zwei Monate?«
Das konnte doch nicht wahr sein. Diese Frau war eine Plage! Und dieses ständige ungefragte Duzen, als wären sie alte Freunde, nervte ihn. »Jutta und ich sind Arbeitskollegen, sonst nichts. Sie ist mir keine Rechenschaft schuldig und ich Ihnen schon gar nicht.«
»Arbeitskollegen, ja?« Klank! Klank!
»Genau!« Tom erhob sich schnaufend, nahm seinen Koffer auf. »Ich wollte nur Gerti abholen«, sagte er beiläufig im Vorbeigehen.
»Gerti?« Sie grinste. Klank! Klank!
»Meine Orchidee«, erklärte Tom. »Jutta hat mir versprochen, sie zu pflegen, während ich in Amerika bin.«
»Du hast deine Pflanze so genannt wie die Kleine aus ›E. T.‹?«
»Ja, und?« Er hatte keine Kraft mehr, diese Frau war der reinste Energie-Vampir. Er spürte förmlich, wie sie ihn aussog.
»Komm rein, G-e-r-t-i ist hier bei mir. War einfacher, alle Pflanzen gleich reinzustellen, dann muss ich nicht dauernd rüberlatschen.«
Tom zögerte, dann trat er ein. Resignation pur. Juttas Nachbarin lief voraus. Ihre Sandalen klapperten auf dem Parkett, ihr Blümchenkaftan wehte, Amberschwaden hinter sich herziehend.
»Setz dich, ich hol dir was Erfrischendes.«
Beim Versuch, etwas zu erwidern, fühlte er Schweiß über Rücken und Bauch rinnen. Als er über seine Haare strich, merkte er, dass sich die Locken mehr kräuselten als sonst, weil sie feucht waren. Er konnte der Couch nicht widerstehen, stellte den Koffer neben den Hochflorteppich und legte sein Sakko fein säuberlich gefaltet darauf. Mit dem Stöhnen eines alten Mannes setzte er sich und verschwand augenblicklich tief in den Kissen, als würde ihn das Sofa verschlingen.
Die Rothaarige kam bereits mit einem Halbliterglas Wasser zurück. Darin schwammen eine Limettenscheibe und drei Minzblätter. »Belebtes Heilsteinwasser.« Sie strahlte, als hätte sie einen Pokal in der Hand. »Die Minze ist von meinem Balkon, ganz bio.
Ich versuche, meinen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Ich bin übrigens Sarah.«
Woher die Limettenscheiben stammten, wagte Tom nicht zu fragen. Auf keinen Fall würde er ihre sicher klebrigen Finger berühren. Er starrte auf ihre Füße, ohne sich vorzustellen. Sie ließ ihre Hand wieder fallen.
»Ich meinte den ökologischen Fußabdruck«, erklärte sie und zog ihre Zehen ein. »Ich bin schon sehr gut, hab sogar mein Auto verkauft.« Endlich reichte sie ihm das Glas.
Dankend nahm Tom es entgegen und stürzte das Wasser gierig hinunter. Welche Wohltat! Sarah sah ihm zu, zupfte an ihrem Haar, holte eine Orchidee vom Fensterbrett und stellte sie vor ihn hin. »Gerti?«
Tom nickte.
»Wenn du der Blume einen Namen gegeben hast, dann muss sie etwas Besonderes sein«, sinnierte sie und strich dabei über die festen Blätter. »Außerdem ist das keine gewöhnliche Orchidee, ich hab diese Art noch nie gesehen.« Eine Fliege setzte sich summend auf die Blüte.
»Ein Geschenk von Jutta. Das ist eine Paphiopedilum stonei philippinese sanderianuin. Eine spezielle Kreuzung einer fast ausgestorbenen Art. Bei unserem letzten Fall mussten wir einen Orchideenzüchter befragen. Sie meinte wohl, in meiner Wohnung würde etwas Lebendes fehlen. Außer mir.«
Ein Lächeln stahl sich unweigerlich in sein Gesicht, als er an den Besuch beim Züchter dachte und an den Moment, als sie ihm den Topf mit der Orchidee in die Hand gedrückt hatte.
Sarah sah ihm lange in die Augen. »Nur Arbeitskollegen? Klar! Du kannst mir erzählen, was du willst, aber Gerti hier spricht eine andere Sprache. Da ist mehr.«
Die Fliege kroch in den Blütenkelch der Orchidee.
»Leider nicht, Sarah. Leider nicht.«
Sarah nickte und hielt ihren Anhänger fest. »Wusste ich es doch. Du bist in Jutta verliebt. Meine Nachbarin hat Glück. Sie erwischt immer die tollen Kerle, während ich an die gruseligen gerate. Sie sehen so lieb aus, aber dann, nach einiger Zeit, wird es seltsam. Keine Ahnung, warum.«
Oh ja, davon konnte auch Tom ein Lied singen. Wenn er an seine letzte Freundin dachte, wurde ihm schlecht. »Tut mir leid, Sarah. Aber ich finde nicht, dass Jutta Glück hat. Simon, ihr Ehemann, ist gestorben, und sie waren wirklich glücklich. Verstehst du? Die zwei waren füreinander bestimmt. Keiner wird Simon je ersetzen.«
»Auch kein Guru?« Sie nahm am anderen Rand der Couch Platz.
Tom schüttelte den Kopf. Nicht einmal ein Guru würde seine Chance erhalten. Mit einem Mal kam er sich richtig blöd vor. Sarah hatte recht. Jeder andere wäre nach so einem langen Flug erst mal nach Hause gefahren, hätte geduscht und geschlafen. Doch alles, woran er denken konnte, war Jutta. Unter dem Vorwand, seine Orchidee abholen zu wollen, war er hergekommen, aber es ging ihm nicht um die Blume. Zwei Monate lang hatte nur Jutta seine Gedanken beherrscht, wenn er abends im Bett lag. Und gleichzeitig wusste er, wie dumm das war, wie aussichtslos. Er und Jutta, das würde nie etwas werden.
Die Rothaarige rutschte näher und spielte mit einer Haarsträhne. »Also, ich würde dich gern aufheitern.« Mit ihren smaragdfarbenen Augen betrachtete sie ihn und klimperte mit den türkis geschminkten Wimpern, während sie immer noch ihren Anhänger fest im Griff hielt und kaute.
Nein, es war keine gute Idee gewesen, in ihre Wohnung zu gehen. Von Anfang an hatte er sich von ihr bedrängt gefühlt, und es wurde nicht besser. Was, wenn diese Frau genauso verrückt war wie seine Ex?
Sarah strich ihm sanft über den Arm. »Ich könnte dein Guru sein. Ich könnte dir helfen, dich selbst zu finden.«
Tom winkte ab. »Ich weiß, wer ich bin. Danke.«
»Ich glaube nicht. Ich sehe sehr viel unverarbeitetes Karma bei dir, aus deinen früheren Leben. Und sehr viel Kontrollzwang. Schau mal auf dein Sakko, wie hübsch du es auf den Koffer gelegt hast. Da sind Blockaden in dir, die du dringend auflösen musst. Ich könnte eine Sitzung mit dir machen.« Als er nicht gleich antwortete, setzte sie nach: »Und warum siezt du mich? Schau ich so alt aus?«
Mist. Die war definitiv verrückt. Sitzung? Blockaden auflösen? Kontrollzwang? So ein Käse. War es denn erstrebenswerter, ein Chaot zu sein? Er blickte sich um. Warum war ihm das nicht gleich aufgefallen? Auf den Regalen standen Buddha-Statuetten nebst Mörsergefäßen und Engeln. Räucherstäbchen steckten in länglichen Vasen mit Mandala-Muster. Über dem Sofa war die »Blume des Lebens« aufgemalt. Am Esstisch lagen ein Bündel Tarotkarten und ein Pendel in einer Glasschale, in der Mitte stand ein Gefäß mit grauer Asche und einer Art Pinsel. An der Wand hing ein Kalender mit Sinnsprüchen, auf der gegenüberliegenden Seite das Konterfei des Dalai-Lamas in einem billigen Rahmen.
Sarah folgte seinem Blick. »Ich habe den Dalai-Lama extra nicht golden eingerahmt, sondern einfach und schlicht. Denn er steht für das einfache Leben, das man aber sinnvoll leben soll. Nicht Geld ist wichtig, sondern Menschen zu helfen.«
»Aha. Und wie leben Sie das? Sind Sie Ärztin, Krankenschwester oder Sozialberaterin?«
Ihre Nase kräuselte sich wieder. »Ich bin Kosmetikerin. Da kann ich Menschen helfen, gut auszusehen.«
Das war bestimmt im Sinne des Dalai-Lamas. Kopfschüttelnd wandte er sich ab. Sarah ergriff seinen Arm.
»Ich biete auch Fußpflege an. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist. Diese armen Diabetikerinnen mit ihren Holznägeln. Die leiden wirklich. Wenn ich ihre Füße wieder hübsch mache, dann strahlen sie beim Rausgehen, und ich weiß, ich hab wieder etwas Gutes getan. Mein Karma aufgefüllt, verstehst du?«
»Also nehmen Sie kein Geld dafür?«
Sarah runzelte die Stirn. »Es ist mein Beruf, meine Berufung ist eine andere. Wenn eine Kundin es möchte, dann schau ich ihr in die Zukunft. Lege ihr die Karten, pendle das Geschlecht des Babys aus oder befrage die Engel.«
Tom gähnte. Eine Beleidigung für seine Gastgeberin.
»Na ja, vielleicht sind Sie noch nicht bereit dafür«, schmollte sie, zupfte an ihrem Kleid und sah auf die Orchidee. »Kommt die Fliege da irgendwann wieder raus?« Sie beugte sich vor und starrte in den Blütenkelch. »Die bewegt sich nicht mehr.«
»Weil sie grade verdaut wird.«
»Oh mein Gott!« Sie hüpfte von der Couch, wedelte mit den Händen. »Schaff die Mörderpflanze weg! Das ist nicht gut für mein Feng-Shui!« Vor Aufregung fiel ihr der Kaugummi aus dem Mund. Mit ihren bloßen Füßen stieg sie darauf und rieb ihn in den Teppich, ohne es zu bemerken.
Tom schüttelte sich, stand auf, drehte sich um die eigene Achse. »Ich denke, für all das hier werde ich nie bereit sein.«
Sarah nagte mangels Kaugummis nun an ihrer Unterlippe und steckte die Hände in die Taschen ihres Leinenkleides. Wenn er sie verletzt hatte, tat es ihm leid, aber er war müde, verschwitzt und enttäuscht darüber, nichts von Juttas Reiseplänen gewusst zu haben. Anscheinend vertraute sie ihm doch nicht oder nicht mehr.
Er legte das Sakko in den Koffer, nahm Gerti in die Hand und reichte die andere Sarah. »Vielen Dank, Sarah, dass Sie meine Blume gegossen haben, und danke für das Wasser.«
»Energetisches Heilsteinwasser. Ich könnte dir zeigen, wie du das ganz einfach zu Hause selbst herstellen kannst …« Sie brach ab, als sie seinen Gesichtsausdruck sah. »Gut, komm doch mal wieder, ich meine, wenn du reden willst oder etwas über deine Zukunft wissen willst.«
»Danke für das Angebot, reden vielleicht gerne einmal, aber an den anderen Hokuspokus glaube ich einfach nicht.«
»Schade, du passt wohl doch nicht zu Jutta. Sie hat sich vor ihrer Reise die Karten legen lassen.«
»Ehrlich?« Das konnte er sich kaum vorstellen.
»Ja. Siehst du, anscheinend kennst du sie nicht so gut, wie du denkst.« Triumphierend legte sie eine Hand auf die Brust.
»Und was haben die Karten ergeben?«
»Das darf ich dir leider nicht erzählen, ich bin diskret, verstehst du? Meine Kunden vertrauen mir.« Sie knabberte an ihrem Zeigefingernagel. »Aber eines kann ich dir sagen: Juttas Suche wird erfolgreich sein, doch sie wird verändert zurückkommen. Mach dich darauf gefasst. Sie wird nicht mehr die sein, die du zu kennen glaubst. Falls du sie überhaupt je gekannt hast.«
Tom nickte und musterte sie durch seine Brillengläser. Er sah sie verschwommen. Doch er hatte jetzt keine Kraft mehr, die Gläser zu putzen, er wollte nur noch hier raus, unter die Dusche und ins Bett. Was Sarah gesagt hatte, nagte an ihm. Konnte es wirklich sein, dass er Jutta nicht so gut kannte, wie er dachte? Konnte es sein, dass sie in einem Aschram oder auf einem Yoga-Workshop war? Und wenn ja, weshalb? Ihm schwirrte der Kopf. Hatten Simons Tod und der Unfall mit Georg sie derart aus der Bahn geworfen, dass sie meinte, nur im Ausland wieder Kraft schöpfen zu können? Aber Georg hatte Gott sei Dank überlebt und war haarscharf an einer Querschnittslähmung vorbeigekommen. Das musste Jutta doch zeigen, dass nicht alles im Leben schlecht ausging.
Im selben Moment erklang Musik aus seinem Handy.
»Wagners ›Ritt der Walküren‹? Als Klingelton? Ernsthaft?« Sarah lachte und hielt sich den Bauch dabei. »Na, du bist wirklich eine Nummer. Ich glaub es nicht.«
Tom stellte Gerti auf den Tisch zurück, zückte das Smartphone und drückte auf »Annehmen«.
»Tom, wie lange bist du schon zurück?«, drang es an sein Ohr. Es war Georg Kunze, sein unmittelbarer Vorgesetzter im Landeskriminalamt, Abteilung Leib und Leben. Was für ein Zufall. Dann fiel Tom ein, dass es keine Zufälle gab.
»Bin vor zwei Stunden gelandet.«
Es raschelte im Hörer. »Ich hoffe, du … hast im …ugzeug gut …eschlafen. Wir brau… dich hier.« Im Hintergrund hörte er Sirenen und das Rufen eines Mannes.
»Jetzt?« Tom rieb sich die Augen.
»Klar, du hast doch in deiner E-Mail vor zwei Tagen deutlich gesagt, dass du sofort wieder einsatzbereit bist.« Die Verbindung war nun besser.
»Ja, aber …« Gott, er war so müde und ausgelaugt.
»Nix aber, du kommst jetzt sofort nach Favoriten in die Werkstätte ›Goran und Co.‹. Jutta ist im Urlaub, Maier und Haricht haben frei. Es gibt zwei Leichen. Also pack dich zusammen, aber hurtig.«
Georg wusste, dass Jutta weg war. Mit einem Mal war Tom unendlich traurig und vermied es, Georg zu gestehen, dass er bereits in Favoriten war. »Mord?«, fragte er stattdessen.
»Das lässt sich noch nicht genau sagen.« Georg räusperte sich. »Aber sie werden in dem Kofferraum wohl kaum ein Mittagsschläfchen abgehalten haben.«
Als Tom schließlich mit seinen Habseligkeiten die Treppe hinunterlief, hallte Sarahs Stimme durch das Stiegenhaus: »Hey! Ich weiß immer noch nicht, wie du heißt!«
»Fragen Sie doch die Karten!«, schrie Tom zurück.
Kapitel 2
Nepal Kathmandu Airport
Jutta
Als die Glastür aufging, schlug ihr heiße Luft entgegen und raubte ihr für kurze Zeit den Atem. Doch diesmal fing sie sich schnell wieder. Schließlich war sie nach zwei Monaten Asienreise dieses Klima und die Luftfeuchtigkeit gewohnt, auch wenn es in Nepal zusätzlich den Höhenunterschied gab, an den sie sich in den nächsten Tagen erst anpassen musste. Akklimatisation nannte man das. Auch der leicht modrige Gestank, mit dem sich der Geruch nach Curry, auf der Straße Gebratenem und Sand vermengte, machte ihr nichts mehr aus.
Kathmandu war schon die siebte Station auf ihrer Suche. In Madras hatte sie begonnen, weil die Aufzeichnungen der Nonne dort ihren Ursprung hatten. Laut diesen war ihre Mutter bis 1974 im Madras-Missionshaus tätig gewesen. Aber ihr Vater war wie das Phantom. Jeder Hinweis, den sie erhielt, führte ins Leere beziehungsweise wieder an einen Ort, an dem sie einen neuen Hinweis erhielt, wo sich ihr Vater aufhalten könnte. Wobei, was wusste sie schon? Nicht einmal seinen Namen hatte sie bis vor Kurzem gekannt. Vielmehr klapperte sie sämtliche Lepradörfer, Missionen und andere frühere Arbeitsstellen ab in der Hoffnung, ihn zu finden. Was, wenn die Aufzeichnungen der Nonne nicht korrekt waren? Was, wenn ihr Vater längst tot war oder mittlerweile auf einem anderen Kontinent lebte?
Ihre Mutter bewahrte immer noch Stillschweigen. Es war zum Verzweifeln. Immer wieder sagte sie Jutta, sie werde bald verstehen, warum sie schwieg. Und dass es eigentlich besser sei, ihren Vater nicht zu suchen. »Was du erfahren wirst, wird dir wehtun, Jutta«, hatte sie kurz vor ihrem Abflug zu ihr gesagt. »Das ist es nicht wert. Bitte bleib.«
Aber diese Ungewissheit ertrug sie nicht länger. Ihre Mutter hatte ihr einen wichtigen Lebensabschnitt vorenthalten, und das jahrzehntelang. Augenscheinlich hatte Jutta ihre ersten Lebensjahre in Indien in einer Leprakolonie verbracht, als ihre Mutter bei »Ärzte ohne Grenzen« im Einsatz gewesen war, und hatte bis vor Kurzem nichts davon gewusst. Seit ihrer Kindheit wurde sie von Albträumen geplagt, von Menschen mit entstellten Gesichtern, armlos, beinlos, mit Bandagen am Körper, blutig, hilflos. Nie hatte Mutter auch nur ein Wort von ihrer Zeit in Indien erwähnt, wenn sie ihr von den Träumen erzählt hatte. Hätte sie damals schon erfahren, dass es Erinnerungen waren, hätte sie sich sicher weniger gefürchtet. Oder auch nicht …
Jutta hatte sich gewundert, dass Lepra in Indien noch nicht ausgerottet war. Auf ihrer Reise hatte sie viele Kranke am Straßenrand betteln sehen, doch sie machte meist einen großen Bogen um die Aussätzigen – nicht ohne sich zu schämen. Irgendwie hatte sie zu viel Angst vor einer Ansteckung. Wie schafften die Missionare und Ärzte in diesen Ländern es, sich nicht zu fürchten?
Sie wusste, dass der heilige Pater Damian de Veuster selbst an Lepra starb, als er auf Moloka’i stationiert war. Hatte er es jemals bereut, Leprakranke versorgt zu haben? Eigentlich war ja sein Bruder für die Reise vorgesehen gewesen, aber Pater Damian nahm seinen Platz ein und wurde so zu einem Vorbild im Kampf gegen Lepra. 2009 hatte Papst Benedikt XVI. ihn heiliggesprochen. Und immer noch gab es vier Millionen Menschen, die an Behinderungen durch die Lepraerkrankung litten. Zweihundertfünfzigtausend Neuinfektionen jährlich wurden weltweit registriert, allein hundertdreißigtausend in Indien.
Jutta blinzelte. Vor ihr war eine Traube dunkelhäutiger Kinder mit verfilzten Haaren zu sehen. Spärlich bekleidet und schmutzig, hielten sie den Passagieren die offenen Händchen entgegen, riefen wild durcheinander, rempelten sich gegenseitig an, denn jeder wollte den besten Platz in der Nähe der weißen Menschen ergattern, die aus dem Flughafengebäude strömten. Weiter vorn ging eine Airline-Crew. Piloten mit stolz erhobenem Haupt schritten voraus, zierliche Flugbegleiterinnen in engen dunkelblauen Kostümen mit hochgesteckten Haaren stöckelten über den Schotter und zogen ihre Miniaturköfferchen hinter sich her.
Jutta sah, wie einer der Flugbegleiterinnen eine Geldbörse aus der Tasche fiel. Sofort lief ein Junge, nur mit zerrissenen Shorts bekleidet, zu der Stelle und grub die Börse aus dem Sand.
Rotz lief aus seiner Nase, mit dem Unterarm wischte er über das Gesicht und verteilte ihn über die Wangen. Jutta dachte, dass die Flugbegleiterin ihr Geld wohl nie wiederbekommen würde, und überlegte, ob sie eingreifen sollte. Da passierte etwas Erstaunliches. Etwas, woran sie sich ihr ganzes Leben immer wieder erinnern würde, das war ihr in diesem Moment ganz klar. Etwas, das ihr zeigte, dass man Glück nicht kaufen konnte.
Der kleine Junge rannte der Crew nach und zupfte die Flugbegleiterin an der Bluse. Diese schimpfte barsch mit ihm, ohne ihn anzusehen, versuchte, seine Hand abzuschütteln, doch er zupfte weiter und hielt sich an ihr fest. Bis sie sich umdrehte. Strahlend überreichte er ihr die Geldbörse. Die Blondine riss sie ihm aus der Hand und schrie: »Du kleiner Dieb!«, drehte sich wieder um und lief ihren Kolleginnen nach. Die Enden ihres gelben Halstuchs flatterten dabei. Der kleine Junge biss an seinen Fingernägeln, zuckte mit den Schultern und sah der Flugbegleiterin grinsend nach, als wäre nichts Schlimmes passiert.
Jutta rührte diese Szene bis ins Mark. Vorsichtig näherte sie sich ihm und sprach ihn an. Der Kleine riss verdutzt die Augen auf, schwarz und glänzend. Im rechten Auge saß eine Fliege und labte sich an der Tränenflüssigkeit. Der Kleine schien sie gar nicht zu bemerken, oder er war schon so gewöhnt daran, dass er sich nicht mehr wehrte. Jutta zückte ihre eigene Geldbörse und hielt dem Knaben einen frischen Fünfzig-Rupien-Schein hin, der Knabe wiederum linste neugierig in ihre Tasche und zeigte auf das Kugelschreiberset und den Notizblock.
»Das willst du haben?«, fragte Jutta.
Der Kleine, der sicher nur ihre Gestik verstand, nickte.
Lachend zog Jutta den neuen Notizblock, drei Kugelschreiber sowie einen Bleistift hervor und reichte sie dem Jungen. Gleich darauf umringten ihn die anderen Kinder johlend. Der Kleine lachte, riss die einzelnen Papierbögen vom Block, gab jedem Kind einen, dann verteilte er die Kugelschreiber und behielt selbst nur den Bleistift. Juttas Augen wurden glasig. Welches westliche Kind hätte so reagiert?
Das Geld, das sie ihm weiterhin anbot, wollte er nicht nehmen. Also lief Jutta mitsamt dem Koffer zurück zum Airport, kaufte sechs Packungen Buntstifte, vier Packungen Bleistifte, fünf Packungen Einwegkugelschreiber und zehn Spiralringblöcke. Damit ging sie wieder hinaus. Die Kinder waren immer noch vor dem Flughafen und streckten den Passanten ihre Hände entgegen. Fast niemand blieb stehen.
Als Jutta ihnen ihre Ausbeute vorbeibrachte, fing der kleine Junge an zu weinen und umarmte sie stürmisch. Die anderen Kinder umarmten sie ebenfalls und lachten. Einige griffen an Juttas Nase oder berührten ihr von der Sonne gebleichtes Haar. Und während sie so zwischen den Kindern stand, begriff sie, warum manche Menschen so etwas nicht mehr missen wollten. Zum ersten Mal hatte sie eine Ahnung davon, warum ihre Mutter damals das Leben bei »Ärzte ohne Grenzen« vorgezogen hatte. Warum ihr das wichtiger gewesen war, als gleich nach dem Studium eine eigene Praxis in Wien zu eröffnen. Hier wurde man wirklich gebraucht, man war dicht dran am wahren Leben. Dieses Ursprüngliche, diese Lebensfreude, nur weil man am Leben war, dieses Lachen, bloß weil der Himmel blau war, das war es, was ihre Mutter in Österreich nie wieder gefunden hatte.
Widerwillig riss Jutta sich von den Kindern los, die ihr noch eine Weile nachliefen, als sie zum Taxistand ging.
Die Flugbegleiterin von vorhin stakste weinend durch den Kies, einen Schuh in der Hand, von dem der Absatz lose baumelte. Jutta konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und sah in den blauen Himmel. Anscheinend gab es doch so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit, Karma, Schicksal oder wie immer man es nennen wollte.
Zufrieden stieg sie in ein Taxi und nannte dem Fahrer die Adresse des Hotels. Noch einmal drehte sie sich um und winkte den Kindern zu.
Der Fahrer trug einen roten Turban auf dem Kopf, strich sich lachend über den dichten weißen Bart und fuhr los. Ein Sikh also, wie viele Taxifahrer hier. Vom Rückspiegel baumelten Blumen- und Perlenketten, ein Abbild von Shiva, oder war es Brahma? Jedenfalls diese Gottheit mit dem Elefantenkopf. Sie brachte die Hindugötter oft durcheinander. Mangels Klimaanlage waren die Fenster weit geöffnet, heitere indische Musik beschallte den Innenraum. Es roch nach Männerschweiß, Curry und Knoblauch.
Jutta lehnte sich zurück und schloss die Augen. Sie hatte im »Yak & Yeti« gebucht. Das Hotel war ihr von einem Flugbegleiter empfohlen worden, mit dem sie in Madras essen gegangen und dessen Crew immer dort einquartiert worden war. Er wirkte sehr interessiert an ihr, und sie fühlte sich zwar geschmeichelt, doch die Wunden waren noch zu frisch gewesen. Den ganzen Abend hatte sie überlegt, wie sie sich aus der Affäre ziehen könnte, und war heilfroh gewesen, als Marc ihr mitteilte, nicht auf Frauen zu stehen. Ab diesem Zeitpunkt hatten sie wirklich Spaß zusammen.
In Mumbai trafen sie sich wieder, und Marc zeigte ihr die Filmstadt. Jeden Abend schauten sie sich einen der zahlreichen Bollywood-Filme an. Jutta fand es anfangs noch ungewohnt, außerdem wurden die Filme in Hindi gezeigt mit englischen Untertiteln, die sie aber bald nicht mehr mitlas, so gebannt war sie von den Farben auf der Leinwand, von der Musik und dem Tanz, den vielen Emotionen, die man den Schauspielern ansah.
Beim Gedanken an Marc musste Jutta lächeln und zog ihren Salwar Kameez glatt. Sie war froh, sich landestypisch eingekleidet zu haben. An einen Sari traute sie sich noch nicht, weil sie befürchtete, das Wickeln nicht alleine zu schaffen, aber diese Zweiteiler waren bequem, luftig, schützten vor der Sonne und saugten den Schweiß auf. Der Name setzte sich aus »Salwar« für Pluderhose und »Kameez« für das Oberteil, eine Art Tunika, die aber auch knöchellang sein konnte, zusammen. Die Kleidung war sehr farbenfroh, die Oberteile hatte Jutta in allen möglichen Formen und Farben. Kein Wunder, dass die Frauen in diesen Gewändern stets strahlten. Dazu gehörte bei Frauen auch die Dupatta, ein Schal, den man sich wahlweise um den Hals oder über den Kopf schlingen konnte.
Sie würde sich in Kathmandu noch ein paar Garnituren kaufen. Wer wusste schon, wie lange sie noch in diesen Ländern einem Traum hinterherjagte, der sich vielleicht nie erfüllen würde? Außerdem liebäugelte sie damit, diese Punjabi-Sets, wie man sie auf Englisch nannte, auch in Österreich zu tragen, in den heißen Sommern.
Sie bereute die Reise kein bisschen. Nach dem Tod Simons – ihr Ehemann, Polizeibeamter und ihre große Liebe, der grausam von einem Dealer namens Jimmy im Zuge einer Razzia erstochen worden war – und dem erschütternden Fall rund um die Klerikermorde hatte sie den Abstand dringend gebraucht, um wieder Kräfte zu sammeln. Auch wenn sie ihren Vater, von dem sie mittlerweile wenigstens den Namen wusste, vielleicht nie finden würde, hatte sie so viele Eindrücke gesammelt, so viele Dinge gesehen, so viele freundliche Menschen kennengelernt, dass sich die Reise als Wohltat erwiesen hatte. Seit Monaten hatte sie endlich wieder regelmäßig gegessen. Das indische Essen war köstlich. Sie konnte nicht genug davon bekommen und hatte ganz schön an Gewicht zugelegt. Auch deshalb war der Salwar Kameez fein, denn die Hosen hatten einen Gummizug.
Falls sich Kathmandu wieder als Sackgasse erweisen sollte, würde sie die Suche jedoch aufgeben, die zwei Wochen in Nepal genießen und nach Wien zurückkehren. Georg hielt sie per WhatsApp auf dem neuesten Stand. In den letzten Wochen hatten sie eine Körperverletzung mit Todesfolge, einen Teenager-Suizid aufgrund eines schlechten Zeugnisses und ein schwer krankes Ehepaar, das sich gemeinsam vergiftet hatte, weil es keinen anderen Ausweg mehr wusste. Nichts davon erforderte ihre dringende Rückkehr in die Dienststelle. Nur das Geld ging ihr langsam aus, da nur fünf Urlaubswochen bezahlt wurden, die restliche Zeit war sie ohne Bezüge freigestellt.
Im Zimmer angekommen, fiel sie mitsamt der Kleidung auf das Bett und schlief sofort ein.
Ein Narbenmeer entstellte die karamellbraune Gesichtshaut des Mädchens. Flecken unregelmäßiger Größe und Farbe wechselten mit knotigen Ausbuchtungen und nässenden Abschürfungen. Die Nasenflügel waren eingefallen. Dunkle Augen blickten Jutta traurig an. Mit ausgestreckten Ärmchen humpelte das Mädchen auf sie zu.
Der Geruch von verfaultem Fleisch vermischte sich mit dem Gestank der Kloaken. Jutta stand inmitten einer Pfütze aus Urin, Schmutzwasser und Blut. Wie ein viel zu enger Mantel legte sich die Hitze um ihren Körper. Das Mädchen lächelte schief, eine Made schlängelte sich aus einem Hautloch und zog eine Eiterspur über ihre rechte Wange. Angewidert sah Jutta weg.
Mehr Kinder tauchten auf. Alle waren nackt, ihre Gliedmaßen ausgedörrt wie Reisig – Kinder ohne Augen, Ohren oder Hände. Drei Buben rutschten beinlos auf dem Sandboden auf Jutta zu, nicht bemerkend, wie die Hitze des Bodens ihre Haut versengte.
Sie kamen näher, zerrten und zupften an ihr; betatschten sie mit ihren feuchtwarmen Händen oder in verschmutzte Baumwolltücher eingewickelten Stümpfen.
Sie jammerten in einer ihr vertrauten und doch fremden Sprache. Einer Kakerlake gleich saß die Angst auf ihrer Schulter und ließ sich nicht abschütteln.
Die Kinder waren überall; hinter ihr, vor ihr; neben ihr. Jutta wollte weglaufen, doch ihre Beine gehorchten nicht. Tränen kühlten ihre erhitzten Wangen. Auch an den Innenseiten ihrer Oberschenkel rannen Rinnsale in den Schlamm. Jutta zitterte und schrie: »Geht weg! Lasst mich in Ruhe!«
Das Kreischen der Kinder schmerzte in ihren Ohren. »Bachaiye! Koi hamari madad kijiye!«
Jutta schluchzte: »Ich kann euch nicht helfen. Geht weg!«
»Bachaiye! Madad!«
Durch ihren eigenen Schrei erwachte Jutta. Diesen Traum hatte sie zuletzt in Wien gehabt. Das war Monate her. Warum suchte er sie jetzt heim? Jutta sprang aus dem Bett, lief ins Badezimmer, drehte den Wasserhahn auf, beugte sich über das Becken und ließ kaltes Wasser über ihren Kopf laufen. Dann setzte sie sich an den Badewannenrand, ohne sich abzutrocknen. Verdammt. Warum war der Traum wieder da?
Es kam Jutta vor wie eine Botschaft. Sie musste ihrer Kindheit auf den Grund gehen, sonst riskierte sie, dass diese Träume in verschiedenen Variationen immer wiederkehrten. Sie durfte die Suche nicht aufgeben. Nur wenn sie an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren konnte, würde sie Ruhe haben und vielleicht herausfinden, was sie von der Zukunft wollte.
Müde stand sie auf. Im Spiegel erblickte sie eine völlig andere Frau, als sie vor zwei Monaten war. Ihr mausbraunes Haar war von der Sonne gebleicht und von goldenen Strähnen durchzogen, auch hatte sie es nicht mehr geschnitten, und so fiel es ihr jetzt über die Schultern. Ihre Haut hatte ordentlich Farbe abbekommen, ihre Wangen waren voller geworden. Ebenso ihr ganzer Körper. Mit einer Bohnenstange würde man sie wohl nicht mehr vergleichen. Sie grinste ihr Spiegelbild an. Sogar ihre Augen schienen heller. Die bernsteinfarbenen Sprenkel im Braun leuchteten geradezu.
Dann schälte sie sich aus dem Salwar Kameez und hüpfte unter die Dusche. Das Dal Bhat, ein Linsenbrei mit Chicken-Curry, sollte im Hotelrestaurant ein Gedicht sein. Ihr Magen grummelte zustimmend. Als die ersten Wasserstrahlen über ihren Körper liefen, wusste sie, dass ihre Suche doch nicht zu Ende war. Jedenfalls noch nicht.
Kapitel 3
Wien-Favoriten, Troststraße, Kfz-Werkstätte »Goran und Co.«
Georg
Sie umschlangen einander an den Beinen und hielten sich fest. Dicht aneinandergeschmiegte, ausgemergelte Körper. Die nackten Fußsohlen schwarz wie Teer. Die Klamotten starr vor Dreck. Die Nasen an die Knie des jeweils anderen gedrückt, lagen sie mit geschlossenen Augen im Kofferraum wie friedlich schlafende Zwillinge im Uterus.
Georg hatte hingegen ein Bild von Holocaust-Opfern vor Augen. Hunderte ausgemergelte Menschen, die sich beim Sterben in der Gaskammer aneinanderkrallten. So fest, dass die SS die Körper im Anschluss an das Töten teilweise gar nicht mehr trennen konnte und ganze Menschenbündel aufgeschichtet und später in die Massengräber geschaufelt hatte.
Georg wagte nicht, die Männer im Kofferraum zu berühren. Die Knochen, die sich durch die braune Haut drückten, wirkten so filigran, dass er Angst hatte, sie würden wie ein Tontopf zerspringen, wenn er auch nur versuchte, sie zu bewegen. Vereinzelt zitterte die Haut, weil sich darunter schon Maden zu schaffen machten. Die Leichen rochen wie verschimmeltes Trockenfleisch. Rauchig, verbrannt und faulig.
Georg blickte sich um. Einer der Mechaniker, die die Toten gefunden hatten, war im Schockzustand und starrte auf dem Boden sitzend ins Leere. Schweiß perlte auf seiner Stirn. Der andere Mechaniker lehnte an der Wand und flüsterte: »Oh Gott, oh Gott.« Immer und immer wieder, wie ein sein Mantra aufsagender meditierender Yogi.
Die Sanitäter, die vor zwei Minuten die Einfahrt passiert hatten, erfassten die Situation sofort. Für die Männer im Kofferraum konnten sie nichts mehr tun, aber um die Mechaniker mussten sie sich kümmern. Beide wurden mit beruhigenden Worten zum Krankenwagen geleitet, wo sie sich erst mal hinsetzten und Wasser schlürften.
Eine junge Sanitäterin trat zu Georg, starrte fassungslos in den Kofferraum und drückte seinen Arm. »Kann ich irgendetwas für Sie tun?«
Georg kickte einen Stein weg. »Ich komm klar. Ist mein Job.«
Die Sanitäterin seufzte. »Auch wenn es unser Job ist, manchmal sieht man Dinge, die einem tiefer unter die Haut gehen, als man es sich selbst eingestehen will.«
»Danke.« Georg wandte sich ihr zu. Sie trug ihr blondes Haar kurz, war ungeschminkt und roch nach Pfirsich und Erdbeeren. Ihre Augen hatten einen sanften Blauton. Sie wirkten beruhigend, was ihr in ihrem Beruf sicher entgegenkam. Auf der Brusttasche ihrer Rote-Kreuz-Jacke war der Name »Tina« eingestickt. »Wie gesagt, Tina, mir geht’s gut«, sagte er.
»Okay. Wenn Sie etwas brauchen, melden Sie sich.« Sie warf noch einen Blick in den Kofferraum und schüttelte den Kopf. Dann sah sie Georg in die Augen. »Ich nehme an, wir sollen die Mechaniker nicht ins Krankenhaus bringen?«
»Wenn es geht, bitte nicht. Schauen Sie, dass sie stabil genug werden, um ein paar Fragen zu beantworten, sobald mein Kollege hier ist.«
»Ich gebe Ihnen Bescheid.« Sie strich ihm sanft über den Rücken und ging zum Ambulanzwagen zurück.
Georg sah ihr einen Augenblick lang nach. So jung und schon so tough. Was hatte sie in ihrem kurzen Leben wohl schon alles gesehen? Beim Anblick der Leichen im Kofferraum hatte sie kaum mit der Wimper gezuckt. Und er selbst? Wie abgestumpft war er selbst nach all den Jahren bei der Kriminalpolizei? Er wusste es nicht. Nur, dass diese Leichen hier ihn nicht kaltließen. Vieles ließ ihn seit dem schweren Autounfall mit Jutta auf der Ringstraße nicht mehr kalt. Damals hatten sie die Journalistin Hanna Wagner beschattet. Doch Jutta hatte Jimmy, den Dealer, entdeckt und war ihm, von Rachegedanken getrieben, hinterhergerast. Die Verfolgungsjagd endete mit einem Unfall. Dieser Tag hatte Georgs Leben verändert. Sein Denken, sein Fühlen und sein Handeln. Um ein Haar wäre er im Rollstuhl gelandet. Und danach war nichts mehr, wie es vorher gewesen war.
Tina war zurückgekehrt, drückte ihm wortlos einen Becher mit Kaffee in die Hand und verschwand wieder. Georg drehte dem Wagen den Rücken zu und nippte am Kaffee. Obwohl es ein heißer Sommertag war, fühlte er sich genau richtig an. Doch Georg kam gar nicht dazu, den Moment der Ruhe zu genießen, denn ein Auto nach dem anderen fuhr auf den Parkplatz der Werkstätte. Amtsarzt Scheibner flirtete kurz mit Tina, bevor er auf Georg zuging und ihm die Hand reichte. »Kunze, schön, dich zu sehen.«
»Na ja, unter diesen Umständen wohl eher nicht.«
»Sonst würden wir uns gar nicht sehen.« Der Amtsarzt grinste und zwirbelte die Enden seines Kaiser-Franz-Joseph-Schnauzers. Damit hatte er recht. Scheibner war nicht gerade ein Mensch, mit dem er auf ein Bier gehen wollte.
»Was hast du für mich?« Scheibner streifte die Handschuhe über und beugte sich über den Kofferraum des roten Passats. »Na hawidere! Das schaut nicht gut aus.«
Georg beugte sich ebenfalls über den Kofferraum. »Hast du so etwas schon einmal gesehen?«
Scheibner überlegte kurz. »Ja, doch, in diesem Film, dem schwarz-weißen von diesem jüdischen Regisseur.«
»›Schindlers Liste‹«, antwortete Georg.
Scheibner nickte. Georg zupfte an seinem Hemd. »Genau den gleichen Gedanken hatte ich vorhin auch.«
»Na, dann schauen wir mal.« Scheibner begutachtete die Leichen. Beim Versuch, einen Arm vom Bein des anderen zu entfernen, knackte es laut. »Die Leichenstarre hat sich bei diesem hier noch nicht ganz aufgelöst. Bei den Temperaturen kann man sagen, dass er nicht länger als achtundvierzig Stunden tot ist. Bei dem anderen sehe ich schon deutliche Verwesungszeichen, Fliegen und zahlreiche Eier, Maden. Kein Wunder bei der Hitze. Der ist wohl schon länger als drei Tage lang tot.« Der Arzt strich sich über die Glatze. »Woran sie gestorben sind, kann ich nicht auf den ersten Blick feststellen. Durch die zusammengekauerte Stellung auf engstem Raum tippe ich am ehesten auf Ersticken. Könnte aber auch Dehydrierung sein. Wenn der Wagen lange in der Sonne gestanden hat, war es durch die Hitze sicher unerträglich.«
Georg nickte. »Backofenklima.«
»Genau. Da stirbt man schnell. Was auch eine Erklärung für die Maden wäre. Der überhitzte Körper verwest wesentlich schneller, das Eiweiß in den Zellen verkocht bei der Überhitzung schon und führt zu Gewebeschäden. Dieser Geruch zieht die Schmeißfliegen sehr rasch an.«
»Ich weiß.« Georg dachte an das Baby, das eine Mutter auf einem Kaufhausparkplatz im Wagen gelassen hatte. Mittags bei sechsunddreißig Grad. In einem Auto hatte man binnen Minuten eine Temperatur von über fünfundvierzig Grad. Wenn die Fenster geschlossen waren, stieg die Temperatur auf siebzig Grad. Das Baby wurde sozusagen bei lebendigem Leibe gegrillt. Obwohl Passanten die Scheibe eingeschlagen und das Kind aus dem Auto gezerrt hatten, war jegliche Hilfe zu spät gekommen.
Die Mutter wurde im Einkaufszentrum ausgerufen, meldete sich aber nicht. Später gab sie an, während des Einkaufens über einen iPod Musik gehört zu haben. Neunzehn Jahre alt, ohne Ausbildung, lebte noch bei den Eltern. Erste Schwangerschaft mit fünfzehn, zweite mit siebzehn. Beide Kinder wurden ihr vom Jugendamt weggenommen, aber niemand hatte es für gefährlich befunden, ihr den Säugling zu lassen. Obwohl weltweit vor den Gefahren gewarnt wurde, starben in den USA immer noch vierzig Kinder im Jahr an Überhitzung, weil sie im Auto gelassen wurden.
»Hey, Georgie!« Tom klopfte ihm auf die Schulter.
Georg drehte sich um und umarmte seinen Kollegen. »Endlich. Hab dich vermisst, Kleiner.«
Tom trat einen Schritt zurück und musterte ihn. »Wow! Was ist denn mit dir passiert? Hat McDonald’s Pleite gemacht?«
Georg strich sich lachend über seinen flachen Bauch. »Der Schuppen läuft sicher gut, aber in meinen Körper kommt kein Fast Food mehr.«
»Ist ja irre!« Tom drückte auf Georgs Oberarm. »Und jetzt sag bloß, du gehst auch noch in die Muckibude?« Er runzelte die Stirn. »Wie war das noch gleich? ›Sport ist Mord‹?«
Georg steckte die Hände in die Hosentaschen. »Ich hab mir so ein Riesending mit Zugmaschine und allem Drum und Dran für zu Hause gekauft, steht im Keller. Ein Laufband, einen Heimtrainer. Und ein paar Hanteln dazu.«
Tom zupfte an Georgs Hosenbein. »Und was ist das? Wo sind die abgewetzten Cordhosen hin?«
»Ausgemustert. Hab ich weggeschmissen.«
Tom strich ihm mit der Hand über den Oberschenkel, ein Glitzern in den Augen wie ein schwuler Modedesigner. »Was ist das für ein Stoff?«
»Fairtrade Organic Cotton.« Georg räusperte sich. »Also Ökobaumwolle.«
»Fühlt sich richtig gut an.« Tom strich ihm über das andere Bein.
»Trägt sich auch gut, leicht und luftig jetzt im Sommer.« Er klatschte Tom auf die Hand. »Und jetzt hör endlich auf, mich anzugrapschen. Oder hat der letzte Fall auf dich abgefärbt?«
Tom richtete sich auf, rieb sich den Handrücken und lachte. »Nein, keine Angst. Hetero und Single wie immer.«
»Gibt’s nicht mal in Amerika eine Frau für dich? Okay, wie es sonst so in Quantico war, kannst du mir später erzählen. Wir haben zu tun.«