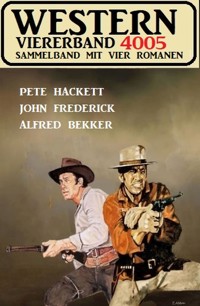
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Western: Alfred Bekker: Zum Sterben nach Sonora Pete Hackett: Stirb! Pete Hackett: Goldrausch am Rio Bonito John Frederick: Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst Es war Nacht. Jonathan Quincy hockte am Ufer des Rio Bonito an einem niedrig brennenden Lagerfeuer. Er hatte zwei Astgabeln zu beiden Seiten des Feuers in die Erde gerammt. Dazwischen hing, aufgespießt auf einen Stock, ein Kaninchen. Dicht beim Wasser hatte Jonathan Quincy sein Pferd und ein Maultier angeleint. Die Leinen waren lang genug, so dass die Tiere zum Wasser konnten, um zu trinken. Jetzt lagen sie am Boden. Jonathan starrte vor sich hin. Hin und wieder drehte er seinen Braten, damit er gleichmäßig durch wurde. Neben Jonathan lag ein schwarzer Wolfshund, die Vorderpfoten ausgestreckt, den Kopf dazwischen gelagert, die Augen geschlossen. Jonathan hatte das Tier mit den Innereien des Kaninchens gefüttert. Silver, so hieß der Hund, war rundum zufrieden. Der Oldtimer warf die letzten drei Aststücke in das Feuer, dann erhob er sich. Silver öffnete die Augen und schielte zu ihm in die Höhe. In seinen braunen Augen spiegelten sich die züngelnden Flammen wider. "Keine Sorge", murmelte Old Jonathan. "Wir bleiben die Nacht über hier. Ich will nur noch etwas Feuerholz suchen." Die Einsamkeit vieler Jahre hatte es bei dem Oldtimer zur Angewohnheit werden lassen, mit seinen Tieren zu sprechen wie mit Menschen. Wahrscheinlich verstanden sie ihn sogar. Denn der Wolfhund schloss wieder die Augen. Die Ohren, die er aufgestellt hatte, als sich Jonathan bewegte, kippten wieder nach vorn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, John Frederick, Alfred Bekker
Western Viererband 4005
Inhaltsverzeichnis
Western Viererband 4005
Copyright
Zum Sterben nach Sonora
Stirb!
Goldrausch am Rio Bonito
Wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst
Western Viererband 4005
Pete Hackett, John Frederick, Alfred Bekker
Dieser Band enthält folgende Western:
Alfred Bekker: Zum Sterben nach Sonora
Pete Hackett: Stirb!
Pete Hackett: Goldrausch am Rio Bonito
John Frederick: Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst
Es war Nacht. Jonathan Quincy hockte am Ufer des Rio Bonito an einem niedrig brennenden Lagerfeuer. Er hatte zwei Astgabeln zu beiden Seiten des Feuers in die Erde gerammt. Dazwischen hing, aufgespießt auf einen Stock, ein Kaninchen.
Dicht beim Wasser hatte Jonathan Quincy sein Pferd und ein Maultier angeleint. Die Leinen waren lang genug, so dass die Tiere zum Wasser konnten, um zu trinken. Jetzt lagen sie am Boden. Jonathan starrte vor sich hin. Hin und wieder drehte er seinen Braten, damit er gleichmäßig durch wurde.
Neben Jonathan lag ein schwarzer Wolfshund, die Vorderpfoten ausgestreckt, den Kopf dazwischen gelagert, die Augen geschlossen. Jonathan hatte das Tier mit den Innereien des Kaninchens gefüttert. Silver, so hieß der Hund, war rundum zufrieden.
Der Oldtimer warf die letzten drei Aststücke in das Feuer, dann erhob er sich. Silver öffnete die Augen und schielte zu ihm in die Höhe. In seinen braunen Augen spiegelten sich die züngelnden Flammen wider.
"Keine Sorge", murmelte Old Jonathan. "Wir bleiben die Nacht über hier. Ich will nur noch etwas Feuerholz suchen."
Die Einsamkeit vieler Jahre hatte es bei dem Oldtimer zur Angewohnheit werden lassen, mit seinen Tieren zu sprechen wie mit Menschen. Wahrscheinlich verstanden sie ihn sogar. Denn der Wolfhund schloss wieder die Augen. Die Ohren, die er aufgestellt hatte, als sich Jonathan bewegte, kippten wieder nach vorn.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Zum Sterben nach Sonora
von Alfred Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 46 Taschenbuchseiten.
Der amerikanische Westen in den Jahren nach dem Bürgerkrieg: Jeff Kane ist vor dem Gesetz über die Grenze nach Mexico geflohen und trifft auf Männer, die nicht wahrhaben wollen, dass der Krieg vorbei ist. Männer, die die Ermordung von Präsident Lincoln bejubeln und sich für eine Wiederaufnahme des Kampfes rüsten...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch
© by Author
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
1
Jeff Kane hatte einen tagelangen Ritt hinter sich, als er Magdalena erreichte, eine kleine Stadt in der mexikanischen Provinz Sonora. Der Mann, den man seit seiner Zeit als Postreiter zwischen San Antonio und Laredo auch ‚Laredo Kid’ nannte, zügelte auf einer nahen Anhöhe vor der Stadt sein Pferd und ließ den Blick schweifen. Wie hingeworfen wirkten die wenigen Häuser von Magdalena in dem schroffen, kargen Land, das einem Glutofen glich. Ein Land, das Gott im Zorn erschaffen haben musste.
Kane ritt die Main Street entlang, die sich in diesem Ort „Calle de los Santos“ nannte – die Straße der Heiligen. Mochte der Teufel wissen, warum sie diesen Namen trug. Es musste einen Grund dafür geben. Vielleicht war die Antwort auf dem Friedhof zu finden, an dem Kane vorbeigekommen war. Viele der Gräber trugen keine Namen und noch mehr trugen Namen, die amerikanisch klangen.
Ansonsten bestand die Stadt nur aus einer schneeweißen Kirche, ein paar Häusern aus Sandstein oder Lehm und einigen Bodegas, in denen die Vaqueros der Gegend ihren Tequila tranken.
Am Ende der „Calle de los Santos“ war die größte dieser Bodegas. Ein hässlicher Holzbau, dessen Fassadenfarbe schon vor Jahrzehnten verblichen sein musste.
Jeff Kane zügelte sein Pferd, stieg ab und machte am Hitchrack vor der Bodega fest. Dann klopfte er sich den Staub von den Sachen. Ein wochenlanger Ritt durch trockene, wüstenähnliche Gebiete ließ den Sand überall hin kriechen und es wurde zweifellos Zeit, dass er mal wieder ein Bad bekam.
In Laredo war er seinen Verfolgern entkommen, die ihn fälschlich des Mordes beschuldigt hatten. Seitdem hatte er sich auf der mexikanischen Seite der Grenze gehalten und außerdem Ortschaften weitgehend gemieden.
Aus der Bodega war zänkisches Stimmengewirr zu hören.
Kane ließ die Schwingtüren auseinander fliegen und trat ein.
Innen herrschte ein angenehmes Halbdunkel.
Der Bodegero war ein kleiner gedrungener Mann mit dunklen Augen und einem buschigen Schnauzbart. Er starrte Kane an wie einen Geist. Die fünf Männer in der Bodega drehten sich um und verstummten. Sie hatten Englisch gesprochen. Es handelte sich offenbar um Amerikaner. Kane fiel gleich auf, dass sie hervorragend bewaffnet waren. Sie trugen tief geschnallte Revolvergurte und Bowie Messer. Ihre Kleidung war zerschlissen. Abgeschabte Drillich-Hosen, die aus ehemaligen Beständen der Konföderierten-Armee stammen mochten, Leinenhemden. Einer der Kerle trug einen bis zum Boden reichenden Saddle Coat. Zwischen den Zähnen steckte ein Zigarillo. Die Hose hatte ihre beste Zeit längst hinter sich, aber der Revolvergurt und die Stiefel waren von so edler Verarbeitung, dass man auf die Idee kommen konnte, dass sie ihm beide noch nicht so lange gehörte.
Ein anderer trug einen dunklen Bart, der ihm bis fast unter die Augen wucherte und eine graue Konföderierten-Mütze, an der die Abzeichen entfernt waren. Ihre Umrisse konnte man deutlich sehen, da der Stoff darunter weniger von der Sonne gebleicht war.
Kane ging zum Schanktisch.
Er trug zwei Revolvergurte um die Hüften – den zweiten so, dass der Coltgriff nach vorne ragte. Der Mann mit der Südstaatenmütze starrte schon die ganze Zeit dort hin. Er selbst trug ein abgewetztes Holster mit einem lang gezogenen Navy-Colt darin. Seine Hand umschloss den Griff des langen Bowie-Messers.
Kane wandte sich an den Bodegero.
„Kann man bei Ihnen ein Bad und ein Zimmer für die Nacht bekommen?“, fragte er.
„Nun, Senor…“, sagte der Bodegero. Kane war nicht entgangen, dass er zunächst zu einem Mann am Ende geblickt hatte, der an einem der Tische saß. Er trug einen Anzug und eine Schleife um den Hemdkragen. Um die Hüften hing ein Army Holster, bei dem die Lasche entfernt worden war, sodass man den Colt sofort ziehen konnte. Sein Gesicht wirkte wie aus Stein gemeißelt. Die Linien waren hart und der Blick seiner stahlblauen Augen durchdringend. Erst nachdem er nickte, gab der Bodegero seine Zustimmung. „Kein Problem, Senor. Wenn Sie im Voraus zahlen.“
Kane legte ein paar Münzen auf den Tisch.
„Das wird für eine Nacht reichen. Wenn Sie Tortillas mögen, ist sogar noch eine Mahlzeit mit drin.“
„Danke. Haben Sie Whiskey? Meine Kehle ist staubtrocken.“
„Nur Tequila, Senor!“
„Meinetwegen…“
Der Bodegero schenkte Kane ein und dieser leerte das Glas in einem Zug.
Der Mann mit dem Saddle Coat deutete auf Kanes Waffen.
„Sie sind ja gut ausgestattet, Mister – zwei Colts! Hat sicher seine Vorteile, wenn man zwei Eisen im Gürtel hat. Vor allem wenn mal eine der Zündhütchen in der Revolvertrommel blockiert.“
„Einen davon verkaufe ich, wenn Sie interessiert sind!“, sagte Kane. „Ich brauche nämlich etwas Geld. Interessiert?“
„Sicher.“
„Hundert amerikanische Dollar – keine Pesos.“
„Lassen Sie mal sehen, Mister.“
Kane schnallte den zweiten Gurt ab, legte ihn zusammengerollt auf den Tresen und schob ihn zu dem Kerl mit dem Saddle Coat hinüber.
Der Kerl mit der Südstaatenmütze spuckte aus und deutete auf den Saddle Coat Mann. „Machen Sie besser keine Geschäfte mit ihm.“
„Weshalb?“, fragte Kane.
„Weil er keine hundert Dollar hat - sondern gerade mal genug Pesos, um sich hier einen Tequila leisten zu können.“
„Halt’s Maul, Dooley!“, knurrte der Saddle Coat Mann, nahm die Waffe aus dem Holster und öffnete die Trommel des Revolvers.
„Ist doch wahr!“, verteidigte sich Dooley und schob die Südstaatenmütze in den Nacken.
„Du bist doch nur selbst scharf auf die Waffe!“, knurrte der Saddle Coat Mann.
Dooley verzog das Gesicht und wandte sich an die anderen Gringos in der Bodega. „Hat jemand von euch schon mal gesehen, dass Brannigan hundert Dollar beisammen hat!“
Gelächter erfüllte den Raum.
Brannigan, der Mann im Saddle Coat, bleckte die Zähne wie ein Raubtier. „Wenn hier jemand anzweifelt, dass ich meine Schulden bezahle, dann soll er es offen sagen, damit ich ihm eine Kugel in den Kopf jagen kann!“
„Immer mit der Ruhe!“, erwiderte Kane. „Ich habe nichts dagegen, den Colt meistbietend zu versteigern!“
Dooley lachte rau.
„Danke, aber ich habe eine Waffe!“
Brannigan sagte: „Ich gebe Ihnen die hundert Dollar, Mister… Wie heißen Sie?“
„Nennen Sie mich Laredo Kid“, erwiderte Kane, weil ihm im Moment nichts Besseres einfiel und er vermeiden wollte, dass sich sein tatsächlicher Name in der Gegend herumsprach. Schließlich wusste er nicht auszuschließen, dass diejenigen, die ihn ungerechtfertigter Weise des Mordes beschuldigten, nicht vielleicht auch in Mexiko an seiner Spur klebten, auch wenn texanische Marshals jenseits der Grenze natürlich eigentlich keinerlei Befugnisse mehr hatten.
Brannigan schnallte sich den Gurt um. Seinen anderen Revolver trug er links und mit dem Griff nach vorn.
„Nicht so hastig“, sagte Kane. „Erst das Geld!“
Brannigan grinste. Dann griff er in die Tasche seines Saddle Coat und holte ein kleines Bündel mit Scheinen hervor. Er zählte hundert Dollar ab und legte sie auf den Schanktisch.
„Hier, Mister.“
Kane würdigte die Scheine eines kurzen Seitenblicks.
„Das sind konföderierte Dollars“, stellte Kane fest. „Seit der Krieg aus ist, kann man sie getrost im Ofen verfeiern!“
Brannigan grinste.
„Hört euch das an Jungs! Muss ein verfluchter Yankee sein, wenn er diese Dollars nicht will!“
Gelächter antwortete ihm. Der Bodegero zog sich in eine Ecke zurück. Er ahnte offenbar, dass er in der Schussbahn stehen konnte, wenn es hart auf hart kam.
„Ich will meinen Gürtel zurück“, sagte Kane ruhig.
„Ein Colt reicht noch für Sie, Laredo Kid! Dann müssen Sie eben immer schön aufpassen, dass die Zündhütchen gut sitzen!“
Kanes Augen wurden schmal. „Ich sage Dinge ungern zweimal!“, zischte er zwischen den Zähnen hindurch.
Brannigan griff zum Colt und riss ihn heraus. Da er offenbar daran gewöhnt war, langte über Kreuz nach seiner eigenen Waffe. Offenbar traute er dem Essen noch nicht so recht, das er Kane abgenommen hatte.
Der Lauf zeigte auf Kanes Brust.
„Was wollen Sie jetzt tun, Laredo Kid?“, fragte er. „Den Handel wieder rückgängig machen? Mir die Waffe abnehmen?“ Brannigan verzog spöttisch den Mund. „Sie können es ja gerne versuchen, dann nehme ich mir auch noch Ihre andere Waffe!“
Augenblicke lang geschah nichts.
Man hätte in diesem Moment eine Stecknadel auf die groben Fußbodenbretter der Bodega fallen hören können.
Brannigan spannte den Hahn.
Es machte klick.
„Na los, Laredo Kid! Worauf warten Sie!“
„Lass es gut sein, Brannigan!“, mischte sich der Mann am Tisch ein. Er stand nun auf. Brannigan schien etwas irritiert. „Major Jackman, ich…“
„Steck die Dollars ein, Brannigan und gib dem Gentleman seinen Gurt zurück“, sage der Mann unerbittlich und rückte sich dabei die Schleife zurecht. Dann lehnte er sich zurück, die rechte ruhte auf dem Army Holster.
Brannigan fluchte vor sich hin.
„Major Jackman, das ist doch wahrscheinlich nur ein verfluchter Yankee!“, meinte er.
„Seiner Sprache nach ist er Texaner“, widersprach der Mann, der mit Major Jackman angeredet worden war. Er stand auf, trat neben Kane und griff in seine Jackentasche. Er holte ein paar Scheine heraus. Unionsdollars. „Ich habe eine bessere Idee“, sagte er.
„Und die wäre?“, fragte Kane.
„Ich kaufe die Waffe. Der Preis ist nicht überhöht und es ist ein schönes Stück.“ Er gab Kane das Geld. Dieser zählte nach und steckte es ein. Jackman streckte die Hand in Brannigans Richtung aus. Woraufhin dieser knurrend abschnallte und Jackman den Revolvergurt gab. Jackman hängte ihn sich über die Schulter.
„Waren Sie im Krieg?“, fragte er.
„Wie fast jeder.“
„Ich nehme an, Sie haben als Texaner für die richtige Seite gekämpft.“
„Sieht wohl jeder anders, was die richtige Seite war“, erwiderte Kane.
Jackman grinste. „Ich war Major in der Armee der Konföderierten Staaten von Amerika – und auch wenn für ein paar Verräter, die die Kapitulation unterzeichnet haben, dieser Krieg schon vorbei ist – für mich ist er es nicht! Und da bin ich nicht der Einzige!“
Kane wusste, dass es einige Unentwegte gab, die nicht einsehen wollten, dass die Sache des Südens verloren war. Aus und vorbei. Guerilla-Einheiten, die dem Geist des Südens noch immer anhingen, trieben ihr Unwesen in Kansas und Missouri – aber auch im Indianergebiet von Oklahoma. Manche zogen sich auch nach Mexiko zurück, wenn ihnen die Blauröcke der Unionsarmee zu sehr auf den Pelz rückten.
Der bekannteste unter diesen Bandenführern war William C. Quantrill. Aber er war keineswegs der einzige.
Viele dieser Gruppen waren trotz ihrer angeblich so hoch stehenden patriotischen Ideale längst zu einfachen Verbrecherbanden herabgesunken.
Und Kane hatte inzwischen die dumpfe Ahnung, dass er es hier mit genau so einem Haufen zu tun hatte.
„Ich bin stolz darauf, in Gettysburg dabei gewesen zu sein“ sagte Jackman. „Und wenn die andere Seite sich im Moment auch zunächst einmal als überlegener erwiesen hat, so ist unser Kampf doch noch lange nicht zu Ende. Wir formieren uns. Haben Sie schon gehört, dass man den Yankee-Präsidenten hingerichtet hat?“
„Lincoln? Dann hat sich das inzwischen sogar bisher herumgesprochen…“, sagte Kane.
„Ein mutiger Patriot hat ihn erschossen.“
„Tut mir Leid, wenn ich Ihnen nicht ganz folgen kann, Major…“
„Ich kann immer gute Leute gebrauchen. Wenn Sie im Krieg waren, können Sie auch schießen. Der Kerl, dem Sie den Revolvergurt abgenommen haben, hätte es wahrscheinlich zu spüren bekommen. Was halten Sie davon, sich uns anzuschließen? Brannigan ist auch Texaner wie Sie!“
„Tut mit Leid, Major Jackman. Daraus wird nichts“, sagte Kane.
„Warum nicht? Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass Sie irgendetwas zu verlieren hätten! Sie sehen eher so aus wie jemand, der gezwungen ist, eine gewisse Zeit hier in Sonora zu verbringen. Dann können Sie das auch bei uns! Und im Übrigen würde sich auch für Sie lohnen. Wir haben hier nämlich so eine Art Steuersystem eingeführt und leben nicht schlecht davon.“
„Ich habe meine eigenen Pläne.“
„Ich würde mit diesem Bastard auch nicht zusammen reiten!“, knurrte Brannigan.
„Halt’s Maul, Brannigan!“, fuhr Major Jackman ihn an, bevor er sich wieder an Kane wandte. „Wir haben über zwanzig Mann unter Waffen. Und wenn Sie in dieser Gegend Wurzeln schlagen wollen, dann sollten Sie sich nicht mit uns anlegen. Denn hier entscheiden ganz allein wir, ob jemand weiter reiten darf oder nicht.“
In diesem Augenblick kam ein Mann in schwarzer Lederweste und schwarzem Hut durch die Schwingtüren.
„Hey, Major, wem gehört denn der Gaul mit dem blauen Yankee-Mantel am Sattel!“
Alle starrten Kane an.
Major Jackman verzog das Gesicht „Jetzt verstehe ich“, murmelte er. „Sie sind also doch ein Yankee!“
„Der Krieg ist vorbei“, sagte Kane.
„Für mich nicht! Für Sie ist in Magdalena kein Platz, Laredo Kid - oder wie immer Sie auch in Wahrheit heißen mögen!“ Major Jackman schnipste mit den Fingern und wandte sich an den Bodegero. „Gib ihm das Geld zurück, das er dir gegeben hat, Hombre…“
„Aber…“
„Tortillas und ein Bad wird er wo anders nehmen müssen!“
Der Bodegero legte das Geld auf den Schanktisch. Kane entschied, das es keinen Sinn hatte, sich durchsetzen zu wollen. Er nahm das Geld, steckte es ein und ging in Richtung der Schwingtüren. Er war nicht auf Ärger aus und der war hier offenbar vorprogrammiert. Major Jackmann und seine Bande schienen Magdalena als ihren Privatbesitz anzusehen.
Der Mann in Schwarz wich vor Kane zur Seite. Er hatte die Daumen hinter den tiefgeschnallten Revolvergurt geklemmt.
Kane hatte die Schanktüren gerade erreicht, da nahm er hinter sich eine Bewegung wahr. Aus den Augenwinkeln heraus sah er, wie Brannigan sich bewegte.
Brannigan riss den Revolver heraus. Ein Schuss krachte aus seinem Revolver.
Kane glitt zur Seite.
Er drängte mit der Schulter die Schwingtür weg und griff gleichzeitig zu seiner eigenen Waffe. Mit einer katzengleichen, hundertfach eingeübten Bewegung riss seine Rechte den 45er aus dem Holster, während die Linke über den Hahn glitt und ihn zurückzog.
Brannigans Kugel zischte dicht an Kane vorbei und brannte ein Loch in das Holz der Schwingtür.
Kanes Schuss hingegen erwischte Brannigan am Arm.
Brannigan schrie auf, ließ die Waffe fallen.
Hart fiel der Colt auf den Boden, während das Blut aus Brannigans Wunde schoss.
„Verdammt!“, krächzte er und verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
Kane spannte den Hahn.
Die Männer des Majors hatten ihre Hände an den Waffen, aber keiner von ihnen wagte es, seinen Colt herauszureißen. Sie hatten gesehen, wie schnell Kane ziehen und wie gut er treffen konnte.
Und jedem von ihnen war klar, dass der jenige von ihnen, der jetzt zur Waffe griff, innerhalb eines Lidschlags sein Leben verlor.
„Schön ruhig bleiben!“, sagte Kane.
„Das wirst du büßen, du Bastard!“, rief Brannigan gepresst. Er versuchte jetzt verzweifelt, die Blutung an seinem Unterarm zu stillen.
Kane zog sich zurück.
Dabei ließ er keinen aus der Meute auch nur für den Bruchteil einer Sekunde aus den Augen.
Rückwärts und mit dem Colt in der Faust trat er ins Freie.
Die Schwingtüren pendelten noch einige Momente hin und her, als er schon verschwunden war und sich die Erstarrung von Jackman und den Mitgliedern seiner Meute schlagartig löste.
Kane lief zu seinem Pferd. Er schwang sich in den Sattel und tätschelte dem Tier den Hals.
Hättest eigentlich was Besseres verdient!, dachte er. Schließlich hatte ihn der Gaul schon den ganzen Tag getragen und hätte etwas Ruhe bitter nötig gehabt.
Aber die musste wohl auf später verschoben werden.
Kane gab dem Pferd die Sporen und preschte die „Calle de los Santos“ entlang bis zu deren Ende.
Die Meute des Majors war inzwischen aus der Bodega gestürmt.
Ein paar Schüsse wurden Kane hinterher geschickt. Aber keines dieser Geschosse fand sein Ziel. Sie sorgten nur dafür, dass Kanes Pferd noch schneller voranpreschte.
Aber der Mann, den man Laredo Kid nannte, war bereits außer Schussweite. Bei allem, was über dreißig Yards hinausging, war das Treffen mit einem Revolver nur noch Glücksache und ehe einer der Kerle seine Winchester aus dem Sattelschuh gezogen hatte, war Kane längst hinter der nächsten Anhöhe verschwunden.
Zwischenzeitlich drehte er sich um und blickte zurück.
Aber es hatte offenbar niemand Lust dazu, ihn zu verfolgen.
Schon bald hatte er das zerklüftete Bergland erreicht und verschwand zwischen den schroffen Felsmassiven.
2
Kane ritt bis zum Abend. Die Sonne wurde schon bald milchig und sank zum Horizont. In der Nacht kampierte er in den Bergen und machte ein kleines Feuer. Es kühlte in dieser Nacht kaum ab und so ließ Kane den alten Army Mantel wo er war - hinten auf dem Sattel seines Pferdes festgeschnallt. Die dünne Decke reichte aus.
Er kratzte die letzten Vorräte zusammen, um sich etwas zum Abendessen zu machen. Der Kaffee war dünn. Aber dafür würde er sich auch noch am nächsten Morgen eine Tasse voll machen können.
In der Nacht erwachte er aus einem leichten Schlaf, als das Pferd unruhig wurde und schnaubte.
Die beiden Winchester Gewehre befanden sich ganz in der Nähe – das eine im Sattelschuh, dem sogenannten Scubbard, das andere war mit der Decke aufgeschnallt gewesen und lehnte nun daneben.
Den Revolver hatte Kane unter der Decke.
Das Feuer war ziemlich niedergebrannt.
Im fahlen Mondlicht sah er eine Gestalt auftauchen. Lautlos bewegte sie sich zwischen den nahen Felsblöcken und näherte sich dem Lager.
Kane verhielt sich ruhig.
Die Gestalt näherte sich wie ein Schatten. In der Linken hielt sie ein Gewehr, das im Schattenriss erkennbar war. In der Rechten etwas anderes. Für einen kurzen Moment fiel das Mondlicht darauf. Die Klinge eines Tomahawks blitzte auf.
Der Tomahawk sauste nieder – genau dorthin wo Kane lag.
Kane drehte sich am Boden um die eigene Achse.
Der Schlag mit dem Tomahawk ging ins Leere. Das Beil grub sich in den Boden
Kane riss den Colt empor, spannte den Hahn und hielt die Mündung an den Kopf seines Gegners.
„Keine Bewegung!“, knurrte er.
Die Gestalt erstarrte. Es war ein Indianer. Mondlicht fiel auf das blauschwarze, von einem breiten, roten Stirnband zusammengehaltene Haar, das ihm bis über die Schultern fiel. Er trug ein buntes Hemd aus Baumwolle, das über die Hose fiel. Darüber ein Gürtel mit Army Holster, Navy Colt und Bowie-Messer. Seine Hose war aus blauem Drillich und hatte die charakteristischen Seitenstreifen der Unions-Armee. Wahrscheinlich war dieser Indianer mal Army Scout gewesen.
In der Linken trug er ein Sharps Gewehr, das er wahrscheinlich beim Ausscheiden aus der Armee einfach hatte mitgehen lassen.
Er atmete tief durch.
Sein gewaltiger Brustkorb hob und senkte sich. Jeder Muskel und jede Sehne seines Körpers waren angespannt.
Die Gesichtszüge wirkten grimmig und verzerrt. Hasserfüllt.
„Die Waffe weg!“, forderte Kane. „Sofort fallen lassen!“
Der Indianer zögerte. Kane hob den Lauf des Revolvers etwas an. Der Indianer ließ das Sharps Gewehr auf den Boden fallen.
„Auch den Revolvergurt.“
Er schnallte ihn ab, ließ ihn zu Boden gleiten.
„Wer bist du?“, fragte Kane.
„Mein Name ist Macondo.“
„Apache?“
„Ja.“
„Wieso versuchst du, mich zu töten?“
„Wieso tötest du mich jetzt nicht gleich?“, fragte er zurück. Sein Englisch war recht gut.
„Weil ich wissen möchte, weshalb du mich im Schlaf überfallen hast.“
„Ich bin deinen Spuren gefolgt. Du kommst aus Magdalena.“
„Ich habe dort einen Tequila getrunken. Ist das schon Grund genug, um einen Mann umzubringen?“
„Ich wollte deine Gewehre. Deinen Revolver. Dein Pferd… Und deinen Skalp. Alle, die für den Mann reiten, der sich Major Jackman nennt, sollen dafür bezahlen, was er meiner Familie angetan hat!“
„Ich reite nicht für Major Jackman!“, erklärte Kane.
„Pah!“, machte Macondo verächtlich und verzog das Gesicht dabei. „In dieser Gegend reitet man entweder für Don Felipe oder für Major Jackman! Und alle Gringos sind bei Jackman!“
„In diesem Fall irrst du dich. Ich bin nicht bei Jackman. Einer seiner Männer hätte mir beinahe eine Kugel in den Rücken gebrannt!“
„Du lügst.“
„Warum sollte ich das tun. Ich könnte dich schließlich auch einfach über den Haufen schießen… Es gibt keinen Grund, weshalb ich dir etwas vormachen sollte.“
Macondo verengte die Augen. Er wirkte noch immer sehr angespannt. Wie ein Puma vor dem Sprung.
„Willst du einen Beweis sehen?“, fragte Kane.
„Welchen Beweis?“
Kane ging in die hocke, zog die Winchester aus dem Scubbard und warf sie ein paar Yards weiter. Die zweite Winchester nahm er an sich, steckte den Colt ein und lud sie durch. Dann trat er einen Schritt zurück und deutete auf den Sattel. Mit dem Lauf der Winchester zeigte er auf den zusammengeschnürten Mantel.
„Sieh dir den Mantel an, roll ihn aus und du wirst sehen, was ich meine.“
Macondo gehorchte.
Er breitete den Mantel aus, sah ihn sich ungläubig an und schaute dann zu Kane.
„Siehst du es?“
„Du hast für den Norden gekämpft?“
„Genau wie du, falls du die Hosen, die du trägst nicht irgendeinem armen Hund im Schlaf geraubt hast, wie du es bei mir vorhattest. Aber begreifst du jetzt, dass ich auf keinen Fall für Major Jackman reiten könnte?“
Macondo nickte.
„Das wusste ich nicht“, bekannte er. „Was geschieht jetzt? Erschießt du mich?“
„Setz dich ans Feuer. Ich will mit dir reden.“
Macondo nickte.
Als sie am Feuer saßen, berichtete Macondo, was Jackman und seine Männer der Familie des Apachen angetan hatten. Nach dem Ende des Bürgerkriegers war er wie hunderttausende andere Soldaten aus der Army der Nordstaaten entlassen worden und anschließend über die Grenze nach Mexiko gezogen, wo seine Sippe inzwischen wohnte.
„Über zwanzig Mann tauchten auf – bewaffnet mit Winchester-Gewehren, wie du zwei besitzt. Dieser Major hat sie angeführt. Da ich noch verschiedene Ausrüstungsstücke aus meiner Zeit als Scout bei den Blauröcken bei mir hatte, glaubten sie, ich wäre vielleicht ein Kundschafter der US-Regierung, der Gruppen wie die Bande des Majors ausspionieren soll!“
„Was ist genau geschehen?“
„Es war nicht weit von hier am Rio Tinto. Sie haben einfach drauflos geschossen und alle getötet. Ich bin der einzige, dem es gelang zu entkommen. Bei uns gab es kaum eine Handvoll Krieger. Der Rest waren alte Männer, Frauen und Kinder. An Waffen gab es bei uns außer Tomahawks und Messern ganze drei einschüssige Hinterlader, mein Sharps Gewehr und meinen Revolver. Unsere Gegner aber hatten Winchester-Karabiner, mit denen man zwölf Mal hintereinander schießen kann, ohne nachladen zu müssen. Wir hatten keine Chance.“
„Wann war das?“, fragte Kane.
„Ist schon ein paar Monde her“, sagte er.
„Und jetzt führst du einen einsamen Krieg gegen diesen Jackman.“
„Ja. Ich will Rache. Und ein Gesetz gibt es hier nicht. Der mexikanische Sheriff von Magdalena ist geflohen – und einem Apachen hätte der wohl auch ohnehin nicht geholfen.“
„Dann spielt sich Jackman hier als eine Art King auf“, stellte Kane fest. „Er wollte mich für seine Bande anheuern, bevor er wusste, dass ich für den Norden gekämpft habe und meinte, er würde Steuern in der Gegend erheben.“
Macondo nickte. „Schutzgelder nennt man das anderswo. Wer nicht zahlt, der bekommt eine Kugel in den Kopf. Ihm gehört das gesamte Gebiet.“
„Ich habe in Magdalena nur sechs Mann gesehen. Wo ist der Rest seiner Truppe?“
„In seinem Hauptquartier. Das hat er sich auf der Hazienda von Don Felipe Hidalgo y Gonzales del Rey eingerichtet, einem Großgrundgrundbesitzer und Rinderzüchter in der Gegend.“
„Du hast den Namen Don Felipe vorhin schon einmal erwähnt.“
Macondo nickte. „Ja. Der hat auch einige Männer unter Waffen…“
„Ich nehme an, dass er es sich nicht gefallen lassen will, dass ihm einfach jemand den Besitz wegnimmt!“
„Du sagst es. Aber Don Felipe hat Schwierigkeiten, Männer zu finden, die bereit sind, für ihn zu reiten. Männer, die mutig genug sind.“
Kane lächelte dünn. „Kann ich verstehen. Gegen Major Jackmans Meute anzutreten dürfte einem Selbstmord gleichen.“
„Mir ist es gleichgültig, ob ich dabei sterbe“, erklärte Macondo, der Kanes Antwort nicht in erster Linie auf Don Felipes Schwierigkeiten, Männer anzuheuern bezog, sondern auf seinen eigenen Kampf, den er gegen den Major und seine Bande führte.
„Warum schließt du dich nicht Don Felipe an?“, fragte Kane. „Du könntest deine Rache befriedigen und wahrscheinlich auch noch gutes Geld dabei verdienen. Ich nehme an, er zahlt nicht schlecht.“
Macondo schüttelte den Kopf.
„Nein, für meine Rache lasse ich mich nicht bezahlen. Aber vielleicht ist das was für dich.“
Kane war überrascht. „Wieso für mich?“
„Ich nehme an, du brauchst Geld und irgendjemand ist in den Staaten hinter dir her.“
„Woher willst du das wissen?“
„Es gibt keinen anderen Grund, um nach Sonora zu reiten. Jedenfalls nicht für einen Gringo wie dich. Ich nehme nicht an, dass du viel Geld hast, es sei denn, man sucht dich wegen Bankraub. Aber dann würdest du dein Geld wahrscheinlich in den Bordellen von Palomas vergeuden und nicht hier in der Wildnis kampieren.“
Kane grinste. Der Apache war ein genauer Beobachter.
„Wie nennt man dich, Gringo?“, fragte er.
„Laredo Kid.“
„Nicht dein wirklicher Name. Das bestätigt meine Annahmen.“
Zu spät bemerkte Kane den Grund dafür, dass Macondos Hand sich immer mehr seinem rechten, fast kniehohen Stiefelschaft genähert hatte.
3
Plötzlich bewegte sich der Indianer.
Wie ein Puma setzte er fast aus dem Nichts zum Sprung an. Aus dem Stiefelschaft riss er ein schlankes Messer, dessen Klinge kurz im Mondlicht blitzte.
Er warf sich auf Kane, der für den Bruchteil einer Sekunde zu spät reagierte.
Der Indianer über ihm bog den Lauf der Winchester zur Seite und setzte das Messer an Kanes Kehle.
Macondos Züge drückten Entschlossenheit aus.
Er bleckte die makellosen Zähne wie ein Raubtier.
Aber irgendetwas ließ ihn zögern, den Schnitt wirklich auszuführen.
„Es wäre gegen meine Ehre, wenn du mich einfach laufen ließest und ich mich nicht selbst befreien würde, Hombre“, murmelte er.
Er nahm das Messer von Kanes Hals und erhob sich.
Dann ging er ein paar Schritte, um seine Waffen vom Boden aufzunehmen. Er schnallte sich den Revolvergurt um, ließ den Tomahawk in eine eigens dafür vorgesehene Schlaufe an der linken Seite gleiten und nahm zuletzt das Sharps Gewehr vom Boden auf.
Dann blickte er zu Kane hinüber.
„Vielleicht führen unsere Wege noch einmal zusammen, Laredo Kid.“
Macondo drehte sich um und verschwand in der Nacht.
Wenig später hörte man in der Ferne den Hufschlag eines Pferdes.
4
Kane legte sich noch ein paar Stunden aufs Ohr. Kurz vor Sonnenaufgang räumte er dann sein Lager auf, sattelte sein Pferd und setzte seinen Weg fort.
In den Stunden gegen Morgen war es angenehm kühl.
Er trieb sein Pferd weiter Richtung Nordwesten.
So schnell wie möglich wollte er die Gegend um Magdalena verlassen. Dies war das Reich des Majors. Er mochte ein Schurke sein, der es verdient hatte, dass ihm jemand das Handwerk legte. Aber das war nicht Kanes Kampf. Er hatte Schwierigkeiten genug, seine eigenen Probleme zu lösen.
Er ritt durch zerklüftetes, schroffes Land, in dem die einzige Vegetation aus ein paar besonders widerstandsfähigen Kakteen-Arten zu bestehen schien.
Wie ein glutroter Ball ging die Sonne auf.
Kane stellte fest, dass seine Wasserflasche nur noch ein paar Tropfen enthielt.
Eigentlich hatte er ja geplant, in der Stadt Magdalena, seine Vorräte auffrischen zu können, was leider nicht möglich gewesen war. Jetzt hatte er zwar die hundert Dollar des Majors bei sich, die der selbsternannte Kriegsherr im Dienst des untergegangenen Südens für den zweiten Revolvergurt bekommen hatte – aber etwas wert waren diese hundert Unionsdollars nur dort, wo es dafür auch etwas zu kaufen gab. Im gesamten Grenzgebiet Mexikos zogen viele Händler den US-Dollar dem instabilen Peso vor. In so fern wäre es kein Problem gewesen, in Magdalena dafür einzukaufen.
Aber hier draußen in der Wüste waren ein paar Tropfen Wasser viel mehr Wert, als hundert Dollar, die dem Lohn eine Cowboys für drei Monate, dem Sold eines Soldaten für ein halbes Jahr entsprachen.
Kane blieb schließlich bei einer Gruppe von Kakteen stehen.
Er schlug ein Stück davon ab, versuchte es anzufassen, ohne sich allzu sehr stechen zu lassen und füllte den darin enthaltenen Saft in seine Feldflasche.
Der Saft schmeckte bitter und ließ Kane das Gesicht verziehen.
Er füllte auch etwas davon in die Blechtasse, aus der er normalerweise Kaffee trank, und versuchte, seinen Gaul auf den Geschmack zu bringen.
Doch das Tier schnaubte nur und wandte den Kopf ab.
„Du bist wohl noch nicht durstig genug, was?“
Kane schwang sich wieder in den Sattel und setzte seinen Weg fort.
5
Es wurde schnell wärmer. Die Sonne brannte vom Himmel und die Luft über dem trockenen, aufgesprungenen Land begann zu flimmern.
Kane erreichte eine Schlucht. Zu beiden Seiten ragten die Hänge steil auf. In der Mitte der Schlucht war der Boden noch feucht. Vor nicht allzu langer Zeit hatte es hier einen Wasserlauf gegeben. Kane hoffte, dass von dem noch etwas übrig geblieben war und folgte ihm.
Er fand schließlich eine Wasserstelle, die den erbärmlichen Rest dieses Gewässers darstellte, das wahrscheinlich nach einem ausgiebigen Regenguss bereits wieder soweit anschwoll, dass es die gesamte Breite der Schlucht ausfüllte.
Das Pferd war kaum zu bremsen.
Kane musste sein ganzes Geschick aufbieten, um das Tier davon abzuhalten, dem unwiderstehlichen Geruch des Wassers zu folgen.
Er band es an einem Strauch fest, um erst einmal selbst die Qualität zu prüfen.
Wenn es salzhaltig war, und das Tier nahm davon ein paar ausgiebige Schluck, bedeutete dies ein Todesurteil für den Gaul.
Kane kniete am Ufer nieder und führte eine Handvoll Wasser zum Mund.
Er spuckte es gleich wieder aus.
Es war ungenießbar.
Im selben Moment hörte er hinter sich das ratschende Geräusch, das entstand, wenn eine Winchester durchgeladen wurde.
„Keine Bewegung, Hombre!“, sagte eine raue Stimme.
Kane wandte den Kopf zur Seite. Aus den Augenwinkeln heraus konnte er den Kerl ausmachen. Er trug einen Sombrero, wie man ihn an der mexikanischen Seite der Grenze häufig zu sehen bekam. Zwei Patronengurte hingen ihm über den Schultern und kreuzten sich über der Brust.
Für die beiden etwas altertümlich wirkenden Pistolen hatte er kein Holster. Sie steckten einfach hinter seinem breiten Gürtel.
Für einen Moment erwog Kane seine Chancen, sich einfach zur Seite fallen zu lassen, den Revolver aus dem Holster zu reißen und auf den Kerl zu feuern.
Der Mann, den man Laredo Kid nannte, war sowohl schnell als auch treffsicher genug.
Aber dann tauchten rings um die Wasserstelle plötzlich ein halbes Dutzend weiterer Männer auf.
Alle mit Gewehren bewaffnet.
Die Läufe waren auf Kane gerichtet.
Die Männer wechselten ein paar Sätze auf Spanisch miteinander, die Kane nicht verstand. Nur einen Namen bekam er mit.
Es war immer wieder von „Don Felipe“ die Rede.
Der Mann mit den gekreuzten Gurten und dem Sombrero näherte sich Kane von hinten und zog ihm den Revolver aus dem Holster, steckte ihn hinter seinen Gürtel und nahm dann auch das Bowie-Messer an sich. Dabei presste er Kane die ganze Zeit über den Lauf der Winchester in den Rücken.
Die Anderen näherten ich jetzt.
Ihrer Kleidung nach handelte es sich ausnahmslos um Mexikaner.
„Alle Achtung!“, meinte einer der Kerle mit unrasiertem, fülligem Gesicht und dunklen, schwarzblauem Haar, dessen Strähnen ihm in den Augen hingen. Den Sombrero trug er an einer Halskordel auf dem Rücken. „Zwei Winchester-Gewehre im Sattel! Das hat nicht jeder, Hombre!“
„Don Felipe wird sich freuen“, glaubte der Kerl mit den gekreuzten Gurten, der Kane die Waffe in den Rücken drückte, sodass dieser zu der Überzeugung kam, dass es das Beste war, im Augenblick gar nichts zu tun und sich ruhig zu verhalten.
Der Mexikaner hinter ihm versetzte ihm einen Schlag mit dem Gewehrkolben. Kane brach zusammen.
Der Mexikaner richtete den Gewehrlauf auf ihn.
„Was sollen wir mit dir machen, Hombre? Es gibt hier so wenig Bäume, an denen man einen Mann hängen könnte!“
„Pedro!“, rief einer der anderen. Es war der Unrasierte, der bei Kanes Pferd gewesen war. „Wir bringen ihn zu Don Felipe!“
„Warum nicht gleich kurzen Prozess mit ihm machen?“, fragte Pedro. Er sprach Englisch – und zwar ganz bewusst, damit Kane jedes Wort mitbekam. Pedros Gesicht verzog sich. „Ein paar gute Freunde von mir haben ins Gras beißen müssen, als dein Boss, dieser Hundesohn, der sich Major Jackman nennt und seinen Rang in der Armee des Teufels haben muss, die Hazienda von Don Felipe überfielen… Du kennst doch die Bibel, oder?“
„Wer nicht?“, ächzte Kane. „Aber ich bin nicht der, für den ihr mich haltet.“
„Mutig genug, um Wehrlose zu töten, das seid ihr. Aber wenn man euch dann zur Verantwortung zieht, seid ihr nichts als Feiglinge und wimmert herum!“
„Ihr haltet mich offenbar für einen von Major Jackmans Männern.“
Pedro grinste schief. „Wir halten dich nicht nur dafür, Kane. Du bist einer von Jackmans Männern. Einer von den Bastarden, die über die Grenze kommen, weil sie in den Staaten niemand braucht. Einer dieser Verblendeten, die nicht wahrhaben wollen, dass der Krieg bei euch da drüben zu Ende ist – und andere, die nur irgendwelche patriotischen Argumente benutzen, um das zu tun, was sie immer schon getan haben. Morden und plündern!“
Kane schüttelte den Kopf. „Ich habe mit diesem Jackman nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. In Magdalena hätten mich seine Leute fast über den Haufen geschossen, weil ich in der Nordstaaten-Armee war.“
Pedro lud seine Winchester durch und zielte auf Kanes Kopf.
Er war offenbar außer sich vor Wut.
Der Gedanke, dass sich ein Mann, den er für mitschuldig am Tod seiner Freunde wähnte, nun auch noch zu rechtfertigen versuchte, ging ihm offenbar über die Hutschnur.
„Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du einem höheren Richter gegenüberstehst! Madre de Dios!“
Ein Schuss krachte aus dem Lauf der Winchester heraus.
Das Mündungsfeuer leckte wie die blutrote Feuerzunge eines Drachen aus der Mündung.
Aber der Schuss ging daneben.
Im letzten Augenblick war der Unrasierte zugesprungen und hatte den Gewehrlauf nach unten gedrückt, sodass sich die Kugel dicht vor Kane in den Boden brannte.
Eine kleine Sandfontäne wurde aufgewirbelt.
Der Unrasierte wechselte mit dem Kerl, der Pedro genannt worden war, ein paar unfreundliche Worte auf Spanisch.
Fein ging es dabei nicht zu.
Aber der Unrasierte setzte sich offenbar durch.
Er wandte sich an Kane.
„Hast du Beweise für das, was du gesagt hast?“
„Sicher!“
„Welche?“
„Der blaue Militärmantel auf meinem Sattel. Ich habe für den Norden gekämpft. Mich hasst Jackman mehr als jeden Mexikaner.“
„So einen Mantel kann jeder haben! Das ist kein Beweis.“
„Ich besitze auch Entlasspapiere aus der Unionsarmee.“
„Zeig uns die!“
Kane erhob sich vorsichtig. Seine Seite schmerzte von dem brutalen Schlag, den Pedro ihm versetzt hatte.
Kane griff in die Innentasche seiner Lederweste und holte ein zusammengefaltetes Dokument hervor. Er reichte es dem Unrasierten. Dieser entfaltete es und starrte darauf wie ein indianischer Medizinmann auf ein Totem. Kane konnte erkennen, dass er das Dokument falsch herum hielt.
Er reichte es Kane zurück.
„Scheint in Ordnung zu sein“, behauptete er.
„Dann hätte ich jetzt gern meine Waffe wieder, damit ich weiterreiten kann.“
„Nein, wir werden dich zu Don Felipe bringen“, widersprach der Unrasierte. „Er wird entscheiden, was geschieht!“
6
Kane wurde auf sein Pferd gesetzt. Man band ihm die Hände auf den Rücken. Außerdem entfernte man die beiden Gewehre aus seinem Sattel-Pack.
Der Unrasierte zog Kanes Pferd hinter sich her.
„Wie heißt du, Hombre?“, fragte er unterwegs.
„Ich dachte, du hast meine Entlasspapiere gelesen“, erwiderte Kane.
„Caramba! Kann ich mir vielleicht jeden Gringo-Namen merken?“
„Nenn mich Laredo Kid“, sagte Kane grinsend.
Die Stunden krochen dahin. Kane bat um Wasser für sich und sein Pferd. Nach einer kleinen Debatte auf Spanisch, in der sehr häufig die Wörter „loco“ und „tonto“ benutzt wurden und es nicht gerade besonders fein zuging, gab der Unrasierte Kane schließlich seine Feldflasche.
Und auch das Pferd bekam etwas.
„Schließlich ist keiner von uns darauf aus, dass du uns dadurch aufhältst, dass du zu Fuß mit uns gehst, weil dein Gaul dir unter den Hintern zusammengebrochen ist, Gringo!“, sagte er.
„Ich weiß eure herzliche Gastfreundschaft zu schätzen!“, erwiderte Kane sarkastisch.
Bis zum frühen Abend zogen sie weiter durch die zerklüftete, karge Landschaft.
Dann erreichten sie eine Ebene, die von Steinen, Sand und einigen mehr oder minder verdorrten Büschen bedeckt wurde.
Ein Kirchturm erhob sich über diese Ebene.
Etwa auf halben Weg zu den nächsten Anhöhen befand sich ein von einer weißen Sandsteinmauer umgebener Bau.
„Ein Kloster?“, fragte Kane.
„Eine verlassene Mission“, nickte der Unrasierte. „Weder Apachen noch Comanchen haben es geschafft, die Mönche zu vertreiben. Das schaffte erst ein gewisser Major Jackman…“
„Was ist passiert?“
„Du spielst den Ahnungslosen ganz ausgezeichnet, Laredo Kid!“
„Du hast meine Entlassungspapiere aus der Unionsarmee gesehen!“
„Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Jackman da irgendeinen Unterschied machen würde. Jeder, der mit einer Waffe umgehen kann und bereit ist, für ihn zu reiten und das Eisen zu schwingen weiß, den nimmt er doch gerne bei sich auf!“
„Du kannst ihn nicht besonders gut kennen, sonst würdest du das nicht sagen“, sagte Kane.
Der Unrasierte grinste. „Vielleicht kenne ich Major Jackman nicht so gut wie du, das kann schon sein, Laredo Kid. Ist das überhaupt ein richtiger Name bei euch Gringos.“
„Du wolltest mir noch erzählen, was in der Mission geschehen ist.“
Der Unrasierte lachte heiser. „Ist schon ein paar Monate her. Vielleicht warst du damals bei diesem Haufen ja wirklich noch nicht dabei, Laredo Kid.“
Eine bissige Bemerkung lag Kane auf der Zunge.
Etwa in der Art, dass er sich darüber gar keine Gedanken zu machen bräuchte, wenn er die Entlasspapiere wirklich gelesen und Jackman und seine Männer auch nur einmal über Nordstaatler hätte reden hören.
Aber Kane ahnte, dass er den Unrasierten ziemlich sauer machte, wenn er ihn bloßstellte. Und das konnte für ihn gefährlich werde. Also hielt Kane sich zurück. Vielleicht fand er in diesem entmachteten Großgrundbesitzer ja jemanden, mit dem man reden konnte.
Jemanden, der lesen konnte.
„Die Mönche sollten wie alle anderen in der Gegend ihre Abgaben an Jackman zahlen“, berichtete der Unrasierte. „Aber das haben sie nicht gemacht. Sie meinten, ihre Überschüsse, die sie erwirtschafteten, seien für die Armen bestimmt und nicht für dahergelaufenes Gesindel wie Jackman und seine Meute.“
„Ich nehme an, der Major ist ziemlich sauer geworden.
„Er soll persönlich zwei der Mönche erschossen haben. Unbewaffnete Männer Gottes, verstehst du? Männer, die in ihrem ganzen Leben noch keiner Fliege etwas zuleide getan und ihr Leben der Hilfe an den Armen gewidmet haben.“ Der Unrasierte spuckte aus. „Kann es etwas Niederträchtigeres geben?“
„Was ist mit den anderen Mönchen?“
„Sind geflohen. Es kann ihnen niemand verdenken. Das waren Männer Gottes, aber nicht jeder bringt die Leidensfähigkeit unseres Herrn Jesus Christus mit – wenn du verstehst, was ich meine.“
„Und jetzt hat dort Don Felipe sein Hauptquartier aufgeschlagen.“
„Vorübergehendes Lager würde ich das nennen“, korrigierte der Unrasierte.
7
Das Tor der Mission wurde geöffnet und die Reitergruppe preschte in den Innenhof.
Ein Mann mit dünnem Oberlippenbart und einem schwarzen Hut mit gerader Krempe trat aus dem Haupthaus.
Er trug einen Revolvergurt, in dem ein langläufiger Navy Colt steckte. Mit den Zähnen hielt er eine Zigarre, die leicht aufglomm.
Die Ankömmlinge begrüßten de Mann als Don Felipe. Was sie sonst noch sagten, konnte Kane nicht verstehen, da er kein Spanisch verstand.
Zwei Kerle packten Kane ziemlich grob und zogen ihn aus dem Sattel. Dann warfen sie ihn in den Staub.
„Meine Männer behaupten, dass Sie einer von Jackmans Leuten seien!“, sagte Don Felipe, nachdem er die Zigarre aus dem Mund genommen und mit dem Rauch ein paar Ringe geformt hatte.
„In meiner linken Westentasche finden Sie Entlasspapiere der Unionsarmee. Jackman hätte jemanden wie mich nie aufgenommen.“
Don Felipe steckte die Zigarre wieder in den Mund, trat auf Kane zu, griff in dessen Westentasche und holte das Dokument heraus. Er sah es sich eingehend an und faltete es wieder zusammen. Dann steckte er es zurück in Kanes Tasche. „Macht den Mann los.“
Pedro meldete sich zu Wort.
Er sprach auf Spanisch und Kane bekam nicht viel mehr mit, als dass ihm die Entscheidung des Bosses offenbar nicht gefiel. Der Unrasierte blieb hingegen ruhig.
Don Felipe beendete den Disput mit ein paar barschen Worten.
Kanes Fesseln wurden augenblicklich gelöst.
Don Felipe wies seine Männer an, Kane die Waffen zurückzugeben, was auch augenblicklich geschah. Der Unrasierte steckte eines der Winchester-Gewehre in den Sattelschuh. Das andere Gewehr übergab er Kane zusammen mit dem Revolver.
„Nichts für ungut, Hombre.“
„Es tut mir leid, dass meine Männer Sie offensichtlich etwas grob behandelt haben“, sagte Don Felipe. „Seien Sie dafür mein Gast, auch wenn ich Ihnen im Augenblick nur einen bescheidenen Luxus bieten kann, der mir streng genommen noch nicht einmal gehört.“
„Einer Ihrer Leute hat mit berichtet, was mit den Mönchen geschehen ist“, sagte Kane.
Don Felipe nickte düster. „Wir bleiben hier eine Weile und suchen uns dann ein anderes Lager…“ Er seufzte. „Kommen Sie rein, Senor…“
„Nennen Sie mich Laredo Kid“, sagte Kane.
Don Felipe musterte Kane von oben bis unten. „Meinetwegen, Senor. Und im Übrigen hoffe ich, dass Ihnen kein ernsthafter Schaden entstanden ist. Und was das Verhalten meiner Leute angeht, müssen Sie es schon entschuldigen. Manche sind vielleicht etwas übereifrig. Aber das kommt daher, dass sie einige gute Freunde in Schießereien mit Jackman und seiner Truppe verloren haben. Manche haben auch Familienangehörige hier in der Gegend zu beklagen. Der Major und seine Truppe fackelt nicht lange. Wenn jemand die sogenannten Steuern nicht bezahlt, ist er dran. Steuern, von denen er angeblich eine Armee aufstellen will, mit denen er das Ergebnis des Bürgerkrieges korrigieren will.“
„Die Schlacht von Gettysburg ist vorbei“, sagte Kane. „Aber leider gibt es Männer wie Jackman, die das nicht begreifen. Die einfach nicht wahrhaben wollen, dass die Sache des Südens nicht mehr aufrecht zu halten ist und unser Land jetzt nichts so dringend braucht wie Frieden.“
„Ich bin ziemlich oft bei Ihnen drüben im Norden gewesen. Als Rinderzüchter kommt man ganz schön rum, Senor. Aber ich sage Ihnen, es wird hundert Jahre dauern, bis es den nächsten Präsidenten in Washington gibt, der aus dem Süden stammt!“
„Ich fürchte, da könnten Sie Recht haben.“
Kane steckte seinen Revolver ins Holster. Don Felipe führte ihn in das Haupthaus, nachdem der Großgrundbesitzer seine Leute angewiesen hatte, sich um die Pferde zu kümmern.
Ausdrücklich wies er den Unrasierten an, auch Kanes Gaul genügend Wasser zu geben. Der Unrasierte quittierte das mit einem Knurren.
Als Kane ins Haus trat, brauchte er einen Augenblick, um sich an das Halbdunkel zu gewöhnen. Ein paar grobe Holzmöbel befanden sich hier. Kein Luxus. Aber der war an einem Ort, an dem Mönche gelebt hatten, auch nicht zu erwarten.
Don Felipe stellte Kane einen Stuhl zurecht.
„Setzen Sie sich, Senor.“
Kane nahm das Angebot an. Die Winchester legte er auf den Schoß. Irgendwie wurde er das Gefühl nicht los, dass Don Felipe noch irgendeinen Hintergedanken verfolgte. Dass er sich für das Verhalten seiner Männer entschuldigen wollte, war eine Sache. Aber er hatte noch irgendetwas anderes im Sinn.
Don Felipe stellte eine Flasche und zwei Blechtassen auf den Tisch.
„Tequila?“, fragte Kane.
„Nein. Kentucky Bourbon.“
„Ich hätte nicht gedacht, dass man in dieser Gegend so etwas bekommt!“
„In Palomas bekommt man alles, was man will.“
Nachdem er die beiden Gläser gefüllt hatte, setzte sich Don Felipe ebenfalls.
Kane nahm einen kräftigen Schluck. Der Bourbon war tatsächlich von hoher Qualität. Don Felipe wusste offenbar, was gut und teuer war.
Don Felipe trank ebenfalls.
Seine Augen wurden schmal.
Er bot Kane eine Zigarre an, aber dieser lehnte ab.
„Hören Sie, es ist mir gleichgültig, weswegen man Sie drüben in den Staaten sucht oder was auch immer Sie auf dem Kerbholz haben. Sie haben in einer Armee gedient und können offenbar mit Waffen umgehen. Das ist mir schon genug…“
„Wenn Sie mich anheuern wollen, dann muss ich Sie leider enttäuschen“, sagte Kane. „Ich persönlich habe jedes Verständnis für den Krieg, den Sie gegen Major Jackman und seine Bastarde führen. Aber dieser Krieg geht mich nichts an. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht die Absicht, für ein paar Dollar mein Leben zu riskieren.“
„Auch nicht, wenn es um eine gerechte Sache geht?“
„Nein.“
„Die Entlassungspapiere aus der Army der Union haben mir gezeigt, dass Sie darüber offenbar mal anders gedacht haben!“
„Das ist vorbei“, erklärte Kane.
Er wollte sich erheben.
„Bleiben Sie sitzen“, wies Don Felipe ihn an. „Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen.“
„Ich glaube nicht, dass diese Geschichte in der Lage ist, mich umzustimmen.“
„Hören Sie sie sich trotzdem an. Das einzige, was Sie dabei riskieren ist, dass sie noch einen Becher voll Bourbon trinken und Ihnen später der Schädel deswegen brummt!“
Kane atmete tief durch. „Also gut.“
Don Felipe beugte sich etwas vor. „Sehen Sie, als diese Bande uns überfiel, mussten wir ziemlich überstürzt fliehen. Meine Frau starb schon vor Jahren, aber ich habe eine Tochter, zwanzig Jahre alt. Bevor ich gegen Jackman vorzugehen begann, habe ich erst einmal dafür gesorgt, dass sie sicher untergebracht ist.“
„Das kann ich gut verstehen“, sagte Kane.
„Ich habe sie nach Palomas zu einem Verwandten gebracht. Eigentlich hatte ich angenommen, dass sie dort sicher wäre. Aber das war nicht der Fall. Jackman und seine Bande hat herausbekommen, wo meine Tochter ist und sie entführt. Er hält sie jetzt auf unserer Hazienda als Geisel gefangen, um sicher sein zu können, dass ich mich von ihm fernhalte. Er kann mich auf diese Weise jederzeit unter Druck setzen.“
„Das tut mir leid, Don Felipe. Aber Sie haben ja eine gut bewaffnete Truppe, die Ihnen sicher bei allem, was Sie planen zur Seite stehen wird.“
„Sie begreifen noch immer nicht! Diese Männer da draußen sind guten Willens. Und sie haben Mut! Und vor allem tragen sie aus dem einen oder anderen Grund Hass in sich. Hass auf diesen Jackman, der sich hier als Herr über Leben und Tod aufspielt. Aber das ist keine gute Voraussetzung, um kämpfen zu können.“
Kanes Augen wurden schmal.
Don Felipe goss ihm den Bourbon nach.
„Worauf wollen Sie hinaus, Don Felipe?“
Der Großgrundbesitzer ging auf Kanes Frage überhaupt nicht ein.
Stattdessen sagte er: „Wenn meine Leute irgendwo auftauchen, weiß Major Jackman sofort, dass ich dahinter stecke. Aber wenn ein Gringo wie Sie…“
„Es tut mir leid, Don Felipe. Meine Entscheidung steht fest. Ich schlage vor, Sie setzen sich mit den Behörden Ihres Lande in Verbindung.“
Don Felipes Faust krachte auf den Tisch. „Die Behörden meines Landes? Die gibt es derzeit in Sonora nicht! Unser Land bewegt sich auf einen chaotischen Zustand hin! In Magdalena gibt es keinen Sheriff und in Palomas ebenfalls nicht. Es gibt keine Männer, die das machen wollen.“
„Die werden ihre Gründe haben“, meinte Kane.
Don Felipe beugte sich vor. „Sie bekommen tausend Dollar. Dafür können Sie sich drei- bis vierhundert Rinder kaufen und sich im Westen als Rancher niederlassen!“
Kane überlegte.
Tausend Dollar.
Der Betrag schien in seinem Kopf förmlich widerzuhallen.
Von tausend Dollar konnte er eine Weile leben. Vielleicht sogar sich irgendwo unter falschem Namen eine neue Existenz aufbauen.
„Was muss ich dafür tun?“
„Trauen Sie sich zu, Isabellita – so heißt meine Tochter – zu befreien?“
„Major Jackmans Männer kennen mich. Ich hatte eine ziemliche üble Begegnung mit ihnen in Magdalena. Wenn Sie also glauben, ich könnte mich dort einschleichen, dann liegen Sie schief.“
„Um so besser! Wenn Sie aufgegriffen werden, wird Sie niemand mit Isabellita und in mir in Verbindung bringen und deswegen wird Jackman ihr auch nichts tun. Wenn ein Mexikaner versucht, auf die Hazienda zu gelangen, glaubt der Major hingegen sofort, dass es einer von meinen Leuten ist und macht seine Drohungen war.“
Kane überlegte. „Vielleicht könnte es klappen“, sagte er.
„Dann arbeiten Sie für mich!“
„Wie viele Männer haben Sie unter Waffen?“
„Zehn. Mit mir selbst und Ihnen sind wir zwölf.“
„Das reicht vielleicht. Aber wir machen es nach meinem Plan… Und ich will einen Teil der Summe im Voraus!“
8
Es war eine mondhelle Nacht als sie sich der Hazienda näherten. Der Herrensitz Don Felipes, den Major Jackman und seine Bande zu ihrem Hauptquartier erkoren hatten, lag auf einer Anhöhe. Es war unmöglich, sich ihr am Tag zu nähern, da man dann in einem Radius von fast 200 Yards so gut wie keine Deckung hatte.
Aber bei Nacht hatte man den Schutz der Dunkelheit.
Die Pferde wurden an einer geschützten Stelle zurückgelassen. Die Männer nahmen ihre Gewehre und legten sich in Deckung – und zwar so, dass sie das Tor gut im Auge behielten. Eine Mauer umschloss die Hazienda. Sie war nur etwa zwei Meter hoch – also durchaus nicht unüberwindbar.
Musik drang herüber. Auf einem Piano klimperte jemand herum. Schrilles Frauenlachen mischte sich in die Musik.
Kane sah Don Felipe fragend an.
„Das Piano habe ich mir von einem Versandhaus an der Ostküste kommen lassen!“, meinte der Großgrundbesitzer.
„Allein der Transport muss ein Vermögen gekostet haben!“, staunte Kane.
„Ja – und wahrscheinlich kostet es noch einmal ein Vermögen, das Instrument wieder herrichten zu lassen, wenn diese Bastarde mit ihren Schmutzfingern das Elfenbein der Tasten besudelt haben.“
Don Felipe verzog das Gesicht, so als würde ihm allein der Gedanke daran körperliche Qualen verursachen.
„Und die Frauen?“, fragte Kane.
Der Unrasierte antwortete an Stelle von Don Felipe.
„Ich nehme an, die kommen aus einem der Bordelle in Palomas.“
„Wo könnte man Ihre Tochter gefangen halten?“, fragte Kane an Don Felipe gerichtet.
„Der sicherste Raum ist der Weinkeller.“ Der Großgrundbesitzer seufzte. Er stellte sich offenbar vor, wie Jackmans ungehobelte Bande sich über die edlen Tropfen hermachten, die Don Felipe im Laufe der Jahre gesammelt hatte.
„Also gut“, sagte Kane. „Dann tritt unser Plan jetzt in die entscheidende Phase.“
9
Sie warteten bis lange nach Mitternacht.
Jackmans Bande bewies eine ziemlich große Ausdauer beim feiern. Das Piano klimperte noch bis drei Uhr in der Früh. Aber gegen vier Uhr war es endlich ruhig. Man hörte gar nichts mehr, abgesehen vom gelegentlichen Schnauben eines Pferdes, die im Stall standen.
Kane schlich bis zur Mauer der Hazienda. Teilweise legte er diesen Weg kriechend vorwärts, verbarg sich hinter kleineren Sträuchern und musste mitunter recht lang darauf warten, dass die Wächter, die an der Brustwehr auftauchten, ein Stück weiter gingen und ihre Aufmerksamkeit einem anderen Stück dieser nächtlichen kargen Wildnis widmeten.
Kane presste sich gegen die Mauer. Er hatte ein Lasso bei sich. Die Schlinge warf er über eine der Zinnen. Dann zog er sich daran hoch. Wenig später überkletterte er die Mauer und befand sich auf dem Wehrgang.
Ein Wächter ging auf der anderen Seite der Hazienda auf dem Wehrgang auf und ab. Seine Gestalt hob sich dunkel gegen das Mondlicht ab.
Kane duckte sich. Er nahm eine Leiter, die hinunterführte. Als er den Boden erreichte, nahm er ganz in der Nähe eine Bewegung wahr.
„Hey, wer ist da?“, fragte eine Stimme.
Kane konnte von dem dazugehörigen Mann nur einen Umriss sehen.
Er trug eine Mütze und als er dann einen Schritt vortrat, sah Kane, dass es Dooley war. Der Mann mit der Südstaatenmütze und dem bis unter die Augen wuchernden Bart.
Er runzelte noch die Stirn, nahm die Winchester, die er in der Linken hielt, in beide Hände und wollte sie gerade in Anschlag nehmen und durchladen, da machte Kane einen Satz nach vorn und verpasste Dooley einen Fausthieb.
Dieser Hieb war so platziert, dass Dooley sofort das Bewusstsein verlor.
Er sackte in sich zusammen.
Mit einem dumpfen Geräusch krachte er auf den Boden.
Reglos blieb er liegen.
Kane schlich weiter vorwärts. Dabei hielt er sich stets in den Schattenzonen, um bei den Wächtern keinen Verdacht zu erwecken. Es waren zwar nur ein paar Männer für diesen Dienst eingeteilt, aber Kane war sich sicher, dass die Mobilisierung aller Bandenmitglieder innerhalb von einem oder zwei Minuten abgeschlossen war.
Weiter ging es entlang der Außenmauern.
Der Weinkeller befand sich unterhalb des Haupthauses. Don Felipe hatte Kane das Haus auf einer Zeichnung veranschaulicht. Und daher wusste Kane, dass Isabellitas Zimmer im Obergeschoss des Haupthauses war und es natürlich auch sein konnte, dass die Tochter des Großgrundbesitzers dort gefangen gehalten wurde. Allerdings gab es da einen Treppenaufgang von außen, sodass die Möglichkeit einer Flucht viel eher gegeben war und daher rechnete Don Felipe nicht mit dieser Möglichkeit.
Kane erreichte den Vordereingang des Haupthauses. Drei Stufen befanden sich dort. Auf der untersten saß ein Wächter mit einer Sharps Rifle im Arm. Aber er schlief. Und die leere Flasche neben ihm ließ vermuten, dass das auch noch eine Weile so bleiben würde.
Kane ging weiter.
Lautlos nahm er die Stufen. Die Tür stand halb offen.
Sie knarrte, als er sie öffnete.
Der Wächter stöhnte auf, veränderte seine Schlafposition, die auf der Treppe sowieso nicht richtig bequem sein konnte.
Kanes Hand war am Revolver. Aber er brauchte ihn nicht. Der Wächter schlief weiter.
Der Flur war ziemlich dunkel. Es kam kaum Mondlicht herein.
Auf einer Kommode fand Kane einen Kerzenleuchter. Er griff nach den Streichhölzern in seiner Westentasche, riss eins davon am Stiefelabsatz an und entzündete die Kerzen am Leuchter.
Damit ging er weiter zur Kellertreppe.
Vor der verschlossenen Tür des Weinkellers lag ein weiterer Wächter. Auch er hatte ordentlich dem Tequila zugesprochen und schnarchte vor sich hin. Der Schlüssel hing an seinem Gürtel. Kane nahm ihn an sich und öffnete. Dann stieß er die Tür auf.
Unzählige Weinflaschen waren hier gelagert. Auf einem Lager aus Strohsäcken lag eine junge Frau mit langem, dunklem Haar. Das flackernde Licht des Kerzenleuchters tauchte ihre feingeschnittenen Gesichtszüge in ein weiches licht. Sie trug Männerkleidung, eng anliegende Reiterhosen und ein Leinenhemd. Angst leuchtete in ihren Augen.
Kane legte den Finger auf den Mund.
„Bleiben Sie ruhig“, flüsterte er. „Isabellita?“
„Wenn Sie mir zu nahe kommen, schreie ich! Dann wird Jackman Sie erschießen.“
„Ihr Vater schickt mich. Ich soll Sie hier herausholen. Kommen Sie mit!“
Sie sah Kane ungläubig an.
„Na los! Er wartet draußen vor der Hazienda auf Sie und will sich seinen Besitz zurückholen. Aber das kann er nur, nachdem Sie befreit sind.“
Sie stand auf und strich ihr Haar zurück.
„Ist das wirklich wahr?“
„Glauben Sie’s oder nicht. Aber eine zweite Chance zur Flucht bekommen Sie so schnell nicht wieder!“
In diesem Moment fielen draußen Schüsse. Pferde wieherten. Irgendein Tumult brach los.
Kane erstarrte.
Isabellita sah ihn fragend an. „Haben Sie eine Ahnung, was da oben jetzt los ist?“, fragte sie.
„Nicht die Geringste. Aber wir werden es sehen.
10
Der Wächter vor der Tür des Weinkellers erwachte und streckte sich. Er griff an den Gürtel, wo er den Schlüssel getragen hatte. Dann ging ein Ruck durch seinen Körper.
Gleichzeitig nahm er den Tumult von draußen war.
Er schnellte hoch, aber Kanes Fausthieb streckte ihn erneut nieder. Er blieb regungslos liegen.
„Kommen Sie, Isabellita!“, forderte Kane und zog die junge Frau hinter sich her.
Sie erreichten das Erdgeschoss. Kane löschte den Leuchter. Vorsichtig ging er zur halb offen stehenden Tür und blickte hinaus. Der Wächter auf der Treppe schlief noch.
In der Mitte des Innenhofs der Hazienda war ein Menschenauflauf entstanden.
Fackeln erhellten die Nacht.
Ungefähr zwanzig Mann hatten sich versammelt. Kane erkannte Jackman und Brannigan.
Ein Mann wurde festgehalten.





























