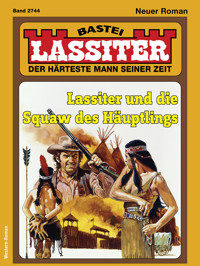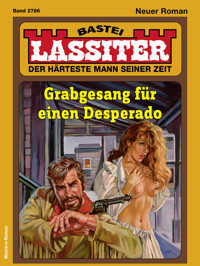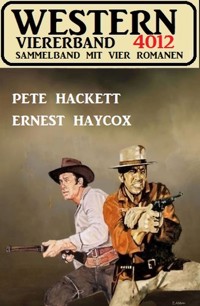
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Western von Pete Hackett: Pete Hackett: Terror am Sweetwater Pete Hackett: Joshua, der Revolvermann Pete Hackett: Express in den Tod Ernest Haycox: Die Trail-Stadt Die Spur führte nach Camp Wheeless. Joe und ich ritten auf der Spur der beiden Mörder Ed Socorro und Price McDaniels. Die beiden Schufte waren in Amarillo gesehen worden. Richter Humphrey hatte Joe Hawk und mich auf ihre Fährte gesetzt. Jetzt befanden wir uns in dem ehemaligen Eisenbahncamp im Indianer-Territorium Oklahoma. Joe und ich ritten zum Mietstall. Im Wagen- und Abstellhof saßen wir ab. Wir führten unsere Pferde ins Stallinnere. Der Stallmann war ein Oldtimer mit einem wüsten Bartgeflecht im Gesicht und einem lückenhaften Gebiss. Auf unsere Frage, ob in den vergangenen Tagen zwei Reiter angekommen waren, sagte er mit galliger Stimme: »Die beiden sind da. Es sind zwei ganz besonders üble Nummern. Sie gebärden sich, als würde die Stadt ihnen gehören. Sie haben einen Mann erschossen und einen anderen schwer verwundet. Es sind Strolche, die die Luft nicht wert sind, die sie atmen.« »Sie bezeichnen das Camp als Stadt?«, gab ich mich erstaunt. »Ja. Es zeichnen sich erste Ansätze ab, dass hier eine Stadt entsteht. Es gibt schon eine Reihe von Einrichtungen, die eine richtige Stadt ausmachen. Ihr werdet es sehen.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, Ernest Haycox
Western Viererband 4012
Inhaltsverzeichnis
Western Viererband 4012
Copyright
Terror am Sweetwater Creek
Joshua, der Revolvermann
Express in den Tod
Die Trail-Stadt
Western Viererband 4012
Pete Hackett, Ernest Haycox
Dieser Band enthält folgende Western
von Pete Hackett:
Pete Hackett: Terror am Sweetwater
Pete Hackett: Joshua, der Revolvermann
Pete Hackett: Express in den Tod
Ernest Haycox: Die Trail-Stadt
Die Spur führte nach Camp Wheeless. Joe und ich ritten auf der Spur der beiden Mörder Ed Socorro und Price McDaniels. Die beiden Schufte waren in Amarillo gesehen worden. Richter Humphrey hatte Joe Hawk und mich auf ihre Fährte gesetzt.
Jetzt befanden wir uns in dem ehemaligen Eisenbahncamp im Indianer-Territorium Oklahoma. Joe und ich ritten zum Mietstall. Im Wagen- und Abstellhof saßen wir ab. Wir führten unsere Pferde ins Stallinnere. Der Stallmann war ein Oldtimer mit einem wüsten Bartgeflecht im Gesicht und einem lückenhaften Gebiss. Auf unsere Frage, ob in den vergangenen Tagen zwei Reiter angekommen waren, sagte er mit galliger Stimme:
»Die beiden sind da. Es sind zwei ganz besonders üble Nummern. Sie gebärden sich, als würde die Stadt ihnen gehören. Sie haben einen Mann erschossen und einen anderen schwer verwundet. Es sind Strolche, die die Luft nicht wert sind, die sie atmen.«
»Sie bezeichnen das Camp als Stadt?«, gab ich mich erstaunt.
»Ja. Es zeichnen sich erste Ansätze ab, dass hier eine Stadt entsteht. Es gibt schon eine Reihe von Einrichtungen, die eine richtige Stadt ausmachen. Ihr werdet es sehen.«
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Terror am Sweetwater Creek
U.S. Marshal Bill Logan
Band 60
Western von Pete Hackett
U.S. Marshal Bill Logan – die neue Western-Romanserie von Bestseller-Autor Pete Hackett! Abgeschlossene Romane aus einer erbarmungslosen Zeit über einen einsamen Kämpfer für das Recht.
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war – eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author www.Haberl-Peter.de
© der Digitalausgabe 2013 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Zwischen engen Lidschlitzen beobachtete Warren McDuncan die beiden Reiter, die sich seiner Ranch näherten. Ihre Pferde gingen im Schritttempo. Die Hufe rissen kleine Staubfontänen in die klare Luft. Die Hände des Smallranchers umklammerten eine Winchester. Eine Kugel befand sich in der Patronenkammer. Das Gewehr war entsichert.
Die beiden Reiter kamen näher. Es waren Kerle mit tagealten Bärten in den Gesichtern, bekleidet mit langen Staubmänteln, auf den Köpfen breitrandige Hüte. Sie hatten sich Revolvergurte umgeschnallt. Diese Kerle gefielen Warren McDuncan nicht. Von ihnen ging etwas Raubtierhaftes aus.
»Das ist nah genug!«, rief McDuncan. Er nahm das Gewehr an die Hüfte. Sein Zeigefinger krümmte sich leicht um den Abzug.
Die Reiter fielen ihren Pferde in die Zügel. Düster musterten sie McDuncan. Die Atmosphäre mutete plötzlich gefährlich und unheilvoll an.
»Warum so feindselig?«, fragte einer der Reiter. Er war ein dunkler, indianerhafter Mann um die 30. Seine stahlblauen Augen blickten McDuncan forschend an. Sein Pferd trat auf der Stelle, peitschte mit dem Schweif und prustete. »Ich denke, in Texas wird Gastfreundschaft ziemlich groß geschrieben.« Er lächelte. Ein kräftiges Gebiss wurde sichtbar.
»Ihr seid fremd hier?«, fragte McDuncan. Er hörte hinter sich Schritte. Betsy trat neben ihn. McDuncans Frau war dunkelhaarig und sehr hübsch. Sie trug eine grüne Schürze. Die Haare hatte sie hochgesteckt.
»Ja, wir sind fremd«, versetzte der dunkelhaarige Reiter und musterte Betsy mit glitzernden Augen.
Betsy hatte das Gefühl, von einem Reptil angestarrt zu werden. Unwillkürlich zog sie die Schultern an, als fröstelte es sie.
Der andere der beiden Reiter war ebenfalls dunkelhaarig und sah ausgesprochen verwegen aus. Er trug den Hut tief in der Stirn, so dass die Augen im Schatten der Hutkrempe lagen. Von seinem Gesicht war nur der untere Teil zu erkennen. Er besaß einen dünnlippigen Mund und ein ausgeprägtes, kantiges Kinn.
»Wohin wollen Sie denn?«, fragte der Smallrancher. Er nahm das Gewehr nicht nach unten. Hoch loderte in ihm die Flamme des Misstrauens. Die Circle-M Ranch hatte in jüngster Zeit des Öfteren ihre Rinder auf McDuncans Weideland getrieben. Alles deutete darauf hin, dass es Ziel der Circle-M war, ihn zu zermürben und zur Aufgabe zu zwingen. Die Methoden, die die Ranches der Panhandle Cattle Company oftmals an den Tag legten, um unliebsame Nachbarn zu vertreiben, waren McDuncan bekannt.
Der Bursche, der bisher gesprochen hatte, schwang sich vom Pferd. Er war über sechs Fuß groß. Auch der andere saß ab. Jetzt konnte man sehen, dass sie die Revolver ziemlich tief geschnallt trugen. »Dürfen wir uns am Brunnen bedienen?«, fragte der indianerhafte Mann.
»Sie pochen auf Gastfreundschaft«, sagte McDuncan, »finden es aber nicht mal für nötig, sich vorzustellen.«
»Mein Name ist Swift Morgan. Das ist mein Freund Brad Sherman. Wir sind auf der Durchreise. – Eine schöne Ranch, die Sie da haben, Mister – äh ...« Herausfordernd musterte Morgan den Smallrancher.
»McDuncan. Warren McDuncan. Ja, es ist eine schöne Ranch. – Uns sind die Gesetze der Gastfreundschaft geläufig, Morgan. Haben Sie Hunger? Es gibt gleich Abendessen. Betsy kann Ihnen sicherlich ein paar Eier mit Speck braten. Wir haben frisches Brot ...«
»Sehr freundlich«, erwiderte Swift Morgan. Mit hintergründigem Blick maß er den Rancher. »Wir nehmen Ihr Angebot gerne an. Vorher aber wollen wir unsere Pferde versorgen.«
Männer, die zuerst an ihre Pferde und dann erst an sich selbst denken, dachte McDuncan, können nicht schlecht sein. Er senkte das Gewehr, nahm es in die Linke und hielt es am langen Arm.
Morgan und Sherman führten ihre Pferde zum Brunnen. Der Abendwind wirbelte den Staub im Hof hoch und trieb ihn vor sich her. Der Himmel im Westen hatte sich rot gefärbt. Die Schatten waren lang und blass. Das Flirren in der Luft hatte nachgelassen. Die Konturen der Dinge waren wieder scharf und klar.
Betsy wechselte mit ihrem Mann einen schnellen Blick, er nickte ihr zu, sie ging ins Haus zurück. Drin war die Stimme eines Kindes zu vernehmen. Ein kleiner Junge fragte, was das für Männer seien, die angekommen waren. Betsy erklärte ihm, dass es sich um Fremde handelte, die zum Abendessen bleiben würden.
Warren McDuncan konnte ihre Stimmen deutlich hören.
Seine beiden Cowboys befanden sich noch auf der Weide.
Die Winde beim Brunnen quietschte, als Morgan einen Eimer Wasser nach oben hievte. Er stellte ihn vor sein Pferd hin. Langsam schlenderte McDuncan näher. »In der Scheune finden Sie Hafer und Heu ...«
Swift Morgans Rechte war zum Revolver gezuckt. Sein Zug war eine fließende Bewegung von Hand, Arm und Schulter. Im Hochschwingen des Revolvers spannte er den Hahn.
McDuncan blieb stehen, als wäre er gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. Er war total überrumpelt. »Was ...« Seine Stimme versagte. Er schluckte würgend. Sein Blick sprang zwischen den beiden Kerlen hin und her. Der Schimmer des Begreifens lief über sein Gesicht. »Ihr kommt von der Circle-M, nicht wahr?«
»Das ist unwichtig, woher wir kommen«, versetzte Morgan kalt. »Lass das Gewehr fallen, Drei-Kühe-Rancher. Mach schon. Wir wollen uns ein wenig mit dir unterhalten. In einer Sprache, die du verstehst.«
Die Hand McDuncans öffnete sich, das Gewehr fiel in den Staub. McDuncans Schultern sackten nach unten, als läge plötzlich eine schwere Last auf ihnen. »Was wollt ihr?«
»Wir möchten dir klarmachen, dass hier am Sweetwater Creek kein Platz für dich und deinen Anhang mehr ist.«
Brad Sherman trat von hinten an McDuncan heran. Er nahm seinen rechten Arm am Handgelenk und drehte ihn auf den Rücken des Smallranchers. Ein gequälter Ton entrang sich McDuncan. Er machte das Kreuz hohl, um dem Druck in seinem Schultergelenk entgegenzuwirken.
Swift Morgan ließ den Revolver einmal um seinen Zeigefinger rotieren, entspannte ihn und versenkte ihn im Holster. Seine Bewegungen waren elegant und geschmeidig. Die Art, wie er mit dem Revolver hantierte, ließ erkennen, dass er ihn professionell handhabte.
Der Gunman trat vor McDuncan hin. »Das ist die letzte Warnung«, knurrte er, dann donnerte er McDuncan die Faust in den Magen. Dem Rancher wurde die Luft aus den Lungen gepresst. Ein Aufschrei entrang sich ihm, er wollte sich nach vorn krümmen, aber da spürte er stechenden Schmerz in der Schulter, weil ihm fast der nach hinten gedrehte Arm ausgekugelt wurde. Doch diesen Schmerz machte Morgans zweiter Schlag schnell vergessen. Seine Faust klatschte mitten in McDuncans Gesicht. Blut schoss aus seiner Nase, seine Lippe platzte auf, Blut rann über sein Kinn und tropfte auf seine Brust. Ein verlöschender Ton entrang sich ihm.
»Du hast 24 Stunden Zeit, zu verschwinden, McDuncan!«, stieß Morgan hervor. »Wenn du nach Ablauf des Ultimatums noch hier sein solltest, darfst du zwar auf deinem Land bleiben – allerdings einige Fuß unter der Erde.«
Und mit seinem letzten Wort rammte Morgen dem Rancher noch einmal die Faust in den Magen. McDuncan japste verzweifelt nach Luft. Seine Augen quollen aus den Höhlen. Ein Röcheln brach aus seiner Kehle. Der Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen.
Aber da erklang die scharfe Stimme Betsy McDuncans. Sie rief: »Lass meinen Mann los, du niederträchtiger Schuft.« Ein Gewehr wurde durchgeladen. Die Frau stand in der Tür des Ranchhauses und hielt eine Henry Rifle mit beiden Händen fest. Sie zielte mit dem Gewehr auf Brad Sherman, der nach wie vor den Arm McDuncans auf dem Rücken festhielt. Betsy nahm das Gewehr ein wenig höher und gab einen Schuss ab. Das Geschoss pfiff über die Köpfe der Banditen hinweg. Die Detonation prallte auseinander und verhallte.
»Hörst du schlecht?«, knirschte die Frau. In ihrem Gesicht zuckte kein Muskel. Ihre Augen blickten hart. Sie war entschlossen, sich durchzusetzen. Das brachte jeder Zug ihres Gesichts deutlich zum Ausdruck.
Sherman ließ McDuncans Arm los und versetzte dem Rancher einen leichten Stoß. Die Rechte Sherman legte sich auf den Knauf des Revolvers. Auch Morgans Hand tastete sich in die Nähe des Sechsschüssers.
McDuncan wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen. Blut besudelte seine Hand. Hass wob in seinen Augen und wütete in seinen Zügen. Er bückte sich nach seinem Gewehr, hob es auf und bewegte sich – rückwärtsgehend –, auf seine Frau zu. Er war dabei darauf bedacht, nicht in ihre Schusslinie zu geraten.
Dann stand er neben Betsy. »Verschwindet!«, gebot er mit brechendem Tonfall. »Setzt euch in Bewegung und haut ab. Ich zähle bis drei. Eins ...«
»Verschwinden wir«, kam es von Morgan. Er wollte zu seinem Pferd gehen.
»Ihr werdet laufen!«, presste McDuncan hervor. »Die Pferde bleiben hier.«
»He, verdammt, wir ...«
McDuncan schoss. Die Kugel pflügte zwischen Swift Morgans Füßen den Staub auf. Der Knall stieß über den Gunman hinweg und zerflatterte. Morgans Miene wurde verkniffen. »Wir werden dir dafür eine gesalzene Rechnung präsentieren ...«
»Wir werden auf der Hut sein. Bestelle Cole Wyler und seinem Vormann, dass ich von meinem Grund und Boden nicht weichen werde. Das Land gehört mir. Es ist im Landregister auf meinen Namen eingetragen. Ich bin nicht bereit, es der Circle-M zu überlassen.«
Sherman glaubte McDuncan und seine Frau abgelenkt. Er riss das Eisen aus dem Holster. Er war schnell – aber nicht schnell genug. Die Kugel McDuncans stoppte ihn. Der Treffer wirbelte ihn halb herum. Der Revolver entfiel seiner kraftlos werdenden Hand, er presste die Linke auf die zerschossene rechte Schulter. Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor. Rasselnd stieß er verbrauchte Atemluft aus seinen Lungen.
McDuncan repetierte sofort. Die Kartusche wurde ausgeworfen und versank im Staub.
Morgan wollte, als sich McDuncan seinem Gefährten zugewandt hatte, den Revolver ziehen. Aber da ertönte es schon scharf von Betsy: »Stopp! Oder willst du dir auch eine Kugel einhandeln?«
Morgan erstarrte mitten in der Bewegung. Stoßweise atmete er durch die Nase.
Das Echo des Schusses war über den Hügeln verebbt.
»Zieh vorsichtig den Revolver aus dem Holster und wirf ihn weg!«, befahl McDuncan.
Morgan zögerte. Doch schließlich kam er dem Befehl nach. »Wir kommen wieder«, grollte er drohend. »Und dann ...«
Den Rest ließ er offen. Er wandte sich Brad Sherman zu. »Gehen wir, Brad. Nimm dein Halstuch und presse es auf die Wunde. Du schaffst es ...« Er brach ab und wandte sich McDuncan zu. »In meiner Satteltasche befindet sich Verbandszeug. Kann ich ihn wenigstens verbinden?«
McDuncan nickte.
*
Jim Tucker hatte die Schüsse gehört. Er hatte das Pferd, das seinen Gefängniswagen zog, angehalten. Der einäugige Marshal lauschte dem Klang des letzten Schusses hinterher. Er saß auf dem Bock des Fuhrwerkes. Sein Reitpferd war hinten am Wagen angeleint. In dem Käfig – in Tuckers fahrbarem Gefängnis also –, befanden sich drei Kerle, denen die Verkommenheit in die Gesichter geschrieben stand. Sie saßen nebeneinander auf einer der Holzbänke an der Bohlenwand, Handschellen, die an der Wand befestigt waren, lagen um ihre Handgelenke. Es waren Banditen – Kerle der übelsten Sorte. Jim Tucker hatte die drei an der Grenze zum Indianerterritorium verhaftet. Auf sie wartete der Galgen ...
Die Namen der drei waren Dave Shaugnessy, Harvey Plummer und Austin Smith. Sie hatten in Borger die Wells Fargo Station überfallen und den Stationer ermordet. Ihre Beute betrug gerade mal 150 Dollar.
»Hüh!« Tucker ließ die lange Leine auf den Rücken des Gespannpferdes klatschen. Das Tier zog an, der Wagen begann zu rollen. Die Achsen quietschten in den Naben, da Staub sich mit dem Fett vermischt hatte. Die drei Banditen auf der Ladefläche wurden durch und durch geschüttelt.
Der rötliche Schein, der auf dem Land lag, verblasste. Von Osten her schob sich die Abenddämmerung ins Land. Die Schatten hatten sich aufgelöst. Der Tag floh vor der Nacht nach Westen.
Tucker erreichte den Sweetwater Creek. Im Ufergebüsch zwitscherten noch die Vögel. Der Widerschein der Sonne, der den Himmel im Westen wie Feuersglut färbte, spiegelte sich im Wasser und ließ es blutrot erscheinen.
Jim Tucker folgte dem Creek. Neben ihm lehnte am Wagenbock das Gewehr. Tucker verströmte Wachsamkeit. Sein gesundes Auge funkelte. Über dem linken Auge trug er eine schwarze Klappe, was ihm das Aussehen eines Piraten verlieh. Ein mächtiger, schwarzer Schnurrbart verdeckte seine Oberlippe.
Das Fuhrwerk holperte und rumpelte. Dann tauchten vor Tucker die Gebäude einer Ranch auf. Rauch stieg aus dem Schornstein. In einem Corral standen ein halbes Dutzend Pferde. Zwei Pferde, die unter den Sätteln standen, waren an einem Holm vor dem Haus festgebunden. Im Hof waren einige Hühner zu sehen. Sie pickten in den Staub ...
Tucker hielt nicht an. Schließlich lenkte er das Gespann zwischen zwei Schuppen hindurch und gelangte in den Ranchhof.
»Anhalten!«, schallte es ihm entgegen. »Wer sind Sie und was wollen Sie?«
Ein Mann stand in der Tür des Ranchhauses. Auch aus einem der Fenster wurde der Lauf eines Gewehres geschoben. Ein metallisches Knacken ertönte, als das Gewehr repetiert wurde.
Das war unmissverständlich.
Jim Tucker zügelte das Gespannpferd. Die Geräusche, die das Fuhrwerk verursachte, verstummten. Das Pferd trat auf der Stelle. Eine Gebisskette klirrte.
Tucker rief: »Ich bin U.S. Marshal Jim Tucker. Sind die Schüsse, die ich hörte, auf der Ranch gefallen?«
McDuncan trat zwei Schritte in den Hof. »Gib Acht, Betsy«, knurrte der Rancher. »Er trägt zwar einen Stern ...«
Das Symbol des Gesetzes, das an Jim Tuckers schwarzer Lederweste befestigt war, funkelte matt und war nicht zu übersehen.
»Wir hatten Besuch«, erklärte McDuncan mit lauter, rauer Stimme. »Zwei hartbeinige Hombres, die mir Cole Wyler schickte.«
McDuncan kam näher. Er ging zur Seite des Fuhrwerks, wo ein solides Eisengitter den Blick auf die drei Gefangenen drei gab. Sie erinnerten an gefangene Raubtiere.
»Cole Wyler ist der Boss der Circle-M«, sagte Tucker. »Weshalb schickte er Ihnen zwei Kerle?«
»Sie haben mir empfohlen, innerhalb von 24 Stunden das Land zu verlassen. Aber wir haben sie zum Teufel gejagt ...«
»Wer ist wir?«
»Meine Frau und ich. Meine beiden Cowboys sind noch nicht von der Weide zurückgekehrt. Einem der Kerle musste ich eine Kugel in die Schulter schießen.« McDuncan senkte das Gewehr. »Es ist in Ordnung, Marshal. Wenn Sie möchten, können Sie die Nacht gerne auf der Ranch verbringen.«
Tucker nickte und fuhr weiter. Vor dem Haupthaus hielt er an. Er schaute sich um. Es gab einen kleinen Anbau, in dem wahrscheinlich die Cowboys wohnten. Darüber hinaus waren ein Stall, eine Scheune und einige kleinere Schuppen zu sehen. In der Remise stand ein Farmwagen mit niedriger Bordwand.
McDuncan war neben dem Gespann hergegangen.
Betsy kam aus dem Haus. Sie hielt die Henry Rifle mit beiden Händen schräg vor ihrer Brust. Jim Tucker entging nicht der herbe Zug um den Mund der Frau. Er verriet ihm, dass sie schon eine Menge an Höhen und Tiefen durchgemacht hatte. Tucker stieg vom Bock und wies mit dem Kinn auf die beiden Pferde am Holm. »Sie haben die beiden Kerle zu Fuß zur Circle-M zurückgeschickt?«
McDuncan nickte. Er wirkte unglücklich. »Es sind Schnellschießer. Nach Ablauf des Ultimatums werden sie wiederkommen, und sie werden eine Reihe weiterer Kerle mitbringen. Jetzt kommt ihre Wut auf mich auch noch dazu.«
»Ich werde da sein«, sagte Jim Tucker. »Oder noch besser: Ich werde morgen früh zur Circle-M reiten und mit Cole Wyler ein paar Takte reden.«
»Er wird Worten nicht zugänglich sein«, verlieh der Smallrancher seiner Skepsis Ausdruck. »Er fühlt sich als ungekrönter König in diesem Landstrich. Sein Wort ist Gesetz. Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn.«
Mit wenigen Worten hatte er Cole Wyler charakterisiert.
Das war so. Der Panhandle Cattle Company gehörte fast das gesamte Weideland im texanischen Panhandle. Es gab zehn Haupt- und 19 Nebenranches. Die Ranchbosse fühlten sich in der Tat wie ungekrönte Könige. Sie schrieben ihre eigenen Gesetze und praktizierten sie ...
»Wir werden sehen«, murmelte Jim Tucker. Er machte sich daran, das Pferd vor dem Fuhrwerk auszuschirren. Betsy McDuncan kehrte ins Haus zurück. Der Rancher band das Pferd Jim Tuckers los und führte es zur Tränke. Als Jim Tucker das Gespannpferd zum Tränketrog brachte, führte McDuncan das Reitpferd in den Stall und in eine Box, nahm ihm Sattel und Zaumzeug ab, und stellte einen Eimer voll Hafer vor das Tier hin. In die Futterraufe stopfte er einen Armvoll Heu.
Schließlich waren die Tiere versorgt.
Tucker holte sein Gewehr vom Sattel und folgte dem Rancher ins Haus. Betsy hatte bereits den Tisch gedeckt. Bobby und Sylvie, die beiden Kinder des Rancherehepaares, musterten den großen, dunklen Mann neugierig. Es roch nach gebratenem Fleisch. Tucker sagte: »Ich brauche auch für meine Gefangenen etwas zu essen. Haben Sie einen übrigen Laib Brot, Mrs. McDuncan, und vielleicht etwas Butter? Ich werde natürlich alles bezahlen.«
»Ich schmiere einige Brote«, erbot sich die Frau.
Tucker und der Rancher setzten sich an den Tisch. Betsy machte sich daran, Brote zu schneiden und mit Butter zu bestreichen.
»Seit wann setzt Ihnen die Circle-M zu?«, fragte Tucker. Er holte sein Rauchzeug aus der Tasche und drehte sich eine Zigarette. Dann schob er den Tabakbeutel und das Papier McDuncan hin, der sich ebenfalls eine Zigarette rollte.
»Es begann vor etwa einem Monat«, berichtete McDuncan, als seine Zigarette brannte. »Da trieben die Cowboys der Circle-M Rinder auf mein Land. Eine große Herde. Als meine Männer und ich sie zurücktreiben wollten, kam es fast zu einer Schießerei. Einer meiner Reiter, John Marten, wurde in Wheeler von Circle-M-Leuten übel verprügelt. Sie empfahlen ihm, sich auf seinen Gaul zu schwingen und den Landstrich zu verlassen. Vor zwei Wochen schließlich liefen einige meiner Rinder auf Circle-M-Land. Sie wurden von den Circle-M-Cowboys abgeknallt. Dann kamen Laughton und einige Burschen auf die Ranch. Laughton meinte, das Weideland der Circle-M reiche nicht mehr aus. Er bot mir 5.000 Dollar für meine Ranch. Natürlich lehnte ich ab. Heute kamen nun die beiden Schufte hier an ...«
Draußen erklang Hufschlag. Ein Pferd wieherte hell. Tucker wollte sich schon erheben und nach seinem Gewehr greifen.
»Das sind Marten und Silver, meine beiden Cowboys«, gab McDuncan zu verstehen. Er erhob sich und ging nach draußen. Das Rot am Westhimmel war einem dunklen Violett gewichen. Die Natur begann ihre Farben zu verlieren. Die Düsternis war fortgeschritten. Überall zwischen den Hügeln woben jetzt die Schatten der Dämmerung. Die grauen Schleier schlugen in den Tälern und Senken zusammen.
Tucker hörte Stimmen.
»Seit wann sind Sie am Sweetwater Creek?«, fragte er die Frau.
»Seit knapp drei Jahren. Bisher hat uns die Circle-M in Ruhe gelassen. Der Terror begann vor einem Monat.«
Sie hatte einen Teller voller Brote geschmiert. Tucker erhob sich, nahm den Teller und verließ das Haus. Von McDuncan und den beiden Cowboys war nichts zu sehen. Sie befanden sich im Stall. Tucker schloss den Gefängniswagen auf, befreite bei jedem der Gefangenen eine Hand und stellte den Teller voller Brote auf den Boden. Dann holte er einen Eimer voll Wasser und die Schöpfkelle, die am Brunnen an einem Nagel hing.
Sie starrten ihn an wie Raubtiere, die sich auf ihr Opfer stürzten möchten. Ihre Augen glitzerten. Einer der Kerle schnappte:
»Noch sind wir nicht in Amarillo, Marshal. Und wir haben Freunde ...«
»Halt die Klappe!«, versetzte Tucker kurz angebunden. »Spar dir deinen Atem fürs Gehängtwerden.«
Der Bandit knirschte mit den Zähnen.
Tucker sah McDuncan und die beiden Cowboys aus dem Stall kommen. Sie schritten näher. »Was haben diese Kerle ausgefressen?«, fragte Wyatt Silver, ein hagerer Bursche mit faltigem Gesicht und grauen Haaren.
»Es sind Räuber und Mörder«, sagte Tucker.
McDuncan und seine Männer gingen weiter und verschwanden im Ranchhaus.
Tucker wartete, bis die Banditen gegessen hatten. Dann kettete er die Hand eines jeden wieder fest. Und dann verschloss er den Wagen und ging zurück ins Haus. McDuncan, seine beiden Kinder sowie die Cowboys aßen bereits. Betsy lud auf Tuckers Teller ein großes Stück gebratenes Fleisch und Kartoffeln ...
*
Joe Hawk und ich verfolgten zwei Banditen, die in Texas wegen Mordes steckbrieflich gesucht wurden. Sie waren in White Deer aufgetaucht und erkannt worden. Der Town Mayor schickte sofort einen Boten nach Amarillo, um das Bezirksgericht zu verständigen.
Die Namen der beiden Schufte waren Elton Hunter und Steve Osborne. Richter Humphrey schickte Joe Hawk und mich los, um die beiden Kerle hinter Schloss und Riegel zu bringen.
Es war Abend, als wir in White Deer ankamen. Wir ritten zunächst den Mietstall an. Der Stallbursche kannte uns von früheren Einsätzen in der kleinen Stadt.
Auf meine entsprechende Frage hin sagte er: »Die beiden Schufte haben heute Mittag die Town verlassen und sind weiter nach Osten geritten. Entweder ist ihr Ziel Pampa, oder sie wollen hinüber nach Wheeler. Von dort aus sind es nur noch wenige Meilen bis ins Indianerterritorium. Da den beiden in Texas der Boden ziemlich heiß geworden zu sein scheint unter den Fußsohlen, ist es möglich, dass sie sich ins Indianerland absetzen möchten.«
»Mist«, murmelte Joe. Er schaute mich an. »Was machen wir, Logan-Amigo? Reiten wir weiter oder blieben wir die Nacht über hier in White Deer?«
»Essen wir zunächst mal einen Happen«, erwiderte ich. »Und dann beratschlagen wir.«
Wir ließen die Pferde im Stall, damit sie versorgt wurden. Joe und ich gingen in den Saloon. Wir tranken ein Bier und aßen zu Abend, und wir kamen zu dem Entschluss, weiterzureiten. Bis Pampa waren es 12 Meilen. Die konnten wir, ohne die Pferde zu verausgaben, in zwei Stunden schaffen. Wenn sich Hunter und Osborne natürlich nicht nach Pampa gewandt hatten, würde es wohl wenig Sinn machen, ihnen noch in der Nacht nach Wheeler zu folgen. Bis zu dieser Stadt waren es von Pampa aus gut 45 Meilen. Aber auch die beiden Banditen mussten schlafen ...
Dunkelheit umgab uns. Das Sattelleder knarrte. Dumpf pochten die Hufe auf dem ausgefahrenen Reit- und Fahrweg, der von White Deer nach Pampa führte. Zu beiden Seiten der Straße wuchsen Büsche. Fledermäuse zogen ihre lautlosen Bahnen. Im Südosten hing die Mondsichel über den Hügeln. Sterne glitzerten. Ausgestorben anmutendes Land umgab uns. Ein kühler Nachtwind wehte ...
Als wir Pampa erreichten, ging es auf Mitternacht zu. In den meisten Häusern brannte kein Licht mehr. Der Saloon hatte noch geöffnet. Auch hier ritten wir zuerst zum Mietstall. Neben dem offen stehenden Tor hing eine Lampe, die einen gelben Lichtkreis in den Hof warf. Auch im Stall hing eine Laterne von einem Balken im Mittelgang, aber sie war weit heruntergedreht, blakte und verbreitete kaum Licht. Stallatmosphäre empfing uns; Pferdeausdünstung, der Geruch von Heu und Stroh, abgestandene Luft.
Wir führten die Pferde hinein. Der Stallbursche hatte sich schon zur Ruhe begeben; er ließ sich jedenfalls nicht blicken. Wir versorgten unsere Pferde selbst. Dann nahm ich die Lampe von dem Stützbalken, drehte sie höher und schritt an den Boxen entlang. Die Tiere, die hier standen, waren trocken und sauber. Es war nicht zu erkennen, ob zwei der Pferde bis vor wenigen Stunden scharf getrieben worden waren. Ich hängte die Laterne an den Nagel zurück, wir nahmen unsere Gewehre und gingen in den Saloon.
Verworrener Lärm empfing uns. Etwa zwei Dutzend Männer bevölkerten den Schankraum. Sie grölten und lachten und unterhielten sich. Als wir eintraten, verebbte der Lärm. Knarrend und quietschend schlugen hinter uns die Türflügel aus. Wir gingen zur Theke, legten die Gewehre darauf und schauten in die Runde.
Elton Hunter und Steve Osborne waren nicht hier.
Wir wurden angestarrt. Erwartungsvolle, fragende Blicke ...
»Sind vor vier oder fünf Stunden zwei Reiter in der Stadt angekommen?«, fragte Joe laut genug, so dass ihn jeder im Saloon hören konnte. Er holte die beiden Steckbriefe aus der Innentasche seiner Weste und faltete sie auseinander. »Ihre Namen sind Hunter und Osborne. Es sind steckbrieflich gesuchte Mörder.«
Joe gab die beiden Steckbriefe einem Mann, der gleich beim Tresen an einem Tisch saß. Der studierte die beiden Konterfeis, schüttelte den Kopf und gab die Steckbriefe an seinen Nachbarn weiter ...
Eine Viertelstunde später wussten wir, dass die beiden von uns gesuchten Banditen nicht nach Pampa geritten waren. Uns würde nichts anderes übrig bleiben, als am kommenden Tag nach Wheeler zu reiten. Wenn wir sie dort nicht einholten, waren sie uns entwischt. Ihrer Fährte ins Indianerland zu folgen war nahezu hoffnungslos. Irgendwo würde sich die Spur verlieren.
Wir mieteten im Saloon zwei Zimmer und tranken noch ein Bier, dann gingen wir schlafen. Wenn der Morgen graute, wollten wir aufbrechen ...
*
Tucker ritt am Morgen zur Circle-M Ranch. Seinen Gefängniswagen hatte er auf der McDuncan-Ranch zurückgelassen. Die Natur erwachte zum Leben. Die Sonne stieg über die Hügel im Osten und schickte ihre ersten wärmenden Strahlen ins Land. Die Circle-M lag am North Ford Red River. Der Marshal musste also nach Süden reiten. Schon eine Stunde, nachdem er die McDuncan-Ranch verlassen hatte, begegneten ihm erste Rinderrudel. Die Tiere trugen das Brandzeichen der Circle-M.
Tuckers Pferd ging im Schritt. Immer wieder ließ der Marshal seinen Blick in die Gegend schweifen; Hügel, Tafelberge, Mesen, weitläufige Senken und Bergsättel wechselten sich ab. Es gab Hickorybäume, Strauchwerk und fast hüfthohes, staubiges Gras. Den Staub brachte der Wind von Südwesten herauf, vom Llano Estacado.
Plötzlich stutzte Tucker. Über einen der Hügel trieb Hufschlag heran. Es waren mehrere Pferde, die scharf geritten wurden. Schnell wurde das Geräusch deutlicher, schließlich schlug das Getrappel wie eine Brandungswelle heran.
Und dann rissen auf dem Kamm des Hügels fünf Reiter ihre Pferde in den Stand. Sie hatten Tucker gesehen. Schlagartig brachen die Hufschläge ab.
Tucker hatte sein Pferd angehalten. Unruhig trat das Tier auf der Stelle. Mit hartem Griff bannte es der Marshal. Sekundenlang starrten die Reiter auf ihn herunter. Sie waren gekleidet wie Cowboys. Schließlich trieben sie ihre Pferde wieder an. Im Schritttempo ritten sie die Hügelflanke hinunter. Jim Tucker erwartete sie. Drei Pferdelängen vor ihm hielten sie an. Einer der Cowboys tippte an die Krempe seines Hutes. »Wohin des Weges, Marshal?«
»Zur Circle-M«, gab Tucker knapp Auskunft.
»Dann können wir ja gemeinsam reiten«, sagte der Mann. »Wir sind ebenfalls auf dem Weg dorthin. Wir kommen vom Sweetwater Creek.«
Tucker schwante etwas. Aber er behielt es noch für sich. Er nagte kurz an seiner Unterlippe, dann knurrte er: »Ich reite lieber alleine.«
Das Gesicht des Sprechers der Cowboys nahm einen verkniffenen Ausdruck an. »Wir sind dir wohl nicht gut genug, Einauge? Natürlich, in deinen Augen sind wir Kuhhirten. Du aber, der stolze Staatenreiter ...«
Tucker hatte sein Pferd herumgezogen und kitzelte es mit den Sporen. Er war kein Mann großer Worte. Man konnte ihn eher als wortkarg bezeichnen. Auf eine Debatte mit dem Weidereiter wollte er sich bei Gott nicht einlassen.
Das Pferd ging an.
»Verdammt!«, knirschte der Weidereiter und ritt neben Tucker. »Ich hasse arrogante Kerle wie dich. Für wen hältst du dich?«
»Ihr kommt von der McDuncan-Weide, nicht wahr?«, stieß Tucker hervor. Er hatte den Kopf gewandt und schaute den Weidereiter an. Zugleich zügelte er sein Pferd.
Auch der Cowboy hielt an. Die anderen Männer trieben ihre Pferde näher. Hämisches Gegrinse zog ihre Münder in die Breite. In ihren Augen glitzerte eine wilde Vorfreude.
Die Männer der PCC waren den Marshals des Distriktgerichts nicht besonders wohl gesonnen. Schon viel zu oft waren ihnen die Gesetzeshüter empfindlich auf die Zehen getreten. Meistens waren es Übergriffe gegen Siedler und Kleinrancher, die die Staatenreiter auf den Plan riefen. Die Marshals hatten in der Vergangenheit rigoros und kompromisslos durchgegriffen ...
»Und wenn es so wäre?«
»Dann rate ich euch, eure Rinder ganz schnell wieder vom Land McDuncans zu treiben. Er hat Anzeige bei mir erstattet. Was ihr treibt, ist Landfriedensbruch.«
Tucker zeigte sich furchtlos und unerschrocken. Er war der härteste Mann, den Richter Humphrey beschäftigte. Der Marshal ahnte, dass die Kerle nicht vorhatten, ihn ungeschoren zu lassen. Sie waren auf Streit aus. Das war deutlich.
»Du scheinst mir ja ein ganz besonders Schlauer zu sein«, knurrte der Cowboy. »Einer, der sich viel zu große Stiefel angezogen hat. An den Grenzen des Circle-M-Weidelandes stehen Hinweisschilder, die zum Ausdruck bringen, dass es Unbefugten verboten ist, das Land zu betreten. Kannst du nicht lesen, Marshal? Oder hast du den Hinweis einfach ignoriert?«
»Der Stern verleiht mir die Befugnis, Amigo«, dehnte Tucker. »Du solltest das akzeptieren.«
»Auf deinen Stern spucken wir ...« Der Cowboys riss sein Pferd herum und trieb es an. Er hatte vor, das Pferd mit dem Marshal zu rammen. Aber Tucker zerrte seinen Vierbeiner zurück und ließ ihn steigen. Als die vorderen Hufe des Tieres am Boden aufschlugen, hielt Tucker den Sechsschüsser in der Faust. Er zielte auf den Cowboy, der jetzt sein Pferd in den Stand zerrte und um die linke Hand zog.
Die Hände der anderen Weidereiter zuckten zu den Revolvern, aber ihr Verstand holte diesen Reflex ein. Irgendetwas ging plötzlich von dem Einäugigen aus, das sie warnte. War es die Ruhe, die Tucker trotz der angespannten und gefährlichen Atmosphäre verströmte? Oder war es lediglich der Revolver in seiner Faust? Keiner wusste es zu sagen. Die Kerle griffen jedenfalls nicht nach den Revolvern.
»Werft die Revolver weg und dann runter von den Pferden!«, gebot Tucker. »Und versucht es lieber nicht. Ich will keinen von euch verletzen oder töten. Wenn ihr mich aber zwingt ...«
Der Bursche, auf den Tucker zielte, griff nach vorsichtig nach dem Revolver, zog ihn aus dem Holster und ließ ihn fallen. Scheinbar wusste er, wann eine Sache verloren war. Die Mündung des Colts in Tuckers Faust starrte ihn an wie das hohle Auge eines Totenschädels. So schnell wie eben den Marshal hatte der Cowboy noch nie einen Mann den Revolver ziehen sehen. Sein Übermut und seine Häme verwandelten sich in Respekt.
Auch die anderen vier Weidereiter warfen die Revolver ins Gras. Dann saßen sie ab.
»Und jetzt Marsch!«, knurrte Tucker. »Ein kleiner Fußmarsch wird eure überhitzten Gemüter ein wenig abkühlen. Eure Pferde und Revolver nehme ich mit zur Circle-M. Adelante, Amigos. Schwingt die Hufe.«
Einer spuckte aus. Dann setzten sie sich in Bewegung. Sie erkannten, dass Worte in den Wind gesprochen gewesen wären. Dieser Marshal war hart wie Granit.
Tucker wartete, bis sie an die 100 Yards entfernt waren, dann holsterte er seinen Sechsschüsser, saß ab und sammelte die Revolver auf, verstaute sie in den Satteltaschen der Pferde, band die Tiere mit den langen Zügeln zusammen und schwang sich wieder aufs Pferd. Eines der Tiere an der Longe führte er das kleine Pferderudel davon.
Er überholte die Kerle. Einer drohte mit der erhobenen Faust. Jim Tucker ließ es kalt. Sie hatten es herausgefordert, und nun mussten sie die Konsequenzen tragen. Es war eine ganz einfache Rechnung ...
*
Joe und ich brachen auf, als der Tag anbrach. Pampa schlief noch. Wir holten unsere Pferde aus dem Mietstall und ritten nach Osten. Die Nacht floh nach Westen. Im Osten war der Himmel schwefelgelb. Südlich der Stadt hingen Nebelbänke über dem North Fork Red River.
Unser Ziel war Wheeler. 45 Meilen durch menschenfeindliche Wildnis, in der nur Coyoten und Klapperschlangen ihr Unwesen trieben. Wir veranschlagten acht Stunden. Etwas über fünf Meilen die Stunde, das bedeutete, dass wir unsere Pferde schonen wollten. Rechter Hand buckelten die Hügel und Felsen, die das Bett des North Fork säumten.
Wir ritten schweigsam. Jeder war in seine Gedanken versunken. Dass uns die beiden Banditen erwarteten, mussten wir nicht befürchten, denn sie wussten nicht, dass wir ihnen folgten. Dennoch waren wir wachsam. Immer wieder ließ ich meinen Blick in die Umgebung schweifen. Es war nicht nur ein schönes und wildes Land, es war auch ein gefährliches Land. Der Tod war allgegenwärtig ...
Wir waren etwa drei Stunden geritten. Am seidenblauen Himmel zogen einige schwarze Punkte lautlose Bahnen. Joe machte mich darauf aufmerksam. Wir parierten die Pferde. Es waren Aasgeier. An der Stelle, über der sie schwebten, musste ein Kadaver liegen. Hatten sich die beiden Banditen ein Stück Wild geschossen und es ausgeweidet?
Wir trieben die Pferde wieder an. Der Weg führte einen Hügel hinauf. Eine weitläufige Senke schloss sich an. Wir ritten in sie hinein. Am Ende dieser Senke sahen wir am Boden weitere Aasgeier. Und dann konnten wir erkennen, was sie angezogen hatte. Es war ein totes Pferd.
Die hässlichen Vögel drehten die nackten Krägen und blickten uns mit glitzernden Augen entgegen. Zwei stritten sich flügelschlagend um ein Stück Beute. Ihr Krächzen erfüllte die Luft. Sie flatterten davon, als wir uns ihnen näherten. Eine schwarze Wolke von Fliegen, angelockt vom süßlichen Blutgeruch, hing über dem Tierkadaver. Es trug ein Brandzeichen, das ich nicht kannte. Sattel und Zaumzeug fehlten.
»Ich denke«, sagte Joe, »dass Hunter und Osborne nur noch ein Pferd haben. Das bedeutet, dass sie nur noch langsam vorwärts kommen.«
Dieser Meinung war ich auch. Das Tier hatte sich wahrscheinlich ein Bein gebrochen und musste getötet werden. Das Blut war schon eingetrocknet, was mir sagte, dass die beiden Banditen immer noch vier oder fünf Stunden Vorsprung hatten.
Eine Fährte zog sich durch das verstaubte Gras nach Osten. Ich konnte sie sehen, bis sie über der Kuppe eines Hügels verschwand. »Reiten wir weiter«, sagte ich.
Von dem Hügel aus hatten wir einen weiten Ausblick. Wie ein dunkler Strich zog sich die Spur durch das hohe Gras ...
Die Sonne stieg höher. Die Hitze nahm zu. Aber sie war erträglich. Dann hatte sie ihren höchsten Stand erreicht. Die heißeste Zeit des Tages war angebrochen. Ein heißer Wind wehte von Süden. Wir ritten unverdrossen weiter. Ich schätzte, dass wir etwa 30 Meilen zurückgelegt hatten. An einem schmalen Creek, der irgendwo weiter südlich in den North Fork mündete, tränken wir die Pferde. Die Spuren verrieten uns, dass hier auch die beiden Banditen ihr Pferd getränkt hatten.
Eine weitere Stunde später lag eine kleine Ranch vor uns. Alles wirkte grau in grau. Es gab ein niedriges Wohnhaus, einen Stall, eine Scheune, einige Schuppen. In einem Corral standen ein halbes Dutzend Pferde.
Wir ritten hin.
Im Hof lag ein Mann auf dem Gesicht. Neben ihm – halb im Staub versunken –, lag das Gewehr. Mein Mund trocknete aus. Joe presste die Lippen zusammen. Wir wechselten einen vielsagenden Blick. »Diese niederträchtigen Schufte«, entrang es sich meinem Freund und Partner.
Eine Tür knarrte. Es war die Tür eines Schuppens, die der Wind bewegte. Ich saß ab und ging zu der reglosen Gestalt hin, drehte sie auf den Rücken und blickte in die gebrochenen Augen des Mannes. Er hatte die Kugel in die Brust bekommen.
Die Haustür stand offen. Ich richtete mich auf. Joe schwang sich vom Pferd. »Wahrscheinlich haben sich die beiden Halunken auf der Ranch ein Pferd besorgt«, konstatierte Joe.
Ich nickte. »Und bezahlt haben sie mit heißem Blei.«
Ich schritt zur Tür. Sie führte direkt in die Küche des Ranchhauses. Ich ging zur nächsten Tür, die in einen Nebenraum führte, öffnete sie und stand im Schlafzimmer. Auf dem Bett lag eine halbnackte Frau. Sie war um die 35 Jahre alt. Und sie war tot. Das Gesicht war noch im letzten Entsetzen ihres Lebens verzerrt. Auch sie blutete aus einer Wunde in der Brust. Eine unsichtbare Hand würgte mich. Das Blut wollte mir gefrieren. Mein Herz schlug höher.
Ich machte kehrt. Der Anblick war unerträglich.
Joe kam in die Küche. Ich deutete mit dem Daumen über die Schulter und sagte mit belegter Stimme: »Die Frau ... Sie haben sie vergewaltigt und ermordet. Es sind Bestien.«
Joe schluckte. »Wir müssen sie begraben«, murmelte er. Er sprach heiser und abgehackt, was mir seine Fassungslosigkeit verriet. Joe fuhr sich mit der flachen Hand über die Augen, als wollte er einen bösen Traum verscheuchen. »Großer Gott ...«, entrang es sich ihm schließlich. Er machte kehrt und ging hinaus.
Auch ich war erschüttert. Hunter und Osborne waren schlimmer als wilde Tiere. Sie waren böse Geschwüre im Angesicht der Erde. Ich schwor, nicht zu ruhen, bis sie zur Rechenschaft gezogen waren.
In einem der Schuppen fand ich Werkzeug, mit dem Joe und ich ein Grab ausheben konnten. Das warf uns zurück. Die Banditen hatten wieder zwei Pferde, vielleicht sogar vier, so dass sie wechseln konnten. Über unsere Gesichter rann der Schweiß. Mein Hemd klebte an mir wie eine zweite Haut. Unter der sengenden Sonne ein Doppelgrab auszuheben war eine Arbeit, die an die Substanz ging. Der Boden war hart und ausgedörrt.
Nun, wir schafften es. Eine Stunde später zeugte nur noch ein flacher Hügel davon, dass hier das Rancherehepaar seine letzte Ruhe gefunden hatte. Ob die Ranch Cowboys beschäftigte, wussten wir nicht. Ich ließ die Pferde aus dem Corral. Joe holte die Milchkuh aus dem Stall. Wir mussten die Tiere sich selbst überlassen ...
Ich trug Hass im Herzen. Unauslöschlichen, grenzenlosen Hass, der sich gegen die beiden Mörder richtete, die skrupellos vergewaltigt und gemordet hatten. Ein Hass, der keine Zugeständnisse, kein Verständnis und keine Versöhnung kannte. Ich wollte die beiden hängen sehen ...
*
Jim Tucker erreichte die Circle-M Ranch. Es war eine große Ranch mit einem einstöckigen Haupthaus, einem lang gezogenen Bunkhouse, mehreren Ställen, Scheunen und Schuppen, einer Remise, in der einige Fuhrwerke standen, einer Schmiede, aus deren Esse Rauch stieg, und vier Corrals, in denen sich wohl insgesamt an die 150 Pferde tummelten.
Einige Ranchhelfer waren bei der Arbeit, bei einem der Corrals sah der Marshal einige Cowboys, die Pferde aussortierten.
Jim Tucker verhielt vor dem Haupthaus. Aus einem Anbau kam ein großer Mann mit dunklen Haaren. Er trug eine schwarze Hose und ein blaues Hemd.
Tucker schwang das rechte Bein über das Sattelhorn und ließ sich aus dem Sattel gleiten. Die lange Leine, mit der er eines der Pferde geführt hatte, schlang er lose um den Holm, der da stand. Die Zügel seines Pferdes hingen auf den Boden.
Der Marshal wandte sich dem Mann zu. »Ich will zu Mr. Wyler«, gab er zu verstehen.
»Ich bin sein Vertreter«, sagte der Bursche. »Mein Name ist Laughton.«
»Aaah, Sie sind der Vormann der Circle-M. Gut. Was es zu sagen gibt, kann ich auch Ihnen sagen. Ich komme von der McDuncan-Ranch. Sie haben McDuncan ein Ultimatum gesetzt, das heute Abend abläuft. Mit welchem Recht versuchen Sie, McDuncan von seinem Land zu vertreiben?«
Tucker redete nicht lange um den heißen Brei herum. Er nannte das Kind beim Namen ...
Laughton musterte die Pferde, die Tucker mit sich geführt hatte, von denen eines an das andere gebunden war. »Die Tiere gehören zur Ranch«, murmelte der Vormann. »Woher haben Sie sie?«
»Fünf Hitzköpfe wollten mich ein wenig zurechtstutzen. In den Satteltaschen befinden sich ihre Revolver. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie auf der Ranch ankommen.«
Laughton befeuchtete sich mit der Zungenspitze die Lippe. »Wie kommen Sie darauf, dass die Circle-M McDuncan vertreiben will?«
»Sie terrorisieren McDuncan seit etwa einem Monat. Eine Circle-M-Herde wurde auf sein Land getrieben. Seine Rinder, die sich auf Circle-M-Land verlaufen hatten, wurden erschossen. Gestern Abend waren zwei Kerle auf der McDuncan-Ranch, die McDuncan aufforderten, bis heute Abend verschwunden zu sein. Und die fünf Kerle, denen ich die Pferde weg nahm, kamen auch von der McDuncan-Weide.«
Aus dem Bunkhouse traten zwei Männer. Sie trugen die Revolver tief geschnallt. Einer von ihnen hielt die Schultern ein wenig schief. Tucker sah sie und stufte sie als Schnellschießer ein. McDuncan hatte berichtet, dass er einem der Kerle, die bei ihm waren, eine Kugel in die Schulter geschossen hatte. Bei dem Burschen, der die Schultern schief hielt, handelte es sich wahrscheinlich um den Verwundeten.
Sie starrten zu Tucker herüber.
»Ich weiß nichts von zwei Kerlen, die McDuncan ein Ultimatum setzten«, ließ Laughton vernehmen. »Dass wir einige von McDuncans Rindern erschossen haben, ist richtig. Sie kamen immer wieder auf Circle-M-Land, und die Ranch braucht das Gras für ihre eigenen Rinder.«
»Was ist mit der Herde, die Sie auf McDuncans Land treiben ließen?«
»Keine Ahnung. Die Rinder müssen sich verlaufen haben. – Sie haben den Weg hierher umsonst gemacht, Marshal. Von Seiten der Circle-M gibt es keine Bestrebungen, um McDuncan von seinem Land zu verjagen. Das bildet sich dieser Narr nur ein.«
»Sie wissen jedenfalls Bescheid, Laughton. Ich warne Sie. Lassen Sie die McDuncans in Ruhe. Sie haben das Land am Sweetwater Creek ordnungsgemäß erworben. Das Recht steht auf McDuncans Seite.«
»Sie drohen mir ...?«
»Ich habe Sie gewarnt. Hände weg von den McDuncans. Ich werde mich persönlich um sie kümmern.«
Die beiden Männer starrten sich an. Es war ein stummes Duell. Laughton unterlag. Sein Blick irrte ab. Er sagte: »Stecken Sie sich Ihre Warnung an den Hut, Marshal. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Vielleicht leidet McDuncan an Verfolgungswahn.«
Tucker hatte sich abgewandt und ging zu seinem Pferd. Er saß auf und angelte nach den Zügeln. Er hatte alles gesagt. Der Vormann der Circle-M wusste Bescheid. Damit sah Tucker seine Mission als beendet an.
Er zog das Pferd um die linke Hand und trieb es an ...
Swift Morgan und Brad Sherman näherten sich dem Vormann, der Tucker hinterher blickte. »Was wollte der Kerl?«, fragte Morgan.
»Er kam von McDuncan. Der Drei-Kühe-Rancher hat uns angezeigt. Dieser Marshal spuckte ziemlich große Töne.«
»Soll ich ihn herunterholen von seinem hohen Ross?«, fragte Morgan. »Dann könnte ich auch gleich McDuncan zeigen, wie wir mit Leuten umgehen, die uns gegen den Karren fahren möchten.«
Laughton nickte. »Ja. Der Marshal könnte Ärger machen. Und was McDuncan betrifft – nun, er hat es herausgefordert.«
Morgan ging in den Stall. Sherman kehrte ins Bunkhouse zurück. Laughton verschwand im Haupthaus der Ranch, um Cole Wyler Bericht zu erstatten. Ein Help kam herbei und führte die fünf Pferde in einen der Ställe, um sie zu versorgen.
Zehn Minuten später verließ Swift Morgan die Ranch. Er ritt eine Grulla-Stute. Das Tier trabte. Der Revolvermann ritt auf der Fährte Jim Tuckers ...
Eine Viertelstunde später hatte er den Marshal eingeholt. Er sah ihn in die Kerbe zwischen zwei Hügeln reiten. Wenig später verschwand Tucker hinter einigen hohen Büschen aus Morgans Blickfeld. Der Killer ritt um den Hügel herum, überholte hinter den Anhöhen den Marshal und legte sich auf die Lauer. Sein Pferd hatte er hinter einem der Hügel zurückgelassen und an den Ast eines Strauches geleint.
Über Kimme und Korn beobachtete das kalte Auge Morgans den Marshal, dessen Pferd Schritttempo ging. Jim Tucker war arglos. Er achtete zwar auf seine Umgebung, rechnete aber nicht mit einem Hinterhalt.
Der Schuss peitschte. Der Knall stieß über Tucker hinweg. Er spürte den Einschlag in seine Brust und stürzte vom Pferd. Hart schlug er am Boden auf, dann schien sich absolute Finsternis auf ihn herunter zu senken, die ihn verschlang.
Vor Morgans Gesicht zerflatterte Pulverdampf. Er wartete noch kurze Zeit. Der Marshal rührte sich nicht mehr. Das Pferd des Marshal senkte seine Nase über die reglose Gestalt und peitschte mit dem Schweif. Plötzlich warf das Tier den Kopf in den Nacken und wieherte hell.
Im Gesicht Morgans zuckte kein Muskel. Seine abgestumpfte Seele kannte kein Mitgefühl. Das Leben eines Menschen war ihm gerade mal den Preis für eine Kugel wert.
Der Revolvermann lief um den Hügel herum zu seinem Pferd, stieß die Winchester in den Scabbard, leinte das Tier los und saß auf. Er ritt zu Jim Tucker hin. Der Marshal lag auf der Seite und hatte die Augen geschlossen. »Farewell, Marshal«, knurrte Morgan ohne die Spur einer Gemütsregung. »In der Hölle sehen wir uns eines Tages vielleicht wieder.«
Dann zog er sein Pferd herum und ritt nach Norden ...
*
Es ging auf Mittag zu, als Swift Morgan die McDuncan-Ranch erreichte. Vom Kamm eines Hügels aus beobachtete Morgan die Ranch. Er befand sich im Schutz dichter Büsche. Schon bald kam er zu dem Schluss, dass sich auf der Ranch nur Betsy McDuncan und die beiden Kinder befanden.
Im Ranchhof stand ein Fuhrwerk, das an einen Raubtierkäfig erinnerte. Morgan entging nicht, dass sich drei Männer in dem fahrbaren Gefängnis befanden.
Morgan ritt von hinten an die Ranch heran. Bei einem Buschgürtel stellte er sein Pferd ab, leinte es an, nahm das Gewehr und ging die letzten Schritte zu Fuß. Er schlich um das Ranchhaus herum, schob sich dicht an der Wand an die Tür heran, öffnete sie und stieß sie auf. Seine Gestalt verdunkelte das Türrechteck.
Betsy, die am Herd stand, war herumgewirbelt. Ein erschreckter Aufschrei erstickte im Ansatz. Sie presste die linke Hand auf ihren Halsansatz, als könnte sie so ihren fliegenden Atem beruhigen.
Die beiden Kinder saßen am Boden und spielten mit hölzernen Bauklötzen, die ihnen Warren McDuncan von einem dünnen Balken abgesägt hatte.
»Was wollen Sie?«, entfuhr es Betsy, als sie ihre Sprache wiedergefunden hatte. Sie hatte den Besucher erkannt. Die Angst schnürte ihr den Hals zu. In ihrem Gesicht zuckten die Nerven.
»Wo ist dein Mann?«
»Auf – auf der Weide. Zusammen mit John und Wyatt. Sie – sie bränden Mavericks.«
»Auf welcher Weide?«
Ein Ruck durchfuhr Betsy. »Warum wollen Sie das wissen?«
Morgan glitt an sie heran. Sein Atem schlug ihr ins Gesicht, als er hervorstieß: »Keine Fragen, Lady. Sag mir, wo ich deinen Mann finde.«
»Das werde ich nicht ...«
Die linke Hand des Banditen zuckte hoch, verkrallte sich in Betsys Haaren, er bog ihr den Kopf in den Nacken. Betsy schrie gequält und zugleich entsetzt auf. Ihr Mund stand halb offen. Sylvie McDuncan, die sechsjährige Tochter Betsys, hatte sich erhoben und lief zu ihrer Mutter, klammerte sich an sie. Morgan packte das Kind an der Schulter und schleuderte es zur Seite. Sylvie stürzte und begann zu weinen.
»Wo?«, presste Morgan hervor.
»Auf – auf der Ostweide ...« Betsy hatte der brutalen Gewalt des Banditen nichts entgegenzusetzen.
Er beugte sich über sie und küsste sie. Dann ließ er ihre Haare los. »Du bist eine hübsche Frau«, sagte er und grinste niederträchtig. In seinen Augen glomm die Habgier. »Vielleicht komme ich wieder. Und dann ...«
Er schwang herum und verließ das Ranchhaus. Draußen ging er zu dem Gefängniswagen. »Was seid ihr für drei? Was habt ihr ausgefressen?«
»Einiges«, versetzte Dave Shaugnessy grinsend. »Wir könnten dir in aller Ruhe alles erzählen, wenn du uns befreien würdest.«
Tucker ging in einen der Schuppen und fand eine Hacke, mit der er das Schloss des rollenden Gefängnisses aufsprengte. Dann ging er ins Haus und ließ sich von Betsy eine Haarnadel geben, die er zurechtbog. Es gelang ihm, damit die Handschellen der drei Banditen aufzuschließen.
Aus dem Haus war noch immer das Weinen des Mädchens zu hören. Betsy sprach beruhigend auf das Kind ein. Sie hatte eine Waffe im Haus. Aber sie wagte nicht, sie zu nehmen. Ihr war klar, dass der Revolvermann, der sie gegen ihren Willen geküsst hatte, vor nichts zurückschreckte. Sein Kuss schien noch auf ihren Lippen zu brennen. Betsy fühlte sich gedemütigt und beschmutzt.
»Nehmt euch Pferde«, sagte Swift Morgan, »und reitet nach Süden. Da stoßt ihr auf die Circle-M. Jesse Laughton, der Vormann, gibt euch sicher einen Job. In nächster Zeit wird es – schätze ich – in der Gegend ziemlich rauchig. Es geht darum, einige unliebsame Zeitgenossen vom Sweetwater Creek zu verjagen.«
»Was ist mit dem Marshal?«, fragte Harvey Plummer. »Er wird kommen und unserer Spur folgen ...«
»Ihr fürchtet doch nicht eine einzelne Figur?«, fragte Morgan spöttisch. »Dann solltet ihr nicht zu Circle-M reiten. Denn dann seid ihr nicht die richtigen Männer für die Jobs, den Laughton zu vergeben hat.«
»Dieser Einäugige ist wie eine Ladung Dynamit«, entgegnete Austin Smith, ein rattenhafter Bursche mit vorstehenden Zähnen. »Er hat uns aussehen lassen wie blutige Anfänger.«
»Keine Sorge«, murmelte Morgan. »Der Marshal schmort bereits in der Hölle. Ihn braucht ihr nicht mehr zu fürchten.«
»Hast du ihn ...«
»Ja.«
Morgan ging am Haus vorbei und holte sein Pferd. Als er zurückkehrte, hatten die drei Banditen für sich Pferde aus der Koppel geholt. Da sie nirgendwo einen Sattel finden konnten, ritten sie die Tiere sattellos. Während die Pferde sie nach Süden trugen, wies die Nase des Tieres, das Morgan ritt, nach Osten.
Er musste über einen Seitenarm des Sweetwater Creek. Das Wasser ging dem Pferd gerade bis zu den Sprunggelenken. Es spritzte unter den stampfenden Hufen. Im Ufergebüsch summten Bienen und Hummeln. Am Himmel trieben einige weiße Wolken. Der Schweißgeruch von Pferd und Reiter zog Stechmücken an. Ab und zu begegneten Morgan kleine Rinderrudel, die den WM-Brand trugen. Warren McDuncan ...
Und dann sah Morgan weit vor sich in einer Senke Rauch. Er stieg in die Höhe und wurde vom schwachen Wind zerpflückt. Eine Herde Longhorns stand in dem Kessel, der von Hügeln begrenzt wurde.
Drei Männer waren bei der Arbeit. Soeben brachte einer von ihnen ein Kalb zum Feuer. Dort wurde es zu Boden geworfen. Warren McDuncan zog das Brandeisen aus der Glut ...
Morgen hielt im Einschnitt zwischen zwei Hügeln an. Muhen und Brüllen hing über der Senke. Horn klapperte gegeneinander. Unruhiges Gewoge ging durch die Herde. Der Geruch von verbranntem Fell wurde vom Wind herangetragen. Jetzt ließ der Bandit das Pferd wieder angehen. Er trieb es nach links den Abhang hinauf. Das Tier musste die Hinterbeine gegen das Zurückgleiten stemmen. Dann waren Pferd und Reiter oben. Hier gab es genügend Buschwerk, das den Banditen deckte. Er saß ab und zog das Gewehr aus dem Sattelschuh. Dann ging er neben einem Strauch auf das linke Knie nieder, lud die Winchester durch und hob sie an seine Schulter.
Morgan zielte sorgfältig. Dann zog er durch. Eine Kugel pfiff über die Herde hinweg, begleitet vom Peitschen der Detonation. Das Geschoss riss Warren McDuncan von den Beinen.
Und dann jagte Morgan Schuss um Schuss in die Herde hinein. Tiere brachen zusammen. Die Unruhe steigerte sich. Die dunklen Leiber der Rinder schienen ineinander zu fließen. Ein Stier brüllte. Und plötzlich setzte sich die Herde in Bewegung. Die vorderen Tiere begannen zu laufen. Morgan jagte weiterhin Kugel um Kugel aus dem Lauf. Und plötzlich war die Stampede perfekt. Die Herde rannte nach Norden, alles niederwalzend, was unter ihre Hufe geriet. Rinder gingen in dem Strom aus Tierleibern unter und wurden in Grund und Boden gestampft.
Morgan hatte die letzte Kugel aus dem Lauf gejagt. Er erhob sich und lief zu seinem Pferd, versenkte die Winchester im Scabbard und schwang sich in den Sattel.
Im gestreckten Galopp stob er nach Südwesten ...
*
Jim Tucker kam zu sich. Die Sonne brannte auf ihn hernieder. Zunächst begriff er gar nichts. Der erste Eindruck, den er aufnahm, war das Pferd, das ihn mit der Nase anstieß. Doch dann kam die Erinnerung. Da war der Knall, dann der heftige Schlag gegen die Brust ...
Der Marshal begriff, dass er aus dem Hinterhalt beschossen worden war. Und jetzt spürte er auch den ziehenden Schmerz in seiner Brust. Er setzte sich auf, der Schmerz in seiner Brust explodierte. Ihm wurde es schwindlig, Benommenheit brandete gegen sein Bewusstsein an, sekundenlang schien sich die Welt um ihn herum zu drehen wie ein Karussell.
Die Kugel war ihm in die rechte Brustseite gefahren. Er ächzte. Seine Mundhöhle war trocken wie Wüstensand. Das Schlucken bereitete ihm Mühe. Aber sein Verstand begann wieder klar und scharf zu arbeiten. Der Marshal zog die Beine an, drückte sich mit den Armen hoch und kam auf alle Viere zu liegen. Sein Atem rasselte. Er konzentrierte sich. Es kostete ihn Überwindung und alle Willenskraft, sich zu erheben. Schwankend stand er schließlich. Er nahm die Wasserflasche vom Sattel, schraubte sie auf und trank einen Schluck. Das Pferd schnaubte. Der Marshal sah seinen Stetson am Boden liegen. Er wagte nicht, sich danach zu bücken, denn er befürchtete, das Gleichgewicht zu verlieren, erneut zu stürzen und nicht mehr hochzukommen.
Tucker verschraubte die Flasche und hängte sie an den Sattel zurück. Das Wasser hatte ihn etwas belebt, wenn es auch abgestanden und ein wenig brackig schmeckte. Er griff nach dem Sattelhorn und stellte sein linkes Bein in den Steigbügel. Unter Einsatz seiner letzten Kräfte gelang es ihm, aufs Pferd zu klettern. Eine Welle der Benommenheit überschwemmte ihn, als er saß.
Der Marshal hielt sich eisern im Sattel. Er ritt nach vorne gekrümmt. Seine Augen waren vom Schweiß entzündet und brannten. Die Schwäche kroch wie flüssiges Blei durch seinen Körper. Immer wieder kam die Benommenheit wie eine graue, alles verschlingende Flut. Mit jedem Tropfen Blut, der aus der Wunde trat, nahm die Schwäche zu. Ein milchiger Schleier legte sich über seine Augen, seine Lider wurden schwer wie Blei. Doch schon in der nächsten Sekunde gewann der Überlebenswille die Oberhand und erfüllte den schwer angeschlagenen Körper mit neuer Kraft.
Irgendwann erreichte Jim Tucker die McDuncan-Ranch. Im Ranchhof verlor er die Kontrolle über seinen Körper. Er kippte seitlich vom Pferd. Staub schlug auseinander, als er am Boden aufprallte. Aber er verlor nicht die Besinnung. Über sich sah er den blauen Himmel und die weißen Wolken.
Über Tucker erschien ein Gesicht. Es war das Gesicht einer Frau – Betsy McDuncans Gesicht. Auf dem Grund ihrer Augen wob das Entsetzen. »Mein Gott ...«, entrang es sich ihr.
»Es – es war ein Hinterhalt«, röchelte der Marshal. Er sprach mit matter Stimme, als kostete ihm jedes Wort übermenschliche Anstrengung. Er selbst vernahm seine Stimme wie aus weiter Ferne. »Geben Sie mir Wasser«, bat er dann.
Die Frau hielt ihm die Wasserflasche an die Lippen. Er schluckte mechanisch. Wasser rann aus seinen Mundwinkeln und über sein Kinn.
»Helfen Sie mir«, murmelte Tucker. »Ich – ich kann hier nicht liegen bleiben. Sie müssen mich verbinden ...«
Mit Unterstützung der Frau kam er auf die Beine. Seine Knie waren weich wie Butter. Schwer stützte er sich auf Betsy, als sie ihn ins Haus führte. Unter der Tür standen die beiden Kinder. Jetzt wichen sie ins Haus zurück.
Plötzlich verließ Jim Tucker die Kraft. Er brach auf die Knie nieder, willenlos kippte er vornüber. Seine Finger verkrallten sich im Fußboden. Nichts in seinem Körper schien mehr zu funktionieren. Die Signale, die sein Gehirn aussandte, blieben unbeantwortet. Er lag mit dem Gesicht nach unten und stemmte sich verbissen gegen die Nebel, die auf ihn zuzukriechen schienen. Sein letzter Eindruck war, in einem pechschwarzen, bodenlosen Schacht zu stürzen.
Betsy packte ihn unter den Achseln und schleppte ihn ins Schlafzimmer. Unter Aufbietung all ihrer Kräfte wuchtete sie den schweren Mann aufs Bett. Dann zog sie ihm Weste und Hemd aus. Seine ganze Brust war blutverschmiert. Sie machte Wasser warm und wusch ihm das Blut ab. Betsy war klar, dass die Kugel in Tuckers Brust steckte und heraus musste. Sie wand aus einem Stück Verbandmull einen Pfropfen, den sie in die Wunde schob. Und dann verband sie Tucker.
Und während sie das alles tat, verzehrte sie die Sorge um ihren Mann. Der Gedanke daran, dass der Revolvermann zur Ostweide geritten war, um Warren zu töten, ließ sie nicht mehr los. Und sie begann es zu bereuen, Warren noch bestärkt zu haben in seinem Entschluss, der Übermacht der Circle-M Ranch nicht zu weichen.
Sie konnte nichts tun. In ihrer Seele war die Qual der Hilflosen. Aber dann entschloss sie sich. Jeder Zug ihres Gesichts verriet ihre Entschiedenheit. Sie befahl den beiden Kindern, im Haus zu bleiben und auf den Mann zu achten, der ohnmächtig im Bett lag. »Wenn er aufwacht, Bobby«, trug sie dem Jungen auf, »dann gib ihm etwas zu trinken und sage ihm, dass ich nach Wheeler geritten bin, um den Doc zu holen.«
Der Junge war alt genug, um sie zu verstehen. Er nickte.
Dann ging Betsy hinaus, stieg auf Tuckers Pferd und ritt an.
Die Sonne stand schon weit im Westen. Die Luft flirrte in der Hitze. Die Konturen verschwammen. Betsy war keine geschickte Reiterin. Bald schon schmerzte ihr der Rücken. Aber ein nahezu dämonischer Wille ließ sie durchhalten. Mit jedem Schritt, den das Pferd machte, näherte sie sich der Stadt ...
*
Es war um die Mitte des Nachmittags, als Joe und ich Wheeler erreichten. Zunächst ritten wir zum Mietstall. Der Stallmann kam uns auf dem Mittelgang entgegen. Er war ein bärtiger Hombre, dessen Kiefer unablässig mahlten. Schließlich spuckte er einen Priem zur Seite aus und sagte: »Ich sehe, ihr tragt Sterne. Jagt ihr die beiden Kerle, die vor drei Stunden hier ankamen? Einer ritt ein Pferd mit dem Wilson-Brand. Frank Wilson hat ihm das Tier sicher nicht freiwillig gegeben.«
»Besitzt Frank Wilson weiter westlich eine kleine Ranch?«, fragte Joe.
Der Stallmann nickte. »Ja, er bewirtschaftet sie zusammen mit seiner Frau. Fleißige Leute, die Wilsons. Kath Wilson verrichtet die Arbeit eines Cowboys.«
»Die beiden sind tot«, sagte ich. »Die Kerle, von denen Sie sprachen, haben sie ermordet. Wo finden wir sie?«
»Vermutlich im Saloon. Vielleicht aber auch im Hotel. – Ich habe es gleich gewusst, dass mit den beiden Strolchen etwas nicht stimmt. Allmächtiger, Frank und Kath Wilson sind tot! Man sollte die beiden Mörder ohne viel Federlesens an den nächsten Baum hängen.«
»Daraus wird wohl nichts«, sagte ich und zog meine Winchester aus dem Scabbard. »Die Zeiten der Salbeibusch-Justiz sind vorbei.«
»War nur so dahergeredet«, meinte der Stallmann.
Wir überließen ihm unsere Pferde. Joe zog ebenfalls sein Gewehr aus dem Sattelschuh und repetierte es. Dann verließen wir den Stall. Wir wussten Bescheid. Der Saloon war ein ganzes Stück die Straße hinunter errichtet worden. Es war ein eingeschossiger Bau mit zwei großen Frontfenstern und einem großen Vorbau. Das Vorbaudach war eingezäunt und man konnte es begehen wie einen ausladenden Balkon. Die Tragebalken waren kunstvoll geschnitzt.
»Nimm du den Hintereingang, Logan-Amigo«, sagte Joe. »Ich warte eine Minute. Das dürfte reichen. Dann gehe ich hinein.«
»All right«, versetzte ich und überquerte in schräger Linie die breite, staubige Main Street. Hier und dort sah ich Passanten auf den Gehsteigen. Ein Fuhrwerk rollte die Straße herauf. In einer Gassenmündung spielten Kinder. Im Schatten unter dem Vorbau des Saloons lag ein großer, schwarzer Hund. Irgendwo war eine keifende Frauenstimme zu hören. Eine Tür flog krachend zu ...
Abgesehen davon vermittelte die Stadt Frieden und Beschaulichkeit. Aber mit den beiden Banditen waren Hass und Tod in sie gekommen. Mich mutete es an wie die Ruhe vor dem Sturm.
Uns stand ein Kampf auf Leben und Tod bevor. Das ahnte ich. Ich glaubte nicht daran, dass die beiden Mörder aufgeben würden, und spürte leichte Beklemmung. Einen Augenblick dachte ich an Jane, meine Geliebte, die am Mulberry Creek eine kleine Pferderanch betrieb. Wieso sie mir ausgerechnet jetzt in den Sinn kam, entzog sich meinem Verstand. War es die hintergründige Angst, sie vielleicht niemals wiederzusehen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gelang es mir, die Gedanken an sie zu verdrängen und mich auf das, was uns bevorstand, zu konzentrieren.
Der Saloon stand frei. Ich ging um ihn herum und erreichte die Rückseite. Der Hof war mit einem Bretterzaun begrenzt. Es gab einen Stall und ein windschiefes Toilettenhäuschen. Der Geruch von Chlorkalk hing in der Luft.
Dann betrat ich – angespannt bis in die letzte Körperfaser – den Saloon durch die Hintertür.
Durch die Vordertür kam Joe in den Schankraum. Die Türpendel schlugen hinter ihm aus.
Ein halbes Dutzend Männer bevölkerten den Saloon. Zwei standen an der Theke, vier saßen an insgesamt zwei Tischen. Die beiden Banditen waren nicht unter ihnen. Neugierige, erwartungsvolle Blicke trafen uns. Wir wurden eingeschätzt. Einer der Männer sagte: »Ihr habt hier sicher die beiden Kerle gesucht, die heute in die Stadt gekommen sind. Die beiden haben sich im Hotel Zimmer gemietet und schlafen wahrscheinlich.«
Wir verließen den Saloon. Das Hotel lag schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Als wir den Vorbau überquerten, sah ich das Gewehr, das aus einem Fenster des Hotels auf uns deutete. Ich versetzte Joe einen harten Stoß, er taumelte zur Seite, ich warf mich nach links. Da peitschte auch schon der Schuss. Die Kugel durchschlug eines der Frontfenster des Saloons ...
Ich feuerte im Liegen auf das Fenster. Repetieren, abdrücken, repetieren ... Ich schoss in rasender Folge.
Joe sprang unter meinem Feuerschutz auf und rannte über die Straße. Zwischen den Häusern waren große Lücken. Auf den leeren Grundstücken wuchs hüfthoch das Unkraut. Joe rannte am Straßenrand entlang und erreichte das Hotel.
Ich schnellte hoch und hetzte ebenfalls über die Straße. Einige Male peitschte das Gewehr meines Gegners, aber ich rannte Zickzack und so traf mich keines der Geschosse.
Joe war schon im Hotel verschwunden.
Auch ich befand mich jetzt im toten Winkel zu dem Schützen und folgte Joe zum Hotel. In der Hotelhalle donnerten Schüsse. Ich drückte die Tür mit meinem Körper auf. Am Fuß der Treppe lag ein Mann. Joe war hinter einem der Sessel in Deckung gegangen, die um einen runden Tisch herum gruppiert waren. Er schaute die Treppe hinauf.
Ich lief zur Rezeption und kniete daneben ab. Auch mein Blick war die Treppe hinauf gerichtet.
»Das ist Hunter«, sagte Joe. »Er stand oben auf der Treppe, als ich in die Halle kam. Ich konnte ihn überraschen ...«
»Dann haben wir es also noch mit Steve Osborne zu tun«, stellte ich fest. »Gib Obacht, Joe. Ich versuche die Treppe hinauf zu gelangen.«
Joe nickte.
Ich lief los, erreichte die Treppe, stieg über Hunter hinweg und rannte sie hinauf. Oben schmiegte ich mich hart an die Wand, lugte um die Ecke. Leer lag der Flur vor mir. Ein halbes Dutzend Türen zweigten auf beiden Seiten ab. Sie führten in die Zimmer. Hinter einer der Türen auf der rechten Seite befand sich Osborne. Ich erreichte die erste der Türen und versuchte sie zu öffnen. Sie war verschlossen. Kurzerhand hielt ich die Mündung des Gewehres gegen das Schloss und drückte ab. Die Tür sprang auf. Ich wartete zwei Atemzüge lang, dann wirbelte ich um den Türstock. Das Gewehr hielt ich an der Seite. Die Mündung beschrieb einen Halbkreis.
Da war niemand.
Ich äugte hinaus auf den Flur. Dann huschte ich zur nächsten Tür. Auch sie war verschlossen. Und auch sie sprang auf, als ich eine Kugel in das Schloss jagte. Doch jetzt krachte es in dem Zimmer. Zwei – drei Kugeln durchschlugen das Türblatt. In den verebbenden Schussdonner hinein erklang eine raue Stimme: »Komm nur herein, Sternschlepper, komm nur und hole mich.«
»Du solltest aufgeben, Osborne«, rief ich. »Aus dem Hotel kommst du nicht mehr hinaus.«
»Lieber aufrecht in den Stiefeln sterben als mit einem Hanfstrick um den Hals!«, versetzte Osborne. »Also komm schon. Vielleicht legt mich dein Gefährte um. Aber du wirst vor mir in die Hölle fahren.«
Ich versetzte dem Türblatt einen Stoß. Es schwang nach innen auf. Sofort krachten wieder Schüsse. Die Detonationen drohten das Gebäude in seinen Fundamenten zu erschüttern. Die Kugeln schlugen in die der Tür gegenüberliegende Wand und meißelten faustgroße Löcher in den Verputz. Das Gewehr in die linke Hand wechselnd zog ich mit der Rechten den Remington und stieß mich ab. Ich sprang auf die andere Seite der Tür. Sofort eröffnete Osborne wieder das Feuer. Er stand an der Wand neben dem Fenster. Das hatte ich, als ich vorbeisprang, sehen können. Ich drehte mich herum und ging auf das rechte Knie nieder, lehnte das Gewehr gegen die Wand, nahm meinen Hut ab, legte ihn neben mir auf den Boden und lugte um den Türstock. Osborne sah es und senkte das Gewehr, um das Ziel aufzunehmen. Aber da schoss ich schon mit dem Revolver.
Osborne wurde von der Wucht des Treffers gegen die Wand geschleudert. Seine Hände öffneten sich, das Gewehr fiel auf den Boden. Und dann brach Osborne zusammen.
Ich erhob mich. Den Remington im Anschlag betrat ich das Zimmer.
Von Steve Osborne aber ging keine Gefahr mehr aus. Er saß am Boden, sein Kinn war auf die Brust gesunken, ein Gurgeln drang aus seiner Kehle. Ich nahm das Gewehr vom Boden auf und warf es auf das Bett, dann zog ich Osborne den Revolver aus dem Holster und ließ ihn dem Gewehr folgen. Osborne hatte die Kugel in die Brust bekommen.
Joe betrat das Zimmer. »Alles klar?«
»Yeah. Ich habe ihn erwischt. Sieht nicht gut aus.«
»Hunter ist tot«, erklärte Joe.