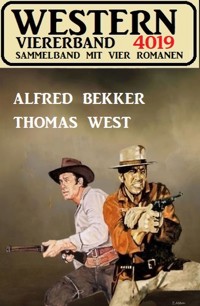
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Western: (499XE) Alfred Bekker: Entscheidung in Nogales Alfred Bekker/Thomas West: Grainger und die Squaw Alfred Bekker: Nelsons Rache Alfred Bekker: Wölfe in der einsamen Geisterstadt Die Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg... Im Grenzgebiet zwischen Mexico und den Vereinigten Staaten treiben beiderseits der Grenze Guerilla-Banden herum. Die Freiheitskämpfer des Benito Juarez ebenso wie diejenigen, die das Ende der Konföderierten nicht wahrhaben und weiterkämpfen wollen - und beide Seiten sind mit gewöhnlichen Banditen durchsetzt. Zwei Männer werden zu Town Tamern: Kane, ein gesuchter Mörder, und Macondo der Apache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West, Alfred Bekker
Western Viererband 4019
Inhaltsverzeichnis
Western Viererband 4019
Copyright
ENTSCHEIDUNG IN NOGALES
Grainger und die Squaw
Nelsons Rache
Wölfe in der einsamen Geisterstadt
Western Viererband 4019
Alfred Bekker, Thomas West
Dieser Band enthält folgende Western:
Alfred Bekker: Entscheidung in Nogales
Alfred Bekker/Thomas West: Grainger und die Squaw
Alfred Bekker: Nelsons Rache
Alfred Bekker: Wölfe in der einsamen Geisterstadt
Die Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg... Im Grenzgebiet zwischen Mexico und den Vereinigten Staaten treiben beiderseits der Grenze Guerilla-Banden herum. Die Freiheitskämpfer des Benito Juarez ebenso wie diejenigen, die das Ende der Konföderierten nicht wahrhaben und weiterkämpfen wollen - und beide Seiten sind mit gewöhnlichen Banditen durchsetzt. Zwei Männer werden zu Town Tamern: Kane, ein gesuchter Mörder, und Macondo der Apache.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
ENTSCHEIDUNG IN NOGALES
von Alfred Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 46 Taschenbuchseiten.
Die Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg... Im Grenzgebiet zwischen Mexico und den Vereinigten Staaten treiben beiderseits der Grenze Guerilla-Banden herum. Die Freiheitskämpfer des Benito Juarez ebenso wie diejenigen, die das Ende der Konföderierten nicht wahrhaben und weiterkämpfen wollen - und beide Seiten sind mit gewöhnlichen Banditen durchsetzt. Zwei Männer werden zu Town Tamern: Kane, ein gesuchter Mörder, und Macondo der Apache.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch
© by Author
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
1
Schüsse peitschten dicht neben Jeff Kane in den trockenen, aufgesprungenen Boden. Eine Fontäne aus Sand wurde empor geschleudert. Die Kugeln schlugen in den steinigen, völlig verdorrten Boden ein.
Kane griff zum Revolver.
Blitzschnell.
Er warf sich zur Seite, rollte um die eigene Achse über den Boden und riss mit einer fließenden, katzenhaften Bewegung den Revolver aus dem Holster.
Kaum einen Lidschlag brauchte er dafür.
Kane spannte den Hahn.
Hinter dem ausgetretenen Lagerfeuer hob sich eine hoch aufragende schlanke Gestalt gegen das Sonnenlicht als dunkler Schatten ab.
Blauschwarzes Haar, das von einem Stirnband zusammengehalten wurde, wehte in dem aufkommenden brandheißen Wind, der aus Südosten über die ausgedörrte, von schroffen Felsbrocken und vertrockneten Baumgruppen unterbrochene Hochebene wehte.
Um die Hüfte trug der Indianer einen Revolvergurt, an dem sich auch eine Schlaufe befand, in der ein Tomahawk steckte sowie die Kunstvoll verzierte Lederscheide eines Bowie-Messers.
Kanes Haltung entspannte sich.
Der harte, entschlossene Zug um die Mundwinkel verschwand und machte einem dünnen Lächeln Platz.
„Ach du bist es, Macondo“, atmete er auf.
Der sippenlose Apache hatte sich seit Kanes Aufbruch aus Magdalena an seiner Seite befunden. Gemeinsam hatten sie das nördliche Mexiko durchstreift und waren dabei so gut es ging jedem anderen ausgewichen.
Macondo senkte den Lauf seines Sharps Gewehrs.
„Sorry, ich habe dich nicht kommen hören.“
„Dann muss etwas mit deinen Ohren nicht stimmen, Laredo Kid.“
„Wieso?“
„Weil ich bei meiner Rückkehr zum Lager keineswegs versucht habe, besonders leise zu sein.“
Der Apache untertrieb natürlich. Kane hatte schon mitbekommen, wie vollkommen lautlos sich der Apache zu bewegen vermochte.
Zweifellos musste er in seiner Zeit bei der Army ein guter Scout gewesen sein.
So verschieden die beiden Männer auch sein mochten: Immerhin das hatten sie gemeinsam. Beide hatten sie während des Bürgerkrieges in der Armee der Union gedient, wofür der blaue und seiner Rangabzeichen beraubte Militärmantel, den Kane hinten auf seinem Sattel festzuschnallen pflegte, ein Zeugnis war.
Kane erhob sich und steckte seinen Revolver ein.
Macondo deutete unterdessen dort hin, wo sein Schuss den Boden aufgesprengt hatte.
Ein zusammen geringelter regloser Schlangenkörper lag dort.
„Ich rette dir das Leben und du versuchst mich zum Dank dafür umzubringen, Laredo Kid“, stellte der Apache trocken und mit regungslosem Gesicht fest.
„Soll nicht wieder vorkommen“, versprach Kane grinsend.
Er erhob sich und begann damit, seine Sachen zusammenzupacken und den Lagerplatz aufzuräumen.
„Ich habe Spuren gesehen“, berichtete Macondo. „Viele Pferde, viele Reiter. Die Hufe waren beschlagen und sie ritten in Kolonne.“
„Soldaten?“
„Ja.“
„Franzosen?“
„Würde ich vermuten. Die Mexikanischen Kavalleristen reiten nicht so exakt in der Kolonne.“
In Mexiko herrschte derzeit Krieg.
Kaiser Maximilian regierte in der Hauptstadt unter dem Schutz französischer Interventionstruppen, während sich unter Führung des früheren Präsidenten Benito Juarez eine Rebellenbewegung gebildet hatte, die durch die Vereinigten Staaten unterstützt wurde.
Die Lage war entsprechend unübersichtlich. Teile des Landes waren schlicht in Anarchie versunken und es war schwer abzuschätzen, auf welcher Seite die jeweiligen lokalen Amtsträger standen.
Hinzu kam, dass manche, die sich plötzlich als Rebellen ausgaben, in Wahrheit Banditen waren, die ihren Schutzgeldern jetzt einfach nur einen anderen Namen gegeben hatten und sie als Revolutionssteuer bezeichneten.
„Ich schlage vor, den Franzosen gehen wir besser aus dem Weg“, meinte Kane. „Die verdächtigen doch wahrscheinlich jeden Nordamerikaner als Unterstützer der Rebellen!“
„Die Rebellen sind aber auch mit Vorsicht zu genießen“, erwiderte Macondo. „Einige dieser Banden, die sich jetzt Juaristas bestehen doch nur aus Männern, die das Chaos genutzt haben, um aus den Gefängnissen zu entfliehen.“
„Sicher – es klingt viel besser, wenn man von sich sagen kann, dass man ein Revolutionär ist anstatt ein Bandit“, stimmte Kane zu.
Sie sattelten die Pferde. Kane steckte eine seiner beiden Winchester-Gewehre in den Scabbard genannten Sattelschuh aus Leder. Das zweite Gewehr schnallte er zusammen mit der Decke und dem Militärmantel hinten auf den Sattel.
Einen halben Tag ritten sie, bis sie eine Wasserstelle erreichten, wo sie die Flaschen auffüllen und die Tiere tränken konnten.
Der Hufschlag eines Pferdes ließ die beiden Männer auffahren.
Ein Reiter kam über eine Hügelkette und preschte im Galopp auf die Wasserstelle zu. Er zog eine Staubwolke hinter sich her.
Dann zügelte er sein Pferd.
Er war vollkommen unpassend für das heiße Klima gekleidet. Wie ein Stutzer!, dachte Kane.
Er trug einen dreiteiligen dunklen Anzug. Um den Hals hatte er eine sorgfältig gebundene Schleife.
Auf dem Kopf saß ein melonenförmiger Bowler-Hut, der vielleicht in die schattigen Straßen von New York, Boston oder irgendeiner anderen Großstadt an der Ostküste passte.
Aber nicht hier her.
Nicht in diesen Glutofen.
Jemand der so daherkam, nannte man im Westen häufig einen Dude – ein anders Wort für Trottel.
Zögernd näherte sich der Anzugträger. Sein Gesicht war krebsrot verbrannt.
Der Mann war bewaffnet. Aus dem Scabbard am Sattel ragte ein Gewehrkolben.
Außerdem beulte sich seine Jacke unter der Achsel.
Kane vermutete, dass er dort einen Revolver im Schulterholster trug. Als der Wind die Jacke etwas zur Seite wehte, bestätigte sich dieser Verdacht.
Er legte zwei Finger an die Krempe seines Bowler-Huts und grüßte.
„Tag, Gentlemen.“
„Sie haben Ihr Tier ziemlich scharf geritten. Noch ein paar Stunden länger in dem Galopp und Sie haben es zu Schanden geritten.“
„Leider bin ich sehr in Eile.“
„Wohin wollen Sie denn?“
„Nach Nogales zur Grenze.“
Er stieg ab und führte seinen Gaul zum Wasser. Das Tier war so erschöpft, dass es nicht einmal angesichts des Wassers unruhig wurde, obwohl es vollkommen ausgedörrt sein musste.
Der Anzugträger musterte zuerst Kane eingehend und wandte dann den Blick in Macondos Richtung. Eine Falte erschien zwischen seinen Augen, als er den Indianer einer eingehenden Begutachtung unterzog.
„Mein Name ist Smith“, sagte er. „Und wer Sind Sie?“
„Nenne Sie mich Laredo Kid“, sagte Kane. Smith – ein Name, so gewöhnlich, dass Kane ihn kaum für echt halten konnte. Aber im Grunde genommen interessiertes ihn auch nicht, ob sein Gegenüber unter falschem Namen reiste. Wie ein typischer Bandit sah er nicht aus. Und er wirkte auch nicht wie einer der ewig gestrigen Südstaaten-Guerillas, die das Chaos im Grenzland für ihre Zwecke nutzten. Männer, die davon träumten, den Bürgerkrieg doch noch weiterführen zu können, auch wenn es die Konföderierten Staaten von Amerika längst nicht mehr gab.
Dieser Reiter wirkte eher wie ein Geschäftsmann, den irgendein ungnädiges Schicksal von der New Yorker Stock Exchange oder den Hafenkontoren von San Francisco in diese Wüste verschlagen hatte.
„Ich komme aus Hermosillo“, sagte Smith. „Geschäfte, Sie verstehen?“
„Sie sind uns keine Rechenschaft schuldig“, sagte Kane. „So wie wir umgekehrt Ihnen auch nicht.“
„Natürlich. Es ist nur so…“
Er brach ab.
Kane hob die Augenbrauen.
„Ja?“
„Es sind unruhige Zeiten. Sie sind Amerikaner.“
„Das ist richtig.“
„Und Landsleute sollten zusammenhalten, finde ich. Also schlage ich vor… Sie wollen doch auch Richtung Norden.“
„Ehrlich gesagt…“
„Sie sollten sehen, dass Sie zurück über die Grenze kommen“, sagte Smith eindringlich. Er löste die Schlaufe um seinen Hals und außerdem den Hemdkragen. Der Schweiß perlte ihm nur so von der Stirn, aber das war angesichts der Tatsache, dass zu seinem Anzug auch eine Weste gehörte, die er zugeknöpft ließ, überhaupt kein Wunder. „Im Süden müssen Sie damit rechnen, überall auf Franzosen zu treffen und die sehen in Ihnen einen möglichen Unterstützer der Juaristas. Zimperlich sind die nicht in Ihrer Vorgehensweise, kann ich Ihnen sagen. Die haben ihre besonderen Methoden, jemanden auszuquetschen. Und je unbeliebter Kaiser Maximilian bei der Bevölkerung wird, desto größer ist der Druck, den die Interventionstruppen ausüben müssen.“
Kane wandte sich an Macondo. „Sollen wir ihn mit uns reiten lassen?“, fragte er.
Smith runzelte die Stirn.
Er schien im ersten Moment etwas irritiert zu sein.
„Sie fragen einen Roten danach, ob ein Landsmann Sie begleiten darf?“ Smith schüttelte den Kopf. „Ich muss schon sagen, das ist sehr merkwürdig.“
Die Verachtung, die er dem Apachen entgegenbrachte war nicht zu übersehen.
Macondo ließ das unberührt.
„Drei Gewehre sind besser als zwei“, sagte der Apache. „Und die Spuren der Kolonne waren ganz in der Nähe…“
Kane nickte leicht. Aber er hatte Zweifel.
Also fragte er: „Was waren das für Geschäfte, die Sie in Hermosillo erledigt haben?“
„Sir, ich weiß nicht, ob das hier wirklich der geeignete Ort für eine Plauderei über solche Dinge ist“, meinte er. „Ich verkaufe alles, was sich zu Geld machen lässt. Rinder, Land…“
„Auch Waffen?“, hakte Kane nach. Das war der Punkt, auf den er hinauswollte.
Smith verengte die Augen.
Kane fuhrt fort: „Ich habe keine Lust, mich Ihrer Geschäfte mit den Juaristas wegen zur Zielscheibe der Franzosen zu machen!“
„Nein“, sagte Smith. „Das einzige, was ich hoffe ist, dass dieser Krieg möglichst schnell wieder vorbei ist und die Regierung in Mexico City nicht auf die Idee kommt, Peso-Noten nach belieben zu drucken, um die Versorgung der Interventionstruppen bezahlen zu können!“
Kane lächelte dünn.
„Okay“, stimmte er zu. „Dann reiten wir zusammen.“
„Gut.“
„Unter einer Bedingung.“
„Welcher?“
„Sie werden nicht das Tempo bestimmen. Ich möchte von meinem Gaul noch etwas länger etwas haben, wenn Sie verstehen, was ich damit sagen will!“
2
Sie setzten den Weg Richtung Norden fort. Kane war dich noch nicht schlüssig darüber, ob der die Grenze tatsächlich überschreiten sollte. Aber Nogales war in jedem Fall ein gutes Ziel. Es gab eine Stadt auf der Arizona-Seite der Grenze, die diesen Namen trug und eine mexikanische Stadt gleichen Namens. Dass sich die Truppen des französischen Interventionsheers auch bereits so weit im Norden breit gemacht hatten, war nicht anzunehmen.
Die drei Reiter gelangten in die Nähe der Stadt Cassita.
Von einer Anhöhe beobachteten sie im Dämmerlicht einen Trupp von mindestens fünfzig französischen Kavalleristen, die am Stadtrand kampierten.
„Du hast dich nicht getäuscht“, stellte Kane an Macondo gerichtet fest.
Der Ort Cassita bestand nur aus wenigen Häusern und einer Kirche. Unterkunft konnten so viele Soldaten dort nicht erwarten. Sie kampieren daher im Freien.
Kane, Macondo und Smith ritten in einem weiten Bogen um Cassita herum, um den Truppen aus dem Weg zu gehen.
Die Dunkelheit brach herein, aber um einen größeren Abstand zu den in Cassita lagernden Truppen zu bekommen, ritten sie mehr als die halbe Nacht weiterer. Der klare Sternenhimmel ermöglichte die Orientierung.
Es war lange nach Mitternacht, als sie schließlich doch für eine Weile Rast machten – den Pferden zu liebe.
Auf ein Feuer verzichteten sie.
Noch vor Sonnenaufgang ritten sie weite Richtung Norden.
Gegen Mittag des folgenden Tages erreichten sie ein ausgetrocknetes Flussbett.
Vergeblich suchten sie nach Wasser, aber sie hofften auf welches zu stoßen, wenn sie dem Flussbett folgten.
Sie fanden schließlich nur einen versalzenen Tümpel.
Dennoch - das Land, in das sie jetzt kamen, war deutlich fruchtbarer als die Wüste, die sie bisher durchquert hatten. Allerdings war ein Großteil der Vegetation vertrocknet.
Der Erschöpfung ihrer Pferde schuldeten sie schließlich eine Pause bei einer Gruppe halbverdorrter Bäume. In einen von ihnen musste mal der Blitz gefahren sein, denn er war in der Mitte gespalten.
„Wir werden beobachtet“, sagte Macondo plötzlich.
„Wer ist es?“, fragte Kane. „Indianer?“
„Nein, die wären geschickter.“
„Was schlägst du vor?“
„Wir reiten ruhig weiter.“
Kane wandte sich an den Mann, der sich Smith genannt hatte. „Sie haben uns nicht zufällig noch irgendetwas zu sagen?“
„Nein, Sir. Ich habe nichts verbrochen. Wir sind hier in einem Gebiet, das von Juaristas beherrscht wird. Ich würde mir nicht allzu viele Sorgen machen.“
Kane musterte ihn.
Gegenüber der Furcht, die er noch am Vortag überdeutlich gezeigt hatte, wirkte er jetzt sehr gelassen.
Er setzte noch hinzu: „Aber wenn Sie sich jetzt von mir trennen wollen, werde ich Sie nicht aufhalten.“
„Seltsam – gestern legten Sie noch großen Wert auf unsere Begleitung.“
„Gestern waren wir auch in einem Gebiet, in dem Soldaten sind!“, mischte sich Macondo ein.
Kane nickte. „Woher wissen Sie so genau, dass dieses Gebiet von den Rebellen beherrscht wird, Mister Smith?“
Er zuckte mit den Schultern. „Das sagt die Erfahrung. Meine geschäftlichen Interessen führen mich häufiger auf den Weg zwischen Hermosillo und Nogales. Momentan bin ich gezwungen, diesen Trail alle paar Wochen zu nehmen und da kann es lebenswichtig sein, stets über die neuesten Entwicklungen Bescheid zu wissen.“
Macondo zog das Sharps Gewehr aus seinem Scabbard, der bei ihm vorne am Sattel hing, was den Vorteil hatte, dass sich das Gewehr sehr schnell aus dem Lederschuh herausziehen ließ. Er stützte den Kolben auf dem Oberschenkel. Seine Augen waren zu schmalen Schlitzen geworden.
Er ließ den Blick schweifen.
Der Gedanke daran beobachtet zu werden, ließ die Gespräche unter den Männern auf ein Minimum reduzieren.
Sie erreichten ein zerklüftetes Gebiet. Schroffe Felswände ragten empor und ihr Weg führte durch schlauchartige Schluchten, die sich bei Regen wohl in Wasserläufe verwandeln konnten.
Der Baumbewuchs wurde seltener, die Kakteen dafür umso häufiger, was Kane irgendwie beruhigte. Kakteensaft schmeckte zwar bei weitem nicht so gut wie frisches Wasser und es war auch nicht gerade ratsam, sich damit Kaffee kochen zu wollen – aber die zahllosen Stachelgewächse, die hier oft in Mannshöhe aus dem Boden sprossen gewährleisteten zumindest immer einen ausreichenden Vorrat an Flüssigkeit.
Plötzlich war Hufschlag zu hören.
Mindestens ein Dutzend Reiter kamen ihnen entgegen.
Kane zügelte sein Pferd.
Die anderen folgten seinem Beispiel.
Einen Moment lang überlegte Kane, ob es nicht das Beste war, einfach wieder zurück zu reiten, doch auch von dort erklang Hufschlag.
Schüsse peitschten plötzlich. Kane blickte empor und sah ein Dutzend Mann oben an den Kämmen der felsigen Hänge auftauchen, die zu beiden Seiten der Schlucht emporragten.
Macondo riss das Sharps Gewehr hoch, aber Smith, der neben ihm ritt, griff zu ihm hinüber und drückte den Lauf nach unten, sodass der erste Schuss sich in den steinigen Untergrund brannte.
Der Indianer riss seine Waffe los und sah Smith zornig an.
„Das waren doch Warnschüsse!“, belehrte Smith den Apachen. „Die haben in die Luft geschossen! Also machen wir die Lage nicht unnötig kompliziert!“
„Mister Smith hat recht“, stellte Kane fest.
Macondo knurrte etwas Unverständliches vor sich hin. Kane war sich nicht ganz sicher, ob er dabei die Apachensprache benutzt hatte.
Jedenfalls wurden nun die umliegenden Anhöhen von bewaffneten Männern umsäumt. Sie trugen die typischen großen Sombreros, wie sie in Mexiko üblich waren. Viele von ihnen hatten Patronengurte über Kreuz geschnallt. Zweifellos waren sie sehr gut bewaffnet.
Kane erkannte Repetiergewehre, wie sie in der Unionsarmee während des Bürgerkrieges Standard gewesen waren.
Von beiden Seiten preschte eine Reiterschar heran.
Der Anführer war ein dicker, schwarzbärtiger Mann in einem weißen Hemd, das fast bis zum Gürtel geöffnet war. Darüber trug er eine Lederweste. An dieser hing in Brusthöhe etwas, das nach einem militärischen Orden aussah.
Zwei Revolver ragten aus den Holstern am Gürtel. Der Hut hing ihm an einer Kordel über den Rücken und der dunkle Bart wucherte ihm fast bis unter die Augen, währen sein Haupthaar nur noch aus einem dünnen Kranz in Ohrhöhe bestand.
Der Schwarzbart hob die Hand, woraufhin seine Männer stoppten.
„Sieh an, wen haben wir denn da!“, sagte er in akzentschwerem Englisch. Sein Blick war dabei auf den Mann gerichtet, den Kane und Macondo als „Mister Smith“ kennen gelernt hatten. „George Allison! Welche Ehre, Sie mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen!“
„Die Freude liegt ganz auf meiner Seite“, sagte der Anzugträger schmallippig.
Der Bärtige drückte seinem Gaul die Hacken in die Weichen und trieb es näher heran. Er streckte die Hand in Richtung jenes Mannes aus, der offenbar in Wirklichkeit George Allison hieß.
„Anderthalb Tagesritte sind es noch bis nach Nogales und Sie wären beinahe an meiner Hazienda vorbei geritten, Mister Allison, ohne ein paar Worte unter guten Freunden und Geschäftspartnern zu wechseln. Was soll ich denn davon halten?“
Allison langte in die Innentasche seiner Jacke und holte ein Bündel mit Dollarnoten hervor, das er kurz abzählen wollte.
Der Bärtige riss es ihm einfach aus der Hand, zählte selber kurz durch und steckte es dann in seine Westentasche.
„Sie wollen doch nicht etwa behaupten, Sie hätten Ihren guten Freund Juan Montalbán vergessen!“
„Natürlich habe ich ihn nicht vergessen“, antwortete Allison. Kane verzog nur das Gesicht. Er hatte inzwischen eine Ahnung von dem, was hier ablief. Offenbar bezahlte Allison - oder wie immer diese zwielichtige Mann nun auch in Wahrheit heißen mochte – die Juaristas in der Gegend dafür, dass sie ihn ungehindert passieren ließen, damit er seinen wahrscheinlich ziemlich zweifelhaften Geschäften in Hermosillo nachgehen konnte.
Aber dieses Mal hatte Allison offenbar den Betrag einsparen wollen…
Kane wechselte einen Blick mit Macondo.
Die Lage gefiel beiden Männern nicht.
Eigentlich war es ihrer beider fester Vorsatz gewesen, sich in keiner Weise in die innermexikanischen Angelegenheiten hineinziehen zu lassen.
Blieb abzuwarten, in wie weit das möglich war.
„Mi Amigo!“, stieß Juan Montalbán an Allison gerichtet hervor und tickte mit dem Finger dabei gegen den Orden an seiner Brust. „Wissen Sie, wer mir das hier verliehen hat, Mister Allison? Das war unserer geliebter Presidente Benito Juarez persönlich! Ich habe mich um die Republik verdient gemacht und kontrolliere jetzt im Auftrag der Revolution das Gebiet zwischen Cassita und der Grenze! Dieser Orden gibt mir das Recht, Truppen zu unterhalten. Aber können Sie mir sagen, wie ich das machen soll, ohne Zölle und Steuern zu erheben, Mister Allison?“
„Sie sollten nicht zu lautstark herumjammern, Mister Montalbán!“, erwiderte Allison. „Schließlich haben Sie einen Großteil Ihrer Waffen von unserer Regierung bekommen!“
„Ausgediente Repetierer der Army – naja, man dankt, Amigo!“ Montalbán verzog das Gesicht und wandte sich jetzt an Kane und Macondo. „Apache?“, fragte er.
„Was spielt das für eine Rolle?“, fragte Kane.
„Ist dein Begleiter stumm?“
„Lassen Sie uns einfach weiter reiten, Mister Montalbán und wir werden beide keine Probleme haben“, erwiderte Kane.
„Aber vorher werden wir auch von Ihnen unseren Wegzoll nehmen. Schließlich wollen Sie doch auch, dass in Mexiko wieder geordnete Verhältnisse einkehren und nicht eine Art französischer Kolonie errichtet wird!“
„Das ist mir persönlich völlig gleichgültig“, erklärte Kane. „Ich will einfach nur meinen Weg fortsetzen. Das ist alles.“
„Carlos! Francisco! Durchsucht seine Sachen! Vielleicht finden wir da etwas, was wir brauchen können. Zum Beispiel denke ich, ist es purer Luxus, dass dieser Mann zwei Gewehre am Sattel trägt. Beides Winchester-Karabiner?“
„Das geht Sie nichts an!“, versetzte Kane, der den Kopf etwas drehte.
Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete er die Männer seitlich von ihm.
Die Lage war prekär.
Kane traute es sich ohne weiteres zu, mit dem Revolver sechsmal hintereinander zu schießen und zu treffen, bevor auch nur einer der Mexikaner seine Waffe gezogen, gezielt und abgedrückt hatte. Aber was war, wenn die sechs Schüsse in der Trommel seines 45er Peacemakers verbraucht waren?
Die Bande zähle einfach zu viele Mitglieder, um sich auf eine Schießerei einlassen zu können. Andererseits war er nicht allein. Und manchmal reichte schon ein entschiedenes Auftreten, um eine Meute wie diese in Schach zu halten. Eine Meute, die, wie Kane überzeugt war, im Grunde aus Feiglingen bestand. Keiner dieser Männer wäre im Zweifelsfall bereit gewesen, aufs Ganze zu gehen und alles auf eine Karte zu setzen.
Kane hatte gelernt, wie man in Gesichtern lesen musste. Er konnte ziemlich abschätzen, wie weit ein Gegner zu gehen bereit war.
Und diese Männer waren ihm ganz gewiss an Entschlusskraft und Kompromisslosigkeit unterlegen.
Nur wenn sie in der Überzahl und schwer bewaffnet waren, zeigten sie Mut.
Noch bevor die beiden Männer, die Montalbán angesprochen hatte, sich in Bewegung setzten, griff der Mann, der Laredo Kid genannt wurde zu seinem 45er an der Hüfte.
Eine gleitende, fast katzenhafte Bewegung.
Den Bruchteil eines Augenaufschlags später hatte er das Eisen in der Hand. Der Lauf zeigte auf den Kopf des Anführers.
Mit einem Klicklaut wurde der Hahn zurückgezogen.
Montalbáns Gesicht erstarrte zu einer Maske des Schreckens. Damit hatte er nicht gerechnet.
Seine Rechte umfasste den Griff eines seiner Revolver, aber er wagte nicht, die Waffe zu ziehen, denn er wusste, dass dies sein sofortiges Ende zur Folge gehabt hätte.
Macondo reagierte im selben Moment.
Fast so, als hätte er die Reaktion Kanes vorausgeahnt.
Er riss das Sharps Gewehr hoch und zielte auf den Kopf eines der Männer, denen Montalbán den Befehl gegeben hatte, Kanes Sachen zu durchsuchen.
„Sorry, Mister Montalbán, ich habe nichts gegen Benito Juarez und Ihre Revolution“, sagte Kane. „Aber ich weigere mich, sie aus meiner Schatulle zu finanzieren. Wenn sich jemand nähert, sind Sie tot.“
„Sie kämen hier niemals lebend weg!“, gab Montalbán zu bedenken.
„Mag ja sein, aber Sie eben auch nicht.“
„Sie pokern hoch! Aber Sie sollten wissen, dass sich mit Juan Montalbán niemand ungestraft anlegt!“
„Mit mir aber auch nicht.“
Für Augenblicke hing alles in der Schwebe.
Die Männer warteten auf ein Zeichen ihres Anführers. Und George Allison saß wie erstarrt in seinem Sattel und schwitzte.
3
Schüsse peitschten plötzlich. Die Geräusche kamen von oben, aber es waren nicht die Juaristas, die geschossen hatten.
Kane blickte empor.
Er sah gleich vier der Bewaffneten, die die Hänge hinabstürzten. Andere drehten sich um, um sich gegen den so plötzlich aus dem Nichts aufgetauchten Gegner zu wehen. Kaum einer der Männer oben an den Kämmen der Hänge schaffte es noch, einen Schuss abzugeben.
Sie fielen die Steilhänge hinab. Todesschreie gellten. Die Körper schlugen schwer auf und blieben in verrenkter Haltung liegen. Aus mindestens zwei Dutzend Gewehren wurde geschossen.
Montalbáns Gesicht verzog sich zu einer Maske des Schreckens. Er schrie seine Leute an und riss den Gaul herum. Dass Kanes Waffe auf ihn gerichtet war, kümmerte in jetzt nicht.
Er ließ sein Pferd voranpreschen.
Sowohl von vorne als auch von hinten ritt ein Trupp französischer Kavalleristen heran. Sie feuerten mit ihren Sattelgewehren.
Oben an den Hängen tauchten jetzt auch die ersten Soldaten auf, legten ihre Karabiner an und feuerten in die Tiefe.
Drei, vier Männer aus Montalbáns Meute wurden sofort aus dem Sattel geholt. Die anderen preschten mit ihren Pferden vorwärts.
Die einzige Möglichkeit, dieser Falle zu entkommen, war Frontalangriff.
Die Mexikaner folgten Montalbán, der seinen Revolver zog und damit wild herumballerte.
Macondo legte sein Sharps Gewehr an und holte einen der Soldaten aus den Felsen. Ein gezielter Schuss, der sein Ziel genau traf. Der Soldat stieß einen gellenden Todesschrei aus und rutschte den Hang hinunter.
Kane steckte den Revolver ein.
Auf einer Entfernung von mehr als dreißig Yards konnte man sich auf die Treffsicherheit selbst des langläufigsten Navy Colts nicht mehr verlassen. Was man jenseits dieser Marke traf, war reine Glücksache.
Für solche Entfernungen brauchte man ein Gewehr.
Kane riss die Winchester aus dem Scabbard und schoss auf einen Soldaten, der gerade angelegt hatte.
Die ersten Mexikaner lieferten sich derweil einen Nahkampf mit den von vorne heran reitenden Soldaten. Innerhalb weniger Augenblicke lagen ein Dutzend Männer und auch ein paar Pferde getroffen am Boden. Aber Montalbán und seine Männer schafften den Durchbruch. Kane und Macondo folgten ihnen. Desgleichen George Allison, der sich dicht hinter ihnen hielt.
Kaum die Hälfte von Montalbáns Männern war noch am Leben. Und auch von denen, die den Durchbruch geschafft hatten, waren nicht alle unversehrt davongekommen. Einige hatten mehrere Schussverletzungen abbekommen.
Aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, als weiter zu reiten und sich dabei so dicht wie möglich an den Rücken des Pferdes zu pressen, um die Trefferfläche klein zu halten – denn die Verfolger kamen rasch näher.
Die Schlucht teilte sich. Montalbán und seine Männer wandten sich nach links.
Kane zügelte sein Pferd.
Er blickte zurück.
Macondo folgte seinem Beispiel. Dabei nutzte er die Gelegenheit, sein Sharps Gewehr nachzuladen.
Der Hufschlag der Verfolger war hinter der nächsten Biegung bereits zu hören.
Im ersten Moment schien es so, als würde sich George Allison die größeren Überlebenschancen ausrechnen, wenn er bei Montalbán und seinen Männern blieb.
Aber dann besann er sich eines besseren.
Er zügelte ebenfalls seinen Gaul.
„Warum bleiben Sie nicht bei Ihren Freunden?“, fragte Kane hart, während er die Winchester nachlud.
„Das sind nicht meine Freunde.“
„Seltsam, es sah für mich aber so aus!“
Kane ließ die Winchester in den Scabbard gleiten und gab seinem Pferd die Sporen. Er nahm den Weg nach Rechts. Macondo und Allison folgten ihm.
Die Schlucht zog sich in einer lang gezogenen Biegung dahin und endete schließlich vor einem geröllhaltigen Hang.
Kane stieg ab, zog das Pferd hinter sich her. Das Tier rutschte.
Macondo und Allison folgten seinem Beispiel.
Der Apache erwies sich dabei als besonders geschickt. Er hatte Kane bald überholt und erreichte zuerst den Kamm. Dort blieb er stehen und blickte zurück.
In der Ferne waren Schüsse zu hören.
Die Franzosen hatten Montalbáns Leute offenbar eingeholt und lieferten sich mit ihnen ein heftiges Gefecht.
Aber das bedeutete keineswegs, dass Kane und seine Begleiter sich in Sicherheit wähnen konnten.
Hufschlag drang durch die Schussgeräusche und hallte zwischen den Hängen wider.
Die ersten beiden Kavalleristen tauchten hinter der Biegung auf.
Macondo legte das Gewehr an und holte den ersten von ihnen aus dem Sattel, während Allison und Kane noch immer ihre Pferde über den Hang zu bugsieren versuchten.
Allison griff unter die Jacke, zog den Revolver aus dem Schulterholster und feuerte in heller Panik herum.
Immerhin trieb das sein Pferd weiter den Hang hinauf.
Weitere Kavalleristen kamen um die Biegung. Kane und Allison schafften es endlich, ihre Pferde über den Hang zu bringen. Dahinter war eine rutschige, von Geröll übersäte Schräge. Kane riss die Winchester aus dem Sattelschuh, ließ seinen Gaul die Schräge hinunterlaufen und lud die Waffe durch.
Er feuerte in Richtung der Angreifer und ging dabei in Deckung. Schuss um Schuss feuerte er in Richtung der Kavalleristen.
Macondo und Allison schossen ebenfalls.
Allison schrie auf, als eine Kugel ihn an der Schulter traf. Der Schuss aus seinem Colt wurde verrissen und ging ungezielt ins Nichts.
Er ließ sich ein Stück die Schräge hinunterrutschen, sodass er nicht mehr getroffen werden konnte. Mit der Handfläche presste er gegen die Wunde. Blutrot lief es ihm zwischen den Fingern hindurch.
„Verdammt!“, knurrte er.
Kane feuerte noch immer mit seiner Winchester. Zwölf Schüsse hatte die Waffe im Magazin.
Macondo war indessen in Deckung getaucht, um seine Waffe nachladen zu können. Jetzt kam er wieder hervor und schoss ebenfalls.
Rechts und links von ihnen streiften die Bleikugeln vorbei. Ein Projektil zertrümmerte einen der Kakteen, dass der kostbare Saft nur so herausspritzte und den vor Trockenheit aufgesprungenen Boden benetzte.
Als Kane und Macondo die Waffen senkten, lagen sieben Kavalleristen tot im Staub.
Offenbar hatten die Verfolger die Spuren studiert und den größeren Teil ihrer Truppe Montalbán und seinen Leuten hinterhergeschickt.
Dieser Umstand bedeutete für Kane und seine Begleiter vielleicht die Chance, den Soldaten doch noch zu entkommen.
In der Ferne war noch immer Gefechtslärm zu hören.
Kane wandte sich an den Indianer.
„Eins steht fest“, sagte er. „Wir werden jetzt wohl kaum in Mexiko bleiben können.“ Er deutete mit dem Winchesterlauf auf die getöteten Kavalleristen.
„Zumindest nicht, solange die Franzosen im Land sind“, stimmte Macondo zu.
Der Gedanke, die Grenze nach Arizona überschreiten zu müssen, gefiel ihm nicht. Es hatte schließlich Gründe, dass er nach Mexiko geflohen war. So ungerechtfertigt und falsch es auch sein mochte, er wurde nun einmal in Texas als Mörder gesucht.
Monate waren vergangen, seit er nur knapp dem Galgen entkommen war –und das nur, weil er sich in Notwehr verteidigt hatte.
Aber er musste damit rechnen, dass Steckbriefe von ihm inzwischen nicht nur in Texas kursierten. Wenn er Pech hatte, war inzwischen sogar eine Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt worden, die Kopfgeldjäger anlockte wie Coyoten die vom Geruch verwesenden Fleisches angezogen wurden.
Aber die Schwierigkeiten, die Jeff Kane in Texas gehabt hatte, waren nichts dagegen, dass er auf mexikanischem Boden Soldaten getötet hatte.
In Mexiko konnte er sich jetzt wohl erst wieder sehen lassen, wenn Kaiser Maximilian und seine Französischen Unterstützer gestürzt waren. Aber danach sah es im Moment überhaupt nicht aus. Im Gegenteil.
4
Kane wandte sich dem Verwundeten zu und half ihm auf. „Wir haben jetzt keine Zeit, Ihre Wunde zu verbinden“, sagte er. „Das werden wir tun, sobald wir einigermaßen in Sicherheit sind.“
„Okay!“, keuchte Allison.
„Haben Sie zufällig eine Flasche Whiskey?“
„In den Satteltaschen!“
„Dann steigt Ihre Überlebenschance erheblich, Mister Allison.“
Kane stützte ihn. Allison sah elend aus. Er war ganz blass geworden. Sein Gesicht hatte beinahe jegliche Farbe verloren.
Sie erreichten die Pferde. Kane half Allison in den Sattel.
„Noch etwas!“, sagte er mit einem deutlich fordernden Unterton.
Allison klammerte sich an den Sattelknauf. Er blinzelte und sah Kane dann offen an.
„Was immer Sie wollen, wenn Sie mich über die Grenze mitnehmen. Lassen Sie mich um Gottes Willen nicht hier!“
„Das hat auch niemand vor“, versicherte Kane. „Aber ich will von Ihnen die Wahrheit wissen!“
„Welche Wahrheit?“
„Darüber, was Sie hier tun!“
„Habe ich Sie vielleicht nach diesen Dingen gefragt?“, fauchte Allison zurück. Sein Kopf lief dabei dunkelrot an: Er musste höllische Schmerzen haben.
Insgeheim bewunderte Kane Allison dafür, dass er bis jetzt die Zähne zusammengebissen hatte.
Allison ächzte.
„Sie arbeiten für die US-Regierung, habe ich recht?“, fragte Kane.
„Das… kann man… unterschiedlich … betrachten“, brachte Allison hervor.
„Ein Waffenhändler“, stellte Macondo fest. „Oder ein Spion. Aber ich tippe auf ersteres. Kundschafter sind besser ausgebildet. Ich kann das sagen.“
5
Sie ritten weiter gen Norden. Die Schüsse in der Ferne verklangen. Nur hin und wieder wurde zwischen den Felsen noch herumgeballert. Vereinzelte kleinere Gefechte zwischen Soldaten und Rebellen flackerten wieder auf.
Allison hing wie ein nasser Sack im Sattel. Er sagt kein Wort.
Sie legten schließlich eine Pause ein, um die Wunde zumindest provisorisch zu versorgen und mit dem hochprozentigen Whiskey zu desinfizieren, den Allison mit sich führte.
In flirrender Hitze setzten sie ihren Weg fort. Sie kamen nicht besonders schnell voran, aber mit einem Verletzten im Schlepptau war das nicht weiter verwunderlich. Allison konnte einfach nicht schneller und Kane verfluchte nicht zum ersten Mal den Augenblick, in dem sie diesem Mann begegnet waren, der ein so falsches Spiel gespielt hatte.
Er hatte Kane und Macondo benutzt – genauso wie er auch die Juaristas um Montalbán für seine Zwecke missbraucht hatte.
Die Bilanz war verheerend.
Mexiko konnte nicht länger eine neue Heimat sein und in Arizona wartete vielleicht ein Kopfgeldjäger auf ihn.
Kane empfand tiefen Grimm darüber.
Er war in einen Krieg hineingezogen worden, der ihn nichts anging. Aber die Franzosen mussten ihn jetzt für einen Juarista halten und wahrscheinlich würden sie ihn und Macondo so weit verfolgen wie ihr Einflussgebiet reichte.
Und Montalbán?
Der musste sich wahrscheinlich mit seinen Leuten erst einmal die Wunden lecken, ehe er wieder in das Geschehen eingreifen konnte – so fern er überhaupt überlebt hatte.
Die Heftigkeit der Kämpfe war durch die Häufigkeit der Schussfolgen auch über viele Meilen hinweg unüberhörbar gewesen.
Als wieder einmal ein paar Schusswechsel aufflammten und Kane kurz sein Pferd stoppte, um zurückzublicken, sagte Macondo: „Wir sollten es nicht bedauern, wenn der Feind unseres Feindes erfolgreich war.“
„Aber der Feind unseres Feindes ist in diese Fall nicht unser Freund“, entgegnete Kane.
6
Sie kampierten zwischendurch, um die Pferde zu tränken. Auch sie selbst genehmigten sich etwas Wasser. Schweigend saßen sie im Schatten eines Felsblocks.
Allison war gar nicht mehr ansprechbar. Auf seiner Stirn glänzte Schweiß und Kane war überzeugt davon, dass er bereits erste Symptome von Wundfieber zeigte.
„Ohne einen Doc kann er es nicht schaffen und ich glaube kaum, dass wir auf dem Weg nach Nogales noch einen Arzt finden, der diesen Namen auch verdient!“
„Ich glaube nicht, dass er es bis Nogales schafft!“, sagte Macondo. Er zuckte mit den breiten Schultern. „Aber ich kann mich irren. Während des Krieges habe ich gesehen, wie Männer an winzigen Verletzungen gestorben sind und andere, in denen schon eigentlich kein Leben mehr hätte sein dürfen, es doch noch geschafft haben.“ Er schüttelte entschieden den Kopf. „Die Ahnen nehmen nur den bei sich auf, dessen Seele für sie bestimmt ist, Laredo Kid!“
„Eine interessante Sichtweise.“
7
Am Abend erreichten sie eine Farm. Sie bestand aus einem Sandsteinhaus und einer Scheune. Offenbar war sie verlassen worden. Angesichts der Trockenheit war das auch kein Wunder. Es hatte keinen Sinn, hier Rinder zu züchten oder Landwirtschaft zu betreiben. Der letzte Regenguss musste schon Jahre her sein.
Als sie das Haus erreichten, stieg Kane ab, machte das Pferd fest und rief: „Ist da wer?“
Niemand antwortete.
Mit dem Revolver in der Hand stieß er die Tür auf.
Das Haus bestand aus einem einzigen Raum. In der Mitte war ein Kamin. Im Dach waren mehrere größere Löcher.
Kane kehrte zurück. Zusammen mit Macondo hievten sie den Verletzten ins Haus. Es gab kein Mobiliar, außer einem Stuhl, der schon aus dem Leim ging und bestenfalls als Brennholz taugte. Die ehemaligen Besitzer der Farm hatten alles mitgenommen, was noch irgendeinen Wert hatte.
Allison murmelte irgendetwas vor sich hin. Das Wundfieber ließ ihn fantasieren.
„Ich kümmere mich um die Pferde“, sagte Macondo. „Ich bringe sie in den Stall.“
„In Ordnung“, meinte Kane.
Er half Macondo zunächst, die Sättel abzunehmen und ins Haus zu tragen. Dann nahm der Apache die Pferde mit.
Allison hatte sich inzwischen aufgerichtet.
„Hey!“, flüsterte er. Er schien auf einmal sehr viel klarer zu sein. Kane war unterdessen in die Hocke gegangen und damit beschäftigt, Alisons Satteltaschen zu durchsuchen. „Lassen Sie das! Nehmen Sie um Himmels Willen die Finger weg!“
Plötzlich hörte Kane das klickende Geräusch eines Revolvers, der gerade gespannt wurde.
Kane drehte sich um.
Sehr langsam, sehr vorsichtig. Dann erhob er sich.
„Stecken Sie das Eisen weg, Mister“, forderte er. „Ich habe wenig Lust, Ihnen noch eine weitere Kugel zu verpassen, aber ich würde es tun, wenn es sein muss! Schnell genug bin ich dazu. Und ob Sie mich in diesem Zustand überhaupt treffen würden, ist fraglich. Ihre Hand zittert ja!“
„Ich will nur nicht, dass Sie meine Sachen durchwühlen!“, fauchte er.
Sein Gesicht verzog sich dabei.
„Ich habe nur nach etwa gesucht, womit man vielleicht Ihren Verband erneuern könnte. Leinenhemden zum Beispiel sind ganz gut dazu geeignet und ich dachte, Sie hätten vielleicht noch ein Ersatzhemd in Ihren Taschen.“
„Ich sagte: Finger weg!“
Kane zuckte mit den Schultern. „Ich reiße mich nicht gerade darum, Sie noch mal zu verbinden. So was gehört nicht gerade zu meinen Lieblingstätigkeiten und wenn es Ihnen lieber ist, an Wundbrand zu sterben - bitte! Das müssen Sie selbst wissen!“
„Werfen Sie die Tasche zu mir herüber!“
Kane verengte die Augen.
Es schien Allison tatsächlich ernst zu sein.
Dann bückte er sich, griff nach den Satteltaschen und warf sie zu Allison hinüber. Dieser schien jetzt beruhigt zu sein. Er atmete tief durch und steckte den Revolver wieder in das Schulterholster.
„Was ist da drin?“, fragte Kane und deutete auf die Satteltaschen. „Hat das zufällig etwas mit den dubiosen Geschäften zu tun, die Sie hier in Mexiko betreiben?“
Er atmete tief durch.
Dann begann er im Inneren der Tasche herumzuwühlen. Er holte schließlich ein zusammengefaltetes Leinenhemd hervor, das er Kane vor die Füße warf. „Das war es doch, was Sie suchten…“
„Hören Sie mir gefällt die Art nicht, in der Sie mit mir reden“, stellte Kane klar. „Ihretwegen sitzen Macondo und ich ziemlich in der Bredrouille und müssen damit rechnen, dass wir uns auf Jahre hinaus in Mexiko nicht mehr sehen lassen können. Und gerade haben Sie eine Waffe auf mich gerichtet, was auch nicht gerade die feine Art ist!“
„Tut mir Leid für Sie.“
„Wahrscheinlich ist es das Beste für Macondo und mich, wenn sich unsere Wege hier trennen.“
„Hören Sie mir zu! Es ist Ihre Pflicht, mir zu helfen!“
„Meine Pflicht?“ Kane lachte. „Ihre Scherze gefallen mir auch nicht, Allison – falls das wirklich Ihr richtiger Name ist.“
„Sie sind Amerikaner. Den Roten in Ihrer Begleitung lassen wir mal außen vor…“
„Sehen Sie und das ist ein weiterer Punkt, der mir nicht gefällt. Wie Sie über jemanden, reden der geholfen hat, Sie am Leben zu erhalten!“
Alison schloss für einen Moment die Augen. Er verzog das Gesicht. Offenbar hatte er schlimme Schmerzen. Vielleicht kündigte sich auch ein neuer Fieberschub an.
Als er die Augen schließlich wieder öffnete, wirkten sie glasig.
„Sie müssen mir helfen, weil ich für die amerikanische Regierung arbeite.“
„Ein Spion?“
„Ein Kurier. Diesen Ausdruck bevorzuge ich.“
„Ich sagte Ihnen schon einmal, dass ich mit diesem Krieg nichts zu tun haben will, gleichgültig, welche Position meine Regierung in dieser Sache einnehmen mag!“, erwiderte Kane kühl. „Und schon gar nicht, wenn ich nicht weiß, worum es geht.“
„Ich habe hier Dokumente aus Hermosillo. Es gibt Beweise dafür, dass Montalbán ein doppeltes Spiel spielt. Er leitet die Waffen, die er von der US-Regierung bekommt, nicht an Benito Juarez weiter, sondern lässt immer einen Teil davon verschwinden. Die verkauft er dann weiter.“
„Und an wen? Doch nicht an die Regierung des Kaisers? Dann wären die Franzosen kaum in Cassita!“
„An Banditen oder wer sonst immer gut dafür zahlt! Ich habe Dokumente, die beweisen, dass er die Waffenlieferungen veruntreut. Und die muss ich nach Tucson, Arizona bringen, damit diesem Kerl nichts mehr geliefert wird.“
„Sie können von Glück sagen, dass Montalban keine Gelegenheit hatte, diese Papiere bei Ihnen zu finden!“
„Falls ich es nicht schaffe, müssen Sie diese Papiere an einen Mann übergeben, dessen Name Brooks lautet. Sie finden ihn in Tucson. Er…“
„Das können Sie sich abschminken“, unterbrach Kane ihn. „Ich sagte doch schon, dass das nicht mein Krieg ist. Und wenn unsere Regierung so dumm ist, an einen Mann wie Montalbán Waffen zu liefern, um sie an Juarez weiterzuleiten, muss sie sich nicht wundern, wenn die Hälfte davon nicht ankommt.“
Wenig später erschien Macondo in der Tür des Hauses.
„Es ist besser, wenn wir kein Feuer machen“, sagte er. „Das sieht man meilenweit. Und wir wissen nicht, wie viele Soldaten tatsächlich in diesem Gebiet sind.“
„Wir werden uns bei den Wachen abwechseln, Macondo“, erwiderte Kane.
Der Apache nickte und lehnte sein Sharps Gewehr gegen die Wand.
„Ich werde die erste Wache übernehmen und dich wecken.“
„In Ordnung.“
8
Die Nacht verlief ruhig und ohne besondere Vorkommnisse – sah man einmal davon ab, dass die Schreie hungriger Coyoten die ganze Zeit über zu hören waren. Zwei Stunden vor Sonnenaufgang brachen sie wieder auf.
Kane hatte Allisons Ersatzhemd sorgfältig in Streifen geschnitten und die Wunde mit dem letzten Whisky versorgt, der ihnen zur Verfügung stand.
Allison musste höllische Schmerzen haben, aber er war offenbar sogar zu schwach, um zu schreien.
Er litt unter Schüttelfrost und sah elend aus.
Im hellen Mondlicht kamen sie in das Bergland südlich der Arizona-Grenze.
Allison hielt sich mit Mühe im Sattel und sie mussten immer wieder Pausen für ihn einlegen.
„Ich frage mich wirklich, weshalb du das für diesen Kerl tust“, äußerte sich Macondo während ihres Ritts. Es schien ihm gleichgültig zu sein, ob Allison das nun mit anhörte oder nicht. „Ein Mann wie der ließe dich nichteinmal aus seiner Flasche trinken, wenn er dich halb verdurstet in der Wüste finden würde!“
„Ein hartes Urteil“, sagte Kane.
„Ich kann nicht nur in den Spuren am Boden lesen“, gab Macondo zurück. „Auch in den Spuren im Gesicht. Dieser Mann ist falsch. Er spricht mit gespaltener Zunge und hat keine Ehre.“
Dem mochte Kane nicht widersprechen.
9
Sie mussten einen Umweg machen, um einem Trupp Franzosen auszuweichen, der in der Gegend herumpatrouillierte. Aber die Gegend war sehr gebirgig und unwegsam, sodass es keine Schwierigkeit bedeutete, sich zu verbergen, zumal die fremden Truppen wenig Erfahrung mit dieser Gegend und ihren Besonderheiten hatten. Zum Beispiel überforderten sie ständig ihre Pferde, was letztlich nur dazu führen konnte, dass sie vorzeitig erschöpft wurden.
Sie tranken den Saft von Kakteen und mieden Wasserlöcher – denn genau dort würden sowohl die Franzosen als auch Montalbáns Bande sie vermuten.
Am späten Nachmittag des folgenden Tages erreichten sie Nogales. Die mexikanische Hälfte dieser Stadt mieden sie, indem sie die Grenze an einer unscheinbaren Stelle überquerten, wo sie sich wie eine unsichtbare Linie schnurgerade durch die Landschaft zog.





























