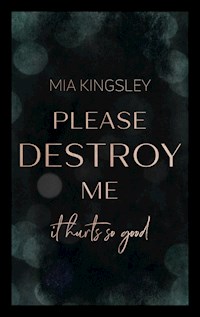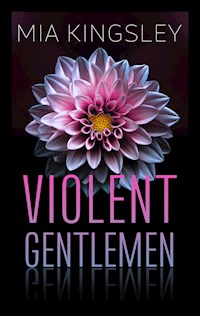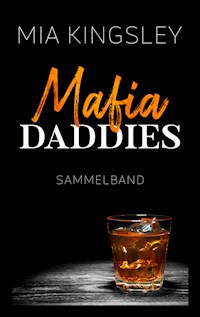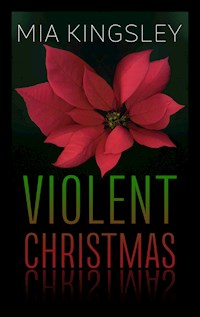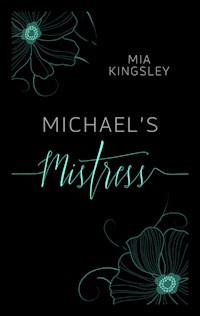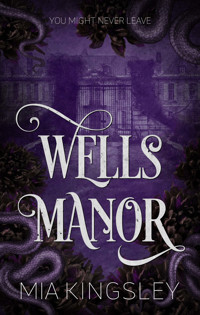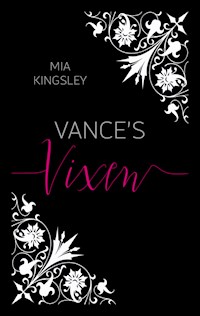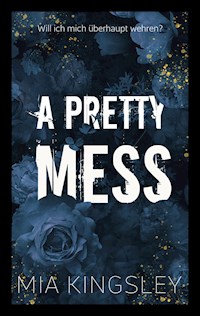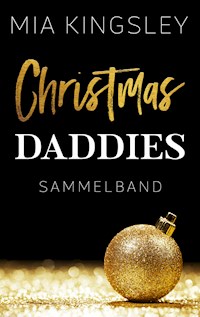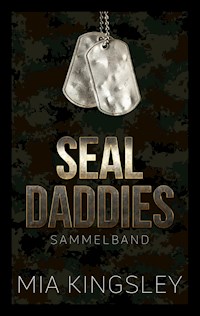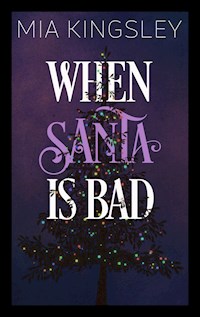
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich war schon kein Fan von Weihnachten, bevor mich Santa Claus von einem abgelegenen Rastplatz entführt hat. Er will meine Hilfe, sagt er – das Elfenkostüm für mich hat er schon. Allerdings braucht er mich nicht, um Geschenke an Kinder zu verteilen. Santa plant ein gutes Dutzend Morde, bei denen ich ihm zur Hand gehen soll ... Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
WHEN SANTA IS BAD
MIA KINGSLEY
DARK ROMANCE
INHALT
When Santa Is Bad
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Mehr von Mia Kingsley lesen
Über Mia Kingsley
Copyright: Mia Kingsley, 2020, Deutschland.
Coverfoto: © Mia Kingsley
Korrektorat: Laura Gosemann
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Black Umbrella Publishing
www.blackumbrellapublishing.com
WHEN SANTA IS BAD
Ich war schon kein Fan von Weihnachten, bevor mich Santa Claus von einem abgelegenen Rastplatz entführt hat.
Er will meine Hilfe, sagt er – das Elfenkostüm für mich hat er schon. Allerdings braucht er mich nicht, um Geschenke an Kinder zu verteilen.
Santa plant ein gutes Dutzend Morde, bei denen ich ihm zur Hand gehen soll ...
Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
KAPITEL1
11. Dezember
Meine Jacke war viel zu dünn. Leider konnte ich diesen Umstand ebenso wenig ändern wie die Tatsache, dass die Busfahrt mich fast mein gesamtes Bargeld gekostet hatte. Ich wusste, was jetzt zu tun war, und die Vorstellung trieb mir Tränen in die Augen.
Allerdings hatte heulen mich in meinem Leben noch nie weitergebracht, weshalb ich das dringende Bedürfnis, mir die Augen aus dem Kopf zu weinen, ignorierte und die Tür zum Diner aufzog.
Der Linoleumboden sah aus, als wäre er das letzte Mal in den Neunzigern gewischt worden, und meine Schuhe verursachten ein lautes Quietschen, das aber zum Glück zwischen der Sportübertragung im Fernsehen und den Stimmen der Trucker unterging.
Zwischen den ganzen Männern und der müde aussehenden Kellnerin stach ich ziemlich hervor, weshalb ich direkt die neugierigen Blicke auf mir spürte.
Ich hatte von der Greyhound-Busstation ein ganzes Stück zu Fuß gehen müssen, weil der Diner mit dem angrenzenden Motel die billigste Unterkunft im Umkreis etlicher Meilen war. Da der nächste Bus erst morgen fuhr, würde ich die Nacht hier verbringen müssen. Die anderen Reisenden, die in dieser gottverlassenen Ecke ausgestiegen waren, hatten sich in Richtung Stadt orientiert.
Am liebsten hätte ich mir das Geld für ein Motelzimmer gespart, aber bei dem dichten Schneefall und den eisigen Temperaturen konnte ich die Nacht nicht draußen verbringen.
Ich zog mir die Kapuze meines Hoodies über die braunen Haare tief ins Gesicht und hielt den Blick gesenkt, als ich zur Theke ging und auf einen der Barhocker kletterte. Die Speisekarte war laminiert und mit etlichen Flecken übersät, aber die Preise waren moderat und ich würde nicht bis morgen früh hungern müssen, wenn ich den Burger nahm – das billigste Gericht.
»Was darf’s sein, Süße?« Die Kellnerin stützte beide Hände auf den Tresen und musterte mich, als wüsste sie bereits nicht mehr, wie Frauen unter dreißig aussahen. Bei der Klientel hier kein Wunder.
»Den Burger.«
»Nur den Burger?«
Ich deutete auf das Menü Nummer 6. »Burger mit Fritten.«
»Alles klar. Was zu trinken?«
Knapp schüttelte ich den Kopf und starrte den Tresen an. Ich war müde, weil ich es nicht gewagt hatte, auf der langen Busfahrt auch nur ein Auge zuzumachen. Zum einen hatte ich nicht ausgeraubt werden wollen, und zum anderen fürchtete ich, dass Paul mir vielleicht auf den Fersen war.
Sobald ich gegessen hatte, würde ich mich in einem der Motelzimmer einschließen, einen Stuhl unter die Türklinke klemmen und ein paar Stunden schlafen. Die Vorstellung klang himmlisch. Noch besser als eine heiße Dusche.
»Kann ich dir einen Milchshake dazu spendieren, Sweetheart?«, fragte der Mann, der genau in diesem Moment auf dem Hocker neben mir Platz nahm.
Ich versteifte mich automatisch. »Nein, danke.«
»Komm schon, hab dich nicht so. Ein hübsches Ding wie du? Du müsstest nie für dein Essen zahlen, wenn du nicht willst.«
Ich verharrte regungslos und hoffte, dass er einfach verschwinden würde, wenn ich nicht auf ihn reagierte. Pauls Worte klangen mir noch deutlich in den Ohren. Wie er am Saum meines Shirts gezupft und mir erklärt hatte, dass es nicht seine Schuld war, dass ich solch ein hübsches Gesicht und einen noch verführerischeren Körper hatte. Dass Männer gegen mich machtlos waren.
»Wie sieht’s jetzt aus mit dem Milchshake?« Der Kerl legte seine Hand auf meinen Oberschenkel und drückte zu, als würde er schon mal die Beschaffenheit testen wollen.
»Larry«, sagte eine andere Stimme. »Lass die Lady in Ruhe.«
»Halt dich aus meinen Angelegenheiten raus, Carl.«
Ich verfolgte den Austausch stumm, rührte keinen Muskel und stellte keinen Blickkontakt her. Warum passierten mir immer wieder solche Dinge? Wieso konnte ich nicht einfach meine Ruhe haben?
An manchen Tagen träumte ich davon, mir ein Messer durch mein ach so hübsches Gesicht zu ziehen, aber ich wagte ernsthaft zu bezweifeln, dass es helfen würde. Die weiten Klamotten und der gesenkte Blick hatten auch nie geholfen.
Die Kellnerin stellte den Teller vor mich. Der Burger sah gut aus, doch mein Magen war wie zugeschnürt, weil da noch die Hand auf meinem Bein lag.
Ich könnte die Gabel nehmen und sie nach unten rammen …
»Du hast ihn gehört, Larry.« Die Kellnerin lächelte nachsichtig. »Lass das Mädchen einfach essen, okay?«
Da Larry die Finger tiefer in mein Bein grub, nahm ich an, dass ihm die Warnung nicht sonderlich gefiel. Dann zog er die Hand zu meiner Erleichterung zurück. Aus dem Augenwinkel sah ich den Blick, den er erst der Kellnerin und schließlich mir zuwarf. Sobald ich gegessen hatte, sollte ich zusehen, dass ich von hier verschwand.
Hastig schob ich zwei Fritten in meinen Mund und kaute.
Die angespannte Stimmung lockerte sich ein wenig, als die Tür aufgestoßen wurde und Kinder hereinkamen, dicht gefolgt von ihren Eltern. Sie waren noch klein, das ältere Mädchen war vielleicht sechs.
Sie sprachen aufgeregt von Milchshakes und darüber, dass ihre Grandma sich bestimmt über die Überraschung freuen würde.
Ich schaute über die Schulter und sah, wie die Eltern die beiden Mädchen zu einer der freien Nischen scheuchten. Draußen auf dem Parkplatz, hinten zwischen den Trucks, stand ein großes Wohnmobil, das vorhin noch nicht da gewesen war.
Mein Herz klopfte schneller. Solange die Familie hier drin saß, könnte ich rausschleichen und mich ein bisschen umsehen. Ich kämpfte mit dem schlechten Gewissen, aber mir blieb keine andere Wahl. Mit Sicherheit hatten sie Geld in dem Wohnmobil versteckt, und wenn nicht, würde ich mir einen oder zwei warme Pullover von der Mutter stehlen können. Und Essen. Sie hatten bestimmt Snacks dabei.
Ich aß noch schneller als sonst, was für die meisten schon ein unerhörtes Tempo war, doch ich war in zahllosen Kinderheimen und bei Pflegeeltern aufgewachsen, und wer nicht schnell beim Essen war, musste sich mit den Resten zufriedengeben. Oder sich mit Paul herumschlagen.
Ich biss direkt zweimal hintereinander in den Burger, schlang das Fleisch regelrecht hinunter. Dazwischen bediente ich mich an den Pommes, die schon bei ihrer Ankunft nur lau gewesen waren.
Mein Teller war schnell leer, und ich zog die passenden Geldscheine aus der Tasche meiner schwarzen Jeans. Meinen Rucksack hatte ich zwischen die Knie geklemmt, und mehr hatte ich nicht dabei – auch weil ich nicht mehr besaß.
Die Kellnerin sah, wie ich das Geld hervorholte, und kam zu mir. Sie beugte sich über den Tresen. »Wo willst du hin?«, fragte sie leise.
»Eigentlich wollte ich mir ein Zimmer nehmen.«
»Wahrscheinlich ist es besser, wenn du aus dem Fenster der Damentoilette kletterst. Larry ist … ungenießbar, wenn er getrunken hat.« Das traurige Lächeln erreichte ihre Augen nicht, und ich spürte, wie mein Magen sich verkrampfte. Bei meinem nächsten Halt würde ich einen weiten Bogen um den Diner machen, dessen Kunden zu neunzig Prozent aus Truckern bestanden.
»Danke«, wisperte ich.
»Warte noch einen Moment.« Sie nahm das Geld. »Er beobachtet dich, aber sein Essen ist gleich fertig, dann ist er abgelenkt.«
Ich nickte, und mein Puls klopfte schneller, weil ich nicht gedacht hatte, dass bereits das Verlassen des Diners einem Actionfilm gleichen würde.
Als die Kellnerin mit den drei Tellern für den Tisch, an dem Larry saß, aus der Küche kam, machte ich mich bereit.
Die Tür schwang auf, und die Mädchen quiekten vor Begeisterung.
»Mama, Mama – der Weihnachtsmann ist hier.«
Sie rannten los und warfen sich dem Mann im Weihnachtsmannkostüm an die Beine. Er lachte gutmütig und stellte seinen Sack ab. »Ho, ho, ho, wen haben wir denn hier?«
Die Mutter stand auf, um ihre Kinder zu holen. »Lexy, Sarah, lasst den armen Mann los. Er hat sicherlich auch Hunger und will etwas essen.«
Ich wusste, dass ich keine bessere Gelegenheit bekommen würde, und stand auf. Als ich zur Tür mit dem Toilettensymbol ging, kam ich an Santa vorbei.
Er hob den Kopf, und für den Bruchteil einer Sekunde kreuzten sich unsere Blicke. Santas Augen über dem künstlichen weißen Bart und der energischen Nase waren dunkel, so dunkelbraun, dass sie beinahe schwarz wirkten – und eiskalt. In ihnen war nicht ein Funken Gefühl zu sehen. Beinahe wäre ich zurückgezuckt, aber ich hatte gerade dringendere Probleme als die Frage, welcher innerlich tote Weihnachtsmann sich so früh im Dezember in voller Kostümierung in eine solche Absteige verirrte.
Da ich der Kellnerin keine zusätzliche Arbeit machen wollte, sperrte ich die Toilettentür von innen nicht ab. Ich zog den Rucksack auf und öffnete das Fenster. Mit festem Griff packte ich den Sims und hievte mich hoch. Beinahe hätte ich nicht genug Kraft gehabt, aber dann fiel mir wieder ein, dass Larry die Alternative war, und schwang mein Bein nach oben. Ich war nicht elegant, aber effizient.
Der Schnee dämpfte das Geräusch meiner Schuhe, als ich auf der anderen Seite hinuntersprang. Ich schob das Fenster, so gut es ging, zu und bückte mich dann, um durch die Dunkelheit außerhalb der einzelnen Laternen zurück zum Parkplatz zu schleichen. Bevor ich mir ein Zimmer nahm, musste ich in das Wohnmobil einbrechen.
Ich würde nicht viel nehmen, versicherte ich mir selbst. Nur das Allernötigste.
Endlich verspürte ich einen kleinen Hauch Zuversicht, denn sie hatten das Wohnmobil so geparkt, dass sich die Tür auf der Seite befand, die vom Diner weg zeigte. Damit hatte ich etwas mehr Zeit, das Schloss zu knacken, weil sich hinter mir bloß die Straße erstreckte, auf der nur etwa alle zwanzig bis dreißig Minuten ein Truck vorbeikam.
Meine Finger zitterten teils vor Kälte, teils vor Nervosität, aber bald hörte ich das Klacken und konnte die Tür öffnen. Im Inneren roch es warm und nach Keksen, was den Knoten in meinem Magen vergrößerte.
So leise wie möglich durchsuchte ich die Staufächer und den Kleiderschrank, fand ein bisschen Bargeld zwischen zwei ordentlich gefalteten Anzughosen. Ich nahm mir lediglich die Hälfte und legte den Rest zurück.
Ganz oben fand ich einen dunkelblauen Sweater, der mir wahrscheinlich passen sollte. Ich steckte ihn in meinen Rucksack, nahm mir im letzten Moment ein Paar Socken, das ich ebenfalls einpackte, bevor ich den Rucksack und den Schrank wieder schloss. Da ich nicht die Blechdose mit den selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen mitnehmen wollte, musste ich mich mit einer Tüte gerösteter Erdnüsse begnügen, weil alles andere bereits geöffnet war. Dazu schnappte ich mir zwei kleine Plastikflaschen Wasser und entschuldigte mich im Geiste bei der Familie.
Vorsichtig warf ich einen Blick aus dem Wohnmobil, doch alles war ruhig, und ich hörte niemanden kommen.
Weil meine Schuhabdrücke ein Problem sein könnten, beschloss ich, denselben Weg zurück zu nehmen, den ich gekommen war, und an der Rückseite des Diners in Richtung der Motelzimmer zu laufen.
Ich stieg die kleine Stufe nach unten und drückte die Tür ins Schloss, als es hinter mir raschelte. Bevor ich mich umdrehen konnte, wurde ich gepackt und brutal gegen die eiskalte Seite des Wohnmobils geschleudert.
Mein Angreifer benutzte seinen ganzen Körper, um mich festzupinnen. Ich fühlte mich wie ein Schmetterling auf der Nadel in der Box eines Sammlers.
Egal, wie ich mich wand und strampelte, ich konnte mich nicht befreien.
»Hast du die Tür aufgebrochen oder stand sie offen?«, knurrte eine tiefe Stimme hinter mir.
»Ich hab sie aufgebrochen.« Mein Herz raste, und ich wusste selbst nicht, warum ich nicht einfach gelogen hatte. Wahrscheinlich, weil mich etwas in seiner Stimme zwang, die Wahrheit zu sagen. War es der Vater? Hatte er mich geschnappt?
Er lachte leise. »Das macht dich perfekt für meine Zwecke.«
Ich erstarrte. Von welchem Zweck sprach er?
Eine Hand packte meine Schulter mit eisernem Griff. So fest, dass ich wimmerte, als er mich umdrehte.
Die andere Hand schnellte vor und legte sich um meine Kehle. Ich konnte nicht atmen, während mein Gehirn verarbeitete, dass mein Angreifer der Weihnachtsmann war. Seine Augen wirkten noch dunkler als im Diner, und so wie ich es beurteilen konnte, war Santa verflucht stark.
»Lass mich los«, bat ich. »Bitte.«
Er drückte fester zu, entlockte mir ein atemloses Röcheln. Punkte flirrten bereits am Rande meines Sichtfeldes, als er ein Messer zog und eine pervers lange Klinge hervorschnellte.
»Hier sind die Spielregeln: Du machst, was ich sage, oder ich tue dir weh. Kannst du mir folgen?«
Verzweifelt packte ich seinen Unterarm. Ich bekam keine Luft, konnte nicht mehr klar denken. Gerade als das Licht beinahe ausging, ließ er mich so abrupt los, dass ich vor ihm auf dem Boden zusammensackte und hustete. Ich betastete meine Kehle und spürte, wie der Schnee meine Jeans an den Knien durchtränkte.
Santa zog mir die Kapuze herunter, griff in mein Haar und zerrte meinen Kopf nach hinten. Die kalte Spitze der Klinge bohrte sich in meinen Hals, und ich spürte, wie ein Tropfen nach unten rann. Blut. Es war dem Kerl ernst. Santa hatte offensichtlich vor, mich auf einem einsamen Parkplatz mitten im Nirgendwo umzubringen, wenn ich nicht machte, was er sagte.
»Hast du einen Namen?«
»Sarah«, stieß ich hervor, woraufhin er härter an meinen Haaren riss.
»Deinen richtigen Namen. Sarah hieß das Mädchen im Diner.«
Ich kapitulierte. »Gray.« Der Atem kondensierte vor meinen Lippen, und Tränen brannten in meinen Augen, während ich den Oberkörper verdrehte, um den brutalen Zug an meinem Haar zu lindern. »Gray Miller.«
»Miller? Wirklich?«
»Standardname, weil das Waisenhaus meine Eltern nicht finden konnte.«
»Sag mir, Gray Miller, hast du die Regeln verstanden?« Die Messerspitze verursachte ein Brennen, als er sie langsam weiter nach unten zog. Nicht weit, vielleicht ein paar Millimeter.
»Ja.«
Er hörte auf, an meinem Haar zu reißen. »Steh auf.«
Ich rappelte mich hoch und klopfte den Schnee von meiner Jeans, zerrte die Kapuze wieder über meinen Kopf und wischte mir die Tränen ab. Als ich meinen Hals betastete, waren meine Fingerkuppen blutig.
Unsicher sah ich Santa an.
»Brauchst du noch mehr Motivation, das zu machen, was ich sage?«
»Nein.«
»Gut.« Er nickte und packte meinen Oberarm, bevor er mit der anderen Hand seinen braunen Jutesack nahm. »Du kommst mit mir.«
KAPITEL2
Santa zerrte mich mitten über den Parkplatz auf die Motelzimmer zu. Dass er noch keinen Schlüssel hatte, erkannte ich, als er mich vor der allerletzten Tür von sich stieß und sagte: »Knack das Schloss.«
Meine Finger zitterten so sehr, dass ich das Dietrich-Set kaum halten konnte. Immer wieder sah ich über meine Schulter, ob jemand kam, bis ich spürte, wie er ungeduldig wurde. Um ehrlich zu sein, hoffte ich auch, vielleicht eine Fluchtmöglichkeit zu finden, aber die freie Fläche hinter uns war nicht optimal. Außerdem brannte die Stelle an meinem Hals, wo Santa mich mit dem Messer geschnitten hatte, und erinnerte mich daran, dass der Mann mir einen Fluchtversuch höchstwahrscheinlich sehr übel nehmen würde.
Endlich klickte es im Inneren des Schlosses, als auch der letzte Stift an die richtige Stelle glitt und ich den Knauf drehen konnte.
»Braves Mädchen«, knurrte der Weihnachtsmann. »Rein mit dir.«
»Bitte, ich …«, fing ich an und leckte mir nervös über die Unterlippe.
»Nicht.« Er funkelte mich an. »Bitte mich jetzt ja nicht, dich gehen zu lassen.«
Meine Knie fühlten sich wie Pudding an, als ich mich aufrichtete und das Zimmer betrat.
Hinter mir fiel die Tür ins Schloss. Dann legte er die Kette vor und nahm sich einen Stuhl von dem kleinen Tisch neben der Küchenzeile, um ihn – genau wie ich es geplant hatte – unter den Türknauf zu klemmen. So schnell würde hier niemand reinkommen. Und ich nicht raus.
Das Licht flammte auf, und Santa zog die Vorhänge zu. Die Wände waren entweder mal weiß gewesen oder cremefarben gestrichen worden. Eine verblichene geblümte Tagesdecke lag auf dem schmalen Doppelbett. Die Nachttischlampe war bloß eine Glühbirne, die von einem Arm hing, der aus der Wand ragte – keine Stehlampe mit Porzellansockel, die ich meinem Entführer gegen den Kopf hätte schmettern können.
Die schmale Küchenzeile war mit einer Kochplatte und einem kleinen Waschbecken ausgestattet, der winzige Kühlschrank summte laut.
Da ich es nicht wagte, mich von der Stelle zu rühren, hatte ich keine Ahnung, was mich möglicherweise im Bad erwartete.
»Zieh die Jacke und die Schuhe aus.« Santa ging an mir vorbei und warf einen Blick ins Badezimmer.
Ich schwankte zwischen Gehorsam und Rebellion. Leider sah er mich aufmerksam an, nachdem er seine Inspektion abgeschlossen hatte, und ich entschied, dass es für den Moment leider smarter war, ihm zu gehorchen.
Der kalte Knoten lag wie ein Stein in meinem Magen, als ich meinen Rucksack abstellte und den Reißverschluss der Jacke öffnete. Ich setzte mich auf die Bettkante und löste die Schnürsenkel, streifte die Schuhe von meinen Füßen.
Santa nickte und packte die große Schnalle seines breiten Gürtels. Als er ihn abgenommen hatte, fiel die Jacke auseinander und enthüllte den künstlichen Bauch, der sich unter einem weißen Unterhemd abzeichnete. Der Ausschnitt war tief genug, damit ich die breiten Brustmuskeln erkennen konnte. Irgendwas sagte mir, dass Santa kein gebrechlicher, alter Mann war.
Er kam zu mir, und bevor mir klar wurde, wie niederträchtig seine Absichten überhaupt waren, packte er mich und schlang den Gürtel um mich. Etwa auf Höhe meiner Ellbogen zog er ihn fest, sodass meine Arme an meinen Körper gepresst wurden.
Dann ging er zu seinem Jutesack und löste das Band, das den Sack oben zusammenhielt. Ich hatte bloß die Möglichkeit, mich vom Bett zu rollen, aber das wollte ich nicht riskieren, denn ohne meine Arme konnte ich den Aufprall nicht abfedern.
Ich versuchte mich aufzurichten, aber in der Sekunde war Santa schon wieder über mir und schlang das Seil um meinen Hals. Das andere Ende band er an dem kleinen Holzknauf fest, der sich oben am Bettrahmen befand. Weil das Seil so kurz war, hatte ich keine Chance, mich auf eine Weise zu drehen, die es mir erlauben würde, mit meinen Händen den Knoten am Knauf zu lösen. Vorher würde ich ersticken.
Wütend starrte ich Santa an.
Er zog den weißen Bart und die Mütze ab. »Muss ich dich knebeln, Gray, oder bist du klug genug, den Mund zu halten?«
Ich dachte prompt daran, was passieren würde, wenn meine Hilfeschreie jemanden wie Larry anlockten. »Mund halten. Ich werde den Mund halten.«
»Gut.« Er packte das Unterhemd und zog es aus, schnallte danach den künstlichen Bauch ab.
Ich wollte ihn nicht anstarren, aber Santa war … verdammt muskulös. Der Kerl hatte definitiv das eine oder andere Fitnessstudio schon mal von innen gesehen. Seine langen Haare hatte er unter seiner Mütze zu einem lässigen Knoten gebunden, und unter Santas Bart verbarg sich sein eigener. Sein Haar war ebenso dunkel wie seine Augen – je nachdem, wie das Licht sich in ihnen brach, glänzte es wie Ebenholz.
Er setzte sich auf die Bettkante und zog die schweren Stiefel aus, bevor er seufzte. »Die Scheißdinger sind eine Nummer zu klein. Aber was anderes war nicht da.«
Ich hoffte inständig, dass dieses Arschloch kein Mitleid erwartete, und hielt meinen Mund.
Er stand auf und streckte sich. »Hör zu, Gray, ich brauche nur ein paar Minuten, dann binde ich dich wieder los, okay?«
Konzentriert starrte ich an die Zimmerdecke und ignorierte ihn.
Er wandte sich ab, nahm den riesigen Jutesack und ging ins Bad. Vermutlich ließ er die Tür offen, damit er frühzeitig gewarnt war, falls ich flüchtete, denn ich hörte sehr deutlich, wie er in die Toilette pinkelte und dann abzog.
Es war nur ein schwacher Trost, dass er sich wenigstens die Hände wusch.
Probehalber wollte ich mich aufrichten, doch die Schlinge um meinen Hals zog sich sofort zu, und ich sank nach hinten, weil ich nicht riskieren wollte, dass sie zusammengezogen blieb und ich elendig erstickte, falls ich mich zu sehr bewegte.
Als ich ein merkwürdiges Klappern hörte, hielt ich inne und lauschte angestrengt.
Schnapp, schnapp, schnapp.
Ich brauchte einen Moment, bis ich es als Schere identifizierte. Was machte er da? Üben, wo er an meinem Körper die Schnitte ansetzen wollte?
Oder er schnitt sich die langen Haare ab. Vielleicht waren sie unter der Mütze mit dem künstlichen Haarteil zu warm.