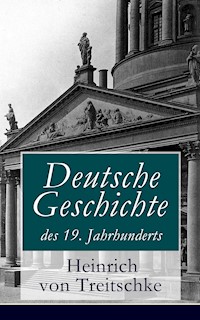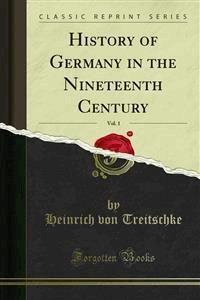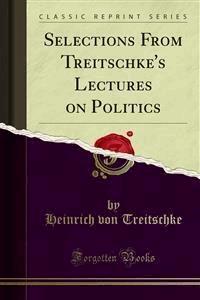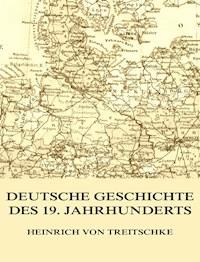Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Dieser Band beinhaltet die wichtigsten Schriften des deutschen Historikers und Mitglied des Reichstages. Inhalt: Die Freiheit. Das deutsche Ordensland Preußen. Luther und Die Deutsche Nation. Gustav Adolf und Deutschlands Freiheit. Milton. Fichte und Die Nationale Idee Königin Luise. Die Völkerschlacht bei Leipzig. Zwei Kaiser. Zum Gedächtnis des großen Krieges. Cavour Lessing. Heinrich von Kleist. Ludwig Uhland. Otto Ludwig. Friedrich Hebbel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1053
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wichtige Schriften
Heinrich von Treitschke
Inhalt:
Heinrich von Treitschke – Biografie und Bibliografie
Wichtige Schriften
Die Freiheit.
Das deutsche Ordensland Preußen.
Luther und die deutsche Nation.
Gustav Adolf und Deutschlands Freiheit.
Milton.
Fichte und die nationale Idee
Königin Luise.
Die Völkerschlacht bei Leipzig.
Zwei Kaiser.
Zum Gedächtnis des großen Krieges.
Cavour
Lessing.
Heinrich von Kleist.
Ludwig Uhland.
Otto Ludwig.
Friedrich Hebbel.
Wichtige Schriften, Heinrich von Treitschke
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849619619
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Heinrich von Treitschke – Biografie und Bibliografie
Die Freiheit.
(Leipzig 1861.)
Wann werden sie jemals aussterben, jene ängstlichen Gemüter, denen es ein Bedürfnis ist, sich die Mühsal des Lebens durch selbstgeschaffene Pein zu erhöhen, denen jeder Fortschritt des Menschengeistes nur ein Anzeichen mehr ist für den Verfall unseres Geschlechtes, für das Nahen des jüngsten Tages? Die große Mehrheit der Zeitgenossen beginnt, Gottlob, wieder recht derb und herzhaft an sich selber zu glauben, doch sind wir schwach genug, mindestens einige der trüben Vorhersagungen jener schwarzsichtigen Geister nachzusprechen. Ein Gemeinplatz geworden ist die Behauptung, die alles beleckende Kultur werde endlich auch die Volkssitten durch eine Menschheitssitte verdrängen und die Welt in einen kosmopolitischen Urbrei verwandeln. Aber es waltet über den Völkern das gleiche Gesetz wie über den einzelnen, welche in der Kindheit geringere Verschiedenheit zeigen als in gereiften Jahren. Hat anders ein Volk überhaupt das Zeug dazu, in dem erbarmungslosen Rassenkampfe der Geschichte sich und sein Volkstum aufrecht zu erhalten, so wird jeder Fortschritt der Gesittung zwar sein äußeres Wesen den anderen Völkern näher bringen, aber die feineren, tieferen Eigenheiten seines Charakters nur um so schärfer ausbilden. Wir fügen uns alle der Tracht von Paris, wir sind durch tausend Interessen mit den Nachbarvölkern verbunden; doch unsere Empfindungen und Ideen stehen heute der Gedankenwelt der Franzosen und Briten unzweifelhaft selbständiger gegenüber als vor siebenhundert Jahren, da der Bauer überall in Europa in der Gebundenheit altväterischer Sitte dahinlebte, der Geistliche in allen Ländern aus denselben Quellen sein Wissen schöpfte, der Adel der lateinischen Christenheit sich unter den Mauern von Jerusalem einen gemeinsamen Ehren- und Sittenkodex schuf. Noch ist der lebendige Ideenaustausch zwischen den Völkern, dessen die Gegenwart mit Recht sich rühmt, niemals ein bloßes Geben und Empfangen gewesen.
In dieser tröstlichen Erkenntnis werden wir bestärkt, wenn wir sehen, wie die Ideen eines deutschen Klassikers über den höchsten Gegenstand männlichen Denkens, über die Freiheit, neuerdings von zwei ausgezeichneten politischen Denkern Frankreichs und Englands auf sehr eigentümliche Weise weitergebildet worden sind. Als vor einigen Jahren Wilhelm von Humboldts Versuch über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zum ersten Male vollständig erschien, da erregte die geistvolle Schrift auch in Deutschland einiges Aufsehen. Wir freuten uns, einen tieferen Einblick zu gewinnen in den Werdegang eines unserer ersten Männer. Die feineren Geister spürten mit Entzücken den belebenden Hauch des goldenen Zeitalters deutscher Humanität, denn wohl nur in Schillers nahverwandten Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts ist das heitere Idealbild schöner Menschlichkeit, das die Deutschen jener Zeit begeisterte, ebenso beredt und vornehm geschildert worden. Unsere Politiker aber blieben von der Schrift fast unberührt. Dem geistvollen Jünglinge, der soeben den ersten Blick getan in das selbstgenügsame Formelwesen der Bureaukratie Friedrich Wilhelms II. und sich von diesem leblosen Treiben erkältet anwandte, um daheim einer ästhetischen Muße zu leben – ihm war wohl zu verzeihen, daß er sehr niedrig dachte vom Staate. Dalberg hatte ihn aufgefordert, das Büchlein zu schreiben – ein Fürst, der alle Güter des Lebens durch eine allwissende und allfürsorgende Verwaltung mit vollen Händen über sein Land auszustreuen gedachte. Um so eifriger betonte der junge Denker, der Staat sei nichts anderes als eine Sicherheitsanstalt, er dürfe nimmermehr weder mittelbar noch unmittelbar auf die Sitten oder den Charakter der Nation einwirken; der Mensch sei dann am freiesten, wenn der Staat das mindeste leiste. Wir Nachlebenden wissen nur zu wohl: das alte deutsche Staatswesen ging eben daran zu Grunde, daß alle freien Köpfe sich so krankhaft feindselig zum Staate stellten, daß sie den Staat flohen, wie der Jüngling Humboldt, statt ihm zu dienen, wie Humboldt der Mann, und ihn zu heben durch den Adel ihrer freien Menschenbildung. Die Lehre, welche im Staate nur eine Schranke, ein notwendiges Übel steht, erscheint der deutschen Gegenwart als überwunden. Doch seltsam, diese Jugendschrift Humboldts wird jetzt von John Stuart Mill in der Schrift On liberty und von Ed. Laboulaye in dem Aufsätze l'Etat et ses limites als eine Fundgrube politischer Weisheit für die Leiden der neuesten Zeit verherrlicht.
Mill ist ein treuer Sohn jener echtgermanischen Mittelklassen Englands, welche seit den Tagen Richards II. im Guten wie im Bösen, durch ernsten Wahrheitstrieb wie durch finsteren, fanatischen Glaubenseifer, die Innerlichkeit, die geistige Arbeit dieses Landes vorzugsweise vertreten haben. Er ist ein reicher Mann geworden, seit er das köstlichste Kleinod unseres Volkes, den deutschen Idealismus, entdeckt und erkannt hat. Von dieser freien Warte herab sagt er der Befangenheit seiner Landsleute und leider auch der deutschen Gegenwart Worte des Tadels, bittere Worte, wie sie nur der gefeierte Nationalökonom ungestraft reden durfte. Aber als ein echter Engländer, als ein Schüler Benthams, prüft er die Ideen Kants an dem Maße des Nützlichen, natürlich des "wohlverstandenen, dauernden" Nutzens, und zeigt damit selber die tiefe Kluft, welche das geistige Schaffen dieser beiden Völker immer trennen wird. Er schwankt zwischen englischer und deutscher Weltanschauung – in der Schrift über die Freiheit wie in seinem späteren Werke Utilitarianism – und hilft sich endlich, indem er den rein materialistischen Gedanken Benthams einen idealen Sinn unterschiebt, der sie dem deutschen Wesen nahe bringt. An der Hand des Apostels deutscher Humanität gelangt er dazu, das nordamerikanische Staatsleben zu preisen, welches von der schönen Menschlichkeit des deutschhellenischen Klassizismus wenig oder gar nichts aufzuweisen hat. Laboulaye dagegen zählt zu jener kleinen Schule einsichtiger Liberaler, welche in der Zentralisation Frankreichs die Schwäche ihres Vaterlandes erkennt und die Keime germanischer Gesittung, die dort unter dem keltisch-romanischen Wesen schlummern, wieder zu erwecken trachtet. Mehr kühn als gründlich springt der geistreiche Mann mit den historischen Tatsachen um; er meint kurzweg, erst das Christentum habe den Wert und die Würde der Person erkannt. Nun muß unser herrlicher Heide Humboldt durchaus ein christlicher Philosoph sein, nun muß im neunzehnten Jahrhundert das Zeitalter nahen, da die Ideen des Christentums sich vollständig verwirklichen und das Individuum herrschen wird, nicht der Staat. Der Franzose wird unter zahlreichen Lesern nur eine kleine Gemeinde von Gläubigen finden. Mills Buch dagegen ist von seinen Landsleuten mit dem höchsten Beifall aufgenommen worden. Man hat es das Evangelium des neunzehnten Jahrhunderts genannt. In der Tat schlagen beide Schriften Töne an, welche in der Brust jedes modernen Menschen mächtigen Widerhall finden; darum ist lehrreich zu prüfen, ob sie wirklich die Grundsätze echter Freiheit predigen.
Haben wir auch gelernt, die Worte des griechischen Philosophen tiefer zu begründen und ihnen einen reicheren Inhalt zu geben, so ist doch kein Denker über jene Erklärung der Freiheit hinausgekommen, welche Aristoteles gefunden. Er meint in seiner erschöpfenden empirischen Weise, die Freiheit umfasse zwei Dinge: die Befugnis der Bürger nach ihrem Belieben zu leben, und die Teilnahme der Bürger an der Staatsregierung (das abwechselnde Regieren und Regiertwerden). Die Einseitigkeit, welche der Hebel alles menschlichen Fortschreitens ist, bewirkt, daß die Völker fast niemals dem vollen Freiheitsbegriffe nachstrebten. Vielmehr ist bekannt, wie die Griechen sich mit Vorliebe an dieses letztere, an die politische Freiheit im engeren Sinne, hielten und einem schönen und guten Gesamtdasein willig die freie Bewegung des Menschen zum Opfer brachten. Gar so ausschließlich, wie gemeinhin behauptet wird, war die Vorliebe der Alten für die politische Freiheit freilich nicht. Jenes Wort des griechischen Denkers beweist ja, daß ihnen das Verständnis für das Leben nach eigenem Belieben, für die bürgerliche, persönliche Freiheit keineswegs fehlte. Aristoteles weiß sehr wohl, daß auch eine Staatsgewalt denkbar ist, welche nicht das gesamte Volksleben umfaßt; er sagt ausdrücklich, die Staaten unterscheiden sich voneinander besonders dadurch, ob alles oder nichts oder wie vieles den Bürgern gemeinsam sei. Jedenfalls blieb in dem ausgewachsenen Staate des Altertums die Vorstellung vorherrschend, daß der Bürger nur ein Teil des Staates ist, die rechte Tugend nur im Staate sich verwirklicht. Darum befassen sich die politischen Denker der Alten bloß mit den Fragen: wer soll herrschen im Staate? und wie soll der Staat geschützt werden? Nur als eine leise Ahnung regt sich dann und wann die tiefere Frage: wie soll der Bürger vor dem Staate geschützt werden? Den Alten steht fest, daß eine Gewalt, welche ein Volk über sich selber ausübt, keiner Beschränkung bedarf. Wie anders die Freiheitsbegriffe der Germanen, welche durchgängig auf das unbeschränkte Recht der Persönlichkeit das Hauptgewicht legen! Überall im Mittelalter beginnt der Staat mit einem unversöhnlichen Kampfe der Staatsgewalt gegen die staatsfeindlichen Unabhängigkeitsgelüste der einzelnen, der Genossenschaften, der Stände; und wir Deutschen haben am eigenen Leibe erfahren, mit welchen Verlusten an Macht und echter Freiheit die "Libertät" der Kleinfürsten, die "habenden Freiheiten der Herren Stände" erkauft werden. Ist dann endlich in diesem Streite, den bei den Neueren die absolute Monarchie glorreich hinausgeführt hat, die Majestät, die Einheit des Staates gerettet, so geht eine Wandlung vor in den Freiheitsbegriffen der Völker, und ein neuer Hader beginnt. Nicht mehr versucht man den einzelnen loszureißen von einer Staatsgewalt, deren Notwendigkeit begriffen worden. Aber man verlangt, daß die Staatsgewalt nicht unabhängig dem Volke gegenüber stehe; eine wirkliche Volksgewalt soll sie werden, wirkend innerhalb fester Formen und an den Willen der Mehrheit der Bürger gebunden.
Jedermann weiß, wie unendlich weit unser Vaterland noch von diesem Ziele entfernt ist. Noch immer ist für den Deutschen eine schwierige, lohnende Aufgabe, was vor nahezu hundert Jahren Vittorio Alfieri als seinen Lebenszweck hinstellte:
di far con penna ai falsi imperi offesa.
Noch heute wiederholt mancher deutsche Heißsporn die grimmige Frage Alfieris: ob ein Mann voll Bürgersinnes unter dem Joche der Gewaltherrschaft es verantworten dürfe, Kinder zu erzeugen? – Wesen ins Dasein zu rufen, welche, je wacher ihr Gewissen, je fester ihr Rechtsgefühl, nur um so schwerer leiden müssen unter jener Verkehrung aller Begriffe von Ehre, Recht und Scham, womit die Tyrannei ein Volk verpestet? Aber es ist den Völkern geschehen, was Alfieri an sich selbst erlebte. Als er im Mannesalter das wilde Pamphlet "über die Tyrannei" herausgab, das der Jüngling einst in heiligem Eifer niedergeschrieben, da mußte er selbst gestehen: mir würde heute der Mut, oder, richtiger zu reden, die Wut mangeln, welche nötig war, ein solches Buch zu verfassen. Mit ähnlichen Empfindungen blicken heute die Völker auf den abstrakten Tyrannenhaß des vergangenen Jahrhunderts. Wir fragen nicht mehr: come si debbe morire nella tirannide , sondern mit gefaßter, unerschütterlicher Zuversicht stehen wir inmitten des Kampfes um die politische Freiheit, dessen Ausgang längst nicht mehr bezweifelt werden kann. Denn auch über diesem Streite hat das gemeine Los alles Menschlichen gewaltet, auch diesmal sind die Gedanken der Völker den Zuständen der Wirklichkeit um ein Großes vorangeeilt. Wie leblos, wie unfruchtbar stehen doch die Männer des Absolutismus den Freiheitsforderungen der Völker gegenüber! Nicht zwei mächtige Gedankenströme rauschen in mächtigem Wogenschwall aufeinander, bis endlich aus dem wilden Wirbel eine neue mittlere Strömung gelassen entweicht. Nein, ein Strom brandet gegen einen festen Damm und bahnt sich durch tausend und tausend Ritzen seinen Weg. Alles Neue, was dies neunzehnte Jahrhundert geschaffen, ist ein Werk des Liberalismus. Die Feinde der Freiheit wissen nur beharrlich zu verneinen oder die Gedanken längst versunkener Tage zum Scheine eines neuen Lebens wachzurufen, oder endlich, sie entlehnen die Waffen ihren Feinden. Auf der Rednerbühne unserer Kammern, mit der freien Presse, die sie den Liberalen verdanken, mit Schlagwörtern, die sie den Gegnern abgelauscht, verfechten sie Grundsätze, welche, durchgeführt, jede Preßfreiheit, jedes parlamentarische Leben vernichten müßten.
Überall, sogar in Ständen, die vor fünfzig Jahren noch jedem politischen Gedanken sich verschlossen, lebt still und fest der Glaube an die Wahrheit jenes großen Wortes, das mit feiner bewußten Bestimmtheit den Markstein einer neuen Zeit bezeichnet, an den Ausspruch der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten: "die gerechten Gewalten der Regierungen kommen her von der Zustimmung der Regierten." So unzweifelhaft ist diese Idee den modernen Menschen, daß sogar ein Gentz den gehaßten Vorkämpfern der Freiheit widerwillig zustimmen mußte, als er fügte, nur so lange dürfe die Staatsgewalt Opfer von dem Bürger fordern, als dieser den Staat seinen Staat nennen könne. Und so alt, so nach allen Seiten durchgearbeitet, so dem Austrage nahe sind diese Freiheitsfragen, daß bereits über die meisten derselben eine Versöhnung und Läuterung der Meinungen sich vollzogen hat. Begriffen ward endlich, daß der Kampf um die politische Freiheit kein Streit ist zwischen Republik und Monarchie, sondern das "Regieren und zugleich Regiertwerden" des Volkes in beiden Staatsformen gleich ausführbar ist. Nur ein Folgesatz der politischen Freiheit bleibt noch heute ein Gegenstand erbitterten, leidenschaftlichen Meinungskampfes. Bildet nämlich das sittliche Bewußtsein des Volkes in Wahrheit die letzte rechtliche Grundlage des Staates, wird das Volk in Wahrheit nach seinem eigenen Willen und zu seinem eigenen Glücke regiert, so erhebt sich von selbst das Verlangen nach nationaler Abschließung der Staaten. Denn nur wo das lebendige zweifellose Bewußtsein des Zusammengehörens alle Glieder des Staates durchdringt, ist der Staat, was er seiner Natur nach sein soll, das einheitlich organisierte Volk. Daher der Drang fremdartige Volkselemente auszuscheiden, und in zersplitterten Nationen der Trieb, das engere der beiden "Vaterländer" abzuschütteln. Es ist nicht unsere Absicht zu schildern, wie vielfachen notwendigen Beschränkungen und Abschwächungen diese politische Freiheit unterliegt. Genug, die Forderung einer Regierung der Völker nach ihrem Willen besteht überall, sie wird erhoben so allgemein und gleichmäßig, wie nie zuvor in der Geschichte, und wird schließlich ebenso gewiß befriedigt werden, als das Dasein der Völker dauernder, berechtigter, stärker ist denn das Leben der widerstrebenden Mächtigen.
Doch sehen wir den Dingen auf den Grund, betrachten wir, wie gänzlich unsere Freiheitsbegriffe sich verwandelt haben in diesem vielgestaltigen Kampfe, dessen Zuschauer und Mitspieler wir selber sind. Nicht mehr mit dem Übermute, mit der unbestimmten Begeisterung der Jugend stehen wir den Freiheitsfragen gegenüber. Politische Freiheit ist politisch beschränkte Freiheit – dieser Satz, vor wenigen Jahrzehnten noch knechtisch gescholten, wird heute von jedem anerkannt, der eines politischen Urteils fähig ist. Und wie unbarmherzig hat eine harte Erfahrung alle jene Wahnbegriffe zerstört, welche sich unter dem großen Namen Freiheit versteckten! Die Freiheitsgedanken, welche während der französischen Revolution vorherrschten, waren ein unklares Gemisch aus den Ideen Montesquieus und den halb-antiken Begriffen Rousseaus. Man wähnte den Bau der politischen Freiheit vollendet, wenn nur die gesetzgebende Gewalt von der ausübenden und von der richterlichen getrennt sei und jeder Bürger gleichberechtigt die Abgeordneten zur Nationalversammlung wählen helfe. Diese Forderungen wurden erfüllt, im reichsten Maße erfüllt, und was war erreicht? Der scheußlichste Despotismus, den Europa je gesehen. Der Götzendienst, den unsere Radikalen allzulange mit den Greueln des Konventes getrieben, beginnt endlich zu verstummen vor der trivialen Erwägung: wenn eine allmächtige Staatsgewalt mir den Mund verbietet, mich zwingt, meinen Glauben zu verleugnen und mich guillotiniert, sobald ich dieser Willkür trotze, so ist sehr gleichgültig, ob diese Gewaltherrschaft geübt wird von einem erblichen Fürsten oder von einem Konvente; Knechtschaft ist das eine wie das andere. Gar zu handgreiflich scheint doch der Trugschluß in dem Satze Rousseaus, daß, wo alle gleich sind, jeder sich selber gehorche. Vielmehr, er gehorcht der Mehrheit, und was hindert, daß diese Mehrheit ebenso tyrannisch verfahre wie ein gewissenloser Monarch?
Wenn wir die fieberischen Zuckungen betrachten, welche seit siebzig Jahren die trotz alledem große Nation jenseits des Rheins geschüttelt haben, so finden wir beschämt, daß die Franzosen trotz aller Begeisterung für die Freiheit immer nur die Gleichheit gekannt haben, doch nie die Freiheit. Die Gleichheit aber ist ein inhaltsloser Begriff, sie kann ebensowohl bedeuten: gleiche Knechtschaft aller – als: gleiche Freiheit aller. Und sie bedeutet dann gewiß das erstere, wenn sie von einem Volke als einziges, höchstes politisches Gut erstrebt wird. Der höchste denkbare Grad der Gleichheit, der Kommunismus, ist, weil er die Unterdrückung aller natürlichen Neigungen voraussetzt, der höchste denkbare Grad der Knechtschaft. Nicht zufällig, fürwahr, regt sich der leidenschaftliche Gleichheitsdrang vornehmlich in jenem Volke, dessen keltisches Blut immer und immer wieder seine Lust daran findet, sich in blinder Unterwürfigkeit um eine große Cäsarengestalt zu scharen, mag diese nun Vercingetorix, Ludwig XIV. oder Napoleon heißen. Wir Germanen pochen zu trotzig auf das unendliche Recht der Person, als daß wir die Freiheit finden könnten in dem allgemeinen Stimmrechte; wir entsinnen uns, daß auch in manchen geistlichen Orden die Oberen durch das allgemeine Stimmrecht gewählt werden, und wer in aller Welt hat je die Freiheit in einem Nonnenkloster gesucht? Der Geist der Freiheit, wahrlich, ist es nicht, der aus der Verkündigung Lamartines vom Jahre 1848 redet: "jeder Franzose ist Wähler, also Selbstherrscher; kein Franzose kann zu dem anderen sagen: du bist mehr ein Herrscher als ich." Welcher Trieb des Menschen wird durch solche Worte befriedigt? Kein anderer, als der gemeinste von allen, der Neid! Auch die Begeisterung Rousseaus für das Bürgertum der Alten hält nicht stand vor ernster Prüfung. Die Bürgerherrlichkeit von Athen ruhte auf der breiten Unterlage der Sklaverei, der Mißachtung jedes wirtschaftlichen Schaffens, während wir Neueren unseren Ruhm finden in der Achtung jedes Menschen, in der Erkenntnis des Adels der Arbeit, jeglicher ehrlicher Arbeit. Der starrste Aristokrat der modernen Welt erscheint als ein Demokrat neben jenem Aristoteles, der unbefangen die Worte schrecklicher Herzenshärtigkeit spricht: "es ist nicht möglich, daß Werke der Tugend übe, wer das Leben eines Handarbeiters führt."
Durch solche Erwägungen wurden schon längst die tieferen Naturen veranlaßt, sorgsamer zu betrachten, auf welchen Grundlagen die vielbeneidete Freiheit der Briten ruht. Sie fanden, daß dort keine allmächtige Staatsgewalt die Geschicke der fernsten Gemeinde bestimmt, sondern jede kleinste Grafschaft ihre Verwaltung selber in der Hand hält. Diese Erkenntnis der segensreichen Wirkung des Selfgovernment war ein ungeheuerer Fortschritt; denn der entnervende Einfluß eines alles bevormundenden Staates auf die Bürger läßt sich kaum düster genug schildern, er ist darum so unheimlich, weil die Krankheit des Volkes erst in einem späteren Geschlechte in ihrer ganzen Größe sich offenbart. Solange das Auge des großen Friedrich über seinen Preußen wachte, hob der Anblick des Helden auch kleine Seelen über ihr eigenes Maß empor, seine Wachsamkeit spornte die Trägen. Doch als er dahinging, hinterließ er ein Geschlecht ohne Willen, gewohnt – wie Napoleon III. von seinen Franzosen rühmt – jeden Antrieb zur Tat vom Staate zu erwarten, geneigt zu jener Eitelkeit, welche das Gegenteil echten nationalen Stolzes ist, fähig einmal aufzuwallen in flüchtiger Begeisterung für die Idee der Staatseinheit, aber unfähig sich selber zu beherrschen, unfähig zu der größten Arbeit, die den modernen Völkern auferlegt ist. Zu kolonisieren, den Segen abendländischer Gesittung unter die Barbaren zu tragen vermögen nur solche Bürger, welche im Selfgovernment gelernt haben, im Notfalle als Staatsmänner zu handeln. Die Besorgung der Gemeindeangelegenheiten durch besoldete Staatsbeamte mag technisch vollkommener sein und dem Grundsatze der Arbeitsteilung besser entsprechen; jedoch ein Staat, der seine Bürger in Ehrenämtern die Sorge für Kreis und Gemeinde freiwillig tragen läßt, gewinnt in dem Selbstgefühle, in der lebendigen, praktischen Vaterlandsliebe der Bürger sittliche Kräfte, welche ein alleinherrschendes Staatsbeamtentum niemals entfesseln kann. – Sicherlich, diese Erkenntnis war eine bedeutsame Vertiefung unserer Freiheitsbegriffe, aber sie enthielt keineswegs die ganze Wahrheit. Denn fragen wir, wo dies Selfgovernment aller kleinen örtlichen Kreise besteht, so entdecken wir mit Erstaunen, daß die zahlreichen kleinen Stämme der Türkei sich dieses Segens in hohem Maße erfreuen. Sie zahlen ihre Steuern, im übrigen leben sie ihrer Neigung, hüten ihre Schweine, jagen, schlagen sich gegenseitig tot und befinden sich vortrefflich dabei – bis plötzlich einmal der Pascha unter das Völkchen fährt und durch Pfählen und Säcken handgreiflich erweist, daß die Selbstregierung der Gemeinden ein Traum ist, wenn nicht die oberste Staatsgewalt innerhalb fester gesetzlicher Schranken wirkt.
So gelangen wir endlich zu der Einsicht: die politische Freiheit ist nicht, wie die Napoleons sagen, eine Zierde, die man dem vollendeten Staatsbau wie eine goldene Kuppel aufsetzen mag, sie muß den ganzen Staat durchdringen und beseelen. Sie ist ein tiefsinniges, umfassendes, wohlzusammenhängendes System politischer Rechte, das keine Lücke duldet. Kein Parlament ohne freie Gemeinden, diese nicht ohne jenes, und beide nicht auf die Dauer, wenn nicht auch die Mittelglieder zwischen der Spitze des Staates und den Gemeinden, die Kreise und Bezirke, verwaltet werden unter Zuziehung der Selbsttätigkeit unabhängiger Bürger. Diese Lücken empfinden wir Deutschen seit langem schmerzlich und machen soeben die ersten bescheidenen Versuche, sie auszufüllen.
Doch ein Staat, beherrscht von einer durch die Mehrheit des Volkes getragenen Regierung, mit einem Parlamente, mit unabhängigen Gerichten, mit Kreisen und Gemeinden, die sich selber verwalten, ist mit alledem noch nicht frei. Er muß seinem Wirken eine Schranke setzen, er muß anerkennen: es gibt persönliche Güter, so hoch und unantastbar, daß der Staat sie nimmer sich unterwerfen darf. Spotte man nicht allzudreist über die Grundrechte der neueren Verfassungen. Sie enthalten mitten unter Phrasen und Torheit die Magna Charta der persönlichen Freiheit, worauf die moderne Welt nicht wieder verzichten wird. Freie Bewegung in Glauben und Wissen, in Handel und Wandel ist die Losung der Zeit: auf diesem Gebiete hat sie ihr Größtes geleistet; diese soziale Freiheit bildet für die große Mehrzahl der Menschen den Inbegriff aller politischen Wünsche. Man darf sagen, wo immer der Staat sich entschloß, einen Zweig des geselligen Wirkens ungehemmt sich entfalten zu lassen, da ward seine Mäßigung herrlich belohnt; alle Wahrsagungen ängstlicher Schwarzseher fielen zu Boden. Wir sind ein anderes Volk geworden, seit uns der Weltverkehr hineinzog in sein Wagen und Werben. Vor zwei Menschenaltern noch erklärte Ludwig Bincke als sorgsamer Präsident seinen Westfalen, wie man es anfangen müsse, um nach englischem Muster eine Landstraße auf Aktien zu bauen. Heute überspannt ein dichtes Netz freier Genossenschaften jeder Art den deutschen Boden. Wir wissen: durch seinen Kaufmann mindestens wird auch der Deutsche teilnehmen an der edlen Bestimmung unserer Rasse, daß sie die weite Erde befruchten soll. Und schon ist kein leerer Traum, daß aus diesem Weltverkehre dereinst eine Staatskunst entstehen wird, vor deren weltumspannendem Blicke alles Schaffen der heutigen Großmächte wie armselige Kleinstaaterei erscheinen wird. – So unermeßlich reich und vielgestaltig ist das Wesen der Freiheit. Darin liegt die tröstliche Gewißheit, daß zu keiner Zeit unmöglich ist, für den Sieg der Freiheit zu wirken. Denn gelingt wohl einer Regierung zeitweise die Teilnahme des Volkes an der Gesetzgebung zu untergraben: nur um so heftiger wird sich der Freiheitsdrang der modernen Menschen auf das wirtschaftliche oder auf das geistige Schaffen werfen, und die Erfolge auf dem einen Gebiete greifen früher oder später auf das andere hinüber. Überlassen wir den Knaben und jenen Völkern, die immer Kinder bleiben, mit leidenschaftlicher Hast der Freiheit nachzujagen wie einem Phantome, das den Gierigen unter den Händen zerfließt. Ein reifes Volk liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib: sie lebt und webt mit uns, sie entzückt uns Tag für Tag durch neue Reize.
Aber mit der steigenden Gesittung ergeben sich neue, ungeahnte Gefahren für die Freiheit. Nicht bloß die Staatsgewalt kann tyrannisch sein; auch die nicht organisierte Mehrheit der Gesellschaft kann durch die langsam und unmerklich, doch unwiderstehlich wirkende Macht ihrer Meinung die Gemüter der Bürger gehässigem Zwange unterwerfen. Und ohne Zweifel ist die Gefahr, daß die selbständige Ausbildung der Persönlichkeit durch die Meinung der Gesamtheit in unzulässiger Weise beschränkt werde, in demokratischen Staaten besonders groß. Denn, war in der Unfreiheit des alten Regimentes mindestens einigen bevorzugten Volksklassen vergönnt, die persönliche Begabung ungehemmt und im Guten wie im Bösen glänzend zu entfalten, so ist der Mittelstand, welcher Europas Zukunft bestimmen wird, nicht frei von einer gewissen Vorliebe für das Mittelmäßige, Er ist mit Recht stolz darauf, daß er alles, was über ihn emporragt, zu sich herabzuziehen, alle unter ihm Stehenden zu sich emporzuheben sucht; und er darf sein Verlangen, im Leben der Staaten zu entscheiden, auf einen rühmlichen Rechtstitel stützen, auf eine große Tat, welche er und mit ihm die alte Monarchie vollzogen hat: auf die Emanzipation unserer niederen Stände. Aber wehe uns, wenn dieser Gleichheitstrieb, der auf dem Gebiete des gemeinen Rechtes die köstlichsten Früchte gezeitigt hat, sich verirrt auf das Gebiet der individuellen Bildung! Der Mittelstand haßt jede offene gewalttätige Tyrannei, doch er ist sehr geneigt, durch den Bannstrahl der öffentlichen Meinung alles zu ächten, was sich über ein gewisses Durchschnittsmaß der Bildung, des Seelenadels, der Kühnheit emporhebt. Die Friedensliebe, welche ihn auszeichnet und ihn an sich zu dem politisch fähigsten Stande macht, kann nur zu leicht ausarten in träges Behagen, in das gedankenlose, schläfrige Bestreben, alle Gegensätze des geistigen Lebens zu vertuschen und zu bemänteln, nur im Bereiche des materiellen Wirkens (des improvement !) ein reges Schaffen zu dulden. Nicht leere Vermutungen sind es, die wir hier aussprechen. Vielmehr drückt in den freiesten Großstaaten der Neuzeit, in England und den Vereinigten Staaten, das Joch der öffentlichen Meinung schwerer als irgendwo. Der Kreis dessen, was die Gesamtheit dem Bürger als ehrbar und anständig zu denken und zu tun erlaubt, ist dort unvergleichlich enger als bei uns. Wer Kunde hat von den denkwürdigen Verfassungsberatungen der Konvention von Massachusetts aus dem Jahre 1853, wer es weiß, wie damals mit Geist und Leidenschaft die Lehre verfochten ward: "ein Bürger kann wohl Untertan einer Partei sein oder einer tatsächlichen Gewalt (!), aber niemals Untertan des Staates," der wird die Gefahr eines Rückfalles in Zustande harter Sitte und schwachen Rechtes, die Gefahr einer sozialen Tyrannei der Mehrheit nicht unterschätzen. Dies hat Mill vortrefflich erkannt, und hierin liegt die Bedeutung seines Buches für die Gegenwart. Er untersucht, ganz abgesehen von der Regierungsform, die Natur und die Grenzen der Gewalt, welche füglich die Gesellschaft über den einzelnen ausüben soll. Humboldt sah die Gefahr für die persönliche Freiheit nur im Staate, er dachte kaum daran, daß die Gesellschaft schöner und vornehmer Geister, welche mit ihm verkehrte, den einzelnen je an der allseitigen Ausbildung seiner Persönlichkeit hindern könnte. Wir aber wissen nunmehr, daß es nicht bloß eine "freie Geselligkeit", sondern auch eine tyrannische öffentliche Meinung geben kann.
Um zu verstehen, in welcher Ausdehnung die Gesellschaft ihre Gewalt über den einzelnen ausüben solle, gilt es zunächst eine Frage wohlgemut über Bord zu werfen, womit die politischen Denker sich unnötigerweise viele böse Stunden bereitet haben, die Frage nämlich: ist der Staat nur ein Mittel zur Beförderung der Lebenszwecke der Bürger? oder hat die Wohlfahrt der Bürger nur den Zweck, ein schönes und gutes Gesamtdasein herbeizuführen? Humboldt, Mill und Laboulaye, sowie der gesamte Liberalismus der Rotteck-Welckerschen Schule entscheiden sich für das erstere, die Alten bekanntlich für das letztere. Mir scheint, die eine Meinung taugt so wenig wie die andere; der Streit betrifft, wie Falstaff sagt, eine gar nicht aufzuwerfende Frage. Denn alle Welt gibt zu, daß ein Verhältnis gegenseitiger Rechte und Pflichten den Staat mit seinen Bürgern verbindet. Zwischen Wesen aber, welche sich zueinander nur wie Mittel und Zweck verhalten, ist eine Gegenseitigkeit undenkbar. Der Staat ist sich selbst Zweck wie alles Lebendige: denn wer darf leugnen, daß der Staat ein ebenso wirkliches Leben führt wie jeder seiner Bürger? Wie wunderlich, daß wir Deutschen aus unserer Kleinstaaterei heraus einen Franzosen und einen Engländer mahnen müssen, größer zu denken vom Staate! Mill und Laboulaye leben beide in einem mächtigen, geachteten Staate, sie nehmen diesen reichen Segen hin als selbstverständlich und sehen in dem Staate nur die erschreckende Macht, welche die Freiheit des Menschen bedroht. Uns Deutschen ist durch schmerzliche Entbehrung der Blick geschärft worden für die Würde des Staats. Wenn wir unter Fremden nach unserem "engeren Vaterlande" gefragt werden, und bei den Namen Reuß jüngerer Linie oder Schwarzburg-Sondershausens Oberherrschaft ein spöttisches Lachen um die Lippen der Hörer spielt, dann empfinden wir wohl, daß der Staat etwas Größeres ist als ein Mittel zur Erleichterung unseres Privatlebens. Seine Ehre ist die unsere, und wer nicht auf seinen Staat mit begeistertem Stolze schauen kann, dessen Seele entbehrt eine der höchsten Empfindungen des Mannes. Wenn heute unsere besten Männer danach trachten, diesem Volke einen Staat zu schaffen, welcher Achtung verdient, so beseelt sie dabei nicht bloß der Wunsch, fortan gesicherter ihr persönliches Dasein zu verbringen; sie wissen, daß sie eine sittliche Pflicht erfüllen, welche jedem Volke auferlegt ist.
Der Staat, der die Ahnen mit seinem Rechte schirmte, den die Väter mit ihrem Leibe verteidigten, den die Lebenden berufen sind auszubauen und höher entwickelt Kindern und Kindeskindern zu vererben, der also ein heiliges Band bildet zwischen vielen Geschlechtern, er ist eine selbständige Ordnung, die nach ihren eigenen Gesetzen lebt. Niemals können die Ansichten der Regierenden und der Regierten sich gänzlich decken; sie werden im freien und reifen Staate zwar zu demselben Ziele gelangen, aber auf weit verschiedenen Wegen. Der Bürger fordert vom Staate das höchstmögliche Maß persönlicher Freiheit, weil er sich selber ausleben, alle seine Kräfte entfalten will. Der Staat gewährt es, nicht weil er dem einzelnen Bürger gefällig sein will, sondern weil er sich selber, das Ganze, im Auge hat: er muß sich stützen auf seine Bürger, in der sittlichen Welt aber stützt nur was frei ist, was auch widerstehen kann. So bildet allerdings die Achtung, welche der Staat der Person und ihrer Freiheit erweist, den sichersten Maßstab seiner Kultur; aber er gewährt diese Achtung zunächst deshalb, weil die politische Freiheit, deren der Staat selber bedarf, unmöglich wird unter Bürgern, die nicht ihre eigensten Angelegenheiten ungehindert selbst besorgen.
Diese unlösbare Verbindung der politischen und der persönlichen Freiheit, überhaupt das Wesen der Freiheit als eines fest zusammenhängenden Systems edler Rechte hat weder Mill noch Laboulaye recht verstanden. Jener, im Vollgenusse des englischen Bürgerrechts, setzt die politische Freiheit stillschweigend voraus; dieser, unter dem Drucke des Bonapartismus, wagt vorderhand nicht daran zu denken. Und doch führt die persönliche Freiheit ohne die politische zur Auflösung des Staates. Wer im Staate nur ein Mittel sieht für die Lebenszwecke der Bürger, muß folgerecht nach gut mittelalterlicher Weise die Freiheit vom Staate, nicht die Freiheit im Staate fordern. Die moderne Welt ist diesem Irrtume entwachsen. Noch weniger indes mag ein Geschlecht, das überwiegend sozialen Zwecken lebt und nur einen kleinen Teil seiner Zeit dem Staate widmen kann, in den entgegengesetzten Irrtum der Alten verfallen. Diese Zeit ist berufen, die unvergänglichen Ergebnisse der Kulturarbeit, auch der politischen Arbeit des Altertums und des Mittelalters in sich aufzunehmen und fortzubilden. So gelangt sie zu der vermittelnden und dennoch selbständigen Erkenntnis: für den Staat besteht die physische Notwendigkeit und die sittliche Pflicht, alles zu befördern, was der persönlichen Ausbildung seiner Bürger dient. Und wieder besteht für den einzelnen die physische Notwendigkeit und die sittliche Pflicht, an einem Staate teilzunehmen und ihm jedes persönliche Opfer zu bringen, das die Erhaltung der Gesamtheit fordert, sogar das Opfer des Lebens. Und zwar unterliegt der Mensch dieser Pflicht nicht bloß darum, weil er nur als ein Bürger ein ganzer Mensch werden kann, sondern auch weil es ein historisches Gebot ist, daß die Menschheit Staaten, schöne und gute Staaten bilde. Die historische Welt ist überreich an solchen Verhältnissen gegenseitiger Rechte, gegenseitiger Abhängigkeit; in ihr erscheint jedes Bedingte zugleich als ein Bedingendes. Eben dies erschwert scharfen mathematischen Köpfen, die wie Mill gern mit einem radikalen Gesetze durchschneiden, oftmals das Verständnis der politischen Dinge.
Mill versucht nun der Wirksamkeit der Gesellschaft ihre erlaubten Grenzen zu ziehen mit dem Satze: eine Einmischung der Gesellschaft in die persönliche Freiheit rechtfertigt sich nur dann, wenn sie notwendig ist, um die Gesamtheit selbst zu schützen oder eine Benachteiligung anderer zu verhindern. Wir wollen diesem Worte nicht widersprechen – wenn es nur nicht gar so inhaltlos wäre! Wie wenig wird mit solchen abstrakten naturrechtlichen Sätzen in einer historischen Wissenschaft ausgerichtet! Denn ist nicht der "Selbstschutz der Gesamtheit" historisch wandelbar? Ist nicht ein theokratischer Staat um des Selbstschutzes willen verpflichtet, sogar in die Gedanken seiner Bürger herrisch einzugreifen? Und sind nicht jene "für die Gesamtheit unentbehrlichen" gemeinsamen Werke, wozu der Bürger gezwungen werden muß, nach Zeit und Ort von grundverschiedener Art? Eine absolute Schranke für die Staatsgewalt gibt es nicht. Es bildet das größte Verdienst der modernen Wissenschaft, daß sie die Politiker gelehrt hat, nur mit Beziehungsbegriffen zu rechnen. Jeder Fortschritt der Gesittung, jede Erweiterung der Volksbildung macht notwendig die Tätigkeit des Staates vielseitiger. Auch Nordamerika erfährt diese Wahrheit; auch dort sind Staat und Gemeinde gezwungen, in den großen Städten eine mannigfaltige Wirksamkeit zu entfalten, deren der Urwald nicht bedarf.
Der vielgerühmte Voluntarismus, die Tätigkeit freier Privatgenossenschaften, reicht schlechterdings nicht überall aus, um den Bedürfnissen unserer Gesellschaft zu genügen. Das Netz unseres Verkehrs hat so enge Maschen, daß sich notwendig tausend Kollisionen der Rechte und der Interessen ergeben; in beiden Fällen hat der Staat die Pflicht, als eine unparteiische Macht versöhnend und vorbeugend einzuschreiten. Desgleichen entstehen in jedem hochgesitteten Volke große Privatmächte, welche tatsächlich den freien Wettbewerb ausschließen; der Staat muß ihre Selbstsucht bändigen, auch wenn sie nicht die Rechte Dritter verletzt. Das englische Parlament befahl vor einigen Jahren den Eisenbahngesellschaften, nicht bloß für die Sicherheit der Reisenden zu sorgen, sondern auch eine gewisse Anzahl sogenannter parlamentarischer Züge mit allen Wagenklassen für den gewöhnlichen Preis abgehen zu lassen. Niemand wird in diesem Gesetze, das den niederen Ständen das Reisen ermöglicht, eine Überschreitung der vernünftigen Grenzen der Staatsgewalt finden. Wer aber im Staate nur eine Sicherheitsanstalt sieht, kann diese Maßregel nur mit Hilfe einer sehr künstlichen und haltlosen Schlußfolgerung verteidigen. Denn wer hat ein Recht, zu verlangen, daß er für drei Schillinge von A nach B befördert werde? Die Eisenbahngesellschaft besitzt ja kein rechtliches Monopol, und es steht jedem frei, eine Parallelbahn zu bauen! Nein, der moderne Staat darf auf eine ausgedehnte positive Tätigkeit für die Wohlfahrt des Volkes nicht verzichten. In jedem Volke gibt es geistige und materielle Güter, ohne welche der Staat nicht bestehen kann. Der konstitutionelle Staat setzt ein hohes Durchschnittsmaß der Volksbildung voraus; nimmermehr mag er dem Belieben der Eltern überlassen, ob sie ihren Kindern den notdürftigsten Unterricht gewähren wollen; er bedarf des Schulzwanges. Der Kreis dieser für das Dasein der Gesamtheit notwendigen Güter erweitert sich unvermeidlich mit der zunehmenden Gesittung. Wer möchte im Ernst unseren Staaten ihre kostbaren Kunstanstalten schließen? Wir alten Kulturvölker werden doch nicht in die rohe Vorstellung zurückfallen, welche in der Kunst einen Luxus sieht; sie ist uns wie das tägliche Brot. In der Tat, der Ruf nach äußerster Beschränkung der Staatstätigkeit wird heute von der Theorie um so lauter erhoben, je mehr die Praxis, auch in freien Ländern, ihm widerspricht. Im Kampfe mit einer alles umfassenden Staatsgewalt, welche die Gesellschaft nicht leiten, sondern ersetzen möchte, ist unter dem zweiten Kaiserreiche die Schule der Tocqueville, Laboulaye, Ch. Dollfus groß geworden, welche ihrerseits über das Ziel hinausschlägt und im Staate nur eine Schranke, eine unterdrückende Gewalt sieht. Auch Mill ist beherrscht von der Meinung, je größer die Macht des Staates, desto geringer die Freiheit. Der Staat aber ist nicht der Feind des Bürgers. England ist frei, und doch hat die englische Polizei eine sehr große diskretionäre Gewalt und muß sie haben: genug, wenn der Bürger jeden Beamten zur gerichtlichen Verantwortung ziehen darf.
Glücklicherweise wirkt dieser steigenden Ausdehnung der Staatsgewalt ein anderes historisches Gesetz entgegen. In demselben Maße als die Bürger reifer werden für die Selbsttätigkeit, in demselben Maße ist der Staat verpflichtet, ja physisch gezwungen, zwar dem Umfange nach vielseitiger, aber der Art nach bescheidener zu wirken. War der unreife Staat ein Vormund für einzelne Zweige der Volkstätigkeit, so umfaßt die Fürsorge des hochgebildeten Staates das gesamte Volksleben, aber er wirkt, soweit möglich, nur anspornend, belehrend, Hindernisse wegräumend. Diese Forderungen also muß ein reifes Volk zur Sicherung seiner persönlichen Freiheit an den Staat stellen: als ein Rechtsgrundsatz ist anzuerkennen das fruchtbarste Ergebnis der metaphysischen Freiheitskämpfe des vergangenen Jahrhunderts, die Wahrheit, der Bürger soll vom Staate nie bloß als Mittel benutzt werden. Sodann: jede Wirksamkeit der Regierung ist segensreich, welche die Selbsttätigkeit der Bürger hervorruft, fördert, läutert; jede von Übel, welche die Selbsttätigkeit der einzelnen unterdrückt. Denn am Ende beruht die ganze Würde des Staates auf dem persönlichen Werte seiner Bürger, und jener Staat ist der sittlichste, welcher die Kräfte der Bürger zu den meisten gemeinnützigen Werken vereinigt und dennoch einen jeden, unberührt vom Zwange des Staats und der öffentlichen Meinung, aufrecht und selbständig seiner persönlichen Ausbildung nachgehen läßt. So stimmen wir in dem letzten Ergebnisse, in dem Verlangen nach dem höchstmöglichen Grade der persönlichen Freiheit, mit Mill und Laboulaye überein, während wir ihre Anschauung vom Staate als einem Gegner der Freiheit nicht teilen.
Hier endlich ist uns vergönnt, auszuruhen von der ermüdenden allgemeinen Untersuchung und zu sagen, was denn dies Nachdenken über die persönliche Freiheit für uns bedeute. Das Vorgefühl einer großen Entscheidung zittert durch den Weltteil und legt jedem Volke die Frage nahe, welchen Hort es besitze an der persönlichen Freiheit, der persönlichen Selbständigkeit seiner Bürger. Wir Deutschen zumal können diese Frage nicht umgehen, wir, deren ganze Zukunft nicht auf der gefesteten Macht alter Staaten, sondern auf der persönlichen Tüchtigkeit unseres Volkes beruht. Denn in diesem unseligen, selten verstandenen Zirkel bewegen sich ja die historischen Dinge: nur ein Volk voll starken Sinnes für die persönliche Freiheit kann die politische Freiheit erringen und erhalten; und wieder: nur unter dem Schutze der politischen Freiheit ist das Gedeihen der echten persönlichen Freiheit möglich, da der Despotismus, in welcher Form er auch erscheine, bloß die niederen Leidenschaften, den Erwerbstrieb und den alltäglichen Ehrgeiz entfesseln darf.
Sehen wir, wie weit der Sinn für persönliche Freiheit in unserem Volke sich entwickelt habe, so dürfen wir wohl jenen Kleinmut verbannen, womit uns das Betrachten unserer Lage so leicht erfüllt. Auch wir tragen an dem gemeinen menschlichen Fluche, daß die Völker ihrer tiefsten und eigensten Vorzüge sich selten klar bewußt sind. Mit unbegreiflich leichtblütiger Hoffnung redet man von jener gewaltigen Macht, welche "die Million Bajonette" des einigen Deutschlands dereinst vorstellen werde. Und doch, gelingt einst das Werk der nationalen Reform, so wird zwar die Schande ein Ende haben, daß ein großes Volk durch sein Grundgesetz zu der defensiven Politik eines Kleinstaates verurteilt ist; aber unsere Macht wird nach wie vor fürs erste eine ziemlich bescheidene sein. Denn so schnell nicht verharschen die Wunden, welche die Sünden und das Unglück von Jahrhunderten geschlagen. Auch das ist eine Täuschung, wenn man meint, der deutsche Staat werde sofort durch seine inneren Einrichtungen zu einem Musterstaate werden. Freilich, wird unsere nationale Einigung je vollendet, so wird uns nicht länger mehr das empörende Schauspiel verletzen, daß einem gesetzlichen, maßvollen Volke kein Schimpfwort zu roh, kein Witzwort zu bitter scheint für die höchste deutsche Behörde; die Welt wird nicht mehr das Unerhörte sehen, daß die Verfassung des gedankenreichsten der Völker grundsätzlich so unwandelbar bleibt wie der Staat der Chinesen; nicht mehr wird man uns zumuten, das Geschenk unseres Todfeindes, die Souveränität der Einzelstaaten, als ein unantastbares Heiligtum zu verehren; und das deutsche Staatsrecht wird endlich auch von einem deutschen Volke zu reden wissen. Mit einem Worte, will's Gott, so werden Zustände schwinden, welche einem glücklicheren Geschlechte nur wie der wüste Traum eines fieberhaften Kopfes erscheinen werden. Aber wäre damit alles erreicht? Wäre damit mehr erreicht, als daß die Würde des Staats, welche nach dem Verhängnis dieses Volkes in den Teilen früher ausgebildet worden als in dem Ganzen, endlich auch im ganzen Deutschland zu ihrem Rechte gelangte? Erst beginnen würden wir dann, uns als Deutsche in jenen Formen der politischen Freiheit zu bewegen, welche andere Völker bereits seit Jahrhunderten ausgebildet haben.
Dagegen unterschätzt man neuerdings ebenso leichtsinnig das köstlichste und eigentümlichste Besitztum unseres Volkes, jene Tugend, welche uns bisher trotz aller politischer Schmach noch immer vor der Verachtung der Fremden bewahrt hat, und welche, wenn wir das einige Deutschland je erschauen, den deutschen Staat zu einer völlig neuen Erscheinung in der politischen Geschichte machen wird: die unausrottbare Liebe des Deutschen zur persönlichen Freiheit. Gar mancher wird hier lächeln und uns die bittere Frage einwerfen: wo denn die Früchte dieser Liebe seien? Und gewiß, errötend stehen wir vor jener stattlichen Reihe von rechtlichen Schutzwehren, welche die angelsächsische Rasse ihrer persönlichen Freiheit errichtet hat. In einer langen Zeit der Entwürdigung hat der deutsche Charakter sehr, sehr viel verloren von jener einfachen Großheit, die unser Mittelalter zeigt. Wer die Geschichte des Deutschen Bundes näher kennt, muß tief beschämt gestehen: Tausende, viele Tausende niederträchtiger Denunziantenseelen und noch weit mehr untertänige Leisetreter hat dies edle Volk erzeugt während zweier Menschenalter. Doch wer das Volksleben als ein Ganzes überschaut, entdeckt notwendig Spuren der Kraft und Gesundheit, welche ihm die gehässige Verbitterung des Urteils verbieten. Wenn wir, wohin wir treten in der Fremde, der Kälte oder einem noch tiefer verletzenden Mitleid begegnen, so dürfen wir uns wohl jeder Anerkennung unserer staatlichen Befähigung freuen, welche uns, aufrichtig weil unwillkürlich, aus fremdem Munde gespendet wird. Mill ist weit davon entfernt, unser Volk zu vergöttern; er fühlt, wie man ihm nicht mit Unrecht nachgesagt, im stillen seine nahe Verwandtschaft mit dem deutschen Genius, aber er fürchtet die Schwächen unseres Wesens, er vermeidet geflissentlich zu tief in die deutsche Literatur einzudringen und hält sich an französische Muster. Und derselbe Mann gesteht: in keinem anderen Lande außer Deutschland allein ist man fähig, die höchste und reinste persönliche Freiheit, die allseitige Entwicklung des Menschengeistes zu verstehen und zu erstreben!
Unsere Wissenschaft ist die freieste der Erde, sie duldet einen Zwang weder von außen noch von innen; ohne jede Voraussetzung sucht sie die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Die Rechthaberei unserer Gelehrten ward sprichwörtlich, doch sie verträgt sich sehr wohl mit der unbefangenen Anerkennung der wissenschaftlichen Bedeutung des Gegners. Trotz des Kastengeistes, der auch unter unseren Gelehrten spukt, darf ein freier Kopf, der auf seinem eignen Wege, nicht auf dem breitgetretenen Pfade der Schule, zu bedeutenden Ergebnissen gelangt, mit Sicherheit zuletzt auf warme Zustimmung zählen. Der rücksichtslosesten polizeilichen Bevormundung, welche deshalb um so schwerer drückt, weil sie im engsten Kreise und von unnatürlichen Mittelpunkten herab wirkt, ist trotz alledem nicht gelungen, den Drang des Deutschen nach persönlicher Eigenart zu brechen. Daß in allen Fragen des Gewissens ein jeder für sich selbst allein stehe, ist eine Überzeugung, welche bereits in den untersten Schichten dieses Volkes feste Wurzeln geschlagen. In Zwergstaaten, die jedes anderen Volkes Charakter bis zum Unkenntlichen verkümmern müßten, predigt man der Jugend das Ideal freier Menschenbildung: den rücksichtslosen Wahrheitstrieb, das Werden des Charakters aus sich selbst heraus, harmonische Ausbildung aller menschlichen Gaben. Und wie notwendig Freiheit und Duldung Hand in Hand gehen, so ist auch nirgendwo die Milde gegen Andersdenkende so heimisch wie bei uns; wir haben sie gelernt in der harten Schule jener Religionskriege, welche dies Volk zum Heile der ganzen Menschheit gefochten hat. Und auch der edelste Segen der inneren Freiheit ist uns geworden: das schöne Maß. Die verwegensten Gedanken über die höchsten Probleme, die den Menschen quälen, sind von Deutschen gedacht, aber nie findet sich bei unseren großen Denkern eine Spur jener fanatischen Verbissenheit, welche die kühnen Köpfe unfreier Völker entstellt: ein Mann, der über das Christentum das écrasez l'infame gesprochen, hätte bei uns nie als ein Heros des Geistes gelten können. Die menschliche Achtung vor allem Menschlichen ward dem Deutschen zur anderen Natur. Darum stehen, trotz alles Ständehaders, der unser Land zerfleischt hat, die Volksklassen in Deutschland in Sitten und Gedanken einander näher als in Ländern mit freieren Staatsformen. Man sieht dem Deutschen nicht so rasch, wie dem Russen oder dem Briten, von fernher an, wes Volkes Kind er sei, aber wir sind von jeher reich gewesen an eigenartigen Charakteren. Und weil das Volk sich die Freiheit seiner persönlichen Bildung niemals hat rauben lassen, so ruht in seinen Tiefen ein ungehobener Schatz starker nachhaltiger Leidenschaft, den dann und wann ein einsichtiger Fremder, ein Capodistrias, eine Frau von Staël, bewundernd erkannte. Was deutsche Leidenschaft bedeute, das wird jeder begreifen, der deutsche Dichtungen mit romanischen oder englischen aus der Zeit nach der Puritanerherrschaft vergleichen will: sie hat sich noch an allen Wendepunkten unserer Geschichte glorreich bewährt. Das ist der Segen der persönlichen Freiheit. Und glaube keiner, daß das freie wissenschaftliche Schaffen der Deutschen den bestehenden Staatsgewalten als ein willkommener Blitzableiter diene. Jeder geistige Erwerb, dessen ein Volk sich rühmen darf, wirkt hinüber auf das staatliche Leben, ist ein Unterpfand mehr für seine politische Größe. Jederzeit wird unter selbstgefälligen Fachgelehrten die Rede gehen, die Wissenschaft habe nichts zu schaffen mit dem Staate: die echten Größen der Wissenschaft denken anders. Man lese die Briefe von Gottfried Hermann und Lobeck. Unwiderstehlich werden die beiden großen Philologen, beide durchaus unpolitische Naturen, in den Kampf um die politische Freiheit hineingezogen; wie tapfer streiten sie bald mit attischem Witze, bald mit mutigem Zornwort, bald mit entschlossener Tat gegen die tenebriones ! Die Welt ringt nach Freiheit, und es bleibt in alle Wege unmöglich, auf dem einen Gebiete dem Lichte zu dienen, auf dem anderen der Finsternis. Vor wenigen Jahrzehnten noch bildeten die Männer der klassischen Gelehrsamkeit unzweifelhaft die geistige Aristokratie unseres Volkes. Dies Verhältnis beginnt sich zu ändern, denn wenn auch für wahrhaft vornehme Naturen die klassische Bildung eine unersetzlich segensreiche Schule bleibt, so steht doch der gemeine Durchschnitt der studierten Leute heute den Kaufleuten, den Technikern weit nach: der gebildete Gewerbtreibende beherrscht in der Regel einen weiteren Horizont, er ist unabhängiger in seinem Denken, und ihn beseelt das stolze Bewußtsein, der Zivilisation eine Gasse zu brechen, welches dem kleinen Theologen und Juristen gänzlich fehlt. Immerhin läßt Deutschlands neueste Geschichte klar erkennen, daß wir von dem geistigen Schaffen langsam zur politischen Arbeit übergehen. Der Trieb des freien genossenschaftlichen Zusammenwirkens, der in diesem Jahrhundert alle Völker ergreift, zeigte sich bei uns zuerst lebhaft auf dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst: unsere Kunstvereine, Gelehrtenversammlungen, Liederfeste sind älter als die verwandten Erscheinungen bei fremden Völkern, während unsere politischen und wirtschaftlichen Vereine dem Beispiele der Nachbarn erst nachhinken. So steht denn auch mit Sicherheit zu erwarten, daß die freie und allseitige Bildung, der selbständige Wahrheitsmut der deutschen Gelehrten rückwirken wird auf die gesamte Nation. Neigung und Fähigkeit zur Selbstverwaltung sind bei uns in reichem Maße vorhanden. Städte wie Berlin und Leipzig stehen mit der Rührigkeit ihrer Verwaltung, mit dem Gemeinsinn ihrer Bürger den großen englischen Kommunen mindestens ebenbürtig gegenüber. Und wie viel Begabung und Lust zur echten persönlichen Freiheit in unserem vierten Stande wohnt, das offenbart sich klarer von Jahr zu Jahr in den Arbeitergenossenschaften.
Ein Volk, das, kaum auferstanden aus dem namenlosen Jammer der dreißig Jahre, die frohe Botschaft der Humanität, der echten Freiheit des Geistes, an alle Welt verkündet hat – ein solches Volk ist nicht dazu angetan, gleich jenen verdammten Seelen der Fabel, in Ewigkeit in der Nacht zu wandeln, suchend nach seiner leiblichen Hülle, seinem Staate. Es ist unser Los – und wer darf sagen: ein trauriges Los? –, daß die innere Freiheit bei uns nicht als die feinste Blüte der politischen Freiheit zu Tage tritt, sondern den festen Grund bildet, auf welchem ein freier nationaler Staat sich erheben wird. Und wessen leidenschaftlicher Ungeduld der verschlungene Werdegang dieses Volkes gar zu langsam scheinen will, der soll sich erinnern, daß wir das jugendlichste der europäischen Völker sind, der soll sich des Glaubens getrösten: kommen wird die Stunde, da mit größerem Rechte als Virgil von seinen Römern ein deutscher Dichter von seinem Volke singen wird: tantae molis erat Germanam condere gentem . Es mag heute vielen wie Prahlerei klingen, aber die Zukunft ist nicht fern, da ein Deutscher den Schriften Mills und Laboulayes ein Buch entgegenstellen wird, welches das Wesen der Freiheit, der politischen und der persönlichen, tiefer, lebensvoller darstellt als jene beiden.
Betrachten wir noch einige Lebensfragen der persönlichen Freiheit, deren Lösung zumeist der Sittlichkeit jedes einzelnen in die Hand gegeben ist. Mills Grundsatz: "in allen Dingen, die nur des einzelnen Heil berühren, soll jeder nach seiner eigenen Willkür handeln dürfen", ist eben wegen seiner Einfachheit und Dehnbarkeit unanfechtbar. Einzig auf dem religiösen Gebiete hat er sich uneingeschränkte theoretische Anerkennung erobert, weil hier nicht bloß keine Partei einen vollständigen Sieg erfochten hat, sondern in Wahrheit unversöhnliche Gegensätze einander gegenüberstehen. Aber wie weit sind wir stolzen Kulturvölker selbst auf diesem einen Felde noch von echter Duldsamkeit entfernt! Welch schwere Anklagen muß Mill hier gegen seine Landsleute erheben! Nicht genug, daß das Gesetz jeden ehrlichen Ungläubigen, der den christlichen Eid nicht leisten will, des gerichtlichen Schutzes beraubt. Wo das Gesetz milder geworden, erhebt sich der finstere Fanatismus der Gesellschaft, besteht mit jüdischer Härte auf der puritanischen Feier des Sabbats, drückt dem ehrlichen Freidenker das soziale Brandmal auf die Stirn, welches tiefer schmerzt als alle Strafen des Staates, macht ihn brotlos und ächtet ihn aus den Kreisen der Bildung und der seinen Sitte. Und wie vieles ließe sich noch sagen gegen jene Engherzigkeit, welche die freie Bewegung des Menschengeistes in Ewigkeit einzwängen will in den beschränkten Gedankenkreis der standard works of theology !
Und haben wir Deutschen ein Recht, bloß mit pharisäischem Behagen dieser Schilderung englischer Unfreiheit zu lauschen? Auch unser Staat ist aus seiner theokratischen Epoche noch nicht gänzlich herausgetreten; noch sehr vielen unserer Gesetze steht auf der Stirn geschrieben, wie unendlich mühsam die Ideen der Toleranz dem unduldsamen Staate und der noch unduldsameren Macht geschlossener Kirchen abgerungen werden mußten. Auch in der Gesellschaft lebt noch weit mehr Unduldsamkeit und – was desselben Dinges Kehrseite ist – weit mehr religiöse Feigheit, als dem Volke Herders und Lessings geziemt. Wer irgendeinen Begriff davon hat, in welcher ungeheuren Ausdehnung der Glaube an die Dogmen der christlichen Offenbarung dem jüngeren Geschlechte geschwunden ist, der kann nur mit schwerer Sorge beobachten, wie gedankenlos, wie träge, ja wie verlogen Tausende einem Lippenglauben huldigen, der ihren Herzen fremd geworden. Nur die wenigsten haben nachgedacht über die grobe Unwahrheit der juristischen Fiktion, in welcher Staat und Kirche bei uns dahinleben, der Annahme: jeder bekennt sich zu dem Glauben, worin er geboren ist. Wie jedes staatliche Übel die Sitten der Bürger berührt, so hat auch die lange unselige Gewohnheit, vor dem Staate zu schweigen und sich zu beugen, entsittlichend eingewirkt auf das religiöse Verhalten des Volkes. Die Furcht vor einer streng gläubigen Behörde, ja die Furcht vor dem Nasenrümpfen der sogenannten guten Gesellschaft reicht hin, unzählige zum Verleugnen ihres Glaubens zu bewegen. In den vornehmen Klassen ist man stillschweigend übereingekommen, gewisse hochwichtige religiöse Fragen nie zu berühren, und so träumen der Gebildeten viele dahin, welche mit Absicht den Kreis ihrer Gedanken verengern, sich grundsätzlich ihres Rechtes begeben, über religiöse Dinge zu denken. In erschreckender Stärke wuchert auf dem religiösen Gebiete der Geist der Unwahrhaftigkeit. Geheime Worterklärungen, Mentalreservationen allerart zwingt man dem widerstrebenden Denken auf; damit gepanzert, geht man hin, teilzunehmen an kirchlichen Gebräuchen, deren eigentlichen Sinn man verwirft. Ganze Richtungen der Theologie, mächtige Zweige des vulgären Rationalismus hängen mit diesem Triebe zusammen: man leugnet die Dogmen der Offenbarung, aber man leiht den alten Worten einen fremden Sinn, statt mannhaft dem Widerwillen der trägen Welt zu trotzen und offen ein Band zu lösen, das für die Seelen nicht mehr besteht.
Doch wie? Ist dies Geschlecht wirklich so tief gesunken? Steht es so gar jämmerlich um die innere Freiheit der Menschen, wie es nach diesen bedenklichen und unleugbaren Erscheinungen der Gegenwart scheinen sollte? Man muß sehr unerfahren sein in den Geheimnissen der Menschenbrust, um auf einem Gebiete, das der unberechenbaren Macht der Selbsttäuschung einen unermeßlichen Spielraum gewährt, einfach mit den Vorwürfen der Lüge und der Gleisnerei hervorzutreten. Und noch weniger wird ein besonnener Kenner der Geschichte die schlichtfriedliche Anhänglichkeit an die Gebräuche der Väter kurzerhand als Trägheit verdammen. Denn die ganze Bewegung der Geschichte besteht in einer fortwährenden Ausgleichung und Versöhnung zwischen den gleichberechtigten Mächten des Beharrens und der fortschreitenden Geistesfreiheit.
Wirklich erklärt aber wird die befremdende Tatsache, daß in diesen hellen Tagen der Kritik der große Mittelschlag der Menschen am Leben der Kirche mit offenbar geringerer geistiger Regsamkeit teilnimmt, als vor dreihundert Jahren, nur durch die andere Tatsache, daß die helleren Köpfe unseres Volkes dem religiösen Meinungsstreite bereits entwachsen sind. Und dies gerade verbürgt uns den schließlichen unvermeidlichen Sieg der Ideen der Duldung, der inneren Freiheit. Nur wenige unserer Denker sind erfüllt von Verbitterung gegen das, was sie den falschen Idealismus der Theologen nennen. Die meisten leben der klaren, ruhigen Meinung: wie gebrechlich immer die Einrichtung der Welt, so gebrechlich ist sie nicht, daß der sittliche Wert des Menschen von Dingen abhängen sollte, die ein fester Wille, ein besonnenes Denken nicht bemeistern kann. Sie haben erfahren, daß von allen Meinungskämpfen allein der Streit über religiöse Fragen notwendig zur Verbitterung und Gehässigkeit führt. So sind sie zu jener Auffassung der Religion emporgehoben worden, welche allein eines freien Mannes würdig ist. Sie erkennen: religiöse Wahrheiten sind Gemütswahrheiten, für den Gläubigen ebenso sicher, ja noch sicherer, als was sich messen und greifen läßt, doch für den Ungläubigen gar nicht vorhanden; die Religion ist ein subjektives Bedürfnis des schwachen Menschenherzens und eben darum kein Gegenstand des Meinungskampfes. Denn über des Menschen sittliche Würde entscheidet nicht, was er glaubt, sondern wie er glaubt. Allzuoft haben wir erlebt, wie ein und derselbe Glaube den einen zum Größten begeisterte, den anderen in widrige Gemeinheit stürzte.
Über diese Fragen denken die kühneren Geister der Gegenwart radikaler, als das achtzehnte Jahrhundert. Die Philosophen jener Epoche meinten zumeist, ohne Glauben an Gott und Unsterblichkeit bestehe echte Tugend nicht. Die Gegenwart bestreitet dies, sie erklärt rund und nett: die Sittlichkeit ist unabhängig vom Dogma. Wir haben inzwischen gelernt, wie grundverschiedene Dinge unter dem Namen der Unsterblichkeit begriffen werden. Daß, wie wir das Schaffen großer Männer und ganzer Völker handgreiflich fortwirken sehen von Geschlecht zu Geschlecht, so auch der schwächste Sterbliche ein notwendiges Glied ist in der großen Kette der Geschichte, daß darum keine unserer Taten ganz verloren geht, keine wieder zu vertilgen ist durch äußerliche Buße – dieser Gedanke ist allerdings die Grundlage jeder streng gewissenhaften Sittlichkeit. Diese Unsterblichkeit soll der Mensch – nicht glauben, denn wer darf beim Glauben von einem Sollen reden? – sondern ernst und klar erkennen. Wer den Mut dazu nicht findet, wird durch die Unsicherheit seines sittlichen Verhaltens die Buße zahlen. Wie anders der Glaube an ein bewußtes Dasein nach dem Tode! Unser Wissen über diese Frage bleibt bisher noch unzureichend, sie fällt noch nicht in das Gebiet des Erkennens, und ebendeshalb hat die Überzeugung von einer Fortdauer nach dem Tode mit unserem Glücke, unserer Tugend an sich nicht das mindeste gemein. Für schwache oder gemeine Naturen kann der Glaube an ein Jenseits ebensowohl eine Quelle der Unsittlichkeit werden wie das Leugnen derselben. Wenn es Menschen gibt, welche zugleich mit dem Glauben an die Unsterblichkeit der christlichen Dogmatik jede Lebensfreude, jeden sittlichen Halt verlieren würden, so leben auch unsittliche Asketen, welche über den entnervenden Träumen von der besseren Welt des Menschen erste Pflicht, die werktätige Liebe gegen den Nächsten, verabsäumen. Nein, unser Urteil über den Menschen und seinen Glauben hängt allein ab von der Frage, ob sein Glaube harmonisch und notwendig aus seinem innersten Wesen heraus sich gebildet habe, ob er in der Tat und in Wahrheit sagen dürfe: "das ist mein Glaube." Jede Überredung kann wohl auf die Erkenntnis, doch schwerlich auf den Willen wirken, kann zwar den Inhalt des Glaubens ändern, aber selten oder nie das Wesentliche, die Form der Überzeugung.
Von dieser Erkenntnis werden sich die freieren Köpfe der Gegenwart auch durch die scheinbarsten Gegengründe nicht abbringen lassen. Man sagt wohl: was ein Mensch glaubt, übt doch unmittelbaren Einfluß auf seine Tugend; wer sich das Jenseits mit rohem, begehrlichem Sinne ausmalt und für jede Liebestat hier unten ein noch reicheres Geschenk droben erwartet, der kann unmöglich, wenn er folgerichtig handelt, ein wahrhaft sittlicher Mensch sein. Gewiß, wenn er folgerichtig handelt! Aber nur die wenigsten sind dazu im stande; und wer nicht Herzen und Nieren prüfen kann, der soll diese geheimen Tiefen der Herzen seiner Nebenmenschen nicht ergründen wollen, sondern ruhig erklären: dies Gebiet des Glaubens ist ein Reich absoluter Freiheit. Solcher Einsicht voll hat sich ein großer Teil der Denkenden von jedem religiösen Meinungsstreite zurückgezogen. Und es zählte diese Ansicht, welche sich mit jedem religiösen Bekenntnisse sehr wohl verträgt, ihre stillen Anhänger bereits nach Tausenden. Denn wer unter unseren Freidenkern ist so roh, daß er lachen sollte, weil ein Geist wie Stein an den geschmacklosen Verslein des alten Gleim sich erbauen konnte? Wer, wie verwegen oder bescheiden seine religiösen Begriffe seien, sollte nicht vielmehr seine bewundernde Lust haben an einem Glauben, der den Gläubigen mit so unerschütterlicher Festigkeit des Gemütes segnete? – Diese humane Auffassung der Religion entbehrt offenbar des Triebes, neue kirchliche Genossenschaften zu gründen, sie sieht in dem Christentume das unvergleichlich wichtigste Element der modernen Kultur, aber doch nur ein Kulturelement, das mit anderen des antiken Heidentums sich vermischen und vertragen muß.
Täuschen wir uns nicht, die Kultur der Gegenwart ist durch und durch weltlich. Die Kirche, weiland der Bannerträger der Gesittung, ist heute unzweifelhaft ärmer an geistigen Kräften als der Staat, die Wissenschaft, die Volkswirtschaft. Durch jahrhundertelange Arbeit ist ein Schatz weltlicher Kenntnis und Erkenntnis aufgestapelt worden, welcher alle Denkenden in schönem Frieden verbindet und sicherlich weit bedeutsamer ist als jene Dogmen, welche die Menschen trennen. Der deutsche Katholik –