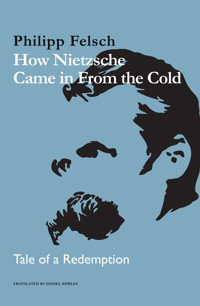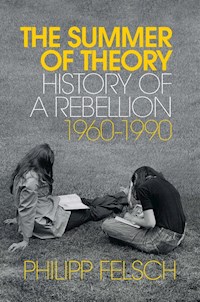5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Wie eine falsche Karte den Wettlauf zum Nordpol auslöste - Ein hinreißend erzähltes Wissensabenteuer für alle Leser von Dava Sobel, Simon Winchester und Sten Nadolny
Nordpol: Ort der Sehnsucht und Entdeckerlust für das 19. Jahrhundert. Ein Deutscher will bei diesem Abenteuer mit dabei sein: der genialische Kartenzeichner August Petermann. Die Engländer reiben sich erstaunt die Augen, als dieser Bücherwurm, der noch nie einen Eisberg gesehen hat, ihnen erklärt, wo sich – »ernsthaften und besonnenen Berechnungen« zufolge – der für verschollen erklärte John Franklin aufhalten muss. Als die Seeoffiziere sich gegen Petermanns Theorien wehren, zieht er sich tief enttäuscht nach Gotha in Thüringen zurück. Dort erobert Petermann den Nordpol auf seine Weise: auf dem Papier. Und schickt zahlreiche Expeditionen in die Irre, weil er von seiner – falschen – Theorie partout nicht lassen will ...
Das subtile Porträt eines typisch deutschen Forschers, eines »Humboldts am Schreibtisch«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
»I shall draw you a map.« August Petermann, 1871
Bild 1
Der Nordpol, das Spielzeug der Geografen.
AUS MANGEL AN BEWEISEN
Lange Zeit hat der Nordpol zu den Requisiten der heroischen Moderne gehört: ein Ort, an dem sich bärtige Männer die Zehen abfroren. Doch gegenwärtig erlebt er eine schillernde Renaissance. Im Sommer 2007 deponierte ein russisches U-Boot die russische Flagge an seinem Grund. Vor der nahe gelegenen Hans-Insel halten sich dänische und kanadische Kriegsschiffe in Schach. Und die Völkerrechtler streiten darüber, ob die Arktis als Land oder Meer oder keines von beiden anzusehen ist. Von der Entscheidung dieser Frage wird es womöglich abhängen, wer das Eismeer in Zukunft ausbeuten darf. Denn alle Parteien warten darauf, dass die Arktis auftaut, dass die Nord-westpassage schiffbar und das Erdöl unter dem Pol zugänglich wird. Dann könnte ein neuer kalter Krieg beginnen. Solange die Eisschollen aber noch nicht geschmolzen und die Bohrinseln noch nicht errichtet sind, wirken die geopolitischen Schachzüge wie eine frostige Operette. Worum, bitte, geht es denn? Um ein treibendes Territorium, so leb- und so nutzlos wie die dunkle Seite des Mondes.
Das hatte schon Robert Peary feststellen müssen, als er am 6. April 1909 seine Flagge ins Eis des Nordpols stieß. Es soll ein sonniger, windstiller Tag gewesen sein. »The Pole at last«Ref. 1, notierte er in sein Tagebuch - »endlich der Pol.« Und direkt darunter: »I cannot bring myself to realize it.« Denn anstatt des verdienten Triumphgefühls gingen ihm merkwürdige Gedanken durch den Kopf. Was bedeutete es, an einem Ort zu sein, an dem in allen Richtungen Süden lag? Und wie groß war der Pol überhaupt? So groß wie ein Vierteldollar, so groß wie ein Hut oder eine kleine Stadt? Natürlich wusste der Ingenieur, dass der Pol ein mathematischer Punkt war, aber gerade diese Abstraktion verstärkte den Eindruck von Unwirklichkeit. Am ehesten, schrieb der zielstrebige Peary, erzeuge der Pol ein Gefühl dafür, »dass die meisten Dinge relativ sind«. Er war an den Nullpunkt der Geografie gelangt. Beim Abmarsch warf er auf sein Lebensziel nicht mehr als einen flüchtigen Blick über die Schulter zurück.
Nach der Rückkehr musste Peary feststellen, dass ein gewisser Frederick Cook, sein ehemaliger Schiffsarzt, behauptete, schon vor ihm am Pol gewesen zu sein. Es folgte eine schmutzige Presseschlacht, die Cook als gebrochenen Mann und Peary als zweifelhaften Sieger zurückließ. Denn am Nordpol gab es nichts zu sehen. Die Beweisfotos der erbitterten Rivalen zeigten flatternde Fahnen und winkende Männer inmitten einer »unbeschreiblichen Leere«. So beschrieb es Cook. Peary behauptete, Cook habe seine Aufnahmen kurz vor der Küste Grönlands gemacht. Cook behauptete, er habe eine Metallröhre am Nordpol vergraben. Doch die war natürlich längst abgedriftet. Verständnislos rätselte der Schiffsarzt in seinem 1911 veröffentlichten Expeditionsbericht über die Natur geografischer Beweise: Seit Kolumbus habe die Menschheit den Erzählungen ihrer Entdecker geglaubt. Warum sollte das in seinem Fall anders sein? Warum hielt ihn die Welt für einen Betrüger? Doch alle Beteuerungen nützten nichts. Cooks Ruf war ruiniert. Am Ende landete er wegen einer windigen Ölspekulation im Gefängnis. Ref. 2
Bis auf den heutigen Tag ist der Streit zwischen Peary und Cook nicht entschieden, nach wie vor werden Bücher veröffentlicht, Beweise begutachtet und Loyalitäten erklärt. Vielleicht zeigt das, dass der Wettlauf zum Nordpol prinzipiell unentscheidbar war. Am Ende, so der niemals zu entkräftende Verdacht, erreichte keiner der beiden Gegner sein Ziel. Dem heroischen Hirngespinst, seit Jahrzehnten von der Presse beschworen, fehlte schlicht und einfach so etwas wie eine handgreifliche geografische Referenz. Der Linguist Roman JakobsonRef. 3 hat in den 1930er Jahren notiert, das späte 19. Jahrhundert sei die Zeit einer galoppierenden Inflation der Zeichen gewesen. Als sich irgendwann herausstellte, dass die Worte nicht länger von der Wirklichkeit gedeckt wurden, erlebten sie einen Schwindel erregenden Wertverfall. Doch alle Versuche, das Vertrauen in die papierne Sprache zurück zu gewinnen, schlugen fehl. Frederick Cook musste das am eigenen Leib erfahren: Seinem 600 Seiten starken Expeditionsbericht wollte niemand mehr Glauben schenken. Und nicht einmal der Pol selbst blieb verschont. Beim Nordpol, könnte man mit den Kulturwissenschaftlern sagen, handelt es sich um den einzigen real existierenden frei flottierenden Signifikanten: um ein Zeichen, das seiner Bedeutung davon getrieben war. Während eine weltweite Öffentlichkeit sich noch ihrer neuen Helden erfreute, hatte Karl Kraus das längst erkannt. »Am Nordpol war nichts weiter wertvoll, als daß er nicht erreicht wurde«, schrieb er im September 1909 in der Fackel. Das »Nichts« habe nicht nur Cook und Peary, es habe im selben Atemzug auch sich selbst desavouiert. Kurz: »Der gute Ruf des Nordpols war dahin.« Dass die Welt einem leeren Zeichen hinterher jagte, hatte Lewis Carroll schon eine Generation früher geahnt. »What’s the good of Mercator’s North Poles and Equators, Tropics, Zones, and Meridian Lines?«, liest man in seiner 1876 erschienenen Jagd nach dem Schnark. »They are merely conventional signs!« Ref. 4
Doch Carroll und Kraus waren ihrer Zeit voraus. Was machte die magnetische Anziehungskraft des Nordpols für alle anderen aus? »Kaum ein Ort der Welt war, seit es Menschen gibt, so unerreichbar und mythenbeladen wie der Nordpol«, lautet die übliche Antwort. Einerseits stimmt das natürlich. Schon bei den alten Griechen lassen sich Quellen auftreiben, die eine Sehnsucht nach dem hohen Norden dokumentieren. Auf der anderen Seite stimmt das vage »Schon-immer« jedoch genau nicht. Das geografische Phantom, dem Peary und Cook zwanghaft hinterher jagten, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Aber seit wann genau? Und warum?
Die kleine Festgesellschaft, die sich im September 1909 in den Anlagen des Gothaer Schlosses versammelte, hätte auf diese Fragen vielleicht eine Antwort gewusst. Eine gemurmelte, etwas verstohlene Antwort womöglich, genau wie die Feierlichkeit, die man im Park beging. »In aller Stille«, so berichtete die lokale Presse, wurde ein Gedenkstein für den Kartografen August Petermann errichtet, der sich 1878 in Rufweite des Gothaer Schlosses das Leben genommen hatte. Zu Lebzeiten war er bekannt gewesen, in Fachkreisen sogar weltberühmt. Doch jetzt, eine Generation später, erinnerte das Denkmal an einen halb Vergessenen. Eigentlich hatte der Stein schon zu Petermanns dreißigstem Todestag errichtet werden sollen. Doch da es nur ein paar Verwandte waren, denen die Sache am Herzen lag, da Geld aufgetrieben und ein passender Bildhauer gefunden werden musste, hatte sich alles verzögert. Im September 1909, als Pearys und Cooks Telegramme von der Eroberung des Nordpols um die Welt jagten, schien es dann plötzlich, als hätte die Geschichte selbst Regie geführt - obwohl sich der Reporter des Gothaischen Tageblatts zu einer solchen Schicksalsgläubigkeit nicht versteigen wollte: »Durch einen freundlichen Zufall«, schrieb er, »wurde die Aufrichtung des Denkmals möglich gerade zu der Zeit, in der uns die Nachrichten erreichten, dass eine von Petermanns Lieblingsideen, die Auffindung des geographischen Nordpols, Tatsache geworden sei.«
Das ist sehr zurückhaltend formuliert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war August Petermann der Motor, der die Entdeckung der Arktis auf Touren brachte. Für den Gothaer Kartografen war der Nordpol der Nabel der Welt und die Eroberung dieses Nabels die wichtigste Kulturaufgabe der Menschheit. Julius Payer, der österreichische EntdeckerRef. 5 von Franz Josephs Land, nannte Petermann den »Vater aller Expeditionen«. Jules Verne und Kurd Laßwitz machten ihn zur Romanfigur. Doch obwohl er zu Lebzeiten zur internationalen Polarprominenz gehörte, geriet Petermann nach seinem Tod bald in Vergessenheit. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Er war kein Held, der sich im Packeis einfrieren ließ. Als armchair explorer, wie man spöttisch in England sagte, als Lehnstuhleroberer dirigierte Petermann die Entdeckung des Nordpols von einer deutschen Provinzstadt aus und gelangte persönlich nie weiter nach Norden als bis Edinburgh. Deshalb blieb sein Ruf immer zweifelhaft. Für die einen war er der große Theoretiker, für die anderen der Spinner der Arktis. Kein Wunder, dass sich die Denksteinlegung im nervösen September 1909 in aller Stille vollzog. Zumal Petermanns arktische Theorien in der Zwischenzeit widerlegt worden waren.
Die Arktis gab das Terrain ab, auf dem sich das 19. Jahrhundert heroisch verausgabte. Doch dieser Verausgabung haftete von Anfang an etwas Unwirkliches an. Schon in den 1850er Jahren desavouierte die Londoner Times den Nordpol als »Spielzeug der Geografen«. Der alte Traum von der Nordwestpassage, vom kürzeren Seeweg nach Indien, der bares, koloniales Geld bedeutet hätte, war gerade geplatzt. John Franklins Schiffe waren auf mysteriöse Weise zwischen Grönland und Labrador verschwunden, und Franklins Retter waren dort, wo die Durchfahrt liegen musste, auf undurchdringliches Packeis gestoßen. Die britische Admiralität gab ihren Schifffahrtsweg und die britische Öffentlichkeit ihren tragischen Helden verloren. Nur August Petermann, der junge Deutsche, der als Sekretär der Royal Geographical Society in der Hirnkammer des Empire saß, schrieb Memoranden über den »wahren« Aufenthaltsort von Franklin und trat dabei unversehens den Wettlauf zum Nordpol los. Ref. 6
In der Petermannwelt, die dieses Buch betritt, war die Arktis eine Frage der Karte. Der Kartograf, den die Engländer instinktiv mit »Professor« anredeten, obwohl er nicht einmal einen Doktortitel besaß, war der Meinung, das größte geografische Rätsel seiner Zeit am Schreibtisch lösen zu können. Als Bewunderer Alexander von Humboldts schob er Strömungstabellen, Temperaturkurven und fiktive Landmassen hin und her und entwickelte dabei einen abenteuerlich anmutenden Rettungsplan. Seine »ernsthaften und besonnenen Berechnungen« - darauf legte er Wert - ergaben, dass sich rund um den Nordpol ein offenes Polarmeer befinden müsse, in das Franklin mit seinen Schiffen eingedrungen sei. Wer ihn finden wolle, müsse Kurs auf den Nordpol selbst nehmen - ein in vielerlei Hinsicht lohnenswertes Ziel. Der Pol, erklärte Petermann, sei der »Schlüssel zu den physikalisch-geographischen Phänomenen der ganzen nördlichen Hemisphäre« und östlich von Spitzbergen leicht über offenes Wasser zu erreichen. Damit fand sich der alte Mythos vom glücklichen Land hinter den Nordwinden unversehens in die harte Währung einer wissenschaftlichen Theorie konvertiert. Wenn man die Strapazen und die Toten, die das nach sich zog, zusammenrechnet, erscheint diese Übersetzungsleistung wie ein tragischer Unfall der Kartografie. Ref. 7
Die pragmatischen englischen Seeoffiziere schüttelten den Kopf. »Die Idee, dass Franklin und seine Begleiter ihre Zeit in der Nähe des Nordpols vertrödeln, ist zu absurd, um die geringste Erwägung zu verdienen«, schrieb die Times und verhöhnte Petermann als weltfremden »preußischen Weisen«. Als die Skepsis an seinen Plänen in offene Anfeindung umschlug, kehrte er London enttäuscht den Rücken und ging nach Thüringen zurück. Im Land der Dichter und Denker, wo man geübt darin war, die Welt im Kopf zu erobern, stieß die Theorie vom eisfreien Polarmeer auf offenere Ohren. Die deutschen und österreichisch-ungarischen Arktisexpeditionen der zweiten Jahrhunderthälfte waren auf der Suche nach Petermanns Gral. Selbst in den USA fanden seine Denkschriften und spekulativen Karten Beachtung. Dass eine Expedition nach der anderen sich im Packeis verrannte, statt in die grüne Polarsee zu stechen, war in den Augen des Nordpolprofessors umso schlimmer für das Packeis. »Ich werde so lange arbeiten«, schrieb er, gegen wachsenden Widerstand, noch zu Beginn der 1870er Jahre, »bis alles bewiesen ist«.
Das war spätestens seit dem Untergang des amerikanischen Dampfers Jeannette der Fall. Der sibirische Hungertod der ganzen Besatzung bewies, dass das offene Polarmeer nicht mehr als ein Kartentraum war. Die weitere Geschichte ist bekannt. Fridtjof Nansen, Kurator am Zoologischen Museum in Bergen, stolperte über die Meldung, dass Wrackteile der Jeannette an der Südküste Grönlands angespült worden seien. Er verstand es, die Reste der Katastrophe zu deuten, und drehte Petermanns Gleichung einfach um, er ersetzte offenes Wasser durch eine treibende Eisdecke und rohe Dampfkraft durch ein Schiff, das dafür konstruiert war, in den Schollen einzufrieren. Diesmal stimmte die Rechnung, obwohl Nansen seinen eigenen Versuch bei 86° nördlicher Breite abbrechen musste. Gut zehn Jahre später waren Peary und Cook seine zweifelhaften Vollstrecker.
August Petermann durfte ihre Eroberung nicht mehr erleben. Wie es sich für Polarhelden gehört, starb er tragisch: Im September 1878, noch bevor die Nachricht vom Untergang der Jeannette eingetroffen war, schoss er sich eine Kugel durch den Kopf. Dass die Natur eines Tages gezwungen sein würde, seiner Theorie entgegen zu schmelzen, hatte er in seinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt.
Über die Entdeckung des Nordpols, über frierende Helden und verschollene Schiffe, existiert eine Unmenge von Literatur. Für die älteren Autoren stellte sich die Sache denkbar einfach dar: Es lag in der Natur des Menschen - oder vielmehr des Mannes -, am trostlosen Ende der Welt über sich selbst hinauszuwachsen. Doch irgendwann veränderte sich das Bild: Die heroisch gestörte Kälteversessenheit der Polarfahrer erschien jetzt als skurriles Symptom eines vergangenen Größenwahns. An die Stelle heroischer Epen ist eine vage Kulturpsychologie getreten, deren Frage, stets aufs Neue, lautet: Warum all dieses sinnlose Heldentum? Ref. 8
Mit August Petermann geraten die Männerfantasien in ein anderes Licht. Nicht umsonst gefielen sich seine Gegner darin, ihn als Feigling zu beschimpfen, denn am Nordpol selbst hatte er kein Interesse. Seine arktischen Abenteuer ereigneten sich auf Papier. Nachdem er - schon früh - den Karten verfallen, Alexander von Humboldt begegnet und nach London, in die Hauptstadt der Geografie, gegangen war, geriet er in den Strom eines epochalen Optimismus. Der Kartografie schien sich ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten zu eröffnen. Die Zuversicht, die dem Wunderkind Tecumseh Spivet in Reif Larsens Roman Die Karte meiner Träume den Stift führt, ergriff damals von einer ganzen Zunft Besitz: Weit über die herkömmliche Topografie hinaus schien sich mit Karten buchstäblich alles darstellen zu lassen, ob das Verhalten von Eisenbahnpassagieren, das Wachstum der Pflanzen, die Ausbreitung der Cholera oder die Launen des Wetters. In dieser Situation geriet Petermann in den Trubel der Franklinsuche. Er reagierte mit den Mitteln des Kartenzeichners und setzte dabei einen unwiderstehlichen Traum vom Nordpol in die Welt.
Petermanns Geschichte handelt vom Aufstieg und Niedergang einer künstlichen Welt. Sie zeigt, welche Wirkungen von einer Karte ausgehen konnten. Und sie folgt den Stadien eines zunehmenden Realitätsverlusts. Denn letztendlich gelang es dem Kartografen nicht, sich von seiner einmal erzeichneten Papierwelt zu lösen - für die Briten ein Fall von typischer deutscher Weltfremdheit. Lewis Carroll, Petermanns Zeitgenosse, der ein Experte für geografische borderlines war, lässt in einem späten Roman einen Fremden auftreten, der von den Kartografen in seinem Heimatland erzählt: von ihren Experimenten mit immer größeren Karten und von den Schwierigkeiten, die beim Maßstab von 1:1 aufgetaucht seien. Die Bauern hätten protestiert, weil die Karte das Sonnenlicht raube, weshalb sie noch niemals ausgebreitet worden sei. »Darum verwenden wir jetzt das Land selber als Karte«, schließt der Bericht, »und ich darf Ihnen versichern, es leistet uns beinah ebenso gute Dienste. « Konnte es Zufall sein, dass das Land, von dem Carroll sprach, Deutschland und der Berichterstatter ein deutscher Professor war? Ref. 9
Man würde August Petermann gerne vor den spöttischen Engländern in Schutz nehmen und von einem sympathischen Humboldt am Schreibtisch erzählen: von einem deutschen Mandarin, der sich redlich in den Papierkram der Vermessung der Welt vergrub. Wir werden solchen Figuren begegnen. Doch auf Petermann selbst trifft das schöne Klischee leider nicht zu. Wenn hier ein »preußischer Weiser« agierte, dann war er - mit einem Wort Theodor Fontanes - durch die Schule der »Verengländerung« gegangen: vom Vorrang der Karte durchdrungen und zugleich vom Willen zur Tat beseelt. Petermann zettelte Expeditionen an und versuchte sie im letzten Moment zu verhindern. Er konnte ebenso vergrübelt wie jähzornig sein. An verschiedenen Stellen dieses Buches wird er sich schlecht benehmen. Für seinen Chronisten ist das nicht angenehm. Die Geschichte und auch die Tragik Ref. 10des Kartografen lassen sich nur verstehen, wenn man bedenkt, dass sein geografischer Hochsitz zwischen den Stühlen stand: zwischen England, dem Land der Welteroberer, und Deutschland, dessen Geografen sich auch nach Hegel bemühten, »den Gesamtstoff der Erdkunde in das Gebiet des Gedankens zu versetzen«. So steht es in Ernst Kapps viel gelesener Vergleichender Allgemeiner Erdkunde, einem Buch, dessen zweite Auflage in dem Jahr erschien, als die erste deutsche Nordpolexpedition ihre Segel setzte.
Bild 2
Deutsche Verkehrswege im Jahr 1845: eine Karte von der Vernichtung des Raumes.
1. UNTER DECK
Für gewöhnlich beginnen Geschichten wie diese mit einer Reise. Der erste, leibhaftige Aufbruch in die Welt - für Entdecker und Forscher ein Schicksalsmoment. Alexander von Humboldt zum Beispiel, den Petermann bewunderte, stach mit Ende zwanzig nach Südamerika in See. Die Mischung aus Abenteuerlust und Heimweh, die ihn beim Verlassen Europas ergriff, überstieg alles, was er bis dato erlebt hatte: »Das Gefühl, mit dem man Ref. 11 zum erstenmal eine weite Reise antritt, hat immer etwas tief Bewegendes.« Auch August Petermann ging im Sommer 1845 auf große Fahrt. Er war 23 Jahre alt und kannte die Route im Schlaf. Auf der großen Deutschlandkarte in Stielers Geographischem Handatlas führte sie zuerst von Potsdam nach Magdeburg: knapp sechzehn Postmeilen, mit der neuen Eisenbahnlinie bequem an einem Vormittag zu schaffen. Von Magdeburg aus ging es im Dampfschiff die Elbe hinab. Die Decks waren festlich erleuchtet, im Kielwasser schaukelten hilflose Treidelkähne, und an den Anlegestellen liefen Menschentrauben zusammen. Bei Dömitz passierte das Schiff die Grenze nach Hannover, dann dampfte es an meck-lenburgischem und holsteinischem Staatsgebiet vorbei und durch unzählige Ortszeiten hindurch im Lauf eines Tages und einer Nacht in die Freie Reichs- und Hansestadt Hamburg: Reisen in Deutschland im Jahr 1845. Selbst innerhalb Preußens hatte jede Kleinstadt damals noch ihre eigene, nach Minuten und Sekunden von Berlin abweichende Zeit. Erst die einheitlichen Eisenbahnfahrpläne machten diesem Flickenteppich in der zweiten Jahrhunderthälfte ein Ende. 1845 war die Strecke von Berlin nach Hamburg noch im Bau.
Hinter Hamburg hörte die Deutschlandkarte im Stieler auf. Nur eine dünne gestrichelte Linie, die in der weißen Nordsee verschwand, deutete den Kurs des Dampfschiffs an, das alle zwei Wochen pünktlich nach Edinburgh ablegte. Je nach Wetter dauerte die Überfahrt zwei bis drei Tage. Damit gelangte Petermann insgesamt in weniger als einer Woche ans Ziel. Atemberaubend schnell für die damalige Zeit. Noch zehn Jahre früher hätte die Reise von Potsdam nach Edinburgh Wochen gedauert, was den Passagieren der Dampfschiffe und Eisenbahnen durchaus bewusst war. Der Dampf, diese »Meeresschlösser und rollende Ortschaften adlerschnell dahinführende« Kraft, erregte allerorten die Gemüter. Poetische Einkleidungen, zumeist in die tierischen Formen von Raubvögeln, Löwen oder edlen Pferden, sorgten für Pathos. Die erste Fahrt mit einer dieser stählernen Kreaturen muss ein geradezu metaphysisches Erlebnis gewesen sein. Denn was zeigte die Erhebung des Menschen über die Naturkräfte deutlicher als ein Dampfer, der unabhängig von Wind und Wellen seinen schnurgeraden Kurs übers Meer pflügte? Nicht einmal Gottes Geist, schrieb ein anonymer Bewunderer des Fortschritts in der Londoner Quarterly Review, könne schwereloser über die Wasser gleiten. Der Raum selbst, diese natürliche, in Postmeilen und Wegstunden unterteilte Größe, wurde durch die neuen Verkehrsmittel vernichtet. Heinrich Heine notierte Ref. 12 1843 mit gemischten Gefühlen, die Nordsee brande neuerdings direkt vor Paris. Für uns Vielflieger ist seine Bestürzung nicht mehr so leicht nachzuvollziehen. Aber auch der bereits zitierte Autor der Quarterly Review sah das Mittelmeer »vor unseren Augen auf die Größe eines Sees zusammengeschrumpft«. Ref. 13
Mit dreißig Stundenkilometern hinter eine Lokomotive gespannt über plattes Land zu rasen, erschien vielen Passagieren wie der Tanz auf einem Feuer speienden Vulkan. Die Mechanisierung des Verkehrs war etwas Unerhörtes, Weltbewegendes, in seinen Auswirkungen Unabsehbares. Auch der junge Petermann muss vom Dampf fasziniert gewesen sein. Die zunehmende Mobilität und der Ausbau der Linien bescherten ihm, als Kartografen, sein tägliches Brot. Und später, als er Pläne zur Entdeckung des Nordpols schmiedete, spielte rohe Maschinenkraft die entscheidende Rolle. »Per Dampfer«, verkündete er zwei Jahrzehnte nach seiner Edinburghreise selbstgewiss, »beträgt die Entfernung von der deutschen Nordseeküste zum Nordpol höchstens zehn Tage.«
Seit Jahren zeichnete Petermann Karten: Landkarten, Seekarten, Eisenbahnkarten; Karten, die wegen der neuen Verkehrswege in immer kürzeren Abständen revidiert werden mussten. Die Grand Tour auf die Britischen Inseln besiegelte das Ende seiner Ausbildungszeit in Heinrich Berghaus’ Geographischer Kunstschule in Potsdam. Er wird diese Reise mit einer Mischung aus jugendlicher Euphorie und kühler Überlegenheit absolviert haben, denn als frischgebackener Kartenzeichner, Lithograf und Kupferstecher war er über die Route weit besser informiert als die meisten seiner Mitreisenden in der preiswerten dritten Klasse. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war der Umgang mit Landkarten noch nicht weit verbreitet. Das, was man kartografische Aufklärung nennen könnte, die Entstehung einer Art räumlichen Selbstbewusstseins, begann gerade erst. Man vergisst heute leicht, dass Landkarten lange, bis zum Ende der Napoleonischen Kriege, Geheimdokumente waren, die die europäischen Staaten und ihre Militärapparate mit Argusaugen hüteten. In der Sowjetunion war das sogar bis zu Gorbatschows Glasnost der Fall. Mit Vorliebe erzählen Kartografiehistoriker von einsamen Eisenbahntrassen durch weißes Niemandsland, von gefälschten Flussmündungen und nicht existierenden Städten in der sibirischen Steppe. Zu wissen, wo man sich im Verhältnis zur Hauptstadt, zur Grenze, zum Meer befindet, ist eine relativ junge Errungenschaft. Ref. 14
Doch trotz seiner Profession scheint der junge Kartograf keinen großen Gefallen am Reisen gefunden zu haben. Er, der sein späteres Leben damit verbrachte, Expeditionen in fremde Länder zu organisieren, sollte nie auf die Idee kommen, sich einem dieser Abenteuer selbst anzuschließen. Erst kurz vor seinem Tod unternahm er eine Amerikareise und klagte über die Hitze auf der Eisenbahnfahrt von Philadelphia an die Niagarafälle. Kritiker legten ihm seine Sesshaftigkeit als Feigheit aus. Aber August Petermann bevorzugte das Reisen auf Papier. Das Fernweh eines Humboldt blieb ihm fremd. Für die Dramaturgie dieser Geschichte würde man gern von einem schrecklichen Sturm, von anhaltender Seekrankheit oder einem nur mit Mühe und Not glimpflich verlaufenen Maschinenschaden berichten, der Petermanns junge Reiselust im Keim erstickte. Aber das geben die überlieferten Quellen nicht her. Daher müssen wir von einem jungen Mann ausgehen, der schon damals, mit Anfang zwanzig, die Welt als schlechtere Landkarte sah: unübersichtlich, in schmutzigen Farben gehalten und in einem viel zu großen Maßstab ausgeführt, der das Zurechtfinden nicht gerade leicht machte. Statt an der Reling zu stehen und den Anblick des Meeres zu genießen, lag Petermann wahrscheinlich in seiner Koje im Zwischendeck, mit irgendeinem geografischen Schmöker beschäftigt, oder saß am Mittagstisch, ein flaues Gefühl im Magen, und erläuterte seinen Mitreisenden das Wachsen des Weltverkehrs, während draußen die graue Nordsee wogte, an deren Horizont nach zwei Tagen der Firth of Forth und schließlich Leith, Edinburghs Hafen, in Sicht kamen.
Bild 3
Petermanns Chimborazo war der Brocken. Mit 15 zeichnete er eine Karte vom Harz.
2. DER HARZ UND DER AMAZONAS
So kann diese Geschichte nicht beginnen. Das Reiseabenteuer ließ Petermann kalt. Aus ihm ergab sich nichts. Wir müssen daher weiter zurückgehen, zu einer Szene, die älter ist: Ein fünfzehnjähriger Junge hat die Zungenspitze zwischen den Zähnen und zeichnet. Er beugt sich über ein großes Folioblatt, zieht Gitterlinien mit dem Lineal, schätzt Entfernungen mit dem Zirkel ab, trägt winzige Ortsnamen ein und tupft Wälder mit grüner Wasserfarbe aufs Papier. Ganz allmählich nimmt etwas Gestalt an, von dem er weiß, dass es alle Erwachsenen in helles Erstaunen versetzen wird: kein Plan eines im Garten vergrabenen Schatzes und keine Ansicht von Robinson Crusoes Insel, sondern eine Spezial-Charte des Harzgebirges. Zumindest der Titel steht schon fest und prangt arabeskenumrankt in der linken unteren Ecke des Papiers. Gleich daneben, auf der Legende, tummeln sich über zwanzig verschiedene Symbole und unterscheiden große von kleinen Städten, Marktflecken von Pfarrdörfern und Blei- von Kupferhütten - um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Petermanns Karte beruhte auf eigenen Beobachtungen. Gerade war er von einer mehrtägigen Wanderung durch den Harz zurückgekehrt, die ihn von Nordhausen, wo er das preußische Gymnasium besuchte, bis auf den Brocken geführt hatte: eine vielleicht frühreife, aber keineswegs ungewöhnliche Tour für seine Zeit. Als wildromantisches Mittelgebirge gehörte der Harz damals bereits zu den touristischen Klassikern, die mit einschlägigen Sehenswürdigkeiten und günstig gelegenen Unterkünften aufwarten konnten. Schon Goethe war auf dem Gipfel des Brockens gewesen. Inzwischen stand dort ein großes Wirtshaus, in dem man sich früh am Morgen vom Wirt wecken lassen konnte, um mit den anderen Gästen den Sonnenaufgang zu bestaunen. Das Taschenbuch für Reisende in den Harz gab dem Aufstieg die Bestnote. Und selbst der spöttische Heinrich Heine war auf dem Brocken in Begeisterung geraten: »Es ist ein erhabener Anblick«, stand in der Harzreise zu lesen, »der die Seele zum Gebet stimmt.« Aber bekanntlich gilt Heine als Autor, mit dem die Romantik zu Ende ging. Und auch der junge Petermann ist bestimmt nicht als müßig verträumter Taugenichts durch den Harz spaziert. Dazu war er als Landvermesser viel zu akribisch. Ref. 15
Wir schreiben das Jahr 1837. In Illinois wurde Wild Bill Hickok geboren. In England hatte Königin Victoria gerade den Thron bestiegen. Im nahen Hannover waren sieben Göttinger Professoren des Hochverrats angeklagt, weil sie sich weigerten, ihren modernen Verfassungseid zugunsten eines Schwurs auf den reaktionären König zurückzunehmen. In Preußen landeten Burschenschaftler, die es wagten, sich in den revolutionären schwarz-rot-goldenen Nationalfarben zu zeigen, derweil im Gefängnis - in besonders schweren Fällen sogar auf dem Schafott. Heines Harzreise, die August Petermann heimlich in seinem Rucksack gehabt haben mag, stand als vaterlandsloses Schrifttum auf dem Index. Während sich das Bürgertum erst allmählich auf seine progressive Rolle besann, verfolgten die größeren und kleineren deutschen Staatsapparate ihre bleierne Restaurationspolitik. Die Historiker bezeichnen die 1830er Jahre für gewöhnlich als »Vormärz«, weil sich die angestaute Frustration am Ende in der Märzrevolution von 1848 entlud. Als charakteristischer Stil dieser nach außen hin stillen Zeit gilt das Biedermeier. So gut es eben ging, steckten die Leute den Kopf in den Sand und igelten sich häuslich im Privaten ein.
Die drückenden äußeren Umstände gingen mit einem langsam in Fahrt kommenden Buchmarkt einher - ein Umstand, der der Situation erst ihre politische Brisanz verlieh. Zwischen Napoleon und Bismarck wurden zumindest die bürgerlichen Deutschen - auch im europäischen Vergleich - zu einem Volk von Lesern. Das lebenslange Wiederkäuen der Bibel gehörte als Lektüreverhalten endgültig der Vergangenheit an. Stattdessen fand man Geschmack an den Neuerscheinungen, die sich von Jahr zu Jahr üppiger auf dem Buchmarkt tummelten. Der Publikumsrenner war die Reiseliteratur. Der trostlose preußische Vormärz bot epischen Leseausflügen in exotische Länder einen idealen Nährboden. August Petermann scheint sich diesem stillen Vergnügen hemmungslos hingegeben zu haben. Als Sohn eines Gerichtsaktuars, eines kleinen Regierungsbeamten, durfte der Junge auf die Unterstützung des Vaters rechnen, dem der gesellschaftliche Aufstieg seiner Kinder am Herzen gelegen haben muss. Petermann junior, der sich früh interessiert und begabt zeigte, wurde, so gut es ging, mit Bildung versorgt. Man hielt sich Bücher, vielleicht auch ein Exemplar von Stielers neuem Handatlas im Haus. Mit 14 kam der Sohn aufs Gymnasium ins benachbarte Nordhausen. Nach dem Plan seiner Eltern sollte er anschließend Theologie studieren, um ein angesehener preußischer Pfarrer zu werden. Ref. 16
Wie ist es aber zu erklären, dass er sich mit Händen und Füßen gegen den elterlichen Berufswunsch wehrte, für einen Bürgersohn mit intellektuellen Neigungen damals eigentlich der normale Weg? Womöglich hatte der kleine August schon zu viel gelesen. Unter dringendem Verdacht stehen literarische Helden mit subversivem Potential. Und es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wer darunter gewesen sein mag. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Robinson Crusoe, dessen Abenteuer zu den meistverkauften Büchern dieser Zeit gehören. Die Geschichte des berühmten Schiffbrüchigen kursierte in unzähligen Versionen selbst in der tiefsten preußischen Provinz. Es gab einen deutschen, einen sächsischen und einen österreichischen Robinson, und nur durch Zufall kann es sie alle auf unterschiedliche Inseln verschlagen haben. Die erfolgreichste Adaption dieser Art, Johann Heinrich Campes Robinson der Jüngere, eine teutonisierte, brachial pädagogische Version von Daniel Defoes Inselabenteuer »zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder«, hatte 1831 schon die 24. Auflage erreicht. Die Anverwandlung seiner englischen Vorlage bereitete dem Erfolgsautor Campe keinerlei Kopfschmerzen. »Es war einmahl ein Mann Ref. 17 in der Stadt Hamburg, der hieß Robinson«, beginnt sein Buch, um den Leser dann rasch mit dem jüngsten Sohn dieses Norddeutschen bekannt zu machen: einem Jungen, »den man Krusoe nannte, ich weiß nicht warum«. Es folgt die bekannte, jedoch erzieherisch veredelte Geschichte von Krusoes Abenteuerlust, von seinem Schiffbruch, von Freitag (dem Campe in Donnerstag einen Vater hinzugesellte) und von der Errichtung einer kleinen Musterkolonie durch Disziplin, Langmut und Fleiß. Als »Bibel der Bourgeoisie« ist der jüngere Robinson bezeichnet worden: ein Buch, das Eltern und Lehrer zur Lektüre empfahlen. Doch die Rechnung ging nicht zwangsläufig auf. Robinsons abenteuerliche Geschichte wirkte auf manche Leser stärker als seine Moral. Daher hat das Buch neben soliden bürgerlichen Tugenden auch brennendes Fernweh geschürt. Dem Berufsziel Pfarrer war das nicht unbedingt zuträglich.
Es gab ein weiteres Leseabenteuer: die Werke Alexander von Humboldts. In den 1830er Jahren füllten sie schon eine kleine Bibliothek - von den zahlreichen Bearbeitungen »für die Jugend« ganz abgesehen. Humboldts leserfreundlichstes Buch, die 1832 abgeschlossene Reise in die Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents, breitete das Panorama einer dunkel lockenden Tropenwelt aus, deren wilde Indianer und kreischende Papageien den preußischen Vormärz noch trostloser aussehen ließen, als er es ohnehin schon war. Der große Reisende hatte mit Unwettern, wilden Tieren und Tropenfieber gekämpft, er war einer majestätischen, ungezähmten Natur begegnet und hatte sie, aller Unbill zum Trotz, mit kühlem Kopf vermessen. Für seine Leser daheim war er daher der »deutsche Kolumbus«, der die neue Welt zum zweiten Mal, und diesmal gründlich, entdeckt hatte. Südamerika, das waren die Tropen schlechthin, das Land verwirrender Sinneseindrücke und wegloser »Urwälder«, wie die Deutschen mit ihrem Faible für Urwörter sagten. In Deutschland, wo der Wald von jeher mythische Qualitäten besaß, setzte dieser Urwald mächtige Fantasien frei. Er beflügelte die Dichter. Er zog Forscher und Maler nach Südamerika. Von Porzellangeschirr und Zimmertapeten aus grüßte er ins bürgerliche Interieur. Er versetzte die Deutschen in ein mildes Tropenfieber, und mit ihnen den jungen Petermann. Seine Art, den Infekt auszuschwitzen, war das Kartenzeichnen. Ref. 18
Denn durch die deutschen Tagträume spukten nicht nur die Urwaldriesen, unter denen sich Humboldt zum Schlafen gelegt, sondern auch die matt schimmernden Messinstrumente - neben Uhren und Barometern lauter unaussprechliches Zeug -, die er heroisch durch den Dschungel getragen hatte. Tropen- und Wissenschaftsbegeisterung gingen Hand in Hand. In Ermangelung eines heimischen Regenwalds musste sich der Bücherwurm Petermann aber in den Harz aufmachen. Es gab hier zwar weder einen Chimborazo noch einen Orinoko zu vermessen, aber auch der Brocken und die Kalte Bode hatten eine gute Karte verdient. Von den Hauptstraßen, Nebenstraßen, Bleihütten, Kupferhütten, Marktflecken und Pfarrdörfern der Gegend ganz zu schweigen. Humboldt, der nichts, was am Wegrand lag, liegen ließ, hätte das ebenso gesehen.
Im Jahr nach der Harzreise, sechzehnjährig, legte Petermann mit einer großen Südamerikakarte nach. Über eigene Anschauung kann er diesmal nicht verfügt haben, von daher handelte es sich um eine Fleißarbeit, die den genauen Kopisten verrät. Die Vorlage muss aus einem der Atlanten gestammt haben, die ihm schon damals vertraut waren. Allerdings zeichnete er keine Staatsgrenzen ein, wie das auf den gängigen politischen Atlaskarten der Fall war. Petermanns Südamerikakarte hob stattdessen die großen Flusssysteme - den Amazonas, den Orinoko, den Rio Negro - hervor und markierte ihre Wasserscheiden mit farbigen Linien. Damit verriet er erneut eine ernsthafte geografische Ambition: Die »Physik der Welt«, Ref. 19 die Humboldt entwickelt hatte, interessierte ihn mehr als die Willkür der Königreiche. Mit immensem Talent und stupender Hartnäckigkeit zeichnete er gegen den Berufswunsch der Eltern an. Wie unzählige Jungen seit dem 19. Jahrhundert schuf er sich eine bunte, papierne Kartenwelt. Im Leben der Entdecker und Forschungsreisenden spielt das ganz oft die Rolle eines Erweckungsmotivs: Auch Humboldt hatte in seiner Jugend über Landkarten gebrütet, bevor er sich im südamerikanischen Regenwald verlor. Joseph Conrad folgte den »aufregenden Flecken aus weißem Papier« bis ins Herz der Finsternis. Anders Petermann: Er blieb seiner ursprünglichen Liebe treu. Anstatt den Sprung vom Papier in die Welt zu wagen, ließ er sich ganz von den Karten fesseln. Ref. 20
3. DIE SCHULE DER KARTOGRAFEN
Spätestens nach der Südamerikakarte scheint Petermanns Vater den Ernst der Lage begriffen zu haben: Er legte das Blatt seinem König, Friedrich Wilhelm III., vor. Der begleitende Brief enthält ein blasses Porträt und die farbige Skizze einer Begabung: In den Worten des Vaters war sein Sohn ein »Jüngling von 16 Jahren, gesund von Körper, wohlgestaltet und von bravem gottesfürchtigem Herzen, legte in litterarischer Beziehung von früh an gute Anlagen an den Tag, so dass ich ihn in seinem 14. Lebensjahre nach Nordhausen brachte und ihn das dortige Gymnasium beziehen ließ. Außer an den im Gymnasio zu Nordhausen getrieben werdenden gelehrten Sprachen, hängt nun aber sein Herz noch besonders an dem Fache der Kunst, namentlich an: Geographie, Mathematik, Portrait-, Plan- und Chartenzeichnen, Calligraphie, Graviren, technische künstliche Arbeiten und Musik. Gern, ja einzig und herzlich gern, möchte er nun aber in dem Fache eines Künstlers und namentlich eines geographischen und topographischen Kupferstechers auf der geographischen Kunstschule, die zu Potsdam errichtet werden soll, sich ausbilden und in diesem Fache dem Staate nützlich werden.« Ref. 21
Gerade rechtzeitig kamen August Petermann die Zeitläufe zu Hilfe. Die Gründung einer Schule für Kartografen, durch Pressemitteilungen in ganz Preußen bekannt gemacht, gab seiner jugendlichen Begeisterung einen staatlich geprüften Ort. Friedrich Wilhelm III. ließ sich zwar mehrfach bitten, schenkte seinem Untertanen schließlich jedoch Gehör. Die Südamerikakarte scheint ihm gefallen zu haben. Er gewährte ihrem viel versprechenden Autor ein Stipendium zum Besuch der Geographischen Kunstanstalt. Die großformatigen Bewerbungsunterlagen ließ er anschließend zurücksenden. Wie teure Reliquien nahm der Junge sie im Frühjahr 1839 nach Potsdam mit, wo er sich als erster Schüler der neuen Institution zum Unterrichtsbeginn einfand. Auch später gab er die Blätter nie wieder aus der Hand. In schwachen Momenten soll er sie mit Genugtuung hergezeigt haben. Ref. 22
In Potsdam stieß Petermann auf seinen großen Gönner. Heinrich Berghaus, der Gründer und Direktor der Kunstanstalt, nahm den Jungen als »Ziehsohn« in seine Familie auf, gewährte ihm Zugang zu seiner umfangreichen Privatbibliothek und machte ihn zu seinem Lieblingsschüler: ein Glücksfall, wenn man bedenkt, dass sich Petermanns leiblicher Vater 1841 das Leben nahm. In der Sprache des 19. Jahrhunderts erlag er seinem schwermütigen Temperament. Wie sich zeigen wird, litt auch der Sohn unter Stimmungsschwankungen. Doch das kam später. In Heinrich Berghaus traf er 1839 auf einen Gesinnungsgenossen, einen passionierten Kartografen, dem allerdings unternehmerische und politische Instinkte fehlten, weshalb er sein späteres Leben in ständiger Geldnot verbrachte. Der große Bruch in der Geschichte der Kartografie, der sich irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ereignete, hat dieses Leben wie ein Wasserzeichen geprägt.
Begonnen hatte Berghaus nämlich in einem alteuropäischen Regime, in dem Karten Geheimdokumente waren, deren Herstellung und Benutzung den Militärapparaten oblag. Als mathematisch begabter Junge - fast alle Biografien von Kartografen scheinen Geschichten von Wunderkindern zu sein - war er bereits 1811 in den Dienst der französischen Besatzungsmacht eingetreten, um als Ingénieur Géographe an der Vermessung Westfalens mitzuwirken. Napoleon ließ breite Chausseen und Kanäle bauen, um die Manövrierfähigkeit seiner Truppen auf dem gerade eroberten Terrain zu erhöhen. Als Berghaus sich von der Schulbank ins Gelände verabschiedete, war er 14 Jahre alt. Fünf Jahre später, die Franzosen hatten inzwischen vor einer begeisterten Koalition nationalistischer Freiheitskämpfer die Waffen gestreckt, heuerte er auf der anderen Seite, beim Preußischen Generalstab, an. Unter General von Müffling arbeitete er an der trigonometrischen Landesaufnahme Preußens mit, aus deren rein militärischem Hintergrund niemand einen Hehl machte: »Die Arbeiten müssen die genaueste Kenntniß der eigenen Länder und der übrigen europäischen Staaten in kriegerischer Hinsicht bezwecken«, heißt es in einem Kommuniqué des Generalstabchefs von 1816, »und alles das vorbereiten, was bei einem entstehenden Kriege nöthig ist.« Die Welle von groß angelegten Landesvermessungen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts stellt das Kielwasser von Napoleons militärischen Innovationen dar. Die Modernisierung der Kriegführung, die Einführung von beweglichen »Divisionen« etwa, deren Aufgabe darin bestand, nach Maßgabe lokaler Gegebenheiten auf eigene Faust zu operieren, machte präzise Geländekenntnisse zu einem strategischen Muss. Die topografische Karte, so wie wir sie bis heute kennen, ist eine Kriegsgeburt. Noch die harmloseste Bergwanderung wäre demnach auf den Missbrauch von Heeresgerät angewiesen. Ref. 23
Heinrich Berghaus, dem der Krieg und die Folgen den Weg ins Metier geebnet hatten, absolvierte die zweite Hälfte seiner Karriere als Zivilist. Für die Entwicklung der Kartografie in dieser Zeit ist das symptomatisch. 1821 verließ er die Armee, wurde Professor für angewandte Mathematik an der Königlichen Bauakademie in Berlin und gründete knapp zwei Jahrzehnte später die Potsdamer Kunstschule. Das Reglement, das Berghaus seiner neuen Anstalt ins Stammbuch schrieb, bewahrt die alte militärische Geheimniskrämerei um die Karte nur noch als Nachgeschmack. Es verpflichtete die Schüler Ref. 24 zu »strengster Verschwiegenheit«, und zwar in Bezug auf »Alles, was in der Kunstschule bearbeitet und besprochen wird«. Tatsächlich war der Schulbetrieb jedoch auf größtmögliche Publizität angewiesen. In Ermangelung staatlicher Gelder musste Berghaus seine Anstalt selbst finanzieren, und das tat er, indem er den Zöglingen kommerzielle Aufgaben übertrug. Geld ließ sich damals vor allem mit Atlanten verdienen - dem Leitmedium eines neuartigen Kartengebrauchs. Atlanten machten geografisches Wissen ebenso handlich wie erschwinglich und trugen es in die Wohnzimmer eines Bürgertums, dem es überhaupt erst seit einer Generation erlaubt war, solches Wissen zu besitzen. Die Aufhebung des Veröffentlichungsverbots für Karten durch Friedrich den Großen datiert von 1783. Der erste deutschsprachige Publikumsatlas kam 1807 auf den Markt. Stielers Handatlas erschien in erster Auflage 1823. Hatte Immanuel Kant in seinen geografischen Vorlesungen noch geklagt, die Deutschen hätten »keine Ansicht von dem Lande, dem Meere und der ganzen Oberfläche der Erde« und könnten »Nachrichten nicht an ihre Stelle bringen«, so war die kartografische Aufklärung inzwischen in vollem Gang. Sie fand neuerdings auch in der Schule statt. Die preußische Unterrichtsreform, die der verstörenden Niederlage gegen Napoleon folgte - eine Art Pisa-Schock des frühen 19. Jahrhunderts -, hatte das Schulfach Geografie auf die Lehrpläne gebracht. Daher gab der preußische Unterrichtsminister, der Berghaus bei der Gründung von dessen Kunstanstalt unterstützt hatte, dem Direktor einen unmissverständlichen Auftrag mit auf den Weg: »Das erste, was Sie machen müssen, ist ein Schul-Atlas.« Ref. 25
Aus diesem Grund begann August Petermann seine Ausbildungszeit mit der Herstellung von Atlanten. Auf den Schul-atlas folgte ein Kleiner geographisch-statistischer Atlas der Preußischen Monarchie, der Karten der »intellectuellen Kultur«, der »Sittlichkeit« und der »Volksdichtigkeit« enthielt, sowie Berghaus’ großer Physikalischer Atlas, von dem noch die Rede sein wird. Dank der Potsdamer Anstalt gehörte Petermann zur ersten Generation von Kartenmachern, deren Karriere nicht mehr zwangsläufig im Schoß des Militärs verlief. Nach wie vor bestand die Aufgabe darin, »dem Staate nützlich zu werden«, wie Petermann senior in seinem Gesuch an den König geschrieben hatte. Aber anstatt Generäle zu instruieren, hieß das nun, geografisch mündige Staatsbürger zu erziehen. In einem Brief an den Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha hat Petermann diese Aufgabe später - ein wenig anbiedernd - selbst umschrieben: »Mögen auch Männer wie Ref. 26 A. v. Humboldt, Carl Ritter und andere die höchste Stufe geographischer Bestrebungen dieses Jahrhunderts einnehmen, der unmittelbar ins Leben greifende, der auf den Unterricht und die Bildung des Volkes direkt ausgeübte Einfluß hat zweifelsohne eine größere, nachhaltigere Bedeutung. Die Atlanten, welche den Namen Stieler tragen, und die vielen Nachahmungen, zu denen ihr hoher Werth geführt, haben zuerst dem Volk im weitesten Sinne des Wortes eine Welt eröffnet in deutlicher Vorstellung und Kenntniß des Planeten, auf dem wir wohnen, während die Physikalischen Karten von Berghaus und Sydow diese Kenntnis auf eine höhere Stufe gestellt und den Sinn für Geographie unter allen civilisierten Völkern der Erde geweckt und erleuchtet haben.«
Die Eröffnung der Welt und die Erleuchtung des Publikums wurden nicht nur durch politischen Druck und guten Willen vollbracht. Genauso entscheidend war die Beschleunigung der technischen Reproduktionsmittel. Heinrich Berghaus schwor auf den Kupferstich, ein Verfahren, das seit Jahrhunderten den »Künsten«, und zwar den höheren, zugerechnet wurde. Wie die Eleven der Geographischen Kunstschule am eigenen Leib erfahren konnten, war diese Technik äußerst zeitraubend. Für die Ausbildung eines »mittelmäßigen« Ref. 27 Kupferstechers hat Petermann selbst später zehn volle Jahre veranschlagt. Eine Handzeichnung spiegelverkehrt in eine Kupferplatte zu stechen, die sich anschließend als Druckvorlage benutzen ließ, erforderte großes manuelles Geschick. Bei einer anspruchsvollen Karte konnte das Monate dauern. Nicht umsonst gab es renommierte, ja sogar berühmte Kupferstecher - bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Danach begann ihr Stern zu sinken. In der Zwischenzeit war nämlich ein schnelleres und billigeres Medium auf der Bildfläche erschienen, das das Kupfer durch Stein und den Stichel durch ätzende Tinte ersetzte: die Lithografie. Man muss sich die Erfindung dieser neuen Technik ähnlich einschneidend vorstellen, wie das Auftauchen des Fotokopierers in den 1970er Jahren: Sie löste einen regelrechten Vervielfältigungsboom aus und überschwemmte Europa mit einer Flut neuer Karten. Die »Kultur der Kopie«, die ein Markenzeichen unserer westlichen Moderne ist, machte mit der Lithografie einen Quantensprung. Heinrich Berghaus, ein Mann alter Schule, nahm das neue Verfahren zwar in den Lehrplan auf. Der Verfall handwerklicher Könnerschaft und die unübersehbaren Qualitätsverluste, die mit der Lithografie einhergingen, erschienen ihm jedoch bedenklich. Seine Schüler, eine Generation zwischen den Technologien, suchten zeitlebens nach Ideallösungen: So experimentierte Petermann später in England mit einem »neuen System«, das in der Lage sein sollte, die Präzision des Kupferstichs mit dem Tempo der Lithografie zu vereinen. Viel Erfolg hatte er damit nicht. Ref. 28
In Petermanns sechsjährige Ausbildungszeit fiel ein Bildungserlebnis, mit dem sich der Rest des Curriculums schwerlich messen konnte: Er lernte Alexander von Humboldt kennen, der im benachbarten Berlin lebte und seine Landkarten gerne von Berghaus anfertigen ließ. In den 1840er Jahren war Humboldt bereits eine lebende Legende: weißhaarig und weltberühmt, der bekannteste Deutsche und einflussreichste Wissenschaftler seiner Zeit. Man muss sich Petermanns Ehrfurcht ausmalen, als er dem Helden seiner Bücherträume plötzlich leibhaftig gegenüberstand. Und er hatte Glück. Als Berghaus’ Lieblingsschüler wurde er dazu auserwählt, eine Kartenskizze des großen Mannes ins Reine zu zeichnen. Keine unheikle Aufgabe, denn wie der Ziehvater unmissverständlich klar machte, war Humboldt, was Landkarten anging, nur schwer zufrieden zu stellen. »Recht klar und sauber«, lautete die Anweisung aus Berlin. Das ließ sich ein Wunderkind nicht zweimal sagen. Petermann zeichnete, und er machte seine Sache so gut, dass Humboldt die Karte tatsächlich im großen Asienbuch
1. Auflage Originalausgabe
Copyright © 2010 by Luchterhand Literaturverlag, München, ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN 978-3-641-05004-7
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe