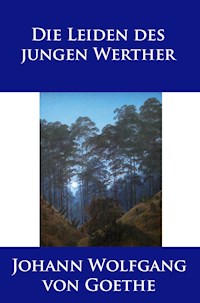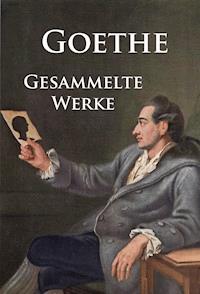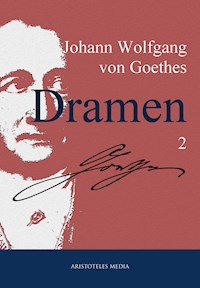Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Fassung in aktueller Rechtschreibung Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden ist ein spät vollendeter Roman von Johann Wolfgang von Goethe. Er gilt als die persönlichste aller Goethe'schen Dichtungen. 1821 erschien die erste Fassung, 1829 die vollständige. Als Vorlage für diese digitale Ausgabe dienten folgende Veröffentlichungen: -Sämtliche Werke, Insel-Verlag, Leipzig, 1982 -Wilhelm Meisters Wanderjahre, Wilhelm Goldmann Verlag, München, 1961 -Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig, 1821 Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johann Wolfgang von Goethe
Wilhelm Meisters Wanderjahre
oder die Entsagenden
Johann Wolfgang von Goethe
Wilhelm Meisters Wanderjahre
oder die Entsagenden
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962816-65-0
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Erstes Kapitel – Die Flucht nach Ägypten
Zweites Kapitel – Sankt Joseph der Zweite
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel – Wer ist der Verräter?
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel – Das nussbraune Mädchen
Zwölftes Kapitel
Zweites Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel – Hersilie an Wilhelm
Elftes Kapitel – Wilhelm an Natalien
Drittes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel – Lenardos Tagebuch
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel – Hersilie an Wilhelm
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Aus Makariens Archiv
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Erstes Buch
Erstes Kapitel – Die Flucht nach Ägypten
Im Schatten eines mächtigen Felsen saß Wilhelm an grauser, bedeutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ecke herum schnell nach der Tiefe wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umhergeklettert war, mit einem Stein in der Hand zu ihm kam. »Wie nennt man diesen Stein, Vater?« sagte der Knabe.
»Ich weiß nicht«, versetzte Wilhelm.
»Ist das wohl Gold, was darin so glänzt?« sagte jener.
»Es ist keins!« versetzte dieser, »und ich erinnere mich, dass es die Leute Katzengold nennen.«
»Katzengold!« sagte der Knabe lächelnd, »und warum?«
»Wahrscheinlich weil es falsch ist und man die Katzen auch für falsch hält.«
»Das will ich mir merken«, sagte der Sohn und steckte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas anderes hervor und fragte: »Was ist das?« – »Eine Frucht«, versetzte der Vater, »und nach den Schuppen zu urteilen, sollte sie mit den Tannenzapfen verwandt sein.« – »Das sieht nicht aus wie ein Zapfen, es ist ja rund.« – »Wir wollen den Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu säen, zu pflanzen und zu warten, dann lassen sie die Stämme wachsen und groß werden, wie sie können.« – »Die Jäger wissen alles; gestern zeigte mir der Bote, wie ein Hirsch über den Weg gegangen sei, er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte; ich war darüber weggesprungen, nun aber sah ich deutlich ein paar Klauen eingedrückt; es mag ein großer Hirsch gewesen sein.« – »Ich hörte wohl, wie du den Boten ausfragtest.« – »Der wusste viel und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Tag im Walde zu sein und die Vögel zu hören, zu wissen, wie sie heißen, wo ihre Nester sind, wie man die Eier aushebt oder die Jungen, wie man sie füttert und wenn man die Alten fängt: das ist gar zu lustig.«
Kaum war dieses gesprochen, so zeigte sich den schroffen Weg herab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Knaben, schön wie der Tag, in farbigen Jäckchen, die man eher für aufgebundene Hemdchen gehalten hätte, sprangen einer nach dem anderen herunter, und Wilhelm fand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutzten und einen Augenblick stillhielten. Um des ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken musste, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klarblauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gefallen über seine schöne Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhingen und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.
Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildnis ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabrief: »Warum steht ihr stille? versperrt uns den Weg nicht!«
Wilhelm sah aufwärts, und hatten ihn die Kinder in Verwunderung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein derber, tüchtiger, nicht allzu großer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einen Esel führte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputztes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanftes, liebenswürdiges Weib saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust drückte und mit unbeschreiblicher Lieblichkeit betrachtete. Dem Führer ging’s wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblickte. Das Tier verzögerte seinen Schritt, aber der Abstieg war zu jäh, die Vorüberziehenden konnten nicht anhalten, und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der vorstehenden Felswand verschwinden.
Nichts war natürlicher, als dass ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riss. Neugierig stand er auf und blickte von seiner Stelle nach der Tiefe hin, ob er sie nicht irgend wieder hervorkommen sähe. Und eben war er im Begriff, hinabzusteigen und diese sonderbaren Wandrer zu begrüßen, als Felix heraufkam und sagte: »Vater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen. Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten halten sie.«
»Ich will mit ihnen reden«, versetzte Wilhelm.
Er fand sich auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Aufmerksamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jetzt war es ihm möglich, noch einen und den anderen besondern Umstand zu bemerken. Der junge, rüstige Mann hatte wirklich eine Polieraxt auf der Schulter und ein langes, schwankes eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilfbüschel, als wenn es Palmen wären; und wenn sie von dieser Seite den Engeln glichen, so schleppten sie auch wieder kleine Körbchen mit Esswaren und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gebirg hin und her zu gehen pflegen. Auch hatte die Mutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blauen Mantel ein rötliches, zart gefärbtes Unterkleid, sodass unser Freund die Flucht nach Ägypten, die er so oft gemalt gesehen, mit Verwunderung hier vor seinen Augen wirklich finden musste.
Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Aufmerksamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte der junge Mann: »Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Wollt Ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen ein gutes Verhältnis entstehen könne?«
Wilhelm bedachte sich ein wenig und versetzte dann: »Der Anblick eures kleinen Familienzuges erregt Vertrauen und Neigung und, dass ich’s nur gleich gestehe, ebensowohl Neugierde und ein lebhaftes Verlangen, euch näher kennen zu lernen. Denn im ersten Augenblicke möchte man bei sich die Frage aufwerfen, ob ihr wirkliche Wanderer oder ob ihr nur Geister seid, die sich ein Vergnügen daraus machen, dieses unwirtbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.«
»So kommt mit in unsere Wohnung«, sagte jener. »Kommt mit!« riefen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich fortzogen. »Kommt mit!« sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freundlichkeit von dem Säugling ab auf den Fremdling wendete.
Ohne sich zu bedenken, sagte Wilhelm: »Es tut mir leid, dass ich euch nicht sogleich folgen kann. Wenigstens diese Nacht noch muss ich oben auf dem Grenzhause zubringen. Mein Mantelsack, meine Papiere, alles liegt noch oben, ungepackt und unbesorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundlichen Einladung genugzutun, so gebe ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist’s hin?«
»Vor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung«, sagte der Zimmermann, »und von dem Grenzhause habt Ihr nur noch anderthalb Stunden. Euer Knabe vermehrt unsern Haushalt für diese Nacht; morgen erwarten wir Euch.«
Der Mann und das Tier setzten sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft, er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbchen ergriffen, womit er beides auszusprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachrief: »Wie soll ich euch aber erfragen?«
»Fragt nur nach Sankt Joseph!« erscholl es aus der Tiefe, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer, mehrstimmiger Gesang tönte verhallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte die Stimme seines Felix zu unterscheiden.
Er stieg aufwärts und verspätete sich dadurch den Sonnenuntergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich der großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feder ergriff und einen Teil der Nacht mit Schreiben zubrachte.
Wilhelm an Natalien
Nun ist endlich die Höhe erreicht, die Höhe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen uns setzen wird als der ganze Landraum bisher. Für mein Gefühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, solange die Ströme von uns zu ihnen laufen. Heute kann ich mir noch einbilden, der Zweig, den ich in den Waldbach werfe, könnte füglich zu ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor ihrem Garten landen; und so sendet unser Geist seine Bilder, das Herz seine Gefühle bequemer abwärts. Aber drüben, fürchte ich, stellt sich eine Scheidewand der Einbildungskraft und der Empfindung entgegen. Doch ist das vielleicht nur eine voreilige Besorglichkeit: denn es wird wohl auch drüben nicht anders sein als hier. Was könnte mich von dir scheiden! von dir, der ich auf ewig geeignet bin, wenngleich ein wundersames Geschick mich von dir trennt und mir den Himmel, dem ich so nahe stand, unerwartet zuschließt. Ich hatte Zeit, mich zu fassen, und doch hätte keine Zeit hingereicht, mir diese Fassung zu geben, hätte ich sie nicht aus deinem Munde gewonnen, von deinen Lippen in jenem entscheidenden Moment. Wie hätte ich mich losreißen können, wenn der dauerhafte Faden nicht gesponnen wäre, der uns für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden soll. Doch ich darf ja von allem dem nicht reden. Deine zarten Gebote will ich nicht übertreten; auf diesem Gipfel sei es das letztemal, dass ich das Wort Trennung vor dir ausspreche. Mein Leben soll eine Wanderschaft werden. Sonderbare Pflichten des Wanderers habe ich auszuüben und ganz eigene Prüfungen zu bestehen. Wie lächle ich manchmal, wenn ich die Bedingungen durchlese, die mir der Verein, die ich mir selbst vorschrieb! Manches wird gehalten, manches übertreten; aber selbst bei der Übertretung dient mir dies Blatt, dieses Zeugnis von meiner letzten Beichte, meiner letzten Absolution statt eines gebietenden Gewissens, und ich lenke wieder ein. Ich hüte mich, und meine Fehler stürzen sich nicht mehr wie Gebirgswasser einer über den anderen.
Doch will ich dir gern gestehen, dass ich oft diejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere, mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich’s und der Welt leicht. Denn gerade diesen Teil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerlichste, der wunderlichste schien, diesen beobachte ich am bequemsten, am liebsten.
Nicht über drei Tage soll ich unter einem Dache bleiben. Keine Herberge soll ich verlassen, ohne dass ich mich wenigstens eine Meile von ihr entferne. Diese Gebote sind wahrhaft geeignet, meine Jahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, dass auch nicht die geringste Versuchung des Ansiedelns bei mir sich finde. Dieser Bedingung habe ich mich bisher genau unterworfen, ja mich der gegebenen Erlaubnis nicht einmal bedient. Hier ist eigentlich das erstemal, dass ich stillhalte, das erstemal, dass ich die dritte Nacht in demselben Bette schlafe. Von hier sende ich dir manches bisher Vernommene, Beobachtete, Gesparte, und dann geht es morgen früh auf der anderen Seite hinab, fürerst zu einer wunderbaren Familie, zu einer heiligen Familie möchte ich wohl sagen, von der du in meinem Tagebuche mehr finden wirst. Jetzt lebe wohl und lege dieses Blatt mit dem Gefühl aus der Hand, dass es nur eins zu sagen habe, nur eines sagen und immer wiederholen möchte, aber es nicht sagen, nicht wiederholen will, bis ich das Glück habe, wieder zu deinen Füßen zu liegen und auf deinen Händen mich über alle das Entbehren auszuweinen.
Morgens.
Es ist eingepackt. Der Bote schnürt den Mantelsack auf das Reff. Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Nebel dampfen aus allen Gründen; aber der obere Himmel ist heiter. Wir steigen in die düstere Tiefe hinab, die sich auch bald über unserm Haupte erhellen wird. Lass mich mein letztes Ach zu dir hinübersenden! Lass meinen letzten Blick zu dir sich noch mit einer unwillkürlichen Träne füllen! Ich bin entschieden und entschlossen. Du sollst keine Klagen mehr von mir hören; du sollst nur hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch kreuzen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hoffnungen und Vorsätze. Glücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote ruft, und der Wirt räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gefühllose, unvorsichtige Erben vor dem Abscheidenden die Anstalten, sich in Besitz zu setzen, nicht verbergen.
Zweites Kapitel – Sankt Joseph der Zweite
Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Fuße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sanfteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, bis sie sich endlich an einem Abhange befanden und in ein sorgfältig bebautes, von Hügeln rings umschlossenes Tal hinabschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Klostergebäude zog sogleich die Aufmerksamkeit an sich. »Dies ist Sankt Joseph«, sagte der Bote; »jammerschade für die schöne Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und Pfeiler durch Gebüsch und Bäume noch so wohlerhalten durchsehen, ob sie gleich schon viele hundert Jahre im Schutt liegt.«
»Die Klostergebäude hingegen«, versetzte Wilhelm, »sehe ich, sind noch wohl erhalten.« – »Ja«, sagte der andere, »es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirtschaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man weit und breit hierher zu zahlen hat.«
Unter diesen Worten waren sie durch das offene Tor in den geräumigen Hof gelangt, der, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuden umgeben, sich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung ankündigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkorb, den eine rüstige Frau vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff, Kirschen zu handeln; eigentlich aber feilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich führte. Nun machte er sogleich als Gast den Wirt, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen, selbst dem Vater war die Erquickung angenehm, mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die farbigen, glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie trage solche weit herauf aus einem großen Garten, bemerkte die Verkäuferin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käufern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Vater werde bald zurückkommen, sagten die Kinder, er solle nur einstweilen in den Saal gehen und dort ausruhen.
Wie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem Raume führten, den sie den Saal nannten. Gleich aus dem Hofe ging es zu einer großen Tür hinein, und unser Wanderer fand sich in einer sehr reinlichen, wohlerhaltenen Kapelle, die aber, wie er wohl sah, zum häuslichen Gebrauch des täglichen Lebens eingerichtet war. An der einen Seite stand ein Tisch, ein Sessel, mehrere Stühle und Bänke, an der anderen Seite ein wohlgeschnitztes Gerüst mit bunter Töpferware, Krügen und Gläsern. Es fehlte nicht an einigen Truhen und Kisten und, so ordentlich alles war, doch nicht an dem Einladenden des häuslichen, täglichen Lebens. Das Licht fiel von hohen Fenstern an der Seite herein. Was aber die Aufmerksamkeit des Wanderers am meisten erregte, waren farbige, auf die Wand gemalte Bilder, die unter den Fenstern in ziemlicher Höhe, wie Teppiche, um drei Teile der Kapelle herumreichten und bis auf ein Getäfel herabgingen, das die übrige Wand bis zur Erde bedeckte. Die Gemälde stellten die Geschichte des heiligen Joseph vor. Hier sah man ihn mit einer Zimmerarbeit beschäftigt; hier begegnete er Marien, und eine Lilie sprosste zwischen beiden aus dem Boden, indem einige Engel sie lauschend umschwebten. Hier wird er getraut; es folgt der englische Gruß. Hier sitzt er missmutig zwischen angefangener Arbeit, lässt die Axt ruhen und sinnt darauf, seine Gattin zu verlassen. Zunächst erscheint ihm aber der Engel im Traum, und seine Lage ändert sich. Mit Andacht betrachtet er das neugeborene Kind im Stalle zu Bethlehem und betet es an. Bald darauf folgt ein wundersam schönes Bild. Man sieht mancherlei Holz gezimmert; eben soll es zusammengesetzt werden, und zufälligerweise bilden ein paar Stücke ein Kreuz. Das Kind ist auf dem Kreuze eingeschlafen, die Mutter sitzt daneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pflegevater hält mit der Arbeit inne, um den Schlaf nicht zu stören. Gleich darauf folgt die Flucht nach Ägypten. Sie erregte bei dem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederholung des gestrigen lebendigen Bildes hier an der Wand sah.
Nicht lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Wirt herein, den er sogleich als den Führer der heiligen Karawane wiedererkannte. Sie begrüßten sich aufs herzlichste, mancherlei Gespräche folgten; doch Wilhelms Aufmerksamkeit blieb auf die Gemälde gerichtet. Der Wirt merkte das Interesse seines Gastes und fing lächelnd an: »Gewiss, Ihr bewundert die Übereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die Ihr gestern kennenlerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuten sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig ist, so kann es auch wohl Lebendiges hervorbringen.«
»O ja!« versetzte Wilhelm. »Es sollte mich wundern, wenn der Geist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Besitzungen und Rechten an sich zog und dafür mannigfaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. Lasst uns jedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit Eurer Geschichte bekannt, damit ich erfahre, wie es möglich war, dass ohne Spielerei und Anmaßung die Vergangenheit sich wieder in Euch darstellt und das, was vorüberging, abermals herantritt.«
Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirtes erwartete, rief eine freundliche Stimme im Hofe den Namen Joseph. Der Wirt hörte darauf und ging nach der Tür.
»Also heißt er auch Joseph!« sagte Wilhelm zu sich selbst. »Das ist doch sonderbar genug und doch eben nicht so sonderbar, als dass er seinen Heiligen im Leben darstellt.« Er blickte zu gleicher Zeit nach der Türe und sah die Mutter Gottes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich: die Frau ging nach der gegenüberstehenden Wohnung. »Marie!« rief er ihr nach, »nur noch ein Wort!« – »Also heißt sie auch Marie!« dachte Wilhelm; »es fehlt nicht viel, so fühle ich mich achtzehnhundert Jahre zurückversetzt.« Er dachte sich das ernsthaft eingeschlossene Tal, in dem er sich befand, die Trümmer und die Stille, und eine wundersam altertümliche Stimmung überfiel ihn. Es war Zeit, dass der Wirt und die Kinder hereintraten. Die letzteren forderten Wilhelm zu einem Spaziergange auf, indes der Wirt noch einigen Geschäften vorstehen wollte. Nun ging es durch die Ruinen des säulenreichen Kirchengebäudes, dessen hohe Giebel und Wände sich in Wind und Wetter zu befestigen schienen, indessen sich starke Bäume von alters her auf den breiten Mauerrücken eingewurzelt hatten und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blumen und Moos kühn in der Luft hängende Gärten vorstellten. Sanfte Wiesenpfade führten einen lebhaften Bach hinan, und von einiger Höhe konnte der Wanderer nun das Gebäude nebst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner immer merkwürdiger geworden und durch die Harmonie mit ihrer Umgebung seine lebhafte Neugier erregt hatten.
Man kehrte zurück und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Obenan stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau niederließ. Neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Vater sodann zur linken Hand und Wilhelm zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. Eine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise- und Trinkgeschirr deuteten gleichfalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlass zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen Wirtin nicht genugsam beobachten konnte.
Nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirt führte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Platze die angenehme Aussicht das Tal hinab vollkommen vor sich hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hintereinander hinausgeschoben sah. »Es ist billig«, sagte der Wirt, »dass ich Ihre Neugierde befriedige, umso mehr, als ich an Ihnen fühle, dass Sie imstande sind, auch das Wunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der heiligen Familie gewidmet und vor alters als Wallfahrt wegen mancher Wunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht. Sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. Die Kapelle, dem heiligen Pflegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchbare Teil der Klostergebäude. Die Einkünfte bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält, und der bin ich, Sohn des vorigen Schaffners, der gleichfalls seinem Vater in dieser Stelle nachfolgte.
Der heilige Joseph, obgleich jede kirchliche Verehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohltätig gewesen, dass man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt fühlte; und daher kam es, dass man mich in der Taufe Joseph nannte und dadurch gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Vater gesellte, indem er die Einnahmen besorgte, so schloss ich mich ebenso gern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Vermögen gern ausspendete und durch ihren guten Willen und durch ihre Wohltaten im ganzen Gebirge bekannt und geliebt war. Sie schickte mich bald da-, bald dorthin, bald zu bringen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich fand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.
Überhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem flachen Lande. Die Bewohner sind einander näher und, wenn man will, auch ferner; die Bedürfnisse geringer, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt, seinen Händen, seinen Füßen muss er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in einer Person; auch steht jeder dem anderen näher, begegnet ihm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.
Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich darauf, einen kleinen Esel mit Körben zu versehen und vor mir her die steilen Fußpfade hinauf und hinab zu treiben. Der Esel ist im Gebirg kein so verächtlich Tier als im flachen Lande, wo der Knecht, der mit Pferden pflügt, sich für besser hält als den anderen, der den Acker mit Ochsen umreißt. Und ich ging umso mehr ohne Bedenken hinter meinem Tiere her, als ich in der Kapelle früh bemerkt hatte, dass es zur Ehre gelangt war, Gott und seine Mutter zu tragen. Doch war diese Kapelle damals nicht in dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig befindet. Sie ward als ein Schuppen, ja fast wie ein Stall behandelt. Brennholz, Stangen, Gerätschaften, Tonnen und Leitern, und was man nur wollte, war übereinander geschoben. Glücklicherweise, dass die Gemälde so hoch stehen und die Täfelung etwas aushält. Aber schon als Kind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz hin und her zu klettern und die Bilder zu betrachten, die mir niemand recht auslegen konnte. Genug, ich wusste, dass der Heilige, dessen Leben oben gezeichnet war, mein Pate sei, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Onkel gewesen wäre. Ich wuchs heran, und weil es eine besondere Bedingung war, dass der, welcher an das einträgliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Handwerk ausüben musste, so sollte ich, dem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünschten, dass künftig diese gute Pfründe auf mich erben möchte, ein Handwerk lernen, und zwar ein solches, das zugleich hier oben in der Wirtschaft nützlich wäre.
Mein Vater war Bötticher und schaffte alles, was von dieser Arbeit nötig war, selbst, woraus ihm und dem Ganzen großer Vorteil erwuchs. Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm darin nachzufolgen. Mein Verlangen zog mich unwiderstehlich nach dem Zimmerhandwerke, wovon ich das Arbeitszeug so umständlich und genau, von Jugend auf, neben meinem Heiligen gemalt gesehen. Ich erklärte meinen Wunsch; man war mir nicht entgegen, umso weniger, als bei so mancherlei Baulichkeiten der Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja bei einigem Geschick und Liebe zu feinerer Arbeit, besonders in Waldgegenden, die Tischler- und sogar die Schnitzerkünste ganz nahe liegen. Und was mich noch mehr in meinen höheren Aussichten bestärkte, war jenes Gemälde, das leider nunmehr fast ganz verloschen ist. Sobald Sie wissen, was es vorstellen soll, so werden Sie sich’s entziffern können, wenn ich Sie nachher davor führe. Dem heiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für den König Herodes zu machen. Zwischen zwei gegebenen Säulen soll der Prachtsitz aufgeführt werden. Joseph nimmt sorgfältig das Maß von Breite und Höhe und arbeitet einen köstlichen Königsthron. Aber wie erstaunt ist er, wie verlegen, als er den Prachtsessel herbeischafft: er findet sich zu hoch und nicht breit genug. Mit König Herodes war, wie bekannt, nicht zu spaßen; der fromme Zimmermeister ist in der größten Verlegenheit. Das Christkind, gewohnt, ihn überallhin zu begleiten, ihm in kindlich demütigem Spiel die Werkzeuge nachzutragen, bemerkt seine Not und ist gleich mit Rat und Tat bei der Hand. Das Wunderkind verlangt vom Pflegevater, er solle den Thron an der einen Seite fassen; es greift in die andere Seite des Schnitzwerks, und beide fangen an zu ziehen. Sehr leicht und bequem, als wär’ er von Leder, zieht sich der Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an der Höhe und passt ganz vortrefflich an Ort und Stelle, zum größten Troste des beruhigten Meisters und zur vollkommenen Zufriedenheit des Königs.
Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der einen Seite werden Sie bemerken können, dass am Schnitzwerk nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen musste, als es dem Zimmermann gewesen wäre, wenn man es von ihm verlangt hätte.
Hieraus zog ich aber keine Bedenklichkeit, sondern ich erblickte das Handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte, dass ich nicht erwarten konnte, bis man mich in die Lehre tat; welches umso leichter auszuführen war, als in der Nachbarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arbeitete und mehrere Gesellen und Lehrburschen beschäftigen konnte. Ich blieb also in der Nähe meiner Eltern und setzte gewissermaßen mein voriges Leben fort, indem ich Feierstunden und Feiertage zu den wohltätigen Botschaften, die mir meine Mutter aufzutragen fortfuhr, verwendete.«
Die Heimsuchung
»So vergingen einige Jahre«, fuhr der Erzähler fort. »Ich begriff die Vorteile des Handwerks sehr bald, und mein Körper, durch Arbeit ausgebildet, war imstande, alles zu übernehmen, was dabei gefordert wurde. Nebenher versah ich meinen alten Dienst, den ich der guten Mutter, oder vielmehr Kranken und Notdürftigen leistete. Ich zog mit meinem Tier durchs Gebirg, verteilte die Ladung pünktlich und nahm von Krämern und Kaufleuten rückwärts mit, was uns hier oben fehlte. Mein Meister war zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich das Vergnügen, auf meinen Wanderungen manches Haus zu sehen, das ich mit aufgeführt, das ich verziert hatte. Denn besonders dieses letzte Einkerben der Balken, dieses Einschneiden von gewissen einfachen Formen, dieses Einbrennen zierender Figuren, dieses Rotmalen einiger Vertiefungen, wodurch ein hölzernes Berghaus den so lustigen Anblick gewährt, solche Künste waren mir besonders übertragen, weil ich mich am besten aus der Sache zog, der ich immer den Thron Herodes’ und seine Zieraten im Sinne hatte.
Unter den hilfsbedürftigen Personen, für die meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, standen besonders junge Frauen obenan, die sich guter Hoffnung befanden, wie ich nach und nach wohl bemerken konnte, ob man schon in solchen Fällen die Botschaften gegen mich geheimnisvoll zu behandeln pflegte. Ich hatte dabei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sondern alles ging durch ein gutes Weib, welche nicht fern das Tal hinab wohnte und Frau Elisabeth genannt wurde. Meine Mutter, selbst in der Kunst erfahren, die so manchen gleich beim Eintritt in das Leben zum Leben rettet, stand mit Frau Elisabeth in fortdauernd gutem Vernehmen, und ich musste oft von allen Seiten hören, dass mancher unserer rüstigen Bergbewohner diesen beiden Frauen sein Dasein zu danken habe. Das Geheimnis, womit mich Elisabeth jederzeit empfing, die bündigen Antworten auf meine rätselhaften Fragen, die ich selbst nicht verstand, erregten mir sonderbare Ehrfurcht für sie, und ihr Haus, das höchst reinlich war, schien mir eine Art von kleinem Heiligtume vorzustellen.
Indessen hatte ich durch meine Kenntnisse und Handwerkstätigkeit in der Familie ziemlichen Einfluss gewonnen. Wie mein Vater als Bötticher für den Keller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Fach und verbesserte manchen schadhaften Teil der alten Gebäude. Besonders wusste ich einige verfallene Scheuern und Remisen für den häuslichen Gebrauch wieder nutzbar zu machen; und kaum war dieses geschehen, als ich meine geliebte Kapelle zu räumen und zu reinigen anfing. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, fast wie Ihr sie sehet; wobei ich mich bemühte, die fehlenden oder beschädigten Teile des Täfelwerks dem Ganzen gleich wiederherzustellen. Auch solltet Ihr diese Flügeltüren des Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in ruhigen Stunden zu schnitzen, nachdem ich sie vorher aus starken eichenen Bohlen im ganzen tüchtig zusammengefügt hatte. Was bis zu dieser Zeit von Gemälden nicht beschädigt oder verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half dem Glasmeister bei einem neuen Bau, mit der Bedingung, dass er bunte Fenster herstellte.
Hatten jene Bilder und die Gedanken an das Leben des Heiligen meine Einbildungskraft beschäftigt, so drückte sich das alles nur viel lebhafter bei mir ein, als ich den Raum wieder für ein Heiligtum ansehen, darin, besonders zur Sommerszeit, verweilen und über das, was ich sah oder vermutete, mit Muße nachdenken konnte. Es lag eine unwiderstehliche Neigung in mir, diesem Heiligen nachzufolgen; und da sich ähnliche Begebenheiten nicht leicht herbeirufen ließen, so wollte ich wenigstens von unten auf anfangen, ihm zu gleichen: wie ich denn wirklich durch den Gebrauch des lastbaren Tiers schon lange begonnen hatte. Das kleine Geschöpf, dessen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genügen; ich suchte mir einen viel stattlicheren Träger aus, sorgte für einen wohlgebauten Sattel, der zum Reiten wie zum Packen gleich bequem war. Ein paar neue Körbe wurden angeschafft, und ein Netz von bunten Schnüren, Flocken und Quasten, mit klingenden Metallstiften untermischt, zierte den Hals des langohrigen Geschöpfs, das sich nun bald neben seinem Musterbilde an der Wand zeigen durfte. Niemanden fiel ein, über mich zu spotten, wenn ich in diesem Aufzuge durchs Gebirge kam: denn man erlaubt ja gern der Wohltätigkeit eine wunderliche Außenseite.
Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die Folge desselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gefährliche Rotten von verlaufenem Gesindel sich versammelten und hie und da manche Gewalttätigkeit, manchen Mutwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streifungen und augenblickliche Wachsamkeit wurde dem Übel zwar bald gesteuert; doch verfiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich’s versah, brachen wieder neue Übeltaten hervor.
Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfade, bis ich eines Tages über die frisch besäte Waldblöße1 kam und an dem Rande des Hegegrabens eine weibliche Gestalt sitzend oder vielmehr liegend fand. Sie schien zu schlafen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühte mich um sie, und als sie ihre schönen Augen aufschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhaftigkeit aus: ›Wo ist er? habt Ihr ihn gesehen?‹ Ich fragte: ›Wen?‹ Sie versetzte: ›Meinen Mann!‹ Bei ihrem höchst jugendlichen Ansehen war mir diese Antwort unerwartet; doch fuhr ich nur um desto lieber fort, ihr beizustehen und sie meiner Teilnahme zu versichern. Ich vernahm, dass die beiden Reisenden sich wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen entfernt gehabt, um einen nähern Fußweg einzuschlagen. In der Nähe seien sie von Bewaffneten überfallen worden, ihr Mann habe sich fechtend entfernt, sie habe ihm nicht weit folgen können und sei an dieser Stelle liegengeblieben, sie wisse nicht wie lange. Sie bitte mich inständig, sie zu verlassen und ihrem Manne nachzueilen. Sie richtete sich auf ihre Füße, und die schönste, liebenswürdigste Gestalt stand vor mir; doch konnte ich leicht bemerken, dass sie sich in einem Zustande befinde, in welchem sie die Beihilfe meiner Mutter und der Frau Elisabeth wohl bald bedürfen möchte. Wir stritten uns eine Weile: denn ich verlangte, sie erst in Sicherheit zu bringen; sie verlangte zuerst Nachricht von ihrem Manne. Sie wollte sich von seiner Spur nicht entfernen, und alle meine Vorstellungen hätten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Kommando unserer Miliz, welche durch die Nachricht von neuen Übeltaten rege geworden war, sich durch den Wald her bewegt hätte. Diese wurden unterrichtet, mit ihnen das Nötige verabredet, der Ort des Zusammentreffens bestimmt und so für diesmal die Sache geschlichtet. Geschwind versteckte ich meine Körbe in eine benachbarte Höhle, die mir schon öfters zur Niederlage gedient hatte, richtete meinen Sattel zum bequemen Sitz und hob, nicht ohne eine sonderbare Empfindung, die schöne Last auf mein williges Tier, das die gewohnten Pfade sogleich von selbst zu finden wusste und mir Gelegenheit gab, nebenher zu gehen.
Ihr denkt, ohne dass ich es weitläufig beschreibe, wie wunderlich mir zumute war. Was ich so lange gesucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich träumte, und dann gleich wieder, als ob ich aus einem Traume erwachte. Diese himmlische Gestalt, wie ich sie gleichsam in der Luft schweben und vor den grünen Bäumen sich her bewegen sah, kam mir jetzt wie ein Traum vor, der durch jene Bilder in der Kapelle sich in meiner Seele erzeugte. Bald schienen mir jene Bilder nur Träume gewesen zu sein, die sich hier in eine schöne Wirklichkeit auflösten. Ich fragte sie manches, sie antwortete mir sanft und gefällig, wie es einer anständig Betrübten ziemt. Oft bat sie mich, wenn wir auf eine entblößte Höhe kamen, stillezuhalten, mich umzusehen, zu horchen. Sie bat mich mit solcher Anmut, mit einem solchen tief wünschenden Blick unter ihren langen schwarzen Augenwimpern hervor, dass ich alles tun musste, was nur möglich war; ja ich erkletterte eine freistehende, hohe, astlose Fichte. Nie war mir dieses Kunststück meines Handwerks willkommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ähnlichen Gipfeln, bei Festen und Jahrmärkten, Bänder und seidene Tücher heruntergeholt. Doch kam ich diesesmal leider ohne Ausbeute; auch oben sah und hörte ich nichts. Endlich rief sie selbst mir, herabzukommen, und winkte gar lebhaft mit der Hand; ja, als ich endlich beim Herabgleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und heruntersprang, tat sie einen Schrei, und eine süße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gesicht, da sie mich unbeschädigt vor sich sah.
Was soll ich Euch lange von den hundert Aufmerksamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen Weg über angenehm zu werden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnte ich es auch! denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit, dass sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht. Für mein Gefühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die fernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälder, die ich ihr nannte, so viel kostbare Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Verhältnis zu setzen, wie man es durch Geschenke zu tun sucht.
Schon hatte sie mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Türe jener guten Frau anlangten und ich schon eine schmerzliche Trennung vor mir sah. Nochmals durchlief ich ihre ganze Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herabkamen, bückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu tun hätte, und küsste den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne dass sie es merkte. Ich half ihr herunter, sprang die Stufen hinauf und rief in die Haustüre: ›Frau Elisabeth, Ihr werdet heimgesucht!‹ Die Gute trat hervor, und ich sah ihr über die Schultern zum Hause hinaus, wie das schöne Wesen die Stufen heraufstieg, mit anmutiger Trauer und innerlichem schmerzlichen Selbstgefühl, dann meine würdige Alte freundlich umarmte und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schlossen sich ein, und ich stand bei meinem Esel vor der Tür, wie einer, der kostbare Waren abgeladen hat und wieder ein ebenso armer Treiber ist als vorher.«
Der Lilienstengel
»Ich zauderte noch, mich zu entfernen, denn ich war unschlüssig, was ich tun sollte, als Frau Elisabeth unter die Türe trat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berufen, alsdann umherzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. ›Marie lässt Euch gar sehr darum ersuchen‹, sagte sie. – ›Kann ich sie nicht noch einmal selbst sprechen?‹ versetzte ich. – ›Das geht nicht an‹, sagte Frau Elisabeth, und wir trennten uns. In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit, noch diesen Abend hinabzugehen und der jungen Fremden hilfreich zu sein. Ich eilte nach dem Lande hinunter und hoffte, bei dem Amtmann die sichersten Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch selbst in Ungewissheit, und weil er mich kannte, hieß er mich die Nacht bei ihm verweilen. Sie ward mir unendlich lang, und immer hatte ich die schöne Gestalt vor Augen, wie sie auf dem Tiere schwankte und so schmerzhaft freundlich zu mir heruntersah. Jeden Augenblick hofft’ ich auf Nachricht. Ich gönnte und wünschte dem guten Ehemann das Leben, und doch mochte ich sie mir so gern als Witwe denken. Das streifende Kommando fand sich nach und nach zusammen, und nach mancherlei abwechselnden Gerüchten zeigte sich endlich die Gewissheit, dass der Wagen gerettet, der unglückliche Gatte aber an seinen Wunden in dem benachbarten Dorfe gestorben sei. Auch vernahm ich, dass nach der früheren Abrede einige gegangen waren, diese Trauerbotschaft der Frau Elisabeth zu verkündigen. Also hatte ich dort nichts mehr zu tun noch zu leisten, und doch trieb mich eine unendliche Ungeduld, ein unermessliches Verlangen durch Berg und Wald wieder vor ihre Türe. Es war Nacht, das Haus verschlossen, ich sah Licht in den Zimmern, ich sah Schatten sich an den Vorhängen bewegen, und so saß ich gegenüber auf einer Bank, immer im Begriff anzuklopfen und immer von mancherlei Betrachtungen zurückgehalten.
Jedoch was erzähl’ ich umständlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat. Genug, auch am folgenden Morgen nahm man mich nicht ins Haus auf. Man wusste die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schickte mich zu meinem Vater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich los sein.
Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hereinrief. ›Tretet sachte auf, mein Freund‹, sagte sie, ›aber kommt getrost näher!‹ Sie führte mich in ein reinliches Zimmer, wo ich in der Ecke durch halbgeöffnete Bettvorhänge meine Schöne aufrecht sitzen sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hub etwas vom Bette auf und brachte mir’s entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt den schönsten Knaben. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle fiel mir der Lilienstengel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph als Zeuge eines reinen Verhältnisses aus der Erde hebt. Von dem Augenblicke an war mir aller Druck vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glücks gewiss. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Knaben auf den Arm nehmen und ihm einen herzlichen Kuss auf die Stirn drücken.
›Wie danke ich Euch für Eure Neigung zu diesem verwaisten Kinde!‹ sagte die Mutter. – Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: ›Es ist keine Waise mehr, wenn Ihr wollt!‹
Frau Elisabeth, klüger als ich, nahm mir das Kind ab und wusste mich zu entfernen.
Noch immer dient mir das Andenken jener Zeit zur glücklichsten Unterhaltung, wenn ich unsere Berge und Täler zu durchwandern genötigt bin. Noch weiß ich mir den kleinsten Umstand zurückzurufen, womit ich Euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen gingen vorüber; Maria hatte sich erholt, ich konnte sie öfter sehen, mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Aufmerksamkeiten. Ihre Familienverhältnisse erlaubten ihr einen Wohnort nach Belieben. Erst verweilte sie bei Frau Elisabeth; dann besuchte sie uns, meiner Mutter und mir für so vielen und freundlichen Beistand zu danken. Sie gefiel sich bei uns, und ich schmeichelte mir, es geschehe zum Teil um meinetwillen. Was ich jedoch so gern gesagt hätte und nicht zu sagen wagte, kam auf eine sonderbare und liebliche Weise zur Sprache, als ich sie in die Kapelle führte, die ich schon damals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr die Bilder, eins nach dem anderen, und entwickelte dabei die Pflichten eines Pflegevaters auf eine so lebendige und herzliche Weise, dass ihr die Tränen in die Augen traten und ich mit meiner Bilderdeutung nicht zu Ende kommen konnte. Ich glaubte ihrer Neigung gewiss zu sein, ob ich gleich nicht stolz genug war, das Andenken ihres Mannes so schnell auslöschen zu wollen. Das Gesetz verpflichtet die Witwen zu einem Trauerjahre, und gewiss ist eine solche Epoche, die den Wechsel aller irdischen Dinge in sich begreift, einem fühlenden Herzen nötig, um die schmerzlichen Eindrücke eines großen Verlustes zu mildern. Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man sieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein.
Ich sprach nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, die mir so sehr am Herzen lag. Sie entdeckte mir darauf, wie schmerzlich Marien der Tod ihres Mannes gewesen und wie sie sich ganz allein durch den Gedanken, dass sie für das Kind leben müsse, wieder aufgerichtet habe. Meine Neigung war den Frauen nicht unbekannt geblieben, und schon hatte sich Marie an die Vorstellung gewöhnt, mit uns zu leben. Sie verweilte noch eine Zeit lang in der Nachbarschaft; dann zog sie zu uns herauf, und wir lebten noch eine Weile in dem frömmsten und glücklichsten Brautstande. Endlich verbanden wir uns. Jenes erste Gefühl, das uns zusammengeführt hatte, verlor sich nicht. Die Pflichten und Freuden des Pflegevaters und Vaters vereinigten sich; und so überschritt zwar unsere kleine Familie, indem sie sich vermehrte, ihr Vorbild an Zahl der Personen, aber die Tugenden jenes Musterbildes an Treue und Reinheit der Gesinnungen wurden von uns heilig bewahrt und geübt. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit den äußern Schein, zu dem wir zufällig gelangt und der so gut zu unserm Innern passt: denn ob wir gleich alle gute Fußgänger und rüstige Träger sind, so bleibt das lastbare Tier doch immer in unserer Gesellschaft, um eine oder die andere Bürde fortzubringen, wenn uns ein Geschäft oder Besuch durch diese Berge und Täler nötigt. Wie Ihr uns gestern angetroffen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz darauf, dass unser Wandel von der Art ist, um jenen heiligen Namen und Gestalten, zu deren Nachahmung wir uns bekennen, keine Schande zu machen.«
Lichtung <<<
Drittes Kapitel
Wilhelm an Natalien
Soeben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines gar wackeren Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte sind, wenn ich hie und da meine Gesinnungen bei Gelegenheit der seinigen ausgedrückt habe, so war es bei der Verwandtschaft, die ich hier mit ihm fühlte, ganz natürlich. Jene Verehrung seines Weibes, gleicht sie nicht derjenigen, die ich für dich empfinde? und hat nicht selbst das Zusammentreffen dieser beiden Liebenden etwas Ähnliches mit dem unsrigen? Dass er aber glücklich genug ist, neben dem Tiere herzugehen, das die doppelt schöne Bürde trägt, dass er mit seinem Familienzug abends in das alte Klostertor eindringen kann, dass er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ist, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiden. Dagegen darf ich nicht einmal mein Schicksal beklagen, weil ich dir zugesagt habe, zu schweigen und zu dulden, wie du es auch übernommen hast.
Gar manchen schönen Zug des Zusammenseins dieser frommen und heitern Menschen muss ich übergehen: denn wie ließe sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der dritte mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu sein.
Mit Felix hatte ich heut einen kleinen Handel: denn er wollte fast mich nötigen, einen meiner guten Vorsätze zu übertreten, die ich dir angelobt habe. Ein Fehler, ein Unglück, ein Schicksal ist mir’s nun einmal, dass sich, ehe ich mich’s versehe, die Gesellschaft um mich vermehrt, dass ich mir eine neue Bürde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft kein Dritter uns ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben, und eben schien sich ein neues, eben nicht erfreuliches Verhältnis anknüpfen zu wollen.
Zu den Kindern des Hauses, mit denen Felix sich spielend diese Tage her ergötzte, hatte sich ein kleiner, munterer, armer Junge gesellt, der sich eben brauchen und missbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst setzte. Und ich merkte schon an allerlei Äußerungen, dass dieser sich einen Gespielen für den nächsten Weg auserkoren hatte. Der Knabe ist hier in der Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gefiel er nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entfernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber, und es gab eine kleine Szene.
Bei dieser Gelegenheit macht’ ich eine Entdeckung, die mir angenehm war. In der Ecke der Kapelle oder des Saals stand ein Kasten mit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wanderung durchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Gestein bekommen, eifrig hervorzog und durchsuchte. Es waren schöne, in die Augen fallende Dinge darunter. Unser Wirt sagte, das Kind könne sich auslesen, was es wolle. Es sei dieses Gestein überblieben von einer großen Masse, die ein Fremder vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du kannst denken, dass ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so manches schuldig sind. Indem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hoffen, ihn auf meiner Wanderung bald zu treffen.
*
Die Nachricht, dass Montan sich in der Nähe befinde, hatte Wilhelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, dass es nicht bloß dem Zufall zu überlassen sei, ob er einen so werten Freund wiedersehen solle, und erkundigte sich daher bei seinem Wirte, ob man nicht wisse, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Niemand hatte davon nähere Kenntnis, und schon war Wilhelm entschlossen, seine Wanderung nach dem ersten Plane fortzusetzen, als Felix ausrief: »Wenn der Vater nicht so eigen wäre, wir wollten Montan schon finden.« – »Auf welche Weise?« fragte Wilhelm. Felix versetzte: »Der kleine Fitz sagte gestern, er wolle den Herrn wohl aufspüren, der schöne Steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstünde.« Nach einigem Hin- und Widerreden entschloss sich Wilhelm zuletzt, den Versuch zu machen und dabei auf den verdächtigen Knaben desto mehr Acht zu geben. Dieser war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es abgesehen sei, Schlegel1 und Eisen und einen tüchtigen Hammer nebst einem Säckchen mit und lief in seiner bergmännischen Tracht munter vorauf.
Der Weg ging seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen miteinander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach und Quelle, und ohne einen Pfad vor sich zu haben, drang Fitz, bald rechts bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell folgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor- und rückwärts und sangen und pfiffen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Aufmerksamkeit des Felix, der nunmehr mit den Lärchen- und Zirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunderbaren Genzianen angezogen ward. Und so fehlte es der beschwerlichen Wanderung von einer Stelle zur anderen nicht an Unterhaltung.
Der kleine Fitz stand auf einmal still und horchte. Er winkte die anderen herbei: »Hört ihr pochen?« sprach er. »Es ist der Schall eines Hammers, der den Fels trifft.« – »Wir hören’s«, versetzten die anderen. – »Das ist Montan!« sagte er, »oder jemand, der uns von ihm Nachricht geben kann.« – Als sie dem Schalle nachgingen, der sich von Zeit zu Zeit wiederholte, trafen sie auf eine Waldblöße und sahen einen steilen, hohen, nackten Felsen über alles hervorragen, die hohen Wälder selbst tief unter sich lassend. Auf dem Gipfel erblickten sie eine Person. Sie stand zu entfernt, um erkannt zu werden. Sogleich machten sich die Kinder auf, die schroffen Pfade zu erklettern. Wilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gefahr: denn wer zuerst einen Felsen hinaufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussucht; einer, der nachfolgt, sieht nur, wohin jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Knaben erreichten bald den Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. »Es ist Jarno!« rief Felix seinem Vater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schroffe Stelle, reichte seinem Freunde die Hand und zog ihn aufwärts. Sie umarmten und bewillkommten sich in der freien Himmelsluft mit Entzücken.
Kaum aber hatten sie sich losgelassen, als Wilhelm ein Schwindel überfiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Kinder über dem ungeheuren Abgrunde hängen sah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen. »Es ist nichts natürlicher«, sagte er, »als dass uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet befinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu fühlen. Aber es ist ja überhaupt kein echter Genuss als da, wo man erst schwindeln muss.«
»Sind denn das da unten die großen Berge, über die wir gestiegen sind?« fragte Felix. »Wie klein sehen sie aus! Und hier«, fuhr er fort, indem er ein Stückchen Stein vom Gipfel loslöste, »ist ja schon das Katzengold wieder; das ist jawohl überall?« – »Es ist weit und breit«, versetzte Jarno; »und da du nach solchen Dingen fragst, so merke dir, dass du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Welt sitzest.« – »Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht?« fragte Felix. – »Schwerlich«, versetzte Montan; »gut Ding will Weile haben.« – »Da unten ist also wieder anderes Gestein«, sagte Felix, »und dort wieder anderes, und immer wieder anderes!« indem er von den nächsten Bergen auf die entfernteren und so in die Ebene hinab wies.
Es war ein sehr schöner Tag, und Jarno ließ sie die herrliche Aussicht im einzelnen betrachten. Noch standen hie und da mehrere Gipfel, dem ähnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg schien heranzustreben, aber erreichte noch lange die Höhe nicht. Weiter hin verflächte es sich immer mehr, doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar, und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszubreiten. Zog sich der Blick wieder zurück, so drang er in schauerliche Tiefen, von Wasserfällen durchrauscht, labyrinthisch miteinander zusammenhängend.
Felix ward des Fragens nicht müde und Jarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemerken glaubte, dass der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig sei. Daher, als die unruhigen Knaben weiterkletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde: »Du hast mit dem Kinde über diese Sachen nicht gesprochen, wie du mit dir selber darüber sprichst.« – »Das ist auch eine starke Forderung«, versetzte Jarno. »Spricht man ja mit sich selbst nicht immer, wie man denkt, und es ist Pflicht, anderen nur dasjenige zu sagen, was sie aufnehmen können. Der Mensch versteht nichts, als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart festzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliefern, ist das Beste, was man tun kann. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen.«
»Es ist ihnen nicht zu verdenken«, versetzte Wilhelm. »Die Mannigfaltigkeit der Gegenstände verwirrt jeden, und es ist bequemer, anstatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen: woher? und wohin?« – »Und doch kann man«, sagte Jarno, »da Kinder die Gegenstände nur oberflächlich sehen, mit ihnen vom Werden und vom Zweck auch nur oberflächlich reden.« – »Die meisten Menschen«, erwiderte Wilhelm, »bleiben lebenslänglich in diesem Falle und erreichen nicht jene herrliche Epoche, in der uns das Fassliche gemein und albern vorkommt.« – »Man kann sie wohl herrlich nennen«, versetzte Jarno, »denn es ist ein Mittelzustand zwischen Verzweiflung und Vergötterung.« – »Lass uns bei dem Knaben verharren«, sagte Wilhelm, »der mir nun vor allem angelegen ist. Er hat nun einmal Freude an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kannst du mir nicht so viel mitteilen, dass ich ihm, wenigstens auf eine Zeit, genugtue?« – »Das geht nicht an«, sagte Jarno. »In einem jeden neuen Kreise muss man zuerst wieder als Kind anfangen, leidenschaftliches Interesse auf die Sache werfen, sich erst an der Schale freuen, bis man zu dem Kerne zu gelangen das Glück hat.«
»So sage mir denn«, versetzte Wilhelm, »wie bist du zu diesen Kenntnissen und Einsichten gelangt? denn es ist doch so lange noch nicht her, dass wir auseinandergingen!« – »Mein Freund«, versetzte Jarno, »wir mussten uns resignieren, wo nicht für immer, doch für eine gute Zeit. Das erste, was einem tüchtigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ist, ein neues Leben zu beginnen. Neue Gegenstände sind ihm nicht genug: diese taugen nur zur Zerstreuung; er fordert ein neues Ganze und stellt sich gleich in dessen Mitte.« – »Warum denn aber«, fiel Wilhelm ihm ein, »gerade dieses Allerseltsamste, diese einsamste aller Neigungen?« – »Eben deshalb«, rief Jarno, »weil sie einsiedlerisch ist. Die Menschen wollt’ ich meiden. Ihnen ist nicht zu helfen, und sie hindern uns, dass man sich selbst hilft. Sind sie glücklich, so soll man sie in ihren Albernheiten gewähren lassen; sind sie unglücklich, so soll man sie retten, ohne diese Albernheiten anzutasten; und niemand fragt jemals, ob du glücklich oder unglücklich bist.« – »Es steht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen«, versetzte Wilhelm lächelnd. – »Ich will dir dein Glück nicht absprechen«, sagte Jarno. »Wandre nur hin, du zweiter Diogenes! Lass dein Lämpchen am hellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwärts liegt eine neue Welt vor dir; aber ich will wetten, es geht darin zu wie in der alten hinter uns. Wenn du nicht kuppeln und Schulden bezahlen kannst, so bist du unter ihnen nichts nütze.« – »Unterhaltender scheinen sie mir doch«, versetzte Wilhelm, »als deine starren Felsen.« – »Keineswegs«, versetzte Jarno, »denn diese sind wenigstens nicht zu begreifen.« – »Du suchst eine Ausrede«, versetzte Wilhelm, »denn es ist nicht in deiner Art, dich mit Dingen abzugeben, die keine Hoffnung übriglassen, sie zu begreifen. Sei aufrichtig und sage mir, was du an diesen kalten und starren Liebhabereien gefunden hast?« – »Das ist schwer von jeder Liebhaberei zu sagen, besonders von dieser.« Dann besann er sich einen Augenblick und sprach: »Buchstaben mögen eine schöne Sache sein, und doch sind sie unzulänglich, die Töne auszudrücken; Töne können wir nicht entbehren, und doch sind sie bei weitem nicht hinreichend, den eigentlichen Sinn verlauten zu lassen; am Ende kleben wir am Buchstaben und am Ton und sind nicht besser dran, als wenn wir sie ganz entbehrten; was wir mitteilen, was uns überliefert wird, ist immer nur das Gemeinste, der Mühe gar nicht wert.«
»Du willst mir ausweichen«, sagte der Freund; »denn was soll das zu diesen Felsen und Zacken?« – »Wenn ich nun aber«, versetzte jener, »eben diese Spalten und Risse als Buchstaben behandelte, sie zu entziffern suchte, sie zu Worten bildete und sie fertig zu lesen lernte, hättest du etwas dagegen?« – »Nein, aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet.« – »Enger, als du denkst; man muss es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Kritzeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, dass ein scharfer Kritikus kommt und mir versichert, das alles sei nur untergeschoben.« – Lächelnd versetzte der Freund: »Und doch wird man auch hier deine Lesarten streitig machen.« – »Eben deswegen«, sagte jener, »red’ ich mit niemanden darüber und mag auch mit dir, eben weil ich dich liebe, das schlechte Zeug von öden Worten nicht weiter wechseln und betrieglich austauschen.«
Eine besondere, von den Bergleuten gebrauchte Art Hammer <<<
Viertes Kapitel
Beide Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mühe, herabgestiegen, um die Kinder zu erreichen, die sich unten an einem schattigen Orte gelagert hatten. Fast eifriger als der Mundvorrat wurden die gesammelten Steinmuster von Montan und Felix ausgepackt. Der letztere hatte viel zu fragen, der erstere viel zu benennen. Felix freute sich, dass jener die Namen von allen wisse, und behielt sie schnell im Gedächtnis. Endlich brachte er noch einen hervor und fragte: »Wie heißt denn dieser?« Montan betrachtete ihn mit Verwunderung und sagte: »Wo habt ihr den her?« Fitz antwortete schnell: »Ich habe ihn gefunden, er ist aus diesem Lande.« – »Er ist nicht aus dieser Gegend«, versetzte Montan. Fitz freute sich, den überlegenen Mann in einigem Zweifel zu sehen. – »Du sollst einen Dukaten haben«, sagte Montan, »wenn du mich an die Stelle bringst, wo er ansteht.« – »Der ist leicht zu verdienen«, versetzte Fitz, »aber nicht gleich.« – »So bezeichne mir den Ort genau, dass ich ihn gewiss finden kann. Das ist aber unmöglich: denn es ist ein Kreuzstein, der von St. Jakob in Compostell kommt und den ein Fremder verloren hat, wenn du ihn nicht gar entwendet hast, da er so wunderbar aussieht.« – »Gebt Euren Dukaten«, sagte Fitz, »dem Reisegefährten in Verwahrung, und ich will aufrichtig bekennen, wo ich den Stein her habe. In der verfallenen Kirche zu St. Joseph befindet sich ein gleichfalls verfallener Altar. Unter den auseinandergebrochenen oberen Steinen desselben entdeckt’ ich eine Schicht von diesem Gestein, das jenen zur Grundlage diente, und schlug davon so viel herunter, als ich habhaft werden konnte. Wälzte man die oberen Steine weg, so würde gewiss noch viel davon zu finden sein.«
»Nimm dein Goldstück«, versetzte Montan, »du verdienst es für diese Entdeckung. Sie ist artig genug. Man freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichnis dessen, was wir lieben und verehren, hervorbringt. Sie erscheint uns in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugnis dessen, was von der Ewigkeit her beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden soll, zum voraus niederlegt. Hierauf als auf eine wundervolle, heilige Schicht hatten die Priester ihren Altar gegründet.«