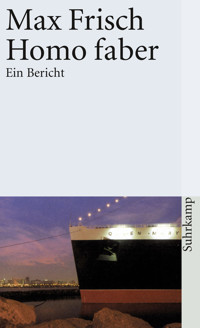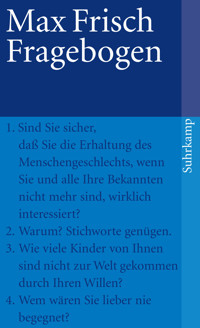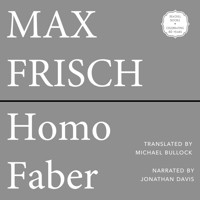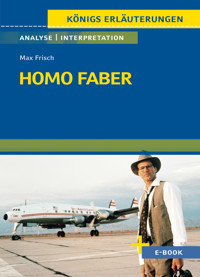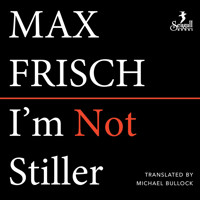6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Tell-Sage zählt zu den berühmten nationalen Mythen. Seit Schiller gilt sie als klassischer Besitz von Triumph des Freiheitswillens über Unterdrückung. An den Schulen wird sie so weitergereicht. Gerade für die Schule erzählt Max Frisch die Tell-Geschichte neu. Seine Sprache ist lakonisch, seine Darstellung souverän, ja heiter. Ein nationaler Mythos wird demontiert: die Vorgänge von 1291 werden aus der Gegenwart gesehen und interpretiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die Tell-Sage zählt zu den berühmten nationalen Mythen. Seit Schiller gilt sie als klassischer Besitz von Triumph des Freiheitswillens über Unterdrückung. An den Schulen wird sie so weitergereicht. Gerade für die Schule erzählt Max Frisch die Tell-Geschichte neu. Seine Sprache ist lakonisch, seine Darstellung souverän, ja heiter. Ein nationaler Mythos wird demontiert: die Vorgänge von 1291 werden aus der Gegenwart gesehen und interpretiert.
Max Frisch, am 15. Mai 1911 in Zürich geboren, starb dort am 4. April 1991. Sein Werk, vielfach ausgezeichnet, erscheint im Suhrkamp Verlag und ist ab Seite 101 verzeichnet.
Max Frisch
Wilhelm Tell für die Schule
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 29. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 2.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1971
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildung: Günther Uecker, Geßlerhut, 2004
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-74759-9
www.suhrkamp.de
Wahrscheinlich Konrad von Tillendorf, ein jüngerer und für seine Jahre dicklicher Mann, damals wohnhaft auf der Kyburg, vielleicht auch ein anderer, der Grisler hieß und in den gleichen Diensten stand, jedenfalls aber ein Ritter ohne Sinn für Landschaft ritt an einem sommerlichen Tag des Jahres 1291 durch die Gegend, die heute als Urschweiz bezeichnet wird. Wahrscheinlich herrschte Föhn; das Gebirge, das der dickliche Ritter vor sich sah, schien näher als nötig. Um dem jungen Rudenz gegenüber, der ihn nach Uri führen sollte, nicht unhöflich zu sein, gab er sich Mühe und lobte mehrmals die blühenden Kirschbäume. Es war heiß und blau. Je länger er ritt, desto schweigsamer wurde der dickliche Ritter, denn die Berge zu beiden Seiten nahmen überhand. Oft wunderte er sich, daß es in dieser Gegend überhaupt einen Pfad gab; aber es gab tatsächlich einen Pfad, der, wie der dickliche Ritter wußte, sogar nach Rom führte, wenn auch immer wieder um Felsen herum. Es wunderte ihn, daß hier Menschen wohnen1. Das sagte er nicht. Je enger die Täler, desto kränkbarer sind die Leute, das spürte der dickliche Ritter schon und lobte nochmals einen blühenden Kirschbaum. In Brunnen am See, zu Mittag, mußte man wieder einen Nauen besteigen. Eine mühsame Gegend. Ritter Konrad oder Grisler fühlte sich in dem Nauen nicht wohl; beide Hände an die Bank geklammert, obschon der schwere Nauen kaum schaukelte, saß er und blickte beklommen in das Tal von Uri, das ihm als das Ende der Welt erschien. Diese Flühe links und Flühe rechts. Er reiste nicht zum Vergnügen, sondern als Vertreter von König Rudolfs Erben2, also dienstlich; daher trug er diese Mütze aus Samt. Sogar auf dem See war es heiß. Kein stürmischer Föhn, aber Föhn. Der Schiffer ruderte hart und wortkarg, tat, als habe er diese gräßlichen Felsen persönlich gemacht, und zeigte überhaupt keinen Humor. Natürlich wußte der dickliche Ritter, daß Uri damals reichsfrei war, das heißt, daß er sich jetzt im Ausland befand; er verschwieg, daß er nicht in Uri leben möchte. Er sagte lediglich, er habe Kopfweh. Der Nauen kam nur langsam voran. Der junge Rudenz, Neffe des Freiherrn von Attinghausen, ließ es sich nicht nehmen und zeigte dies und das, was den Einheimischen besonders sehenswert vorkam. Ab und zu tauchte der dickliche Ritter, während er höflich nickte, die Hand ins kalte Wasser des Vierwaldstättersees, damit sein Kopfweh vergehe; er beachtete weder die sommerliche Wiese des Rütli3 noch den Fels, der später berühmt wurde als Tellenplatte4, sondern blickte geradeaus, wo er plötzlich den Sankt Gotthard zu sehen meinte. Das war das einzige Mal, daß der Schiffer, der wahrscheinlich Ruodi hieß, kurz und bündig grinste. Schnee auf den Bergen im Sommer, das sah man bei klaren Tagen schon von der Kyburg aus; jetzt verwunderte es ihn trotzdem: Schnee im Sommer. Er äußerte sich nicht dazu. Die Leute von Uri schienen stolz zu sein auf diesen Schnee. Einmal fragte er den braven Schiffer, wie lange er denn nach Flüelen noch brauche. Keine Antwort. Der junge Rudenz, dem es peinlich war, wenn seine Waldleute sich unartig zeigten, packte jetzt einen Imbiß aus dem Lederbeutel, um den habsburgischen Beamten abzulenken von dieser Eigenart der Waldleute, wahrscheinlich Käse und Brot, auch harte Eier, die aber, als Ulrich von Rudenz sie vor dem hohen Gast auf die Bank legte, sofort herunterfielen und in dem Nauen hin und her rollten. Auch darüber vermochte der brave Schiffer nicht zu lächeln, denn er galt als der wackerste Schiffer auf dem Urner-See, und daß der fremde Fötzel ihn gefragt hatte, wie lange er bis Flüelen noch brauche, vergaß er sein Lebtag nicht. Leider hatte der Vertreter von König Rudolfs Erben überhaupt keinen Appetit, was aussah, als verachtete er den einheimischen Käse. Die Fahrt in diesem Nauen kam ihm endlos vor. Immer öfter schloß er die Augen, um wenigstens keine Berge zu sehen, und hörte nur den harten Wellenschlag, das Klatschen unter dem Nauen, dazu das Ächzen der Ruder. Er versuchte an seine diplomatische Mission zu denken, beide Hände an die Bank geklammert; dabei wurde er das Gefühl nicht los, man fahre in der verkehrten Richtung, genau in der verkehrten Richtung … Herr Vogt! sagte der junge Rudenz: Wir sind da! – ein Rudel von Hütten in grünen Wiesen mit Apfelbäumen, das also war Flüelen. Der Vertreter von König Rudolfs Erben hatte sich Flüelen überhaupt nicht vorgestellt, und insofern überraschte es ihn gar nicht. Er dankte dem wackeren Schiffer; dieser aber war noch immer beleidigt wegen der Frage, wie lange er nach Flüelen brauche, und blickte geradezu unheimlich. Es war, als hätte der Mann mittlerweile einen Kropf bekommen. Ein anderer, der die Pferde bereithielt, hatte einen wirklichen Kropf. Als sie entlang der Reuß gegen Altdorf ritten, fragte der dickliche Ritter, ob es in diesen Tälern viel Inzucht gebe. Die Auskunft des jungen Rudenz ist nicht überliefert. Hingegen soll der Herr Vogt kurz darauf sein Pferd angehalten haben, um zu sagen: Diese Berge, ringsum diese Berge! Sein Kopfweh war noch nicht vergangen, als man in Altdorf ankam.
Als Ritter Konrad oder Grisler, auch schon verwechselt mit einem Grafen von Seedorf5, am andern Morgen erwachte und an das niedrige Fenster trat, keinen Himmel erblickte, sondern nur Felsen und Tannen und Geröll, machte er sich Mut, indem er Milch trank. Wahrscheinlich hatte er’s auf der Leber, ohne es zu wissen; daher sein Hang zur Melancholie. Er lobte die Milch. Die Leute, die in diesem Tal geboren waren, taten ihm leid; Sonne schien an die Felsen hochoben, das Tal aber lag im Schatten, und wenn er zum Himmel schaute, kam es ihm vor, als wäre er in eine Zisterne gefallen. Er schickte sofort, noch ehe er seine Milch getrunken hatte, einen Knecht hinüber nach Attinghausen6, um sich als Reichsvogt anzumelden. Es eile. Der dickliche Ritter wünschte sich seinen Aufenthalt in Uri so kurz wie möglich. Schon die erste Stunde, während er auf die Antwort aus Attinghausen wartete, wurde ihm lang. Eine Ahnung, was ihn in diesen Waldstätten erwartete, hatte der dickliche Ritter offenbar nicht; nämlich als er in der Kapelle kniete, betete er nicht für seine Person, sondern bekreuzigte sich in der allgemeinen Hoffnung auf bessere Zeiten. Sein Kopfweh war vergangen, was er schon für ein gutes Zeichen hielt. Leider meldete der Knecht, der Freiherr von Attinghausen fühle sich nicht wohl, könne den Reichsvogt erst in der kommenden Woche empfangen. Auch dies hielt er noch für ein gutes Zeichen, denn es hätte ja auch sein können, daß der Greis von Attinghausen gerade gestorben war. So machte er denn, um nicht müßig zu sein, einen ersten Ritt in die Umgebung, besuchte dienstlich eine Baustelle zwischen Silenen und Amsteg, wo zur Zeit ein Turm erstellt wurde, um den Pfad zum Gotthard zu sichern7. Inzwischen war die Sonne auch ins Tal gekommen, aber die Laune auf der Baustelle war mißlich. Ein alter Bauführer, damals Fronvogt genannt, ein Tiroler, der den Leuten von Uri schon seines andern Tonfalls wegen verhaßt war, hatte vermutlich aus persönlicher Ranküne, weil sie ihn Fötzel nannten, den schnöden Namen der Burg erfunden: TWING-URI. Das mußte, wie Ritter Konrad oder Grisler verstand, die braven Urner reizen. Der Tiroler wurde auf der Stelle entlassen – zu spät; der Name blieb im Gerücht für alle Zeit8.
Schlimm waren die Abende in Altdorf, diese Abende mit einem Fräulein von Bruneck und dem jungen Rudenz, der für die ältliche Jungfer viel zu jung war, aber geil auf ihr Erbe. Abende mit Fledermäusen in einem Turm. Sie würfelten. Auch wenn er kein Kopfweh hatte, ging der dickliche Ritter oft schon um neun Uhr ins Bett. So langweilig hatte er sich diese Dienstreise nicht vorgestellt. Offenbar ahnte er nicht, daß er sich in der Urschweiz9 befand, also an der Geburtsstätte unserer Freiheit10. Als Ausländer, der er in jedem Fall war, ob Ritter Konrad oder Grisler, wunderte er sich über mancherlei. Der Senn, der täglich die Milch brachte, tat’s mit einer Miene, daß man sich fragen mußte, ob er nicht in die Milch gepißt hatte. Wie es Ausländern heute noch eigen ist, bemerkte der dickliche Ritter lauter Eigentümlichkeiten, die nicht typisch sind oder die nur die Einheimischen zu würdigen wissen11. Manchmal fürchtete er sich vor diesen Berglern; ihre Seele blieb ihm verschlossen12. Fragte er unterwegs einen Hirten nach dem Wetter, so redete dieser plötzlich mit seinem Vieh, schlug mit einem Stock auf das stumme Vieh, um es weiterzutreiben, und blickte nach einer Weile zurück, als gehe es einen fremden Fötzel13