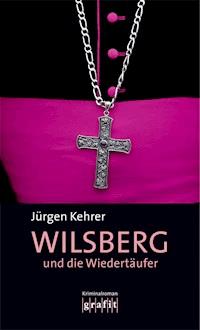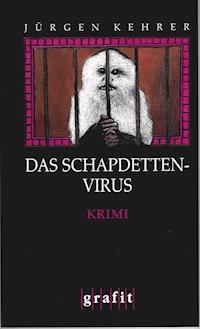Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wilsberg
- Sprache: Deutsch
Nach 32 Jahren und 21 Fällen: Kultdetektiv Wilsberg ermittelt zum allerletzten Mal! 1989 bekommt der junge Rechtsanwalt Wilsberg die Chance, in einem spektakulären Mordprozess die Verteidigung zu übernehmen: Der Angeklagte Frank Knieriem feuert kurz vor Prozessbeginn seinen bisherigen Verteidiger und Wilsberg springt ein. Die Beweise sind erdrückend, aber mit Unterstützung seiner Freundin Shirin gelingt es Wilsberg wider Erwarten, eine Entlastungszeugin zu finden. Kurz darauf steht in seinem Leben allerdings kein Stein mehr auf dem anderen. Gut dreißig Jahre später trifft Wilsberg, inzwischen ein alternder Privatdetektiv, erneut auf Knieriem – im Zuge einer Geiselnahme. Und sein einstiger Mandant lässt keinen Zweifel daran, dass er mit Wilsberg noch eine Rechnung offen hat …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Jürgen Kehrer
Wilsberg –
Sein erster und sein letzter Fall
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Franziska Emons-Hausen
unter Verwendung von photocase.de/P_Alt
Lektorat: Nadine Buranaseda, typo18, Bornheim
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
eISBN 978-3-98708-000-5
Dieser Roman wurde gefördert im Rahmen des Stipendienprogramms der VG WORT in NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Jürgen Kehrer, geboren 1956 in Essen, lebt in Münster und Berlin. Er ist der geistige Vater des münsterschen Privatdetektivs Georg Wilsberg, der 1990 in Und die Toten lässt man ruhen seinen ersten Auftritt hatte. Wilsberg – Sein erster und sein letzter Fall ist der 21. Band der Reihe. Seit 1995 ermittelt Wilsberg auch im Fernsehen und gehört inzwischen zu den beliebtesten ZDF-Krimis am Samstagabend. Jürgen Kehrer ist verheiratet mit der Schriftstellerin Sandra Lüpkes.
www.juergen-kehrer.de
This is the end,
Beautiful friend.
This is the end.
1
April 2022
Ich bin mir sicher, dass Hosen in Zukunft für mich nicht einfach nur Hosen sein werden, es wird die Zeit vor und die Zeit nach den Hosen geben. Seit zwanzig Minuten sitze ich nämlich zwischen Bergen von Hosen. Hosen auf Bügeln, Hosen in Regalen, Hosen in Stapeln. In der Herrenabteilung eines Kaufhauses, das im Glockenklangbereich der Lambertikirche liegt. Ein paar Meter rechts von mir hockt eine Frau, links von mir ein Mann, ein Stück weiter eine komplette Familie, Vater, Mutter, zwei jugendliche Kinder. Wir verständigen uns hauptsächlich durch Mimik und mit Handzeichen, aus Angst, alles andere könnte gefährlich werden. Einige schwarz gekleidete, maskierte Gestalten mit Schnellfeuerwaffen haben das Kaufhaus überfallen, unsere Handys einkassiert und uns auf den Boden gezwungen. Möglicherweise ein Raubüberfall, vielleicht auch ein Terroranschlag, in jedem Fall sind wir Geiseln.
An Widerstand oder Flucht ist nicht zu denken, sie haben alle Kunden und Beschäftigte des Kaufhauses auf unserer Etage zusammengetrieben und bewachen die Ausgänge. Immerhin ist bis jetzt niemand verletzt worden, die Geiselnehmer haben sich damit begnügt, einige Löcher in die Decke zu schießen, wohl als Einschüchterungsmaßnahme. Seitdem hängt Pulvergeruch in der Luft, außerdem klingeln mir die Ohren. Bei den Tätern handelt es sich anscheinend um Deutsche, die gebrüllten Befehle klingen akzentfrei. Ihre Anführerin ist eine schmale, ziemlich große Frau, ich habe sie »Nummer eins« getauft. Nummer eins wirkt cool, im Gegensatz zu ihrem Vize, Nummer zwei, der hektisch herumrennt und alle anschreit, die ihm begegnen, die eigenen Leute ebenso wie uns Geiseln. Auch mich, als ich mich nicht schnell genug hingesetzt habe. Trotz der Nervosität, die Nummer zwei verbreitet, habe ich das Gefühl, dass es für die Geiselnehmer nach Plan läuft. Fragt sich nur, nach welchem.
Die Frau rechts von mir robbt ein Stück in meine Richtung. Ihr Flüstern dringt kaum durch den Klingelton in meinen Ohren. »Was wollen die?«
»Die warten auf irgendwas«, spekuliere ich. »Wenn’s nur darum ginge, das Kaufhaus auszurauben, würden sie sich mehr beeilen.«
»Oder sie wollen uns gegen Lösegeld austauschen.« Der Mann von links schließt sich unserer Diskussionsrunde an. »Dann legen sie es darauf an, dass die Polizei auftaucht.«
»Auch möglich«, gebe ich zu. »Die Polizei ist auf solche Situationen vorbereitet. In jedem Polizeipräsidium gibt es eine Verhandlungsgruppe, die das ständig trainiert.«
»Kennen Sie sich da aus?« In den Augen der Frau glimmt die Hoffnung auf professionellen Beistand.
»Nicht direkt. Aber Kriminalität ist mein Business.«
»Scheiß auf dein Business!« Nummer zwei, der hinter einem Hosenständer aufgetaucht ist, richtet den Lauf seiner Maschinenpistole auf meine Brust. »Ihr sollt die Fresse halten, kapiert?«
»Sorry«, sage ich. »Wird nicht wieder vorkommen.«
»Klugscheißer, was?« Er tritt noch einen Schritt näher. Sein Testosteron stinkt schlimmer als das Pulver. Ich rieche förmlich seinen Wunsch, mir eine Abreibung zu verpassen.
»Lass das!« Ich habe nur auf Nummer zwei geachtet und Nummer eins nicht kommen sehen. »Für so was haben wir keine Zeit.«
Nummer zwei dreht widerwillig ab. Und Nummer eins mustert mich einen Moment länger als notwendig. Als würde sie überlegen, woher sie mich kennt.
Ich weiß nicht, was mir mehr Sorgen bereiten sollte, die fehlende Selbstkontrolle von Nummer zwei oder die Gedanken von Nummer eins.
Von draußen sind Polizeisirenen zu hören.
»Es geht los!«, ruft Nummer eins. Fürs Erste bin ich vergessen.
An der Kasse, nur drei Ständerreihen von uns entfernt, klingelt das Telefon. Nummer eins schlendert demonstrativ langsam hinüber, nimmt ab und hört kurz zu.
»Sparen Sie sich das!«, kanzelt sie ihren Gesprächspartner ab. »Wir haben zwei Forderungen und ich wiederhole mich nicht, also hören Sie gut zu. Forderung eins: Frank Knieriem, derzeit in der JVA Münster, kommt frei. Forderung zwei: Frank gibt im Studio des WDR ein Liveinterview. Überall in Deutschland zu sehen. Zehn Minuten. Keine Aufzeichnung, keine Bearbeitung, keine Tricks. Anschließend bringen Sie ihn her. Das alles muss bis zwanzig Uhr passieren. Ist Frank dann nicht hier oder konnte nicht sagen, was er sagen wollte, erschießen wir um eine Minute nach acht die erste Geisel. Ende der Durchsage.«
Nummer eins legt auf.
Frank Knieriem. In den letzten dreißig Jahren habe ich nicht viel von ihm gehört.
2
Oktober 1989
»Anwaltskanzlei« war ein ziemlich hochtrabender Name für die beiden Räume, die ich hinter dem Ladenlokal einer Biobäckerei an der Hammer Straße gemietet hatte. Es gab noch einen Zugang über den Hof, allerdings musste man dann eine Lagerhalle durchqueren, die der Biobäcker mit ausrangiertem Zeugs vollgestellt hatte.
Daher empfahl ich allen, die mich besuchen wollten, besonders aktuellen und zukünftigen Mandanten, den Weg durch die Bäckerei zu nehmen. Zum beiderseitigen Vorteil. Ich zahlte wegen der ungünstigen Lage eine geringe Miete und die Bäckerei erweiterte ihre Kundschaft. Wer mochte, konnte sich die Wartezeit mit einem Brötchen oder einem der hervorragenden Mandelhörnchen aus dem Backladen verkürzen. Sigi, meine Sekretärin, hatte die Anweisung, unseren Kunden die nebenan erhältlichen Bioprodukte anzupreisen. Einschließlich des fair gehandelten Kaffees, für den ich mit der Bäckerei eine Monatspauschale vereinbart hatte. Das ersparte uns das lästige Kaffeekochen.
Sigis Büro, in dem sie hinter einem der zwei neu angeschafften Atari-ST-Computer – der andere stand in meinem Büro – und einer Telefonanlage thronte, diente gleichzeitig als Wartezimmer. Ein paar aus dem Sperrmüll gefischte Stühle und ein wackliges Tischchen, auf dem die täglichen Ausgaben der taz, der Frankfurter Rundschau und – für die ganz Hartgesottenen – der Westfälischen Nachrichten lagen, mussten reichen, um meine Mandanten bei Laune zu halten. Allzu anspruchsvoll und damit zahlungskräftig waren sie ohnehin nicht. Ich schlug mich und die Kanzlei mit Rechtsstreitigkeiten durch, die sich fast ausschließlich um Bagatelldelikte drehten. Ein paar Gramm Haschisch zu viel in der Tasche, einen Polizisten bei einer Demo falsch angeguckt, solche Sachen. Es reichte für mich zum Überleben, aber Urlaub fiel bereits unter die Kategorie »entbehrlicher Luxus«.
Ich stellte meinen klapprigen Golf in der Nähe der Josefskirche ab, steckte mir einen Zigarillo an und schlenderte die Hammer Straße entlang. Trotz allem ging es mir mit meiner Entscheidung, mich selbstständig zu machen, ganz gut. Nach dem Jurastudium und der Referendarzeit hatte ich ein paar Jahre in einer großen Kanzlei gearbeitet. Doch der Druck, den Umsatz steigern und mich mit Mandanten abgeben zu müssen, die bei jeder Begegnung den Wunsch nach einem Wannenbad aufkommen ließen, nervte mich von Monat zu Monat mehr. Gleichzeitig verlor die Aussicht, irgendwann in den Kreis der Seniorpartner aufzusteigen und wie sie mit einem protzigen Porsche in der firmeneigenen Tiefgarage zu parken, stetig an Reiz.
Nach drei Jahren hatte ich gekündigt, mit meiner Bank über einen Gründerkredit verhandelt und die Räume in der Bäckerei gemietet. Der Stresspegel sackte von da an erfreulich nach unten, leider parallel mit den Umsatzzahlen. Denn die spektakulären Fälle, von denen ich immer geträumt hatte, blieben Mangelware.
Mein derzeitiges Highlight war ein Prozess gegen Tierversuchsgegner, meine Mandantin eine Soziologiestudentin, die zusammen mit Gleichgesinnten Hunde aus einem Forschungslabor eines Pharmakonzerns entführt oder, wie sie es nannte, befreit hatte. Dummerweise war an den Hunden ein Medikament getestet worden, dessen plötzliches Ausbleiben katastrophale Folgen hatte. Die Hälfte der Hunde starb, die andere Hälfte wurde, weil den Aktivisten nichts Besseres einfiel, mehr oder weniger komatös zum Forschungslabor zurückgebracht. Kurz darauf geriet einer der Tierbefreier in die Hände der Polizei. Mit dem Versprechen, ohne Gefängnisstrafe davonzukommen, hatte man ihn zum Kronzeugen gegen die übrigen umgedreht. Schlechte Aussichten also für meine Mandantin. Davon wollten ihre Eltern, die mich bezahlten, nichts wissen. Ich solle gefälligst einen Freispruch erwirken, verlangte die Mutter, alles andere sei inakzeptabel.
Ich trat den Zigarillo aus, stiefelte in die Bäckerei und nahm gleich noch einen Kaffee mit auf den Weg in meine Geschäftsräume. Sigi saß an ihrem Schreibtisch und tippte sekretärinnenhaft auf dem Computer herum.
»Morgen«, sagte ich. »Irgendwelche Anrufe?«
»Guten Morgen, Georg«, erwiderte Sigi. »Und ja. Sogar zwei.«
»Mach’s nicht so spannend.«
Sigi hob einen Daumen. »Anruf eins, man möchte dich als Pflichtverteidiger gewinnen.«
In der linken Szene Münsters kursierte mein Name. Ich war bekannt dafür, nicht vor Körperverletzung zum Nachteil eines Polizisten oder Landfriedensbruch zurückzuschrecken. Manche Staatsfeinde hielten mich sogar für einen der ihren. Ich ließ sie meistens in dem Glauben. »Um was geht es?«
»Mord.«
Die Kaffeetasse in meiner Hand klapperte. Fast hätte ich sie mitsamt der Untertasse fallen gelassen. »Wie, Mord?«
»Frank Knieriem«, sagte Sigi. »Soll vor einem halben Jahr seine Freundin ermordet haben.«
Ich hatte darüber in der Zeitung gelesen. Angeblich eine Beziehungstat. Mann tötet Freundin aus Eifersucht. »Und wie ist der auf mich gekommen?«
Sigi betrachtete mich mitleidig. »Vermutlich nicht, weil du so genial bist. Eher, weil alle anderen abgesagt haben. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Georg, aber du bist nicht seine erste Wahl. Knieriem hatte bereits einen Verteidiger, dem er jetzt, kurz vor Prozessbeginn, das Vertrauen entzogen hat. Deshalb braucht er dringend Ersatz.«
»Egal«, sagte ich. »Ein Mordprozess ist unbezahlbare Werbung für unsere Kanzlei. Das treibt die dickeren Fische ins Netz.«
Sigi nickte. »Habe ich mir auch gedacht.«
»Und du hast …«
»Geantwortet, dass du es machst. Ja.«
»Okay«, sagte ich gedehnt. »Beim nächsten Mal würde ich lieber vorher gefragt werden.«
»Wie du meinst«, schnippte Sigi.
Ich ging rückwärts zur Tür. »Sag bitte alle Termine für heute ab. Ich fahre zum Gericht und zur Staatsanwaltschaft und anschließend zur JVA, um mit Knieriem zu reden.«
Sigi hob Daumen und Zeigefinger. »Willst du nicht wissen, von wem der zweite Anruf kam?«
Ich stöhnte. »Meinetwegen.«
»Carlo Ponti.«
»Der Betreiber des Bad? Die Schlagzeuglegende?«
Sigi zog ihre ungezupften Brauen hoch. »Kennst du noch jemanden in Münster, der so heißt?«
In meinem vorherigen Leben als Großkanzleianwalt mit Anzug- und Krawattenpflicht hatte ich Carlo Ponti mal in einem Unterhaltsprozess vertreten. Anscheinend war es mir dabei gelungen, meine Abneigung gegen seine Egozentrik geschickt zu verbergen. »Und was will er?«
»Er fühlt sich beleidigt. Von so einem Stadtmagazin hier in Münster. Du sollst die Redakteure verklagen oder, besser noch, ans Kreuz nageln. Habe ich jedenfalls so verstanden, er redet ziemlich schnell und ohne Punkt und Komma. Irgendwann habe ich abgeschaltet.«
»Alles klar«, sagte ich. »Ich rufe ihn an. Heute oder in den nächsten Tagen.«
»Er machte nicht den Eindruck, als würde er lange warten wollen.«
Ich drehte mich um und öffnete die Tür. »Du wirst schon mit ihm fertig.«
»Vergiss nicht, dass du morgen um neun im Amtsgericht sein musst!«, rief Sigi mir hinterher.
Der Tierbefreierprozess. Wie könnte ich den vergessen?
Nachdem ich im Gericht die Formalitäten erledigt und mir bei der Staatsanwaltschaft eine Kopie der Akten besorgt hatte, fuhr ich zum Gefängnis. Das münstersche Gefängnis war eines der ältesten Deutschlands, ein sternförmiger Rotklinkerbau, der noch fast genauso aussah wie zur Zeit seiner Entstehung Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals lag er noch außerhalb der Stadt, inzwischen stand er mittendrin und war umgeben von einigen der begehrtesten Wohnviertel Münsters, ein Luxusausblick, auf den seine Insassen wahrscheinlich gerne verzichtet hätten.
Ich wies mich aus und wurde in einen der Räume gebracht, die für ungestörte Gespräche zwischen Rechtsanwälten und Häftlingen vorgesehen waren. Ein paar Minuten später lieferte man Frank Knieriem bei mir ab. Knieriem war eine imposante Erscheinung, mindestens einen Meter neunzig groß, athletisch gebaut und mit Oberarmen, die ihn zum Türsteher qualifiziert hätten. Eine Strähne seines schulterlangen, beneidenswert dichten blonden Haars hing ihm ins Gesicht und wurde von ihm ab und zu mit einer ruckartigen Kopfbewegung zur Seite geschleudert. Ich schätzte ihn auf Ende zwanzig bis Anfang dreißig, um seinen Mund spielte ein grundloses Macholächeln, das Männer wie er oft verwenden, um ihr Revier zu markieren. Nicht mal die Fesseln an seinen Händen schienen ihn sonderlich zu stören.
Knieriem setzte sich an den Tisch, auf dem ich die Akten ausgebreitet hatte. »Haben Sie mal eine Zigarette?«
Ich erklärte ihm, dass ich keine Zigaretten, sondern nur Zigarillos rauchen würde.
»Dann eben einen Zigarillo.«
Ich gab ihm einen braunen Stängel und zündete mir selbst einen an. In dem kleinen Raum gab es kein Fenster, meine Kleidung würde hinterher sowieso müffeln, also konnte ich auch gleich mitrauchen. »Wie sind Sie auf mich gekommen?«
»Jemand hat mir von Ihnen erzählt.«
»Wer?«
»Weiß ich nicht mehr.« Knieriem hockte breitbeinig auf seinem Stuhl und schaute mich trotz gleicher Augenhöhe irgendwie von oben herab an. »Spielt das eine Rolle?«
»Nein. Nur Marktforschung. Aber eines würde mich tatsächlich interessieren: Was hat Ihr erster Anwalt falsch gemacht?«
»Der hat nicht verstanden, was ich will.«
»Und das heißt?«
Knieriem beugte sich vor, die Kette zwischen seinen Handgelenken rasselte. »Damit eines klar ist, Herr Wilsberg: Ich will keine Absprache mit der Staatsanwaltschaft, keine mildernden Umstände oder wie das heißt. Ich bestehe auf Freispruch, weil ich Ulla nicht umgebracht habe.«
»Und Ihr erster Anwalt sah dafür keine Chance?«
»Der meinte, ich soll auf reuigen Sünder machen. Erzählen, dass es mir leidtut, oder so’n Scheiß. Aber es tut mir nichts leid, denn ich habe Ulla nicht angerührt.«
»Verstehe«, sagte ich. »Wir plädieren auf unschuldig.«
Knieriem lehnte sich zurück und nahm einen tiefen Zug. Niemand, dem seine Atemorgane etwas bedeuten, raucht Zigarillos auf Lunge. Knieriem hustete nicht einmal. »Korrekt, Herr Wilsberg.«
»Noch etwas«, sagte ich. »Der Prozess beginnt in drei Tagen. Ich brauche Zeit, um mich in die Akten einzuarbeiten. Deshalb werde ich einen Aufschub beantragen.«
Knieriem fixierte mich durch die Rauchschwaden. »Negativ. Kein Aufschub.«
»Wie soll das gehen?«, fragte ich. »Ich habe aus der Staatsanwaltschaft fünf Aktenordner mitgenommen und bislang kein einziges Blatt gelesen. Außerdem vertrete ich noch andere Fälle, die lassen sich nicht umterminieren und schon gar nicht von heute auf morgen. Wenn ich Ihre Interessen ernsthaft …«
»Mir egal, wie Sie das anstellen«, unterbrach er mich. »Der Prozess findet wie vorgesehen statt. Falls Sie damit ein Problem haben, suche ich mir jemand anders.«
Unterwegs kaufte ich mir einen Döner »mit alles drauf« zum Mitnehmen, kurvte fünf Minuten durchs Kreuzviertel, bis ich einen Parkplatz gefunden hatte, und schleppte dann die Aktenordner und den Döner zu meiner Wohnung hinauf. Während ich aß, blätterte ich mit fettigen Fingern im ersten Aktenordner herum. Zwei Tassen Kaffee und anderthalb grob überflogene Aktenordner später wusste ich, warum mein Vorgänger im Anwaltsjob Frank Knieriem zum Geständnis hatte bewegen wollen. Es sah nämlich verdammt schlecht aus für meinen Mandanten. Quasi alle Beweise und Zeugenaussagen sprachen gegen ihn. Freundinnen des Mordopfers hatten bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass Knieriem seine Langzeitbeziehung Ulla Hülsken psychisch terrorisiert und mehrfach geschlagen habe, zuletzt zwei Tage vor dem Mord. Grund der eskalierenden Auseinandersetzung war offenbar, dass sich Ulla Hülsken von Knieriem trennen wollte. Es gab auch bereits eine Alternative, einen Arbeitskollegen von Ulla Hülsken namens Gert Bröskamp, der Ulla seine Unterstützung und vielleicht noch einiges mehr angeboten hatte. Knieriem sah in Bröskamp den eigentlichen Anlass für Ullas Trennungswünsche. Bröskamp sagte aus, Knieriem habe ihn am Telefon und auf der Straße bedroht, einmal sei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Wörtlich formulierte Bröskamp: Ulla hat das alles sehr mitgenommen, sie ist nur deshalb bei Knieriem geblieben, weil sie Angst hatte, er würde sich an ihr rächen. »Ich muss ihn dazu bringen, die Trennung zu akzeptieren«, hat sie gemeint, »sonst lässt er mich nie in Ruhe.« Ich habe ihr abgeraten und es für das Beste gehalten, dass sie ein paar Sachen zusammenpackt und einfach verschwindet. Aber davon wollte sie nichts wissen.
Am 4. März gegen neunzehn Uhr hörten Nachbarn einen lautstarken Streit aus der Wohnung von Knieriem und Hülsken. Dann sei es plötzlich sehr still geworden. Knieriem räumte gegenüber der Polizei später einen Streit ein, behauptete allerdings, der habe früher am Tag stattgefunden, denn gegen achtzehn Uhr habe er die Wohnung für etwa zwei Stunden verlassen, um sich bei einem Spaziergang abzuregen. Da sei es Ulla Hülsken noch gut gegangen. An die genaue Wegstrecke des Spaziergangs und eventuelle Zeugen konnte er sich nicht erinnern, bei der Polizei meldete sich auch niemand, der ihn gesehen haben wollte. Der ohnehin dürftige Versuch, ein Alibi zu konstruieren, erwies sich als Fehlschlag und machte Knieriem nur noch verdächtiger.
Ebenso wie das, was danach passierte. Am übernächsten Morgen erschien Ulla Hülsken nicht in der Schule, in der sie als Lehrerin arbeitete. Anrufern erklärte Knieriem, er wisse nicht, wo sie sich aufhalte, wahrscheinlich sei sie bei ihrem neuen Freund. Bröskamp konnte das Missverständnis schnell aufklären, doch Ulla blieb verschwunden und die Anrufe von Ullas Freundinnen und ihrer Familie wurden dringlicher. Am Morgen des folgenden Tages ging Knieriem zur Polizei und meldete seine Freundin als vermisst. Den Polizisten kam die Sache gleich seltsam vor, sie befragten Nachbarn, Angehörige, Arbeitskollegen und Freundinnen und stießen auf den schwelenden Eifersuchtsstreit. In der Wohnung entdeckte man eine Reihe von Blutspuren, die beim oberflächlichen Putzen übersehen worden waren. Knieriem hatte die Kleidung, die er am 4. März getragen hatte, zwar gewaschen, jedoch die Schuhe vergessen, an denen sich kleinere Blutspritzer fanden. Den schwerwiegendsten Hinweis auf die Tat und deren versuchte Vertuschung ergab die Untersuchung von Knieriems Auto. Im Kofferraum sicherten die Spezialisten der Polizei nicht nur weitere Blutflecke, sondern auch Fasern von Ulla Hülskens Kleidung. Erdspuren an den Autoreifen ließen darauf schließen, dass Knieriem mit der Leiche in einen Wald gefahren war.
An diesem Punkt der Ermittlungen revidierte Frank Knieriem seine Aussage. Er gab zu, Ullas Leiche vergraben zu haben, führte die Polizisten in den Boniburger Wald und zeigte ihnen die genaue Stelle. Dennoch bestritt er weiter, sie ermordet zu haben. Als ich um zwanzig Uhr dreißig nach Hause kam, notierte der vernehmende Beamte, ein Kriminaloberkommissar Stürzenbecher, Knieriems Aussage, lag Ulla tot auf dem Boden. Mir war sofort klar, dass man mir das anhängen würde. – Also haben Sie die Leiche weggeschafft?, fragte Stürzenbecher. Antwort Knieriem: War blöd von mir, ich weiß. So eine Art Kurzschlusshandlung. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht.
Ich stand auf, bewegte die vom langen Lesen verkrampfte Nackenmuskulatur und überlegte, ob ich mir noch eine Tasse Kaffee oder lieber ein Bier holen sollte. Eigentlich musste ich einen klaren Kopf behalten, schließlich war es mein Job, unter der erdrückenden Beweislast irgendein Schlupfloch für Knieriem zu entdecken. Andererseits bezweifelte ich, ob ich selbst nach einer Kanne intravenös verabreichten Kaffees auf eine glorreiche Idee kommen würde. Knieriem hatte nicht nur Ullas, sondern auch sein eigenes Grab geschaufelt, aus dem er wohl kaum wieder herauskam. Warum, fragte ich mich, lehnte er es ab, durch ein Geständnis seine Strafe um ein paar Jahre zu verkürzen? Fehlten ihm schlicht die schauspielerischen Fähigkeiten, die er für das Bekunden von Schuld und Reue benötigte? Oder war er ein Spieler, der alles auf eine Karte setzte? Freiheit oder Untergang, dazwischen gab es nichts? Nun, ich würde ihn in den Untergang begleiten, notfalls bis in die höchste Instanz, konnte ich mich doch damit trösten, dass er es so gewollt hatte. Für mein Renommee als Rechtsanwalt würde eine krachende Niederlage nicht gerade förderlich sein, aber rein moralisch betrachtet sprach nichts dagegen, Knieriem lebenslänglich im Gefängnis vermodern zu lassen.
Das Telefon klingelte. Ich ging zu dem Tischchen im Flur, auf dem es stand, und nahm ab.
»Schorsch«, sagte eine männliche Stimme, »warum hörst du deinen AB nicht ab?«
»Carlo Ponti?«
»Wer denn sonst? Ich habe dich heute schon dreimal angerufen.«
Jetzt sah ich es auch. Auf dem Anrufbeantworter blinkte eine grüne Drei. »Tut mir leid, ich habe im Moment viel um die Ohren. Gerade heute bin ich als Pflichtverteidiger für einen …«
»Das ist nichts gegen die Scheiße, mit der ich beworfen werde«, unterbrach Ponti mich. »Hör zu, Schorsch, du musst dieses Stinkblatt zum Schweigen bringen.«
»Bevor wir darüber reden, muss ich erst einmal lesen, um was es geht.«
»Die wollen mich fertigmachen, Schorsch, die behaupten Dinge über mich, die einfach falsch sind. Der Oberbürgermeister hat mich bereits angerufen und gefragt, wie es mir damit geht. Der Oberbürgermeister. Begreifst du, was das heißt, Schorsch? Der will, dass ich das nicht auf mir sitzen lasse. Ich muss da so schnell wie möglich was unternehmen, Schorsch, sonst …«
»Ich verstehe dich vollkommen«, grätschte ich in seinen Monolog. »Das Problem ist nur, ich muss zuerst den Artikel lesen, bevor ich etwas dazu sagen, geschweige denn unternehmen kann.«
»Die lügen stumpf das Blaue und auch noch das Rote und das Gelbe vom Himmel«, redete er unbeirrt weiter. »Das ist so was von schofel, ich kann gar nicht sagen, wie mich das ankotzt.«
»Okay«, sagte ich. »Mit Stinkblatt meinst du sicher …«
»Ja, wen wohl, Schorsch? Die Jungs und Mädels, die am Hafen sitzen, natürlich.«
»Pass auf, Carlo«, startete ich einen neuen Versuch, »heute und morgen bin ich im Stress, da habe ich keine freie Minute. Danach, ich verspreche es, kaufe ich mir dieses Blatt und …«
»Das kannst du nicht mit mir machen.« Er klang zutiefst enttäuscht. »Sei mir nicht böse, Schorsch, ich halte dich für einen guten Mann, für einen der besten …«
»Danke.«
»Würde ich dich sonst anrufen? Sei ehrlich, Schorsch, würde ich dich anbetteln, dass du mich als mein Anwalt vertrittst, wenn du nicht der Beste wärst?«
Ich sagte ihm, was er hören wollte. »Vermutlich nicht.«
»Na also, Schorsch, deshalb darfst du mich nicht enttäuschen. Ich verstehe ja, dass du viel zu tun hast, bestimmt wichtige Sachen …«
»Immerhin ein Mordprozess«, warf ich ein.
»Meinetwegen auch ein Mordprozess«, gab er sich gönnerhaft. »Aber der Mord ist schon passiert, den kannst du nicht rückgängig machen. Die Scheiße, die mich betrifft, läuft immer noch. Und wenn du es nicht schaffst, zum Zeitungsladen zu gehen und das verfickte Blatt zu kaufen, dann lass ich es dir einfach bringen. Sag mir, wo du wohnst, und ich schicke jemanden vorbei, der dir das verkackte Ding in den Briefkasten steckt.«
»Lieber zur Kanzlei.« Auf keinen Fall wollte ich ihm meine Privatadresse verraten, sonst würde er wahrscheinlich noch heute Nacht vor meiner Tür stehen. »Und falls du dazu kommst, schreib ein paar Anmerkungen an den Rand, was deiner Meinung nach nicht den Tatsachen entspricht. Dann bin ich beim nächsten Mal besser vorbereitet.«
»Mach ich«, versprach er. »Wusstest du eigentlich, dass ich mit deiner Sekretärin Sigi mal eine Affäre hatte?«
Bestimmt fast eine halbe Nacht lang, dachte ich und sagte laut: »Tatsächlich?«
»Ja. Sie war eine echt scharfe Braut. Ich …«
»Du, ich muss jetzt wirklich«, würgte ich ihn ab. »Ich melde mich.«
Ich legte auf, bevor er noch etwas sagen konnte. Jetzt brauchte ich wirklich ein Bier.
3
April 2022
»Sie kennen Frank Knieriem?«, fragt die Frau von rechts verwundert.
»Ich kannte ihn«, erkläre ich. »Vor dreißig Jahren. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr.«
»Wissen Sie, weshalb er im Knast sitzt?«, fragt der Mann von links.
»Er hat einen Polizisten schwer verletzt. Schon vor einigen Jahren. Ging damals durch die Medien.« Ich hatte alles dazu gelesen, einschließlich der Berichte über den Prozess, der mit einer siebenjährigen Haftstrafe für Knieriem endete. »Der Polizist gehörte zu einem Einsatzkommando, das sein Haus stürmen sollte. Knieriem hatte sich mit den Behörden angelegt, keine Steuern gezahlt, Mahnungen und Strafbefehle ignoriert …«
»Ein Reichsbürger«, vermutet mein linker Nachbar.
»So was in der Art«, bestätige ich. »Außerdem gab es den Verdacht auf illegalen Waffenbesitz. Die Polizisten waren also gewarnt und trugen Schusswesten, auch der Verletzte. Genutzt hat es ihm nichts, die Kugel traf ihn knapp unterhalb der Weste. Knieriem hat später behauptet, die Polizisten hätten sich nicht zu erkennen gegeben, er sei von einem Überfall ausgegangen und habe in Notwehr gehandelt.«
»Ernsthaft?«
»Na ja, das Gericht hat ihm die Geschichte nicht abgenommen, deshalb sitzt er ja in der JVA Münster. Wahrscheinlich würde er in ein oder zwei Jahren sowieso freikommen.«
»Und für so einen Idioten riskieren die ihr Leben und nehmen wer weiß wie viele Geiseln?« Meine rechte Nachbarin schüttelt den Kopf. »Das ist doch Wahnsinn.«
Ich verstehe es auch nicht. Hinter der Aktion muss mehr stecken. Vielleicht hängt es mit dem zusammen, was Knieriem nach seiner Freilassung im Fernsehstudio erzählen will.
Damals, vor seiner Festnahme, hatte er sich nicht irgendeinem obskuren Verein angeschlossen, sondern gleich seinen eigenen gegründet, die Aktion Freies Münsterland. Den Bauernhof im Kreis Warendorf, auf dem er lebte, erklärte er zum unabhängigen Staat, mit sich selbst als Präsidenten, gesetzgebender Versammlung und Exekutive in einer Person. Das Programm der AFM, wie sie abgekürzt hieß, war nicht sonderlich originell, ein trübes Gemisch aus Verschwörungsmythen, Reichsbürgerunsinn und rechtspopulistischen Anwandlungen, garniert mit Fremdenfeindlichkeit und einer Prise Antisemitismus.
Allerdings hatte Knieriem seinen Staat nicht ganz uneigennützig aus dem Boden gestampft: Zu gesalzenen Preisen konnten Unterstützer Anteilsscheine oder Dokumente wie Personalausweis und Führerschein erwerben. Das Geschäft, hatte ich gelesen, lief blendend. Bis zu Knieriems Verhaftung. Die nicht gerade überraschend kam. Er erwartete sie geradezu. Nachdem er zuvor seine Anhänger aufgestachelt und sich selbst zum Märtyrer stilisiert hatte, war ein schlichtes Aufgeben nicht mehr möglich, als es tatsächlich passierte. Es musste zum Showdown kommen – mit blutigem Ende.
Das Telefon an der Kasse meldet sich. Nummer eins lässt es zwei Minuten klingeln, bevor sie abnimmt. Sie hört zu, wippt genervt herum und faucht dann: »Wozu?« Anscheinend folgen weitere Erklärungen, Nummer eins guckt gelangweilt zur Decke, lenkt schließlich ein. »Na schön. Eine Minute. Mehr nicht.« Mit dem Telefonhörer in der Hand blickt sie sich um. »Die sogenannte Polizei will mit einer Geisel sprechen. Freiwillige vor.«
Niemand rührt sich.
»Was ist?«, mault Nummer eins. »Es tut nicht weh. Ihr habt mein Wort.«
Ich stehe auf.
»Sieh an, der Klugscheißer.« Sie winkt mich zu sich. »Nun mach schon! Wir haben nicht ewig Zeit.«
Ich lächle deeskalierend und greife nach dem Hörer.
»Eine Minute«, instruiert sie mich. »Dann ist Schluss. Und pass auf, was du der Tussi erzählst. Kein Wort über mich und meine Leute.«
»Mein Name ist Georg Wilsberg«, sage ich ins Telefon. »Ich bin eine der Geiseln.«
Die Polizistin, die mir antwortet, schafft es, zugleich kompetent und vertrauenerweckend zu klingen. »Und ich bin Corinna Haferkamp. Ich stelle Ihnen jetzt einige Fragen. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein, verstanden?«
»Ja«, sage ich.
»Geht es Ihnen und den anderen Geiseln den Umständen entsprechend gut?«
»Ja.«
»Gibt es Verletzte oder Tote?«
»Nein.«
»Haben Sie das Gefühl, dass es in nächster Zeit zu einem Gewaltausbruch kommt?«
»Nein.«
»Das heißt, Sie denken, dass die Situation bis zwanzig Uhr einigermaßen stabil bleibt?«
»Wahrscheinlich. Ich meine, ja.«
Nummer eins, die neben mir gestanden und die Ohren gespitzt hat, nimmt mir den Telefonhörer ab. »Das reicht.« Und ins Telefon: »Keine Hinhaltetaktik mehr. Wenn du mir beim nächsten Anruf nicht sagst, wann Frank im Lügenfernsehen zu sehen ist, kannst du dir die Mühe sparen, klar?«
Es liegt mir auf der Zunge, sie auf den Widerspruch hinzuweisen, dass Frank Knieriem im Lügenfernsehen ja kaum Wahrheiten verkünden kann, doch der vernunftbegabte Teil meines Gehirns legt ein Veto ein. Gegenüber Leuten, die Maschinenpistolen haben, sollte man sich mit Spitzfindigkeiten zurückhalten.
Nummer eins beendet das Gespräch und sieht mich an. »Georg Wilsberg?«
»Richtig.«
»Und was machst du so, Georg Wilsberg?«
»Ich bin Privatdetektiv«, antworte ich wahrheitsgemäß.
»Seit wann?«
»Schon sehr lange.«
Nummer eins nickt. »Was ist? Warum stehst du hier noch rum?«
»Ich gehe ja schon.« Und das tue ich tatsächlich. Dabei sehe ich, dass ich gerade die Lage etwas schöngefärbt habe. Einigen Geiseln geht es nicht so gut, wie ich gegenüber der Polizistin behauptet habe, sie hängen mit kreidebleichen Gesichtern in den Seilen. Besonders schlimm scheint es die Mutter der vierköpfigen Familie erwischt zu haben, während der Vater ihre Füße hochstemmt, bemüht sich die Tochter, sie wach zu halten.
Ich drehe mich noch einmal um. »Entschuldigung …«
»Was denn noch?«, meckert Nummer eins.
Nun walzt auch Nummer zwei heran. »Du sollst dich hinsetzen, Arschloch.«
»Sehen Sie nicht, dass einige Geiseln dehydriert sind und kurz vor dem Kreislaufkollaps stehen?«, frage ich Nummer eins. »Ich schlage vor, wir holen aus dem Restaurant in der obersten Etage ein paar Kisten Wasser und was zu essen.«
»Sonst noch was?«, höhnt Nummer zwei. »Möchte der feine Herr vielleicht eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen?«
»Kollabierte Geiseln nützen Ihnen nichts«, rede ich weiter mit Nummer eins. »Früher oder später wird die Polizei hier Kameras anzapfen oder einschmuggeln. Sollten dann leblose Menschen zu sehen sein, provozieren Sie damit einen Angriff.«
»Wo ist das Problem?«, höhnt Nummer zwei. »Wir legen einfach ein paar Klamotten drüber, dann sieht man sie nicht.«
»Der Typ hat recht«, klärt Nummer eins ihren Vize auf. »Schick zwei von unseren Leuten mit ihm und drei anderen Geiseln ins Restaurant.« Und zu mir: »Wer versucht zu fliehen, kassiert eine Kugel, klar?«
»Das ist nicht dein Ernst, Jen.« Nummer zwei stockt.
»Idiot«, faucht Nummer eins, vermutlich besser bekannt unter dem Namen Jennifer. Wie Frank Knieriems rund zwanzig Jahre jüngere Ehefrau, die in seinem Kleinstaat die Rolle der stellvertretenden Präsidentin übernommen hatte.
Eine halbe Stunde später haben Nummer drei und ich Wasser und belegte Brötchen verteilt. Da taucht auch schon das nächste Problem auf. Der zur vierköpfigen Familie gehörende Junge erhebt sich und ruft: »Ich muss mal aufs Klo!«
»Da hast du’s«, knurrt Nummer zwei Richtung Nummer eins. »Jetzt kommt jeder mit Extrawünschen.«
»Berufsrisiko, wenn man Geiseln nimmt«, sage ich.
»Halt die Klappe!«, fährt er mich an.
Ich hebe die Hände und schweige.
»Wir holen ein paar Eimer«, schlägt Nummer zwei vor.
»Na toll«, murmele ich. »Dann stinkt’s hier bald wie in einer öffentlichen Herrentoilette.«
»Du sollst …«
»Wir bringen sie in Dreiergruppen zu den Toiletten«, entscheidet Nummer eins. »Die sind in der Etage über unserer.«
Nummer zwei schüttelt fassungslos den Kopf.
»Das hätte Frank genauso gemacht«, schiebt Nummer eins hinterher.
Ein Argument, das sich nicht widerlegen lässt. Nummer zwei trollt sich und ich will zurück in meine Hosenecke.
Nummer eins stoppt mich mit einer Handbewegung. »Du bleibst hier.« Anscheinend hat sie Gefallen an der Plauderei mit mir gefunden. »Kennst du Frank Knieriem?«
»Flüchtig«, sage ich. »Eine Zeit lang war er in den Medien ja ziemlich präsent.«
Sie nickt. »Wie wird Frank wohl reagieren, wenn er dich sieht?«
»Keine Ahnung.« Und das meine ich völlig ernst. Von einem Lachanfall bis zu einem Kopfschuss ist jede Reaktion denkbar.
Nummer vier und Nummer fünf, ein Mann mit Türsteherkreuz und eine gedrungene blonde Frau, die auch schon mit mir im Restaurant waren, brechen mit der ersten Dreiergruppe zu den Toiletten auf.
»Mal angenommen, die Polizei geht auf Ihre Forderungen ein«, sage ich. »Was passiert dann?«
Nummer eins lächelt. Sicher bin ich mir allerdings nicht, schließlich ist der größte Teil ihres Gesichts hinter einer schwarzen Kopfhaube versteckt, nur ein schmaler Augenstreifen und der Mund sind ausgespart. »Glaubst du wirklich, das erzähle ich dir?«
»Nein«, gebe ich zu. »Aber ich musste es zumindest versuchen.«
»Sagen wir mal so: Wenn alles gut läuft, wird niemand sterben.«
Von oben ist ein Schuss zu hören, dann Gebrüll, gefolgt von mehreren Salven aus mindestens zwei verschiedenen Schusswaffen. Dann herrscht Ruhe. Beinahe jedenfalls, denn irgendwer ist offenbar getroffen und schreit vor Schmerzen.
4
Oktober 1989
Ich stellte meinen Wagen auf dem Parkplatz vor dem Schloss ab. Eigentlich war es nicht weit von meiner Wohnung im Kreuzviertel bis zum Amtsgericht am Hindenburgplatz und ich hätte auch das Fahrrad nehmen können. Aber nach nur drei Stunden Schlaf war ich dankbar für jede Bewegung, die sich vermeiden ließ.
Außerdem hatte ich so eine Ahnung, dass ich an diesem Tag noch etliche Male kreuz und quer durch Münster fahren müsste, und beschlossen, mehr mich und weniger die Umwelt zu schonen.
Das Amtsgericht residierte zusammen mit der Staatsanwaltschaft in einem schlichten Zweckbau neben dem wesentlich imposanteren ehemaligen Landgerichtsgebäude, das derzeit renoviert wurde, weil das Landgericht bereits in einen dahintergelegenen schicken Neubau umgezogen war. Zukünftig sollte der noch aus der Kaiserzeit stammende Altbau hauptsächlich von der niederen Justiz genutzt werden, doch bis es so weit war, quetschten sich nebenan viel zu viele Menschen in zu wenige und enge Räume. Oder standen vor der Tür, wie die Unterstützer der Tierbefreier, die nicht mehr hineingelassen worden waren. Angesichts der Menschentraube und eines vor dem Eingang parkenden Übertragungswagens des WDR beschleunigte sich mein Puls. Hätte mich Frank Knieriems Akte nicht um den Schlaf gebracht, wäre mein Ego jetzt vermutlich noch viel aufgekratzter gewesen. Ein Gutes hatte der Trubel trotzdem: Ich wurde wach. Und das war auch bitter nötig, denn heute standen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung auf dem Programm – da war volle Konzentration gefragt.
Nachdem ich mich durch den Menschenauflauf gedrängt und die Eingangskontrolle passiert hatte, entdeckte ich meine Mandantin samt ihren Eltern auf dem Flur vor dem Verhandlungssaal.
»Da sind Sie ja endlich«, begrüßte mich Mutter Cordula Conradi.
Von den dreien schien sie die aufgeregteste zu sein. Tochter Julia, die Angeklagte, guckte betont missmutig, während Vater Walter vor Verlegenheit nicht wusste, was er mit sich und seinen Händen anstellen sollte. Alles um ihn herum war ihm sichtlich peinlich. Dass sich seine Tochter einer Horde fehlgeleiteter, schlampig gekleideter Tierrechtsaktivisten angeschlossen hatte, dass er sich genötigt fühlte, sie zu diesem unsäglichen Prozess zu begleiten – und dass er sich mit einem Winkeladvokaten wie mir abgeben musste.
»Guten Morgen«, sagte ich. »Es ist alles geklärt. Ich habe mich mit den anderen Anwälten im Vorfeld abgesprochen, damit wir nicht alle das Gleiche erzählen.«
»Ich rede von uns.« Cordula Conradis Kinn zitterte, die roten Flecke an ihrem Hals blühten. »Die arme Julia hätte etwas Zuspruch gebrauchen können.«
»Mama!« Julia verdrehte die Augen. »Mach dir keine Illusionen. Die Justiz und die Konzerne stecken unter einer Decke. Das Urteil steht längst fest. Da kann Wilsberg auch nichts dran ändern.«
»Das stimmt doch nicht. Oder, Herr Wilsberg?« Weit aufgerissene Augen bettelten um Widerspruch.
Nur jetzt nicht weinen, dachte ich.
»Warum sagen Sie denn nichts?« Das Kinnzittern wurde stärker.
»Herrgott noch mal«, stöhnte Walter Conradi.
»Ja, also …« Ich kramte umständlich meine Robe aus der Tasche. »Sicher ist der eine oder andere Richter voreingenommen, was solche politischen Aktionen angeht. Grundsätzlich bin ich allerdings von der Unabhängigkeit der Justiz überzeugt. Kein Gericht wird sich von Politikern oder Konzernen vorschreiben lassen, wie es zu entscheiden hat.«
Julia gab ein empörtes Zischen von sich.
»Das Problem ist nur«, wandte ich mich direkt an meine Mandantin, »dass wir es mit zwei verschiedenen Wertesystemen zu tun haben. Für Sie ist das, was in den Laboren passiert, Tierquälerei.«
»Was denn sonst?« Sie wurde laut, Leute drehten sich zu uns um.
»Julia! Bitte!«, sagte ihr Vater.
»Ich bin vollkommen auf Ihrer Seite«, beruhigte ich sie. »Und wahrscheinlich wird sich diese Auffassung in Zukunft auch durchsetzen. Nur im Moment handelt es sich bei Ihrer Aktion – rein juristisch betrachtet – um Einbruch und Diebstahl.«
»Weil für diese Wichser Tiere nur Gegenstände sind, irgendwas, das man benutzen darf, so wie Autos oder Juwelen. Das ist pervers.«
Ein Justizwachtmeister öffnete die Tür des Verhandlungssaals von innen.
Ich zog meine Robe über. »Wir reden später weiter.«
Nach dem ersten Schreck, erwischt worden zu sein und sich vor Gericht verantworten zu müssen, hatten sich die sieben Mitglieder des Kommando Professor Landois