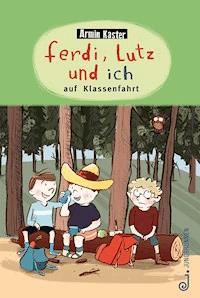Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Arthur, 15, ist wohlstandsgelangweilt und rebellisch. Am ehesten finden seine Mutter und sein Großvater Moscho einen Draht zu ihm. Als die herzkranke Mutter stirbt, ist der Vater seinem Sohn gegenüber ziemlich hilflos. Im englischen Internat wird Arthur immer mehr zum Außenseiter, er verhält sich Schulkollegen und Lehrern gegenüber aggressiv. In den Weihnachtsferien fliegt er früher nach Hause als angekündigt und geht in ein Apartment seines Großvaters, zu dem ihm dieser "für alle Fälle" den Schlüssel gegeben hat. Dort lässt er aber nur seine Sachen und lebt die folgende Woche auf der Straße – schläft zwischen Müllsäcken in der Kälte, isst nicht, legt sich mit Obdachlosen an. Seit langem ist sein Inneres wie vereist, umgeben von gläsernen Mauern. Um wieder etwas zu spüren, greift er zu immer extremeren Mitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armin Kaster
Winterauge
ISBN 978-3-7026-5912-7
1. Auflage 2017
Einbandgestaltung: b3k
© 2017 Verlag Jungbrunnen Wien
Alle Rechte vorbehalten – printed in Austria
Druck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan
Armin Kaster
Winterauge
Roman eines Jugendlichen
Inhalt
Winter
Sommer
Altweibersommer
Winter
Wintertag
Winterauge
Winternacht
Heiligabend
Frühling
Armin Kaster
wurde 1969 in Wuppertal geboren. Als Junge las er Weltliteratur, die er nicht verstand, und wünschte sich dennoch, Schriftsteller zu werden. Nach exotischen Ausflügen in den Groß- und Außenhandel sowie die Wirtschaftswissenschaft, bog er ab zur Pädagogik und danach zur Kunst. Jetzt arbeitet er als freier Autor und Künstler und lebt mit seiner Familie in Düsseldorf. Seit Jahren führt er literarisch-künstlerische Projekte mit Kindern und Jugendlichen im In- und Ausland durch. Dabei begeistern ihn vor allem die originellen Lebenswelten junger Menschen, die er am liebsten in Geschichten verwandelt.
Winter
Als ich war, was ich dachte zu sein, war ich glücklich. Zumindest für kurze Zeit. Die Menschen brauchten mich. Sie kauften sich ein wenig Trost bei mir. Sie fütterten sich mit meinem Leben. Sie wollten ihr schlechtes Gewissen beruhigen. Und ich machte sie satt, weil ich ihr Geld nahm.
Dass sie trotzdem ihre Nasen rümpften, gehörte dazu. Ich roch schlecht, war ungekämmt, die Haut war gelblich-braun, die Nägel meiner Finger waren abgebrochen oder zu lang, mit dunklen Halbmonden aus Dreck und Fett.
Wenn mir die Menschen zu nahe kamen, um ihr Geld in meine Mütze zu werfen, hielten sie die Luft an. Erst im Weggehen lächelten sie wieder. Gequält und erleichtert. Sie wollten die Weihnachtszeit genießen. Sie mussten etwas opfern, wollten etwas tun, was ihnen schwerfiel. Danach verschwanden sie im Gedränge des Weihnachtsmarktes. Befreit und zufrieden, etwas Gutes getan zu haben.
Andere kamen auf mich zu. Mehr Geld fiel in meine Mütze. Es kümmerte mich nicht. Ich war halb verhungert, fror, war immer draußen. Doch ich hatte alles, was ich brauchte. Dieses Leben war mein Glück.
Und dann endete das Glück. Als ich dem wilden Mann unter die Brücke folgte und er mich anschrie, mir ins Gesicht schlug und mich in die Seite trat. Als dann ein Hund auf mich losgelassen wurde, bin ich weggerannt. Über die Treppe in die Stadt, wo mich der Weihnachtsmarkt mit seinen unzähligen Lichtern auszulachen schien.
Da tat es weh. Zum ersten Mal seit Tagen. Nicht die Lücke zwischen den Zähnen oder das pulsierende Blut in meinem Mund. Mein Herz tat weh. So sehr, dass ich ans Sterben dachte, an meinen Tod. Und fragte mich:
„Sieht man das Kommen des Todes?“
„Hat er eine Stimme?“
Und dann sah und hörte ich meine Erlöserin.
Sie fragte: „Brauchst du Geld?“
Ich antwortete: „Nein.“
Sie sagte: „Ich würde mich freuen, wenn du zu mir kommst.“
Und ich ging zu ihr und wurde gerettet.
Das ist alles.
Und alles ist wahr.
Sommer
Die Sonne scheint. Ich sitze am Pool. Es ist heiß. Ich habe die Füße im Wasser, während der Rest meines Körpers im Schatten eines Schirmes ist. Eines großen Schirmes. Neben anderen großen Schirmen, umsäumt von Zedern, die älter sind als meine Großeltern. Welche an der Bar sitzen und ihren Mittagsimbiss einnehmen.
Auch meine Eltern sitzen da. Wie jeden Sommer. Im Parkhotel in Oberitalien. Seit ich denken kann, sind wir hier: der Pool, die Bar, die Schirme. Und am Abend das Restaurant mit den Kellnern, die unauffällig im Halbdunkel stehen und sofort zur Stelle sind, wenn etwas fehlt.
Meine Eltern haben die Junior-Suite gegenüber meinem Comfort-Einzelzimmer. Unter ihren Fenstern ist der Park zu sehen, mit dem Springbrunnen und den kleinen Kieswegen zwischen den Bäumen, umsäumt von Rosenbeeten und anderen Blumen. Die weißen Fensterläden der Zimmer sind aus Holz und halb geschlossen. Durch ihre Lamellen dringt Licht in die Zimmer. Mein Vater sagt, es sei das Licht Italiens.
„Italien ist meine Kindheit“, sagt er.
Oder: „Wir waren immer hier, nicht wahr, Moscho?“
Moscho ist mein Großvater, der schweigt, während Großmutter meinen Vater ansieht, und, an meine Mutter gewandt, sagt: „Liebes, wir sind hier fast zu Hause.“
Meine Mutter tippt etwas in ihr Handy.
„Ja, das seid ihr …“, sagt sie abwesend.
Ihre Sonnenbrille ist so groß wie eine Kinderfaust.
Ich trinke Cola. Auf Essen verzichte ich. Großmutter denkt, es wäre gut, wenn ich mittags esse. Aber ich habe keinen Hunger. „Arthur!“, ruft sie. „Komm zu uns! Wir haben Agnolotti. Es wird dir schmecken.“
Ich schaue in die Baumkronen. Die Beats auf meinen Ohren sind wirklich nicht zu übersehen. Die Beats sind meine Tarnkappe. Trotzdem spricht sie mich an. Als wüsste sie, dass ich keine Musik höre. Weil ich die Beats nur trage, um in Ruhe gelassen zu werden.
„Antworte deiner Großmutter“, sagt mein Vater.
Ich flüstere: „Ich esse keine Leichen.“
Was ich immer sage, wenn Großmutter Essensvorschläge macht. Und sehe lächelnd ins Wasser.
Großmutter hat mich nicht gehört. Sie fragt: „Soll ich dir einen Teller bringen?“
Ich sage: „Steck dir deine toten Tiere sonst wo hin.“
Aber nur so laut, dass es niemand hört.
Großmutter hält sich die Hand ans Ohr und fragt: „Was hast du gesagt?“
Ich winke ihr zu. Ich bin gut erzogen und rufe: „Ich habe keinen Hunger, danke!“
Ein leichter Wind rauscht in den Bäumen. Es ist wirklich heiß. Ich presse meine Fersen gegen die Wand des Pools. Dann trete ich mit dem linken Bein durchs Wasser. Es spritzt, und ich muss lachen.
Mein Vater starrt in sein Glas.
Meine Mutter schaut auf ihr Handy.
Meine Großmutter legt ihr Besteck beiseite.
Es ist Sonntag. Wir sind gestern angekommen. Wir bleiben noch bis Samstag. Danach fliegen wir nach Portugal.
Da zischt mein Vater: „Sag Arthur, er soll essen.“
Meine Mutter hebt den Kopf, lächelt, obwohl das Lächeln keinem von uns gilt, und ruft: „Er soll essen!“
Ich sage nichts.
„Arthur?“
Die Stimme meines Vaters überschlägt sich. Ich nehme die Beats ab.
„Was ist denn?“, frage ich.
„Nichts!“, sagt Moscho. „Du kannst weiter so tun, als wärst du nicht hier.“
Moscho steckt das Ende seiner Pfeife in den Mund und entzündet ein Streichholz. Sein Kopf verschwindet in einer Rauchwolke. Darin erkenne ich sein Lächeln.
Ich drehe mich weg und schaue zu meinem Zimmer im ersten Stock. Es hat die gleichen weißen Lamellen wie die Junior-Suite meiner Eltern, halb geschlossen und umrahmt von Efeu. „Dein Vater war auch ein schlechter Esser“, sagt Moscho. „Dafür trinkt er heute umso besser.“
Er sieht mich an. Die lachenden, hellblauen Augen stehen etwas auseinander, sein gestutzter Bart ist grau. Und während er ein leises Lachen folgen lässt, starrt meine Mutter auf ihr Handy und mein Vater leert sein Glas in einem Zug.
„Ich geh rauf“, sage ich.
Es ist kurz nach drei. Um acht bin ich mit meinen Großeltern im Restaurant verabredet. Meine Mutter wird joggen und mein Vater in der Hotelbar sitzen. Wie jeden Abend.
„Arthur“, sagt meine Großmutter, „wir wollen dich nicht drängen, aber …“
Es ist viertel nach acht. Ich sitze im Restaurant. Ein Kellner steht neben mir. Großmutter sieht mich an. Moscho sitzt mir gegenüber und nickt mit seinem grau behaarten Riesenkopf. Er sitzt da wie immer und schweigt mit einer Mischung aus Belustigung und Allwissenheit. Nur manchmal, da spricht er. Und dann hören alle zu und denken, dass er recht hat. Mit allem, was er sagt. Auch wenn er völlig danebenliegt.
„Schau Ari, es gibt hier etwas, das dir schmecken könnte.“
Großmutter schiebt mir die Speisekarte herüber.
Ich klimpere mit den Augen.
„Kurz gebratener Thunfisch, Zucchini-Spaghetti und Erbsen. Du magst doch Erbsen. Oder nicht?“
Ich nicke. Und sage: „Für mich die Spaghetti alla Chitarra, bitte särr?!“
„Oh Arthur …“, stöhnt Großmutter. „Muss das sein?“
Moschos Mundwinkel zucken.
„Das ist lecker!“, sage ich.
Großmutter sagt: „Es ist eintönig, Ari! Schrecklich eintönig. Jeden Tag das gleiche, ich bitte dich!“
„Ich bin eintönig, Großmutter. Ganz schräääcklich eintönig.“
„Rede keinen Unsinn“, brummt Moscho. „Du bist eigensinnig. Das ist was anderes.“
Niemand sagt etwas. Bis der Kellner sagt: „Die Herrschaften haben gewählt …“
Großmutters Mund ist jetzt ganz klein. Sie bestellt ein paar Tierleichen und Moscho trommelt mit seinen fleischigen Fingern auf der gestärkten Tischdecke.
Er fragt: „Cola oder Cognac?“, und sieht mich an.
Ich sehe zurück.
Und Großmutter sagt: „Wir hätten gern drei Fragolino.“
„Und eine Cola und einen Cognac“, sagt Moscho.
So nimmt der Abend seinen Lauf. Weil jeder Abend mit dem Fragolino beginnt und dann verläuft, wie es Moscho vorgibt.
Weil hier alle denken, Moscho hätte den Durchblick. Seit ich denken kann ist das so.
„Darf ich?“
Mein Vater steht neben dem Tisch.
Großmutter lächelt und Moscho verschränkt die Arme vor der Brust. Sein Gesicht ist unbewegt.
Mein Vater setzt sich. Der Kellner steht neben ihm.
„Prego, Signore, ich darf Ihnen die Karte bringen …“
„Nein, aber einen Gin Sul“, sagt mein Vater.
Der Kellner nickt und geht.
Moschos helle Augen sind auf meinen Vater gerichtet und Großmutter tätschelt meinen Arm und flüstert: „Ari, es gibt hier wirklich Besseres, als deine ewigen Chitarra.“
Ich sehe sie an.
„Was denn so?“, frage ich.
Sie hebt die Hände.
„Ich darf dir was vorschlagen?“
Ich sage: „Nein …“
Und als die Getränke kommen, fragt Großmutter an meinen Vater gewandt: „Wie läuft es denn in der Agentur so ohne dich?“ Mein Vater sieht auf. Sein Blick ist müde.
„Ich mache mir keine Sorgen“, sagt er.
Moscho sieht meinen Vater an.
„Machst du nicht?“
Mein Vater wird ernst.
„Nein, mache ich nicht. Robert hat alles im Griff.“
„Ist Robert eine Frau?“, frage ich.
„Natürlich nicht“, sagt mein Vater und kippt den Gin Sul runter. Ich weiß, dass mein Vater ab und zu mit seinem Geschäftspartner Robert telefoniert. Aber manchmal stelle ich mir vor, er würde mit einer Frau telefonieren. Diese Frau wäre seine Affäre. So stelle ich mir das vor.
„Dann ist ja alles gut!“, sagt Großmutter.
Mein Vater lacht.
„Und wer ist die Frau, mit der du immer telefonierst?“, frage ich und verziehe keine Miene. Kleiner Scherz. Um die Langeweile zu überbrücken.
Mein Vater erstarrt. Er ignoriert die Frage, während der Kellner zwei kleine Schalen mit einer gelben Creme und geröstetes Brot auf den Tisch stellt. Moscho greift zu, und mein Vater sagt dem Kellner, dass er ein weiteres Glas wünscht.
Großmutter lächelt in die Runde.
„Morgen gehen wir wandern, nicht wahr?“
Mein Vater sagt: „Wir bleiben im Hotel. Julia geht es nicht gut.“
Und Moscho schüttet den Cognac in meine Cola. Ich zucke mit den Schultern.
Mein Vater lacht.
Und Großmutter sagt: „Musst du den Jungen zum Trinken animieren?“
Moscho nimmt das Glas und sagt, an meinen Vater gewandt: „Und weil Julia so krank ist, geht sie jeden Tag joggen?“ Großmutter verdreht die Augen, während mein Vater sein Lachen wieder einpackt und den zweiten Gin Sul hinunterkippt.
„Ich dachte, Robert ist eine Frau“, sage ich.
„Arthur! Hör auf damit!“
Mein Vater ist gereizt.
Ich versuche, ein möglichst unbeteiligtes Gesicht zu machen. Dabei geht mir der böse Blick meines Vaters am Arsch vorbei. Was Moscho am Arsch vorbei geht, weiß ich nicht. Vielleicht, dass wir immer um 20.00 Uhr im Restaurant sitzen und Müll reden, damit wir nicht merken, wie beschissen es ist, um 20.00 Uhr in einem Restaurant zu sitzen, in dem man aus Langeweile endlos Müll redet.
„Stopp!“, ruft mein Vater, obwohl niemand was gesagt hat. Sein Drink ist da.
„Ich möchte nur mal kurz klarstellen, dass Julia ernsthaft krank ist. Und wie lange das dauert, kann im Moment niemand sagen. Am allerwenigsten sie selbst. Also lasst uns einfach ein paar schöne Tage verbringen und entspannen. Ist das möglich?“
Er ist echt gereizt.
Alle schweigen. Sogar die Leute am Nachbartisch. Eine Gelegenheit für Moscho zu sagen: „Guter Hinweis, Grischa. Prost!“ Zwei Gläser Hochprozentiges verschwinden in den Körpern meiner direkten männlichen Verwandten und Großmutter atmet tief ein, was kaum zu hören ist, weil sie es unauffällig macht.
„Vielleicht ist Robert ja im Stimmbruch“, reite ich auf meinem Witz herum und schaue auf die strahlend weiße Tischdecke. Mein Vater bebt. Und schweigt. Während Moscho grinst und den Arm hebt.
Als der Kellner da ist, sagt er: „Wir machen das heute mal so. Immer wenn ein Glas leer ist, bringen Sie ein neues. Haben Sie das?“
Der Kellner nickt. Und Großmutter nickt auch. Sie macht das ständig. Mein Vater scherzt, sie habe Parkinson, was nicht lustig ist, weil es eine Krankheit ist, wie meine Mutter sagt. Wenn sie mal was sagt. Was nicht allzu oft geschieht, seit sie in der Klinik war.
„Am Ende des Tages wird alles gut“, sagt meine Großmutter. Was Unsinn ist, weil jetzt das Ende des Tages da ist. Großmutters Leben ist voll im Arsch, was sie nicht wahrhaben will und darum ständig von Essen und irgendwelchen Dingen spricht, die wir machen könnten.
Deshalb sage ich: „Ich esse heute mal was anderes. Suchst du mir was aus, Oma?“
So aus Mitleid.
Und Großmutter strahlt. Und ruft den Kellner. Er notiert, was sie ihm nennt, und zieht mit einer Bestellung ab, die ich nicht essen werde.
„Arthur, dass du dich auf diese Küche einlässt, ist wirklich schön“, jubelt sie. „Der Koch ist noch sehr jung. Er hat aber schon Preise gewonnen!“
Sie tippt mit dem linken Zeigefinger auf die Karte. Dort steht mein Gericht. Kurz gebratener Thunfisch, Zucchini-Spaghetti und Erbsen.
Mein Vater sagt: „Prost …“ und lächelt müde, während ich an meine Mutter denke. Was ich ziemlich häufig tue. Seit ich vor ein paar Wochen erfuhr, dass sie in einer Klinik ist. Einer Nervenklinik. Wo man nur hinkommt, wenn man wirklich am Ende ist. Was ich gar nicht wusste. Bis ich es von Mr Davis erfuhr.
Im Zimmer des Internatsleiters.
Der Internatsleiter und Arthur sitzen einander gegenüber. Ein großes Zimmer, gefüllt mit Teppichen, Regalen voller Bücher und einem Ölbild, das den Internatsgründer zeigt. Am Fenster ein alter Globus aus Holz.
Der Internatsleiter (mit besorgter Miene): „Dein Vater hat mich gebeten, mit dir zu sprechen. Deiner Mutter geht es nicht gut. Sie ist in einer Nervenklinik. Sie muss ihr Leben neu sortieren. Verstehst du das?“
Arthur: „Meine Mutter ist verrückt?“
Der Internatsleiter sieht zur Decke. Ein trauriges Lächeln.
Der Internatsleiter: „Deine Mutter wäre gerne anders. Also dir gegenüber, mein Junge. Verstehst du?“
Arthur: „Wie möchte meine Mutter denn sein?“
Der Internatsleiter (lächelnd): „Dein Vater denkt, es wäre besser, wenn du die Osterferien bei deinen Großeltern verbringst. Was meinst du?“
Arthur: „Was hat meine Mutter denn?“
Der Internatsleiter: „Deine Mutter liebt dich sehr. Sie kann es nur nicht zeigen. Ihre Krankheit lässt das nicht zu.“
Arthur (aufstehend): „Soll ich meinen Koffer packen?“
Der Internatsleiter nickt.
Die beiden geben sich die Hand.
„Arthur, träumst du?“
Meine Großmutter wedelt mit der Hand vor meinen Augen.
Das passiert mir tausendmal am Tag. Immer schon. Und besonders, wenn wir in Italien sind. Ich träume mit offenen Augen. Aber egal.
Denn Großmutter sagt: „Arthur! Ich habe dich gefragt, ob du dich an Hannah von Weizenfell erinnern kannst? Die von Weizenfells sind heute angereist.“
„Ja, klar“, sage ich und denke sofort an den Abend im Park. Als wir zusammen abgehauen sind. Als ich noch ein Kind war.
Hannah war damals fast erwachsen. Das weiß ich noch.
Mein Vater grinst aus irgendeinem Grund. Er sieht gut aus. Das liegt an seinem Krafttraining. Doch für mich fühlt es sich an, als wäre er von innen hohl. Irgendwie zerfressen.
Ich werfe einen Blick auf Moscho, der sein Glas in der Hand dreht. Daneben Großmutter. Ellenbogen auf dem Tisch, die Hände an die Wangen gelegt, zwei Millionen Ringe an der faltigen Hand. Tonnenschweres Parfum. Vermutlich badet sie darin.
„Die von Weizenfells sind wie lange hier?“, fragt mein Vater.
„Nur ein paar Tage“, sagt Großmutter. „Hannah studiert jetzt.“
Sie zwinkert mir zu.
Mein Vater ist erstaunt. „Sie hat schon Abitur?“
„Aber sicher“, sagt Großmutter. „Sie ist zwanzig. Das wurde wohl auch Zeit.“
„Und was studiert sie?“, will mein Vater wissen.
„Jura. Wie alle von Weizenfells.“
„Und was soll Hannah damit anstellen?“
„Vermutlich das, was man damit anstellen kann“, sagt Großmutter und lacht.
„Einen Gin Sul, der Herr …“
Der Kellner stellt das nächste Glas auf den Tisch.
Moscho betrachtet meinen Vater.
Großmutter legt ihre Hand auf den Arm des Kellners und sagt:
„Für mich gilt die Regelung meines Mannes nicht. Ich bekomme ein Wasser.“
„Mit Kohlensäure …“
Großmutter nickt.
Und mein Vater beugt sich vor.
„Hannah wird Anwältin?“
„Vermutlich“, sagt Großmutter. „Vorausgesetzt, sie schafft das Studium.“
„Wenn nicht, nimmst du sie in die Agentur“, sagt Moscho.
Mein Vater hebt den Kopf.
„Wieso sollte ich?“, fragt er.
Moscho lacht und verdreht die Augen.
Mein Vater sagt „Aha …“ und rutscht auf die Stuhlkante. Die Stimmung ist jetzt deutlich im Minus.
Ich sehe die stark pulsierende Ader am Hals meines Vaters.
Moscho scheint das nicht zu kümmern. Er legt den Kopf in den Nacken und lässt den Cognac in seinen Hals laufen.
Da steht mein Vater auf.
„Ihr entschuldigt mich …“
Ich frage: „Gehst du telefonieren?“
Stille. Wie nach einem Knall. Großmutter sitzt ganz ruhig da. Ich nicht, da mein Vater wütend ist. Und Moscho klatscht lachend in die Hände.
Als mein Vater draußen ist, flüstert Großmutter: „Ich halte das nicht mehr aus …“
Ihre Augen füllen sich mit Tränen.
„Einmal das Oktopus-Gröstl mit Blumenkohl und violetten Kartoffeln …“
Der Kellner serviert die Vorspeise.
Und ich esse das Zeug, obwohl ich kotzen könnte.
Um Großmutter einen Gefallen zu tun.
Dann kommt der Hauptgang.
Dann gibt es den Nachtisch.
Dann rollen die Schnapsflaschen auf einem Wagen heran. Dann gehe ich in mein Zimmer.
Dann stelle ich mich ans Fenster und sehe in den Stadtpark.
Dann verschlucken mich die Träume:
Die Nachtluft dringt als warmer Block ins Zimmer. Arthur steht am Fenster und schaut in den Wald am Fuße seines Schlosses. Er ist von dem Gebell der Hunde wach geworden. Zwei Bestien mit langen, scharfen Zähnen kämpfen miteinander. Ein Hund ist verletzt. Das blutige Fell glänzt im Fackellicht. Der andere Hund hat die Zähne gefletscht und lauert auf den nächsten Angriff. Von den Kampfgeräuschen angelockt, kommen zwei Männer über die Wiese gelaufen. Sie rudern mit den Armen und versuchen, die Tiere zu trennen. Eine Handvoll Frauen beobachtet das. Der blutende Hund ist unter einen Busch gekrochen, während der andere mit gesenktem Kopf zu seinem Besitzer trabt. Mit schnellem Griff packt ihn der eine Mann am Schwanz und schlägt ihm auf die Schnauze. Der Hund rollt sich auf den Rücken. Dann zieht der andere Mann den Hund unter dem Busch hervor. Er betrachtet die blutenden Risse im Fell, schüttelt den Kopf, springt hoch und stürzt sich auf den ersten Mann. Sie fallen ins Gras. Sofort sind die Hunde zur Stelle. Sie springen bellend umher, während die Frauen ihre Hände zum Himmel heben und schreien. Das gefällt den Männern, und sie schlagen sich eine Weile. Als sie wieder getrennt sind, gehen die Frauen fort und werfen ihre Haare in den Nacken, während die Hunde aufgeregt umherlaufen und winselnd gegen die Bäume pinkeln.
Ich drehe mich vom Fenster weg und stelle mich in die Mitte des Zimmers. Es ist ein Eckzimmer mit zwei Fenstern. Ecke links, das Fenster zum Stadtpark. Ecke rechts, das Fenster zum Hotelpark.
Wo die Hotelgäste von dem Aufruhr im Stadtpark nichts bemerkt haben. Weil der Hotelpark durch einen hohen Zaun vom Stadtpark getrennt ist und der plätschernde Springbrunnen alle von außen kommenden Geräusche übertönt.
Ich beobachte jeden Tag, was die Menschen im Stadtpark machen. So aus Interesse. Und aus Langeweile. Weil hier nichts passiert, was aufregend wäre. Seit Jahren schon. Seit dem Tag, als ich dieses Zimmer zum ersten Mal betrat.
Damals war ich acht Jahre alt und meine Eltern sagten, ich sei jetzt groß genug für das Comfort-Einzelzimmer. In den Jahren davor hatte ich die Urlaube mit meinen Eltern in der Junior-Suite verbracht. Jetzt sollte ich ein eigenes Zimmer haben. Mit anderen Worten, ich war nachts allein.
Meine Mutter sagte: „He, Ari, siehst du den Park? Das Restaurant und die Bar? Wenn du im Bett liegst, weißt du immer, wo wir sind. Das ist doch cool, oder?“
Ich sah den Park. Aber nicht den Hotelpark, sondern den Stadtpark im linken Fenster. Ich sah die Menschen darin. Noch nie hatte ich solche Menschen gesehen. Sie lagen auf den Bänken, lachten, grölten, rauchten, schrien und waren umgeben von Hunden, die wie Wölfe aussahen. Es waren wilde Menschen. Und ich war sofort von ihnen gefangen. Von einem auf den anderen Moment. Von den Menschen und ihren Hunden. Von den wilden Menschen mit ihren wölfischen Hunden. Weil sie so anders waren, so gefährlich aussahen. Weil sie machten, was sie wollten.
„Das war in dem Jahr, als ich mit Hannah im Stadtpark war“, denke ich. Mit Hannah von Weizenfell.
Die ich jetzt am Pool sehe. Im Hotelpark. Ich habe sie sofort erkannt. Ihre Beine sind in das grün leuchtende Wasser getaucht. Ihre Haare hängen herab. Sie starrt ins Wasser.
„Hannah! Wir sind hier! Kommst du?“
Hannah hat den Kopf gehoben. Ich trete zurück, obwohl sie mich nicht sehen kann.
„Hörst du, Hannah? Wir sind in der Bar!“
Hannah ruft: „Ja, Mama! Gleich!“
Ihre Füße sind im Wasser seltsam verzerrt, die Waden verschwommen. Ich sehe ihre Beine. Kann den Blick nicht davon nehmen. Zugleich stoßen sie mich ab.
„Wir sitzen auf der vorderen Terrasse. Magst du etwas trinken?
Ich bestelle gerne für dich.“
„Mama!“
„Ist gut, Hannah-Schätzchen. Bis später. Du kommst nach, ja?“ Hannah lässt sich nach hinten fallen, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, die Beine übereinandergeschlagen. Sie lächelt. Ihr Haar liegt als schwarzer Fächer auf der Wiese. Ein Kellner nähert sich, beugt sich zu ihr, und Hannah dreht den Kopf in die andere Richtung. Sieht zu dem gegenüberliegenden Teil des Hotels. Wo sich die Junior-Suite meiner Eltern befindet. Wo ich bis zu meinem achten Lebensjahr die Urlaube verbracht habe. In der es jetzt dunkel ist. Weil meine Mutter joggt und mein Vater in der Hotelbar sitzt. Während Großmutter zwei Etagen höher schläft und Moscho durch die Stadt läuft.
Alles wie immer.
Nur dass Hannah wieder da ist. Nach sieben Jahren. Einer halben Ewigkeit. Und ich die gleichen Bauchschmerzen bekomme wie damals. Als ich mit Hannah im Stadtpark war und sie sich vor mir auszog.
Dann gehe ich ins Bett.
Dann sehe ich das funkelnde Schattenspiel des Springbrunnens an der Zimmerdecke.
Dann höre ich das Sirren einer Mücke an meinem Ohr.
Dann wache ich am nächsten Morgen auf.
„Voll der Bringer …“
Hannah. In einem Liegestuhl.
Großmutter ist mit den von Weizenfells zum Wandern auf den Berg gefahren. Moscho ist in der Stadt. Und Paul steht vor Hannah und hält eine Heuschrecke in der Hand. Ich habe meine Beats auf den Ohren. Paul sieht mich an.
„Willst du sie mal anfassen?“
Ich starre ins Wasser.
Hannah trägt eine Sonnenbrille. Das Modell meiner Mutter. Ich habe mit ihr noch kein Wort gewechselt. Mein Hals ist irgendwie verschlossen. Staubtrocken.
Mein Vater lehnt an der Bar.
Der kantigen Heuschrecke in Pauls Hand fehlt ein Bein und neben dem linken Flügel hängt gelber Glibber.
„Tot?“, frage ich.
Paul zuckt mit den Schultern.
Hannah wippt mit dem Bein.
Paul ist ihr Bruder. Er ist acht und nervt. Er zieht an der Heuschrecke. Sie lebt. Ihre Fühler wackeln neben ihren riesigen Augen und die Vorderbeine strampeln ins Leere.
„Da hinten können wir sie beerdigen“, sagt er und zeigt zu den Rosenbeeten.
Ich sage: „Dein Ernst? Du willst sie begraben? Sie lebt doch noch.“ Hannah grinst. Ich sehe weg, sehe zur Bar. Mein Vater hebt die Hand.
„Arthur! Tu ihm den Gefallen.“
Paul sieht aus wie Hannah, irgendwie. Ich habe ihn das letzte Mal als Baby gesehen. Seit heute Morgen will er ständig was von mir. Und jetzt soll ich mit ihm eine lebendige Heuschrecke beerdigen.
Hannah hat ihren rechten Fuß auf den linken Oberschenkel gelegt. Hannahs Haut ist weiß. Paul hat Sommersprossen. Und einen irren Blick. Wie seine Schwester.