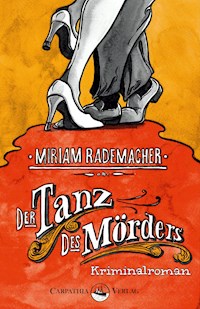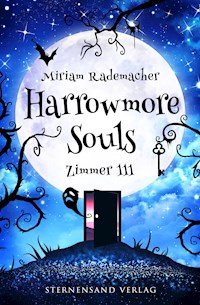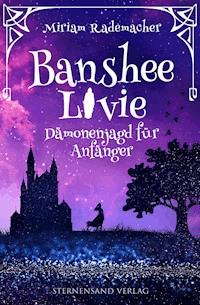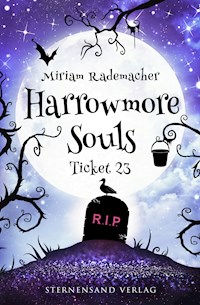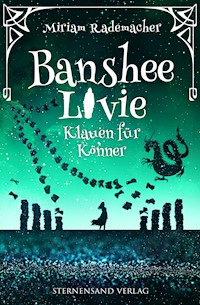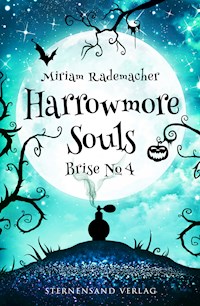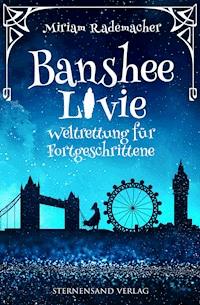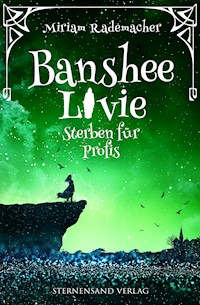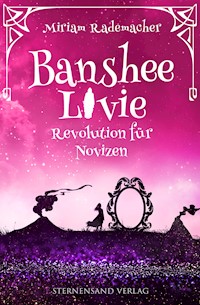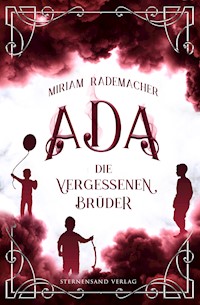4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historischer-Berlin-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein tragischer Unfall ... oder Mord? Berlin, 1928: Es soll ein unterhaltsamer Tanzabend werden, doch stattdessen wird Kommissarin Billa Morgenthal Augenzeugin, wie ein Mann mitten auf der Tanzfläche unter einem Kronleuchter begraben wird. Schnell erkennt sie, dass der Leuchter nicht durch Zufall in die Menge hinabgerauscht ist. Währenddessen ist ihr Kollege Julius Haak an einem anderen Tatort: In einer Wohnung wurde eine Leiche entdeckt, die zum Entsetzen des Kommissars schon länger dort verweilt. In den Räumen gibt es keinen Hinweis auf die Identität des Toten. Die Wohnung wurde unter falschem Namen angemietet und jemand hat sich große Mühe gegeben, alle persönlichen Gegenstände zu entfernen. Mit dem Aufdecken falscher Identitäten hat Billa Morgenthal Erfahrung, doch wie sehr ihre Ermittlungen sie selbst in Gefahr bringen werden, ahnt sie nicht. Die Fortsetzung der historischen Krimi-Serie mit der zielstrebigen jungen Kommissarin Billa Morgenthal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Miriam Rademacher
Wintergrab
Kommissarin Morgenthal ermittelt
Kriminalroman
Über dieses Buch
Tödliches Spiel der Identitäten
Berlin, 1928: Es soll ein unterhaltsamer Tanzabend werden, doch stattdessen wird Kommissarin Billa Morgenthal Augenzeugin eines Mordes. Mitten auf der Tanzfläche wird ein Mann von einem Kronleuchter erschlagen. Der Täter kann im Geschehen flüchten, und das Mordopfer trägt einen offensichtlich falschen Ausweis bei sich.
Währenddessen ist Billas Kollege Julius Haak an einem anderen Tatort: In einer Wohnung wurde eine Leiche entdeckt, die zum Entsetzen des Kommissars schon länger dort verweilt. Nirgends in den Räumen gibt es einen Hinweis auf die Identität des Toten. Jemand hat sich große Mühe gegeben, alle persönlichen Gegenstände zu entfernen, und die Wohnung wurde zudem unter falschem Namen angemietet.
Mit dem Aufdecken falscher Identitäten hat Billa Morgenthal bereits Erfahrung. Sie ermittelt mit Hilfe des guten Gespürs ihres Freundes Leonard Reiter. Doch sie geraten ins Visier derjenigen, die um jeden Preis verhindern wollen, dass das Rätsel um die namenlosen Toten gelöst wird.
Vita
Miriam Rademacher, Jahrgang 1973, wuchs auf einem kleinen Barockschloss im Emsland auf. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Osnabrück, wo sie an ihren Büchern arbeitet und Tanz unterrichtet. Sie hat zahlreiche Fantasy-Romane, Krimis und Kinderbücher in verschiedenen Verlagen veröffentlicht.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Jan Karsten
Covergestaltung bürosüd, München
Coverabbildung Malgorzata Maj/Arcangel Images; Sammlung Berliner Verlag/akg-images
ISBN 978-3-644-01572-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Dahlem
Juli 1928
«Können wir nicht auf einen Abend warten, an dem niemand zu Hause ist?», flüsterte der ungläubige Thomas mit seiner unverwechselbaren hohen Stimme.
«Der Juwelier Albrecht ist ein Stubenhocker, der geht nie aus», lautete die lapidare Antwort, die irgendwo aus der Dunkelheit kam.
Horst wünschte sich, die Männer würden einfach die Klappe halten und auf ihren Einsatz warten. Vor ihm, in der strahlend weißen Villa unter den hohen Kastanien, verlosch soeben das letzte Licht hinter einem der Fenster im ersten Stock. Nicht mehr lange, und die ganze Familie Albrecht würde in tiefen Schlaf sinken, nicht ahnend, dass zwischen den Rhododendren ihres Vorgartens fünf Männer genau darauf lauerten.
«Wir warten noch», hörte Horst die Stimme Hasslers sagen, der dicht neben ihm stand. Niemand der anderen widersprach. Obwohl die Nacht kalt war und sich vermutlich alle Beteiligten wünschten, den Bruch bereits hinter sich zu haben, wollten sie den Erfolg ihres Vorhabens nicht durch voreiliges Handeln gefährden.
Horst Kauper selbst war noch keine dreißig Jahre alt und in die kriminellen Kreise gewissermaßen hineingeboren worden. Schon sein Vater war im Jahre 1890 einer der Mitbegründer des ersten Reichsvereins ehemaliger Strafgefangener gewesen. Er war als ehrlicher Spucknapfleerer gestorben und hatte sich für seinen einzigen Sohn etwas Besseres erträumt.
Horst hatte sich auch tatsächlich um eine ehrliche Arbeit bemüht. Gleich nach dem Krieg war er in seiner Uniform als hübscher Bursche durch die Tanzsäle gezogen, um sich seinen Unterhalt als Gigolo zu verdienen. Er war recht hübsch, besaß noch alle Hände und Füße, und für eine Weile war er mit dem wenigen, was er an einem Abend verdienen konnte, ausgekommen. Doch dann war ihm eine vermeintlich günstige Gelegenheit zum Verhängnis geworden und hatte ihm zwei Jahre Zuchthaus eingebracht. Diese Zeit hatte ihn geprägt. Seit er wieder draußen war, trug er mit Stolz die Nadel seines Ringvereins und war finanziell weit besser gestellt als je zuvor.
«Und du bist dir ganz sicher, dass der Juwelier in seinem Zuhause dicke Klunker lagert?» Das war erneut die Stimme vom ungläubigen Thomas, der bei jedem Bruch bis zur letzten Sekunde überflüssige Fragen stellte. Und er war ganz offensichtlich noch nicht fertig damit. «Sind fünf Leute nicht ein bisschen viel für diese Sache?»
«Halt die Klappe», zischte jemand, dessen Stimme Horst in dieser Dunkelheit nicht ohne Weiteres zuordnen konnte. «Der Mann hat sich gerade einen nagelneuen Safe in die Bude bauen lassen. Was meinst du denn, was der darin lagert? Kartoffeln?»
Niemand lachte. Sie alle dachten daran, wie sie in Kürze besagten Safe so leise wie möglich samt seinem wertvollen Inhalt davontragen würden. In Anbetracht des enormen Gewichts und der wenig handlichen Bauweise waren fünf Helfer gewiss nicht zu großzügig bemessen.
Endlich gab Hassler, ihr Anführer, das Kommando zum Aufbruch. Und wenige Minuten später stieg auch Horst Kauper wie seine vier Komplizen durch das von ihm lautlos aufgehebelte Fenster im Erdgeschoss.
«Dies ist aber nicht das Arbeitszimmer», raunte der ungläubige Thomas und deutete auf ein Plättbrett, als ein Feuerzeug aufflammte und die Umgebung erhellte. «Das sieht mir eher nach einem Wirtschaftsraum aus. Hat der Juwelier seinen Safe etwa zwischen der dreckigen Wäsche versteckt?»
«Ruhe», fauchte Hassler. «Niemand spricht von jetzt an auch nur ein Wort. Folgt mir einfach.»
Leise wurde die einzige Tür des Raumes geöffnet, und der ganze Trupp schlich auf Fußlappen geräuschlos in einen dunklen Flur hinaus, von dem mehrere geschlossene Türen in benachbarte Räume führten. Gerade kamen Horst erste Zweifel an der angeblich perfekten Vorbereitung dieses Raubzugs, als das Deckenlicht über ihren Köpfen anging. Ein grauhaariger Mann in einem grünen Morgenmantel stand am Fuß der Treppe und starrte die Bande verblüfft an.
Horst Kauper überfiel spontan sein ausgesprochen gut entwickelter Fluchtinstinkt. Und er hätte auch fast kehrtgemacht, um durch das Fenster des Hauswirtschaftsraums in den Garten zu fliehen. Doch noch bevor seine Füße sich in Bewegung setzen konnten, packten zwei seiner Kumpane den verdutzten Juwelier, hielten ihm den Mund zu und drückten ihn zu Boden.
«Ist mir auch recht», murmelte der ungläubige Thomas, der ruhig neben Horst stehen geblieben war. «Der kennt sich hier wenigstens aus und kann uns den Weg zu seinem Safe zeigen.»
«Halt die Klappe», fauchte Hassler, zog einen Armeerevolver hervor und begann, damit vor dem Gesicht des nun völlig verängstigten Hausherrn herumzufuchteln. «Das ist jetzt aber mal dumm gelaufen, mein Freund. Eigentlich solltest du von alledem hier nischt mitkriegen.»
«Ich kenne Sie», hörte Horst den Juwelier Albrecht rufen. «Sie sind einer der Männer, die meinen Tresor angeliefert haben.»
«Sehr schlau, der Herr. Und jetzt bin ich gekommen, um ihn wieder mitzunehmen. Ich hoffe, du hast dett Ding inzwischen jut jefüllt. Also geh voran und zeig uns, wo er steht.»
Horst konnte sehen, wie der Juwelier auf seine Füße gestellt und ihm der Lauf des Revolvers in die Seite gedrückt wurde. «Sie sind im Irrtum, wenn Sie glauben, es würden sich große Besitztümer darin befinden. Ich lagere dort nur wichtige Unterlagen und ein paar wenige Schmuckstücke meiner Frau.»
«Fein, dann gib uns doch die», lautete die Antwort. «Du ersparst uns mit deiner Hilfe eine ganze Menge Arbeit. Pech nur, dass ich keinen Wert auf Zeugen lege. Den ursprünglichen Plan hättest du überlebt.»
Augenblicklich begriff der Juwelier die Bedeutung dieser Worte. Die nackte Angst trat in seinen Blick, und er verlegte sich aufs Betteln. «Bitte lassen Sie mich leben. Ich gebe den Herren ja alles, was sie möchten. Wollen Sie meine Uhr? Fangen wir mit der Taschenuhr an, die ist aus echtem Gold. Ich gebe sie Ihnen freiwillig.» Spontan tastete der Mann seine Brust ab, bis ihm bewusst wurde, dass er ja nur einen Morgenrock trug. Die Szene entbehrte nicht einer gewissen Komik, und Horst verspürte den Drang zu lachen, der jedoch sofort verflog, als die Katastrophe ihren Lauf nahm.
«Papa?»
Der Klang einer hellen Stimme ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Auf dem oberen Treppenabsatz war eine gespenstisch anmutende Gestalt erschienen. Ein kleines Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und in einem bodenlangen weißen Nachthemd sah unschlüssig auf die Versammlung herab.
Horst beschloss, die ganze Aktion als gescheitert zu betrachten, und wollte gerade endgültig seinem Fluchtreflex nachgeben, als ein Schuss durch die Stille krachte und die Kleine auf dem Treppenabsatz lautlos zusammenbrach. Gleichzeitig begann ihr Vater ohrenbetäubend zu schreien, woraufhin Hassler dem Juwelier kräftig mit dem Pistolengriff auf den Hinterkopf schlug. Der Mann sackte zu Boden, doch die Schreie brachen nicht ab. Sie hallten im Hausflur wider und stammten jetzt von einer Frau im seidenen Morgenrock, die die Treppe hinuntergestürmt kam. Ein weiterer Schuss krachte, und sie fiel die letzten Stufen hinab, vorbei am Körper ihrer Tochter, bis sie unterhalb der ersten Stufe, nahe bei ihrem Mann, liegen blieb.
«Raus hier», rief der ungläubige Thomas und packte Horst, der wie erstarrt dastand und in die offenen Augen der toten Frau blickte, am Arm.
«Nichts da», brüllte Hassler und richtete seine Waffe jetzt gegen seine Kumpane. «Ihr bleibt, wo ihr seid, oder ihr werdet es bereuen. Soll denn alles umsonst gewesen sein? Jetzt knacken wir das Ding erst recht, und zwar gleich hier. Wecken können wir ja wohl keinen mehr.»
Unwilliges Murren breitete sich unter den Männern aus, woraufhin ein weiterer Schuss losging. Das Geschoss traf die Decke, und Putz rieselte auf Horst herab. Hassler, der wie ein Standbild neben dem reglos am Boden liegenden Juwelier stand, deutete mit dem Lauf der Waffe auf eine geschlossene Tür.
«Ich schätze, da geht’s lang. Mitkommen!» Alle gehorchten. Auch Horst Kauper.
Tatsächlich fanden sie an der Rückwand des angrenzenden Raumes einen dunkelgrünen Safe der Firma Petzold mit blinkenden Messingbeschlägen. Und während Horst verbissen damit begann, der stabilen Schmuckschachtel mit Hammer und Meißel zu Leibe zu rücken, dachte er daran, wie im Knast mit Männern umgegangen wurde, die sich in irgendeiner Form an Kindern vergriffen hatten. Eine leichte Übelkeit stieg in ihm auf. Das Bild des Mädchens, wie es von Schüssen getroffen zusammensackte, ließ ihn nicht los.
«Wir stecken allesamt knietief im Dreck», hörte er den ungläubigen Thomas murmeln, der sich ebenfalls mit großer Verbissenheit an dem Safe zu schaffen machte. «Hoffentlich ist da drin genug Schmuck, um uns allen einen sehr langen Urlaub an einem sehr einsamen Ort zu ermöglichen.»
Kapitel 1
Bahnhof Grunewald
November 1928
Seine Verabredung ließ auf sich warten. Das verschaffte ihm die Zeit, sich zu fragen, ob er im Begriff war, einen schwerwiegenden Fehler zu begehen. Dieses Treffen barg ein nicht unerhebliches Risiko, und noch blieb ihm die Möglichkeit, einfach davonzulaufen und Berlin für immer den Rücken zu kehren. Doch bei genauer Betrachtung seiner Situation existierte dieser Ausweg für ihn nicht mehr. Denn er wusste nur zu gut, wie wenig er noch zu verlieren hatte. So behielt er die Straße im Auge und wartete.
Der Abend war bereits vorangeschritten, und es wurde rasch kühler. Niemand hielt sich in der Nähe des mittelalterlich wirkenden Burgtors am S-Bahnhof länger auf als unbedingt nötig. Mit gesenkten Köpfen und hochgezogenen Schultern eilten die Menschen an ihm vorbei, um rasch in den eigenen vier Wänden anzukommen, wo sie vor der Kälte des Winterabends in Sicherheit waren. Er aber harrte weiterhin aus. Als endlich die angekündigte Taxe, ein alter Rechtslenker mit abgefahrenen Reifen, neben ihm am Bordstein hielt, spürte er seine Finger- und Zehenspitzen bereits nicht mehr.
Ohne auf eine Aufforderung zu warten, riss er die hintere Tür auf und sprang hinein. Kaum saß er auf der Rückbank, gab der Fahrer auch schon wieder Gas und brauste los, ohne dass ihm ein Ziel genannt worden war. Offensichtlich wusste er sehr genau, wohin die Fahrt gehen sollte. Dicht neben ihm lehnte ein Mann mit hochgestelltem Mantelkragen und tief ins Gesicht gezogenem Hut in den Polstern, der nun ohne Umschweife zur Sache kam.
«Wir haben nicht erwartet, noch einmal von Ihnen zu hören. Eine Botschaft aus Kreide an eine Wand zu schmieren, ist zudem ein recht ungewöhnlicher Weg der Kontaktaufnahme.»
«Ich wusste mir nicht anders zu helfen.» Er spürte, wie seine Stimme sich vor Nervosität überschlagen wollte, und zwang sich zur Ruhe. «Mir ist das Geld ausgegangen, und zwar wesentlich früher als erwartet. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll und an wen ich mich außer Ihnen wenden kann.»
«Das klingt nicht so, als wäre es unser Problem. Zumal man Ihnen die Lösung bereits bei Vertragsabschluss in die Hand gegeben hat, oder etwa nicht?»
«Schon.» Er begann, sich auf seinem Sitz zu winden. «Aber ich konnte nicht ahnen, dass am Ende des Geldes noch so viel Leben übrig sein würde, verstehen Sie?»
Der Fremde mit dem Hut ging nicht auf seinen Einwand ein. Stattdessen fragte er: «Haben Sie alle Anweisungen aus dem Brief genau befolgt?»
«Alle», lautete seine schnelle Antwort. «Und hinterher habe ich das Schreiben wie gewünscht verbrannt. Ich habe jetzt kein Zuhause, keine Freunde, nicht einmal einen Namen. Rein äußerlich betrachtet, sehe ich mir selbst auch nicht mehr ähnlich. Der Bart ist ab. Und schauen Sie mal.» Er riss sich mit einer hastigen Bewegung die Mütze vom Kopf. «Die Haare sind auch weg. Mein ganzer Stolz. In meinem Alter sind so volle Haare nicht selbstverständlich. Früher war ich, glaube ich, recht eitel. Es wäre mir nie eingefallen, mich auf diese Weise selbst zu verunstalten. Aber die Zeiten haben sich geändert.»
«Das haben sie allerdings.» Ein Feuerzeug glomm auf, und gleich darauf wurde die rote Glut einer Zigarre unter der Hutkrempe sichtbar. «Wenn also alles zu unser aller Zufriedenheit geregelt ist, was wollen Sie noch von uns? Sie wissen, was von Ihnen erwartet wird. Brauchen Sie etwa zusätzliche Hilfestellung? Das ließe sich natürlich arrangieren.» Die Hand des Fremden fuhr ganz langsam in die leicht ausgebeulte Manteltasche.
«Nein!» Ein Anflug von Panik erfasste ihn. Dies war genau das Szenario, das er befürchtet hatte. «Nein danke, ich komme allein zurecht. Nur halte ich den Moment noch für verfrüht. Ich fühle mich erstaunlich wohl, erfreue mich bester Gesundheit und habe das Gefühl, dass noch viele gute Tage vor mir liegen könnten.»
«Es stand Ihnen frei, sich Zeit und Geld nach Belieben einzuteilen.» Die Glut leuchtete auf, und eine Rauchwolke verteilte ihren schweren Duft in der Kabine des Wagens. «Sie werden doch wohl nicht uns die Schuld an Ihrer Fehlkalkulation geben wollen.»
Je länger dieses Gespräch dauerte, desto mehr sank sein Mut. Es schien hoffnungslos. Wie hatte er nur glauben können, an dieser Stelle noch etwas zu bewirken? Hier war er als Bittsteller an die falsche Adresse geraten. Sie waren Geschäftspartner, die einander nicht einmal kennen wollten, und mehr nicht.
«Nur ein paar Mark», startete er einen Versuch. «Um wenigstens einen letzten vergnüglichen Abend zu finanzieren. Um das Leben noch einmal zu feiern.»
«Mein Freund, ich fürchte, die Feier ist für Sie bereits vorbei. Sie haben es nur einfach noch nicht bemerkt.»
Angesichts dieser ernüchternden Worte stieß er einen Seufzer aus und blickte dabei zufällig aus dem Beifahrerfenster. Draußen war es merklich dunkler als noch Minuten zuvor, was auf das Fehlen von Straßenlaternen zurückzuführen war. Das Taxi brauste mit hoher Geschwindigkeit über eine von kahlen Bäumen umstellte Straße, und noch immer wusste er nicht, wohin man ihn bringen wollte.
Ein mulmiges Gefühl überkam ihn. «Wohin fahren wir eigentlich?»
Erneut erhielt er keine Antwort und erntete stattdessen eine Gegenfrage. «Das Geschenk, das Sie von uns erhalten haben, tragen Sie es gerade bei sich?»
«Natürlich. Es befindet sich gut verwahrt in der Innentasche meines Mantels.» Er klopfte sich demonstrativ aufs Revers, als ihm ein schrecklicher Verdacht kam. «Aber ich werde es bestimmt nicht brauchen. Heute ist nicht der richtige Abend dafür.»
«Ich denke doch.» Der Fremde zog nun hastiger an seiner Zigarre, während seine Hand ein blitzendes Messer aus der verdächtig aussehenden Manteltasche zog und es demonstrativ in die Höhe hielt. «Es gibt kaum eine passendere Gelegenheit als diese. Das ist zumindest unsere Meinung.»
Schlagartig breitete sich die Angst in ihm aus, trieb seinen Puls in die Höhe und ließ die Handflächen schweißnass werden. Unwillkürlich wanderte sein Blick wieder zum Seitenfenster, wo die Stämme der kahlen Bäume vorbeihuschten und das halsbrecherische Tempo verrieten, mit dem der Wagen mittlerweile über die Straße brauste. In diesem Moment trat der Chauffeur unvermittelt auf die Bremse. Den physikalischen Gesetzen hilflos ausgeliefert, wurden seine Fahrgäste fast aus den Sitzen katapultiert und hatten Mühe, Halt zu finden. Einen Augenblick später hielten sie am Straßenrand an.
«Wo sind wir hier?» Er kniff die Augen zusammen, um etwas in der Dunkelheit erkennen zu können. Da bemerkte er im fahlen Licht des Mondes die Umrisse eines steinernen Tores, dessen offen stehende Flügeltüren ihren Schatten über Hügel aus feinem Sand und aufgeschichtete Steine warfen. Die Mauer zu beiden Seiten des Durchgangs war noch nicht fertiggestellt worden. Er befand sich allem Anschein nach auf einer Baustelle mitten im Wald. Eine dumpfe Ahnung überfiel ihn, wo sich diese unfertige Grundstückseinfassung samt dem dazugehörigen Tor befinden musste, und erneut ergriff das Entsetzen von ihm Besitz.
«Nein», entfuhr es ihm. «Nicht hier. Nicht an einem Ort wie diesem.»
«Gerade hier. Es gibt in ganz Berlin wohl kaum einen passenderen Platz. Es lässt für den Rest der Welt später alles ganz schlüssig erscheinen.» Die Klinge in der Hand des Fremden richtete sich nun direkt gegen ihn. «Falls Sie mein Angebot der Hilfestellung doch noch annehmen wollen, steigen wir beide jetzt besser aus. Blut hinterlässt so hässliche Flecken auf Autositzen. Und bevor Sie auf die Idee kommen, sich zu wehren, führen Sie sich doch bitte einmal kurz Ihre Situation vor Augen. In allen Details.»
«Ich will nicht!», entfuhr es ihm. «Es ist zu früh, aber das ist natürlich ganz allein mein Problem und nicht Ihres. Ich habe einen Fehler gemacht, das sehe ich jetzt ein!»
«Schade, dass Sie es so sehen. Nur ändert es nichts mehr. Holen Sie nun bitte das Geschenk aus der Innentasche Ihres Mantels und öffnen Sie die Verpackung», lautete der klare Befehl.
«Ich will nicht», widersprach er noch einmal, doch seine Hand tastete trotzdem bereits gehorsam nach der kleinen Dose, die er schon seit Wochen bei sich trug. Er zog sie mit zitternden Händen hervor und ließ den runden Deckel aufschnappen. Im einfallenden Licht des Wintermondes sah er eine einzelne, erschreckend kleine Kapsel darin liegen.
«Es ist ganz leicht.» Plötzlich hatte die Stimme des Fremden einen einschmeichelnden Klang angenommen. «Bedenken Sie nur, was Ihnen alles erspart bleibt.»
«Ich kann das nicht.» Ihm war bewusst, dass er wie ein quengelndes Kind klang. «Es wird wehtun.»
«Ganz ohne Schmerzen geht es nie. So ist das eben», fuhr der Fremde fort. «Sie aber haben die Wahl, wie lange die Schmerzen sich hinziehen sollen. Dies hier ist der kurze Weg. Und gehen müssen Sie Ihn ohnehin. Das wissen Sie doch.»
Tränen der Verzweiflung drückten hinter seinen Augen, als er zu der Hand, die das Messer hielt, hinüberschielte, während er die Kapsel aus der Dose nahm. Eine gespenstische Stille herrschte im Wagen, als er den ovalen Gegenstand an seine Lippen führte, den Mund öffnete und innehielt. Weder der Fremde noch der Chauffeur hinter dem Steuer des Taxis gaben in diesem Moment einen Laut von sich. Eine seltsame Spannung lag in der Luft, und für einen Augenblick wusste er nicht, was er als Nächstes tun sollte.
In diesem Moment des Zögerns fand der Mann mit der Zigarre seine Sprache wieder: «Nicht zerbeißen, bitte. Schlucken Sie es einfach hinunter. Ansonsten könnte eine natürliche Abwehrreaktion ausgelöst werden. Und Erbrochenes auf Autositzen ist fast genauso schlimm wie Blut.»
«Ich verstehe.» Die Kapsel vor Augen, saß er wie erstarrt da und lispelte: «Ich habe nichts, um sie hinunterzuspülen.» Und jetzt liefen ihm tatsächlich Tränen über die Wangen.
Kommentarlos wurde ihm eine Schnapsflasche gereicht. Doch er zögerte noch immer. Da packte ihn plötzlich die Hand des Hutträgers am Kinn, drückte seine Lippen auseinander, und schon hatte die Kapsel seine Lippen passiert. Hart und kalt lag sie auf seiner Zunge.
«Du schluckst das jetzt, verdammt noch mal, das kann doch nicht so schwer sein!», hörte er den Mann fauchen.
Gleich darauf wurde ihm auch noch die Schnapsflasche gegen die Zähne gedrückt, und ein Schwall brennender Flüssigkeit landete in seinem Mund und dann in der Speise- und Luftröhre.
Unter heftigem Husten und Würgen kam er wieder zu Atem und stellte zu seinem Entsetzen fest, dass sich die Kapsel mit ihrem tödlichen Inhalt nicht mehr in seinem Mund befand. Panisch tastete er seine Brust ab, suchte in seinem Schoß und auf der Sitzbank. Doch das teuflische Ding war nicht mehr zu finden. Er hatte den Tod heruntergeschluckt, ohne es recht zu bemerken.
«Mit etwas Glück dauert es nur Minuten», ließ sich der Fremde vernehmen, der nun wieder gelassen in den Polstern lehnte. «Im schlimmsten Fall eine halbe Stunde. Aber das wollen wir in Ihrem Interesse ja nicht hoffen.»
Er hörte gar nicht mehr richtig hin, denn schon breitete sich ein heißer Schmerz in seiner Magengegend aus. Sein ganzer Oberkörper krümmte sich reflexartig zusammen.
«Eine höhere Dosis beschleunigt den Prozess übrigens nicht, sie verstärkt nur die Schmerzen. Betteln Sie also nicht um mehr.» Die Stimme des Fremden klang nun völlig unbeteiligt. «Sagen Sie Bescheid, wenn Ihnen das Messer als Alternative doch verlockender erscheinen sollte. Ich helfe gern noch einmal aus.»
Ein Wimmern stahl sich über seine Lippen. Die Krämpfe nahmen an Intensität zu. Bald würde das Gift in seinem Körper die Sauerstoffaufnahme der Zellen vereiteln und er als Folge dessen innerlich ersticken. Er wünschte sich von Herzen, der Moment wäre bereits gekommen.
Da öffnete sich neben ihm mit einem Ruck die Wagentür, und jemand packte ihn fest an den Schultern und zog ihn aus dem Taxi.
«Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen», hörte er den Fremden im Innern des Wagens rufen. «Jetzt ist alles zufriedenstellend geregelt. Und sagen Sie selbst: Gibt es einen passenderen Ort für Ihr Ableben als den Selbstmörderfriedhof im Grunewald?»
Eine Antwort blieb er dem Mann mit dem Hut schuldig. Seine Zunge versagte ihm bereits den Dienst. Er wusste nicht, ob die Kälte, die ihm nun in die Glieder fuhr, die des Winters oder die des Todes war.
Deutlich hörte er die letzten Worte des Fremden: «Tja, wie ich bereits sagte: Für Sie ist die Feier nun vorbei.» Dann wurde die Wagentür zugeschlagen, und einen Augenblick später sprang der Motor an und die Taxe brauste davon. Nach Atem ringend, blieb er am Boden liegen und betete um Erlösung, die nicht lange auf sich warten ließ.
Kreuzberg, Fledermaus-Club
Zwei Wochen später
«Beeil dich ein bisschen, die Feier geht los», rief Levi Kurz ihr zu und warf seinen Mantel auf den Tresen der Garderobiere.
Billa hätte nur zu gern ebenso viel Elan an den Tag gelegt, doch hinter ihr lag ein langer und harter Arbeitstag. Seit Billa Morgenthal, Vorzeigepolizistin der Abteilung K der Berliner Polizei, ihr glückliches Händchen für schwierige Mordfälle bewiesen hatte, liefen die Dinge im Präsidium recht gut für sie. Ernst Gennat selbst, der Chef der Mordkommission, traute ihr eine Menge zu. Das brachte ihr neben der langersehnten Anerkennung aber auch immer mehr Arbeit ein, und gerade heute, an dem Abend, da sie endlich wieder einmal ausging, fühlte sie sich ziemlich erschöpft.
Doch Levi Kurz zuliebe, einem sowohl anstrengenden als auch nützlichen Journalisten und Freund, riss sie sich zusammen und heuchelte ein wenig Begeisterung, während sie die Knöpfe ihres Mantels öffnete.
Diese Verabredung stand schon lange fest, und Billa hatte sich nach getaner Arbeit extra dafür in einem der Waschräume des Präsidiums umgezogen. Jetzt trug sie eines ihrer wenigen Abendkleider und sogar hochhackige Sandaletten, weswegen ihr schon auf dem Weg hierher beinahe die Zehen abgefroren wären. Es war ihr ein Rätsel, warum Frauen sich unpraktische und viel zu dünne Kleidung antaten, nur um attraktiver zu sein. Und das auch noch für Männer, die ihrerseits in festem Schuhwerk zum Tanzlokal kamen.
Nachdem sie sich aus ihrem sehr langen, handgestrickten Schal gewunden und ihn zusammen mit dem Mantel der zierlichen Garderobenfrau überreicht hatte, erfuhr sie nun in ihrem waldgrünen Kostüm die tröstende Anerkennung, die ihren Aufwand rechtfertigte. Ihrem Begleiter entfuhr ein anerkennender Pfiff.
«Billa, in diesem Aufzug darfst du mir jederzeit Handschellen anlegen. Ich wusste gar nicht, was für eine hübsche Frau sich unter deinen hausbackenen Pullis und Röcken verbirgt. Das ist ein sehr raffiniert geschnittenes Kleid. Du hast Figur darin.»
«Vielen Dank», erwiderte Billa, unsicher, ob diese Worte überhaupt als Kompliment durchgingen. Und ehe sie sich bremsen konnte, ergänzte ihr loses Mundwerk: «Dein Kummerbund erfüllt ebenfalls seinen Zweck und macht einige Pfunde wett.»
Die Garderobenfrau hinter ihrem Tresen senkte den Blick, griff sich an die Stirn und sah betreten zu Boden. Levi aber brach in lautes Gelächter aus, strich sich unnötigerweise das mit viel Pomade an den Kopf geklebte Haar zurück und bot Billa seinen Arm, woraufhin sie sich dankbar bei ihm einhakte. Auf diese Weise konnte sie eventuelle Unsicherheiten auf dem glatten Parkettboden überspielen.
«Und wir dürfen hier einfach so eintreten und Spaß haben?», vergewisserte sie sich noch einmal bei Levi. «Die ‹Fledermaus› ist meines Wissens ein Club, in den man eingeführt werden muss.»
«Wir wurden eingeführt, wie oft soll ich dir das noch sagen», versicherte ihr Levi. «Leonard hat alles bestens arrangiert. Wir brauchen nicht einmal unsere Getränke zu bezahlen. Das geht alles auf seinen Deckel.»
Leonard Reiter war der zweite und vielleicht beste Freund in Billas Leben. Der selbst ernannte Hellseher besaß ein feines Gespür für seine Mitmenschen und leider auch ein großes Talent, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen.
Aktuell schien er mit seinem neuen Arbeitsplatz allerdings das große Los gezogen zu haben, denn soweit Billa unterrichtet war, verbrachte Leonard jeden Abend der Woche hier in der ‹Fledermaus› und unterhielt die Gäste, indem er ihnen die Zukunft vorhersagte. Unabhängig davon, wie gut er darin war, erhielt Leonard dafür vom Betreiber des Clubs ein festes Gehalt.
«Ich besorge uns etwas zu trinken», verkündete Levi, ließ Billa gefährlich nahe am Rande der Tanzfläche stehen und verschwand im Gewühl.
Schon verbeugte sich ein freundlich lächelnder Herr vor ihr, und Billa brachte es einfach nicht fertig, ihm einen Korb zu geben. Obwohl der Fremde nach wenigen Schritten sicher erkennen würde, dass ihm mit einer Abfuhr besser gedient gewesen wäre.
Mit verbissenem Gesichtsausdruck kämpfte sich Billa durch ihren persönlichen Albtraum: einen schnellen Foxtrott. Die Perlen ihrer doppelreihigen Kette klapperten bei jedem einzelnen Hopser und Pendelschritt, was die Hauptbestandteile dieser albernen Bewegungsart zu sein schienen. In den darauffolgenden Wiegeschritten verlor sie regelmäßig die Balance, was sich nicht allein auf die Glätte des Tanzbodens zurückführen ließ und ihrem Partner ordentlich zu schaffen machte. Doch er hielt sich und auch Billa tapfer in der Senkrechten, obwohl sein Lächeln zunehmend verkrampfter wirkte. Als die Kapelle verstummte, war nicht nur sie erleichtert, dass der Tanz vorbei war. Ihr Galan zog es vor, nach einem flüchtigen Kopfnicken das Weite zu suchen, und Billa beeilte sich, an den Rand des Geschehens zu flüchten, wo sie zu ihrer grenzenlosen Erleichterung auf Leonard traf.
Der hübsche Mann mit den markanten Wangenknochen und den ausdrucksstarken Brauen schloss sie spontan in die Arme. «Ich freue mich, dich endlich einmal wiederzusehen», rief er, und sie konnte ihm ansehen, dass diese Worte von Herzen kamen. «Seit der Affäre um Lina Stiehl haben wir einander nicht mehr gesehen, und das ist Monate her. Was hat sich bei dir seitdem getan?»
Leonard musste brüllen, um sich verständlich zu machen, denn inzwischen hatte die Kapelle wieder eingesetzt und spielte einen flotten Charleston, der die Tanzenden unter den hell strahlenden Kronleuchtern nahezu in Hysterie zu versetzen schien. Anstatt zu antworten, schnappte sich Billa Leonards Ärmel und zog ihn in Richtung einiger Tische, an deren Kanten sich die Erschöpften und Unbegabten klammerten. Als sie selbst auf einem der Stühle Platz genommen hatte und Leonard sich zu ihr setzte, wähnte sie sich, zumindest für eine Weile, vor weiteren Aufforderungen zum Tanz in Sicherheit.
«Levi sagte, du verbringst jeden Abend hier», brüllte Billa quer über den Tisch, um gegen das Trompetensolo anzukommen. «Wie hältst du das nur aus?»
«Oh, das ist leicht.» Er grinste. «Ich denke einfach an die Bezahlung und trinke mir die einsamen Herzen schön, die mich bis Mitternacht belagern und von mir wissen wollen, wann der Mann ihres Lebens sich denn endlich einmal blicken lässt.»
Nun musste auch Billa grinsen. «Ich wette, es gelingt dir, jede Einzelne von ihnen glücklich zu machen.»
«Nur mit Worten, mein schönes Kind. Aber ja, dafür habe ich eine natürliche Begabung. Warum sollte ich ihnen auch erzählen, dass nicht auf jeden von uns das große Liebesglück wartet? Schlechte Nachrichten verkaufen sich an einem Ort wie diesem leider überhaupt nicht gut. Und du wirst es kaum glauben, aber wenn sie mich strahlend und voller Hoffnung verlassen, dann ist ihre Wirkung auf die Männerwelt gleich eine ganz andere. Hier erfüllen sich meine Prophezeiungen wie von selbst, weil ich die Frauen glücklich mache und man es ihnen ansieht.»
Billa lächelte und beobachtete über Leonards Kopf hinweg, wie Levi sich mit einem Tablett voller Cocktailgläser einen Weg zu ihnen bahnte. Ein paar Takte später hatte er ihren Tisch erreicht und stellte schwungvoll gleich mehrere Getränke vor Billa ab.
«Wenn alles gratis ist, müssen wir auch alles probieren, oder was meint ihr?» Er schnappte sich zwei Yellow Bird Martini und stieß mit sich selbst an. «Prost, Levi. Heute wird eine wunderbare Nacht.»
«So ganz gratis ist es zwar nicht, aber ich bekomme die Drinks sehr viel günstiger, alldieweil ich meiner Arbeit nachgehe», meinte Leonard und schob Billa ein Glas zu. «Und gute Freunde darf ich auch schon mal einladen.»
«Was ist das?», wollte Billa wissen und betrachtete misstrauisch die braune Flüssigkeit, in der einige Eiswürfel glitzerten.
«Ein Negroni», erklärte Leonard bereitwillig. «Gin, Campari und Wermut zu gleichen Teilen. Er ist trinkbar, vertrau mir. Ich kenne den Mann hinter der Bar schon recht gut. Er ist ein netter Kerl und versteht sein Handwerk.»
«Aha.» Skeptisch schnüffelte sie an dem Cocktail und unterdrückte ein Hüsteln. «Den Alkohol mit ein wenig Saft oder Limonade zu strecken, ist ihm aber nicht eingefallen, oder?»
«Heute wird nicht gestreckt, heute wird gefeiert!», rief Levi, der ihre Worte gehört hatte, da die Kapelle sich endlich eine kleine Pause gönnte. «Freunde, dies wird unsere persönliche kleine Weihnachtsfeier, so jung kommen wir nie wieder zusammen!»
Leonard hob eine Braue und beäugte den Journalisten kritisch. «Gib es zu, du hast den ersten Cocktail noch an der Theke probiert.»
Levi reagierte nicht darauf. Er erhob sein Glas und intonierte einen Schlager, woraufhin der ganze Nebentisch begeistert einstimmte. «Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt …»
Billa biss sich auf die Lippen und warf Leonard einen vielsagenden Blick zu. Ihr schwante, wie dieser Abend verlaufen würde. Gut, dass sie mehr als einen potenziellen Gesprächspartner bei sich hatte. Auch wenn dieser streng genommen dafür bezahlt wurde, die anderen Gäste zu unterhalten, und gerade jetzt, da die Kapelle schwieg, sicher Besseres zu tun hatte, als hier bei ihr zu sitzen.
Prompt beugte Leonard sich vor und raunte ihr zu. «Ich muss mal gerade ein bisschen Glück unter die Menschen bringen. Lauf nicht weg. Wenn ich wiederkomme, erzählst du mir, wie viele spannende Fälle du seit unserer letzten Begegnung gelöst hast.»
«Wir finden heute Abend bestimmt noch schönere und passendere Themen», erwiderte sie und nippte an ihrem Cocktail. Er schmeckte scheußlich.
Eine halbe Stunde später war Leonard noch immer nicht zurückgekehrt, Levi dafür aber der Star am Nebentisch, wo mittlerweile der ‹schöne Sigismund› besungen wurde. Billa hatte den Negroni gegen irgendein grünes Getränk mit Minzgeschmack eingetauscht und beobachtete das Treiben auf der Tanzfläche.
Vor einigen Minuten war ihr aufgefallen, dass hier nicht wild und unkontrolliert herumgesprungen wurde, sondern dass es unter den Besuchern der ‹Fledermaus› ein System zu geben schien. Eine Art geheime Absprache, der zufolge die Plätze auf dem Parkett alles andere als willkürlich vergeben wurden. Einige Paare begannen jeden Tanz exakt am gleichen Fleck, unabhängig davon, wo der letzte für sie geendet hatte. So sah Billa immer wieder Herren im Frack und in Lackschuhen herumrennen, die ihre Partnerin hinter sich herzogen, um wieder zurück an den Startpunkt zu gelangen. Hier und da schien es sogar zu kleinen Streitigkeiten deswegen zu kommen, wenn jemand sich dreist an einen Platz gestellt hatte, der ihm nicht zustand. Gerade eben begann zu den ersten Klängen eines Tangos eine Diskussion auf der gegenüberliegenden Seite der Tanzfläche, die ein junger Herr mit früh ergrauten Haaren für sich entschied. Das andere Tanzpaar räumte murrend das Feld und begann den Tango nun zwei Meter weiter.
Die Tanzfläche hatte sich dieses Mal mit Einsetzen der Musik merklich geleert. Tango schien nicht jedermanns Sache zu sein. Billa selbst bewunderte die exakt gesetzten Schritte und die komplizierten Abläufe. Sie wusste, dass diese Form des Tangos nicht dem hierzulande noch immer verbotenen Original entsprach. Der enge Körperkontakt, das Reiben an der Innenseite eines Damenschenkels, das war nicht nur dem Papst, der das Tangoverbot erlassen hatte, sondern auch vielen sonst so zügellosen Tänzern zu körperlich. Hier in der ‹Fledermaus› tanzte man die bereinigte, europäische Fassung mit leichtem Menuett-Einschlag, Knicksen und Scherenschritten. Billa beherrschte nichts davon, bewunderte aber jene, die es konnten. Wie beispielsweise den Mann mit dem grauen Haar, der seinen Platz so energisch verteidigt hatte. Er war wirklich gut, und seine adrette Partnerin, die noch sehr jung wirkte, lag zufrieden in seinen Armen.
Billa hatte ihn und seine Dame dank der überschaubaren Zahl der anderen Tanzpaare genau im Blick, als das Unfassbare geschah. Direkt vor ihren Augen senkte sich einer der ausladenden Messingkronleuchter mit seinem schweren Glasbehang und der bedrohlich wirkenden, mittig sitzenden Metallspitze herab. In rasantem Tempo krachte er auf das eben noch so diszipliniert seine Schritte setzende Tanzpaar und begrub es unter sich. Begleitet von dem knirschenden Laut des berstenden Kristalls, das seine Splitter quer über den Boden schoss, verschwanden der Mann und die Frau aus ihrem Sichtfeld. Spitze Schreie und ungläubige Rufe erfüllten den Saal. Die Musik brach ab, und sogar Levi verstummte mitten im Lied. Allen war sofort bewusst, dass sich soeben eine Tragödie ereignet hatte.
Billa selbst saß einen Augenblick wie festgefroren auf ihrem Stuhl. Dann sprang sie auf, drängte sich durch die Umstehenden und starrte ungläubig auf das sich ihr bietende Bild der Zerstörung. Während man die junge Tänzerin in ihrem rosafarbenen, mit Perlen bestickten Kleid bereits unter einem der Leuchter-Arme hervorgezogen hatte, lag ihr Partner unbeweglich in einer sich ausbreitenden Blutlache. Billa hätte gerne etwas für ihn getan. Doch seine weit geöffneten Augen blinzelten bereits nicht mehr. Sein Mund stand offen, als ob er selbst nicht glauben konnte, was ihm gerade widerfahren war. Dieser Mann war so tot, wie man nur sein konnte, wenn die Messingspitze eines Leuchters einem die Brust durchbohrt hatte. Zu seinem Glück konnte man sagen, dass es wenigstens sehr schnell gegangen war.
Während seine Begleiterin ebenfalls begriff, was ihrem Partner geschehen war, und hysterisch zu schreien anfing, legte Billa den Kopf in den Nacken und sah zur Decke des Tanzsaals hinauf. Dort markierte ein erstaunlich kleines Loch, aus dem ein Rest Kabel hing, den ursprünglichen Platz des Kronleuchters. Von dem anderen Ende der stabilen Eisenkette, von der noch einige Glieder an dem völlig zerstörten Leuchtergerippe baumelten, war nichts zu entdecken. Billa kniff die Augen zusammen, und für einen Moment war es ihr, als ob sich dort oben in eben jenem Loch vom Durchmesser einer Sektflöte die Lichtverhältnisse geändert hätten. Etwas schien sich dort über ihr bewegt zu haben, oder es war sogar ein Lichtschalter betätigt worden.
Ein beunruhigendes Gefühl überkam die junge Polizistin. Rasch schob sie sich in umgekehrter Richtung durch die Menge der Umstehenden und packte Leonard, der gerade zum Ort des Geschehens eilen wollte, am Arm.
«Schnell, sag mir, wo es hier nach oben geht», rief sie und schüttelte ihn, um seine Aufmerksamkeit ganz auf sich zu lenken.
«Nach oben?» Die Verwirrung in seinem Blick hielt glücklicherweise nicht lange an. Auch er schaute einmal schnell zur Decke hinauf, dann ergriff er Billas Hand und zog sie mit sich in Richtung Ausgang. Während sie hinter ihm herstolperte, verfluchte sie ihre Tanzschuhe und rutschte mehr als sie lief über das glatte Parkett.
Kaum hatten sie die Tanzfläche überquert, da schloss sich ihnen auch schon ein erstaunlich nüchtern wirkender Levi an. Der Journalist in ihm witterte zweifellos eine Story und wollte nichts von dem, was nun vor sich ging, verpassen.
Im Foyer angekommen, schob Leonard einen dunkelroten Samtvorhang zur Seite, hinter dem sich eine Treppe verbarg, und zu dritt eilten sie die Stufen hinauf. Schon am ersten Treppenabsatz öffnete der Hellseher eine Tür und betätigte den Lichtschalter. Billa schob sich an ihm vorbei und erkannte, dass sie sich auf einer Art Zwischenboden direkt über dem Tanzsaal befanden.
Der Raum war niedrig, völlig verstaubt und diente den Betreibern des Clubs als Lager von Dekorationsmaterial. Maritimer Wandschmuck lehnte hier neben überdimensionalen Ostereiern aus Pappmaché. Darüber hinaus verliefen zu ihren Füßen, quer über den Boden, die Kabel und Aufhängungen für die Saalbeleuchtung.
Billa schob ein paar quer gespannte Girlanden beiseite und trat in die Mitte des Raumes, wobei sie sich suchend umblickte. Schnell entdeckte sie das einzige Loch im Boden, zu dem keine stabile Kette mehr führte. Jenes Loch, von dem sie wusste, dass darunter ein toter Tänzer lag. Suchend blickte sie sich um und versuchte, zwischen dem herumstehenden Trödel eine Bewegung oder einen verdächtigen Schatten auszumachen.
«Ist hier jemand?» Sie hatte keine Antwort erwartet und bekam auch keine. Vorsichtig ging sie voran, lauschte auf jedes Geräusch, registrierte aber nur die leisen Schritte ihrer beiden Begleiter.
Bald hatte sie das nutzlose Loch im Boden erreicht. Sie blieb mit gebührendem Abstand davor stehen und betrachtete einige zierliche Fußabdrücke im Staub sowie ein zurückgelassenes Werkzeug in Form einer großen Zange. Offensichtlich waren damit die Glieder der Kette, welche den Leuchter an seinem Platz gehalten hatte, aufgebogen worden.
«Ich muss meine Kollegen verständigen», murmelte Billa und sah zu ihren Freunden hinüber. Levi und Leonard waren ebenfalls stehen geblieben und hatten genau wie sie erkannt, dass hier die Spuren eines Verbrechens zu sehen waren. Die Männer wagten kaum noch, sich zu rühren. Zu groß war ihre Sorge, Spuren zu vernichten oder schlimmer noch: selbst welche zu hinterlassen.
«Julius Haak muss herkommen», rief Billa und wandte sich zum Gehen. «Oder am besten gleich Ernst Gennat persönlich. Das hier war nie und nimmer ein Unfall.»
«Ich hol schnell meine Kamera aus der Garderobe», rief Levi, hechtete noch vor Billa durch die geöffnete Tür, und einen Augenblick später hörte man seine schweren Schritte die Treppe hinunterpoltern. Der Sensationsreporter in ihm war erwacht und ließ dem Alkohol in seinem Blut keine Chance.
Leonard indes blieb an ihrer Seite, als sie nun ebenfalls den Zwischenboden verlassen wollte. Dabei glitt sein Blick fortwährend suchend durch den Raum, als erwarte er, jemanden zwischen den Kulissen, Kartons und Schachteln zu entdecken.
«Du glaubst also wirklich, es war Vorsatz?», vergewisserte er sich. «Aber wer sollte so etwas planen? Wer würde auf eine solch absurde Weise vorgehen und einen Mord begehen, während sein Opfer in der Öffentlichkeit steht und gerade einen Tango tanzt?»
«Jemand, der einen gewissen Sinn für Theatralik hat», erwiderte Billa und deutete auf die Spuren im Staub. «Das sind keinesfalls die Abdrücke von Herrenschuhen, da stimmst du mir zu, oder? Unser Täter ist allem Anschein nach eine Frau, und sie hat sich einen dramatischen Abgang für ihr Opfer gewünscht. Nun, möglicherweise soll es auch nur so auf uns wirken, um das wahre Motiv zu verschleiern. Ich bin gespannt, was Julius dazu sagt, sobald er hier eintrifft. Hoffentlich ist er noch im Präsidium.»
Kapitel 2
Prenzlauer Berg
Julius Haak stand in diesem Moment im Schlafzimmer einer Wohnung im Bötzowviertel und wünschte sich von Herzen zurück an seinen Schreibtisch. Ein Stück entfernt, draußen im Hausflur, konnte er den Besitzer der Immobilie lautstark zetern hören.
«Ich kann diese Art von Ereignissen gar nicht leiden», rief Lovis Reek gerade. «Ich ziehe es vor, wenn finanzielle Angelegenheiten reibungslos vonstattengehen und die Mieter meiner Wohnungen ihre Mieten pünktlich und unaufgefordert zahlen. Lebendig sind sie mir zudem deutlich lieber als tot.»
Julius warf noch einen Blick auf das, was dort auf dem Bett lag, und war davon überzeugt, dass dieser Mann nie wieder pünktlich und reibungslos seine Miete zahlen würde. Wie schon beim Betreten des Raumes unterdrückte er ein Würgen, öffnete rasch noch eines der Fenster und überließ das Feld den eilig herbeigerufenen Kollegen, die alle Spuren sichern sollten.
Er selbst flüchtete sich vor dem Fäulnisgeruch zurück auf den Treppenabsatz, wo ein weiterer Kollege schon seinen Klapptisch aufgebaut hatte, bereit, die Aussagen jener aufzunehmen, die das Pech hatten, den Toten zu entdecken. Es handelte sich um den noch immer nörgelnden Hausbesitzer Lovis Reek und seinen wesentlich betroffener wirkenden Hauswart, Moritz Schönrogge. Zusammen hatten sie dem säumigen Mieter von Nummer 4 im ersten Stock an diesem Abend noch einen Besuch abstatten wollen, um ihn an seine Schulden zu erinnern. Ganz höflich, wie sie den Polizisten unaufgefordert versichert hatten.
Lovis Reek war ein stattlicher Mann in maßgeschneiderter Kleidung mit Hut, Gehstock und mit Lammfell gefütterten Handschuhen. Er gehörte, laut eigener Aussage, zu den Glücklichen, die es allein durch Geburt zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht hatten. Sein Vater hatte ihm gleich mehrere Mietshäuser wie dieses im Bötzowviertel hinterlassen. Hübsche Gebäude mit Erkern, Türmchen und überdachten Balkonen zur Straße hin, erbaut für den Mittelstand. Die daraus resultierenden Mieteinnahmen sicherten Lovis Reek ein nahezu sorgenfreies Leben.
All das hatte Haak von ihm schon erfahren, während sie die Stufen zu Nummer 4 hinaufgestiegen waren. Reek lag viel daran, als das erkannt zu werden, was er war: ein Mann von Welt, der es nicht nötig hatte, seine Mieter um die Ecke zu bringen. Und tot war der Herr aus Nummer 4 schon eine ganze Weile, wie Julius Haak hatte feststellen dürfen, als er einen Blick auf die Leiche warf.
«Der Mann, der diese Wohnung gemietet hatte, nannte sich Emil Müller, ist das richtig?» Haaks Blick war auf Reek gerichtet, doch die Antwort erhielt er vom übereifrigen Hauswart.
«Jawohl. Emil Müller. Und er hat die ersten zwei Monate im Voraus bezahlt. Dann aber floss kein Geld mehr, deshalb wollten wir heute einmal persönlich mit dem Mann sprechen.» Schönrogge schielte zu seinem Arbeitgeber hinüber.
Dieser ließ nur zögerlich sein vor Nase und Mund gepresstes Taschentuch sinken und ergänzte: «Ich tue so etwas ungern, aber oft helfen nur ein paar deutliche Worte, damit das mir zustehende Geld den Weg in meine Taschen findet.»
«Kommt so etwas häufig vor? Dass Sie bei Ihren Mietern persönlich vorstellig werden müssen, um die Miete einzutreiben?» Haak versuchte, Reek seine Antipathie nicht allzu deutlich spüren zu lassen, fürchtete aber, dass ihm dies nicht so recht gelang. Der Hauseigentümer wirkte wie die Art Mensch, die ohne mit der Wimper zu zucken den Wochenlohn eines Polizisten auf die nächste Rennbahn trug und sich gleichzeitig um die Sorgen und Nöte einfacher Leute keinen Deut scherte.
Reek, der nun dazu überging, sich mit seinen Handschuhen Luft zuzufächeln, schüttelte den Kopf. «Nein, in diesem Haus ist es bisher noch nie zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Hier wohnen Leute, die sich einen gewissen Lebensstandard leisten können. In meiner anderen Immobilie im Wedding ist es zuweilen komplizierter. Umso verwunderlicher war es für mich, dass uns niemand öffnen wollte, als wir an die Tür von Herrn Müller klopften.»
Sein Hauswart Schönrogge, ein Mann mit dem Charme einer Bulldogge, ergänzte: «Wir mussten schwere Geschütze auffahren, um überhaupt hineinzugelangen.» Jetzt erst bemerkte Haak den Hammer, der aus der Tasche des Hausmeisterkittels ragte. «Mit einem Schlüssel ließ sich die Tür nicht mehr öffnen. Sie war von innen vernagelt worden.»
«Und das hat Sie nicht stutzig werden lassen?» Haak hob fragend eine Augenbraue.
«Doch, aber ich kenne alle Schliche säumiger Mieter.» Schönrogge verschränkte die Arme vor der Brust. «Die veranstalten oft einen ziemlichen Heckmeck, um sich vor den Zahlungen zu drücken.»
«Dieser ganz besonders», stellte Haak fest. «Er ist lieber gestorben, als zu bezahlen.»
Schönrogge sah betreten drein und schwieg, ebenso sein Dienstherr. Beide schienen der Meinung zu sein, damit genug zu den Ermittlungen beigetragen zu haben, und warfen sehnsüchtige Blicke in Richtung Haustür. Doch Haak war noch nicht bereit, die beiden gehen zu lassen.
«Ist Ihnen der Geruch denn zuvor gar nicht aufgefallen?»
«Der wurde ja erst so richtig schlimm, nachdem ich ein Loch ins Türblatt gehauen hatte», erklärte Schönrogge. «Vorher roch es mehr wie in der Speisekammer meiner Oma. Als ob etwas zu lange gelagert wurde und zu gammeln anfängt.»
«Sehen Sie, die Rohre im Haus sind nicht mehr ganz neu und müssten mal ausgetauscht werden», rechtfertigte sich nun auch Reek. «Ich dachte, der Geruch hätte darin seine Ursache.»
Julius Haak tastete in seiner Manteltasche nach einer Zigarette. Nicht, weil ihm der Sinn nach dem Genuss von Nikotin stand, sondern weil er hoffte, den in der Luft hängenden Verwesungsgestank mit Rauch überlagern zu können.
«Wir hatten zuvor auf allen Wegen versucht, Herrn Emil Müller zu kontaktieren», versicherte Reek nun und presste sich erneut sein Taschentuch vor Mund und Nase, um ebenfalls der penetranten Duftnote zu entfliehen. «Herr Schönrogge hat mehrmals täglich angeklopft und nach Herrn Müller gerufen. Ich habe ihm mahnende, aber höfliche Briefe geschrieben, alles ohne Erfolg.»
Der Hausmeister nickte zur Bestätigung. «Ich hatte sogar schon den Verdacht, der Kerl könnte einfach abgehauen sein.»
Reek nickte eifrig. «Daher waren wir quasi gezwungen, einmal nachzusehen und in Erfahrung zu bringen, in welchem Zustand er mein Hab und Gut hinterlassen hat.»