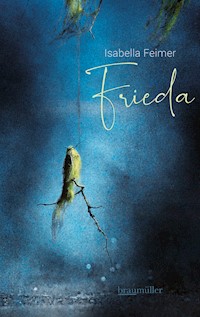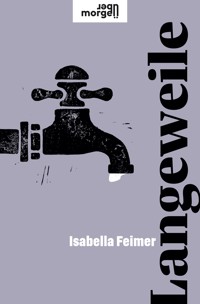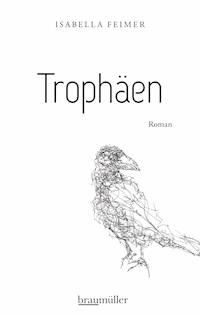19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Blätter, die an Ella haften bleiben, sie festhalten, ihr Atem auf ihrer Haut. Der nahe Dschungel wird bedrohlicher, je länger sich Ella in dem kleinen kolumbianischen Dorf aufhält. Die Flucht vor ihrer Vergangenheit hat sie hierhergebracht. Doch jene Zeit lässt sich nicht vergessen. Nicht ihre Kindheit in Wien ohne Vater und mit einer psychisch kranken Mutter, nicht die Jugend bei ihrer Tante und dessen Mann in Paris, der ihre emotionale Abhängigkeit ausgenutzt hatte. Das undurchdringliche Dickicht, das sie umgibt, ruft diese Erinnerungen hervor. Und während die politischen Unruhen im Land zunehmen, scheint es Ella, als würde sie langsam mit dem Dschungel verwachsen. In dessen Überwucherung durchlebt Ella ein Bewegen in einer Gesellschaft, die nur noch wenig hat, an dem man sich festhalten kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Wir könnten Dschungel sein
Mein Dank geht an
Impressum
Wir könnten Dschungel sein
für Anita, meine Wortbegleiterin
„Von der Welt,
so könnte man behaupten,
gibt es nichts als ein Phantasma.“
Christine Buci-Glucksmann
„Das Leben ist nichts anderes
als eine kontinuierliche Abfolge
von Überlebensmöglichkeiten.“
Gabriel García Márquez
Blätter, die an mir haften bleiben, mich festhalten, mich weiterziehen, ihre Adern auf meiner Haut, und la selva spricht mit mir, indem sie mich berührt, spricht von Sternen und Knochenstaub,
von Flügeln, von Raum und Zeit verschlungen.
Wartend auf das erste Licht lehne ich in den Arkaden, ein Farnblatt streift meine Wange, unweit des Fensterbogens sitzt eine Seidenspinne in ihrem Netz, Netz und Farn tragen den nächtlichen Regen in sich, den zerrissenen Himmel und die sichtbaren Sterne. Dem Dschungel lausche ich, noch flüstert er, ist im Erwachen aus den Geräuschen der dunklen Stunden in die des Tages, ein Übergang, der für Augenblicke Stille heißt.
Während ich Zigarettenrauch über das Schwarz des Dschungels schicke und mein Tuch enger um mich wickle, höre ich Gesang aus dem Haus, das an dieses Grundstück schließt. Jeden Abend zwischen zehn und Mitternacht spielt Musik aus einem Radio, Cumbia-Klänge, deren Lautstärke der Wind bestimmt, jeden Morgen singt eine mir unbekannte Frau Lieder, die sie am Abend zuvor vernommen hat. Klar, als stünde sie neben mir, höre ich ihre Stimme, mache einzelne Wörter aus, corazón, amor, el lloro, die Klage, die Herz und Liebe überschattet. Singt die Frau ihre Lieder, klingen sie traurig, der freudige Rhythmus fehlt, la alegría, und die Lust, selbst im Leid das Leben zu tanzen, komme, was da wolle. Das Vertraute der Melodie bleibt, das mir in Zeit vertraut Gewordene, es wärmt mich wie mein Tuch.
Langsam nur bekommt der Dschungel Kontur, und es ist, als würde er sich mit mir aus der Dunkelheit stemmen müssen, als hätte das Licht Angst vor la selva und dem, was die Nacht in ihr freigesetzt hat. Der Tag erst besänftigt sie, zäunt sie ein, sodass das Dorf erwachen kann, das Dorf Minca, das in das wuchernde Grün der Sierra Nevada de Santa Marta gebettet ist. Ein paar schmutzige Straßen gibt es, eine Kirche und einen Supermarkt. Kaffeeduft zieht von den Fincas weiter oben in den Bergen ins Tal hinab, murales entlang der Hauptstraße erzählen die Geschichte des Dschungels, in den Farbschatten die seiner Ahnen.
Noch ist die Kälte der Nacht anwesend, die erst dann aus den Gliedern weicht, wenn die Sonne über der Sierra steht, noch sind die säumenden Minuten des Übergangs, etwas, das in der Zeit angehalten hat und die Zeit selbst umschlossen hält. Geräusche aus dem Dorf und die aus dem Dschungel mehren und vermengen sich, treiben mich in Richtung Licht und lassen meinen Herzschlag schneller werden. Das Holz unter mir knarrt, ein Kolibri surrt an mir vorbei, fliegt zickzack zu einer Blüte, dann zu einem der Gefäße mit Zuckersirup, die an dem Balken über der Veranda hängen.
Der Gesang der mir unbekannten Frau ist verklungen, und erste Lichtstrahlen strecken sich über den Kamm der Sierra, ich will sie in mich ziehen, beuge mich in den Flug der Kolibris, vor, zurück, seitwärts, in den surrenden Stillstand mitunter. Es sind mehr Kolibris geworden, die um den Sirup schwirren und sich hektisch Nahrung holen, ums Überleben geht es, immer ums Überleben.
Jede verstreichende Minute intensiviert das Morgenlicht, den goldenen Glanz, der über den Wäldern schimmert, der in die Bäume und Sträucher dringt und dem Gefieder der Kolibris ein Schillern malt. Ich gehe zurück, setze mich an einen der Tische unterhalb der Fenster, noch ist es dunkel im Inneren des Gästehauses, und Toni verspätet sich. Er erzählte mir, dass das Licht von den Lamellen der Federn zurückgeworfen werde, durch Lichtbrechung komme die Wirkung des Farbspiels zustande, und durch die Perspektive.
Ich betrachte den mesmerisierenden Schwirrflug der flinken Vögel, suche mich an dem einen oder anderen zu fassen, dem Flug hin und weg vom Zuckersirup zu folgen, zu schnell sind sie, zu unberechenbar. Als ich zum ersten Mal einen Kolibri fliegen sah, war ich erstaunt darüber, wie laut sein Flügelschlag gewesen war und wie mechanisch er geklungen hatte, eine Frage der Geschwindigkeit, sagte Toni, und schau sie dir an, die zänkischen Blütenküsser, wenn sie auf der Stelle fliegen, ist es, als hielte man Zeit und Welt gemeinsam an.
Viele Male habe ich Toni auf seinen Erkundungen durch das umliegende Dickicht begleitet, im Morgengrauen sind wir los, er, ich, manchmal seine Tochter Anna, die sich wie ihr Papá der Vogelkunde verschrieben hat. Dass er seit frühester Kindheit, seit weit über fünfzig Jahren den Stimmen der Vögel folge, sagte er, und dass er glücklich über seine Anna sei, dass sie ihm nach, er unterbrach sich und schmunzelte, fliege. Er drückte Anna einen Augenblick, dann zeigte er zu einem der Bäume hoch, ¡mira!, Ella, un cuco.
Cuco in meiner Sprache, und in deiner?, fragte er, Kuckuck, sagte ich, wiederholte das Wort und gab ihm jenen melodischen Klang, den mir ein Lied aus der Kindheit auferlegt hatte, der Kuckuck, der aus dem Wald ruft, sich selbst den Frühling zu, und die Kinder müssen die Rufe hören und folgsam dazu springen. El cuco, sagte Toni, der die Nester anderer Vögel von allem, was Parasit und gefährlich ist, säubert, der dann, sagte ich, sein eigenes Ei in dieses Nest legt, Licht und Dunkelheit, luz y oscuridad, sagte Toni schulterzuckend, como todo en la vida.
In den stillen Schritten, die folgten, bedauerte ich, dass es in meiner Kindheit keine Lieder über Kolibris gegeben hatte. Schön wäre es gewesen, ihr aufmüpfiges Schnattern aus einem Dschungel zu hören, anstatt der dumpfen Vogelrufe aus den nördlichen Wäldern, keine Überbringer von Licht, sondern unglückverheißende Wesen aus einem Märchenbuch der Schatten.
Die Sonne, die über den Hügelkamm gestiegen ist, flutet den Dschungel und blendet mich, ich halte ihr Zigarettenrauch entgegen. Es waren viele Abende, die Toni und ich auf ebendieser Veranda, an ebendiesem Tisch geredet wie geschwiegen haben. Er nahm hin, dass die Umstände ihn dazu genötigt hatten, im Gästehaus zu arbeiten, dass er Besorgungen machen, manchmal kochen und zwischendurch den Garten betreuen müsse, früher, erzählte er, habe er Touristen in die Vogelwelt geführt, und gut habe er davon leben können, aber jetzt, alles zu gefährlich, alle haben Angst, und zu Recht haben sie die.
Ich spüre das sich verdichtende Licht und den Dschungel nach mir greifen und gehe zum Geländer. Das Holz ist feucht und klebrig, verschütteter Zuckersirup, er lockt die Ameisen an. Das Schwirren der Kolibris ist hungriger geworden, in für den Blick kaum nachvollziehbarer Geschwindigkeit stecken sie, einer nach dem anderen, ihre langen Zungen in die Öffnungen der Plastikgefäße, kommen sie einander dabei in die Quere, zanken sie im Flug.
In den Büschen hinter dem Avocadobaum raschelt es, nah der Stelle, an der wir die Schalen von Früchten sammeln. Für die Amazonenpapageien tun wir das, die in der Nähe brüten, vor allem aber für die Agutis, die mit dem ersten und dem letzten Licht des Tages durch den Garten ziehen. Man muss Glück haben und Geduld, will man einen der scheuen Nager sehen, kaum bewegt man sich in ihre Richtung, verschwinden sie im Grün.
Die Sonne kriecht in den Körper, und der Schwirrflug des Gegenwärtigen schüttelt das letzte bisschen Kälte ab. Die Nacht zittert sich aus mir heraus, mit ihr der Traum, der eine Gestalt, dunkler als die mich umgebende Dunkelheit, an meinen Bettrand stellte. Eine Taube gurrte, und ich hörte eine Spinne und wie sie mit ihren Beinchen zuerst auf ihr Netz, dann auf den Boden klopfte, spürte die Beschaffenheit eines Farnblatts auf meiner Haut und wie aus der Gestalt der Dschungel wuchs und dieses Wachsen sich mir näherte, sich mit mir verband und in mich drang. Sterne, Knochenstaub, Licht. Schreie, Schüsse. Blut, nein, nicht nur mein Blut klebte an meiner Kleidung, nicht nur mein Schmerz besetzte mein Herz, nicht nur meine Dunkelheit zitterte.
Bis zu einer Stunde kann es dauern, dass sich ein Kolibri aus der Nacht gezittert hat und wieder fliegen kann, im Schlaf senkt er Herzfrequenz und Körpertemperatur ab, reduziert den Stoffwechsel und sitzt die Stunden bis zum ersten Licht in Teilnahmslosigkeit ab, Torpidität heißt der Zustand dieser Starre. Toni sagte das, Toni, den ich vermisse, wenn er nicht an meiner Seite ist und der mich jeden Morgen fragt, ob ich mich wachgezittert habe, und ich bejahe, porque a veces yo soy un colibrí.
Sterne, Knochenstaub, Licht, das noch nicht aufgegeben hat, Licht zu sein, der Dschungel, la selva und ihre Blätter ledrig, und ich hetze der Dunkelheit hinterher, lege meinen Atem in sie, die Fähigkeit zu atmen, und Blätter wie Hände fassen meine Haut, verpacken sie, ihre Adern binden sich an meine, verbinden sich mit mir, verdichtet ist jedes noch so leise Geräusch, jeder Tropfen Feuchtigkeit, ich rieche ihn, schmecke ihn, höre das Schnattern eines Kolibris, den mechanischen Flügelschlag, auch die eigenen Flügel, die mich hierhergebracht haben, hierher in den Traum dieses Kontinents und in die Unendlichkeit der Dinge.
Are you there, Ella,
are you coming?
Flügel schlagen auseinander, eine Taube gurrt, ich höre eine Spinne und wie sie mit ihren Beinchen auf einen Faden ihres Netzes klopft, um Beute anzulocken, spüre die Beschaffenheit eines Farnblatts auf meiner Haut, etwas Raues, es drückt in mich, stößt tief, ein Schrei und ein Verlangen, und ich stöhne auf. Wind bewegt den dünnen Vorhangstoff, und mit der Brise dringt der Duft reifer Mangos in mein Zimmer, Ella, are you there?
Pat ruft nach mir, will Gesellschaft und mich an seine Seite. Jeden Tag fordert er ein paar Stunden meiner Zeit als Gegenleistung, dass ich in seinem Haus Unterkunft habe und dass er mir Geld gibt, damit ich mich in Santa Marta bewegen kann, hin und wieder mit dem Taxi in die Stadt hinein. Pats Haus liegt außerhalb des Zentrums in einem Viertel mit hohen Mauern, und auf den Mauern liegt Stacheldraht, und die Eingänge haben Alarmanlagen und Videoüberwachung sichert sie.
Ich drehe mich in Richtung der offenen Balkontür, sehe den Baum, seine Früchte und dahinter das Wellblechdach, auf dem eine Katze streunt. Ich richte mich auf, mir schwindelt von der drückenden Hitze. Ich sollte ihn nicht länger warten lassen, nicht im Traum verweilen, den ich vage erinnere.
Fern höre ich den Verkehr, der zu keiner Stunde Ruhe gibt, unkontrolliert zieht er durch die Straßen, an den Verkaufsständen vorbei, am dicht gedrängten Marktgeschrei rund um die Kathedrale, bilde mir ein, leise kann ich den Ozean hören, die Wellen und ihr Schäumen, das im Sand versickert, auch in meiner Haut.
Ich ziehe Kleid und Unterwäsche aus, greife nach dem Badeanzug, der auf der Stuhllehne liegt. Hineinschlüpfen will ich, doch kann es nicht, frage mich, wie viele Tage ich bereits in diesem Zimmer bin, wie lange in dieser Stadt und in einer Starre. Bei der Kathedrale war es, als ich Pat zum ersten Mal begegnet bin. Ich saß auf den Stufen vor dem Holztor, sah dem Treiben auf der Plaza zu, dem Getümmel zwischen Essensständen und bunten Luftballons, den Gesprächen, ihren Gesten, den Umarmungen des Wiedersehens und des Abschieds. Ob ich auf jemanden warte, fragte er, und ob ich Lust hätte, auf einen Drink zu gehen.
Pat sitzt am Beckenrand, das Handtuch auf seinen Schultern. Wie so oft stößt mich die räumliche Nähe zu ihm ab, die Rücksichtslosigkeit, die in jeder Pore seines Körpers sitzt, die Überheblichkeit seiner texanischen Herkunft, dass er Geld hat und dass er sich jederzeit alles und jeden damit kaufen kann, und dennoch. Ich setze mich zu ihm, so nah, dass wir einander gerade nicht berühren. I like watching when you swim, sagt Pat, I even like watching when you’re doing nothing at all, er lacht, creepy, right? Ich sage, I know worse, dann drücke ich mich vom Beckenrand ins Wasser.
Da ist dieser Moment Dunkelheit, nachdem man untergetaucht, noch nicht wieder ganz aufgetaucht und doch im Begriff ist, es zu tun, der Körper macht von selbst, die Lunge will sich Luft zum Atmen holen, und doch hält einen für Sekundenbruchteile dieser Moment zurück, gefangen. Was, wenn man nicht mehr an die Oberfläche käme? Was, wenn der Moment die Zeit anhalten könnte und der Körper im Wasser bliebe?
Die Dunkelheit legt sich als zweite Haut um die eigene, schnürt mich ein, ich unterdrücke das Bedürfnis, meinen Mund zu öffnen und Wasser in mich aufzunehmen, nur um mich aus dieser zweiten Haut zu befreien, Wasser als Ersatz für Luft, gleichzeitig unterdrücke ich die Aufwärtsbewegung, in die es mich drängt, ich öffne die Augen, sehe die blaue Farbe des Beckens, die hellblauen Fliesen unter dem Beckenrand, Pats Füße, darüber, verschwommen, ihn. Unter Wasser will ich bleiben, in strenger Umarmung, doch kann es nicht.
Ich hole Luft, streiche mir das Haar aus dem Gesicht, Pat drückt sich vom Beckenrand und lässt sich ins Wasser und zu mir gleiten. Nur Zentimeter zwischen uns, ich kann das Grobe seines Körpers spüren. You’re going to swim now?, fragt Pat, ich sage, and while I do, you keep an eye on me.
Nah waren wir uns, als wir in dieser Bar hinter la catedral saßen, Pat hatte mir Wein bestellt, er trank Tequila aus einem Whiskyglas, das er sich vom Barkeeper immer wieder auffüllen ließ, dass ich gestrandet sei, sagte ich, und weder bleiben könne noch weiterziehen.
Sanft schaukle ich in der Hängematte unter dem Wellblechdach, mit Stroh ist es ausgekleidet und schützt einen Teil des Beckens vor der Sonne. Im Blick habe ich das Haus und die weiß gestrichene Mauer rundum, Blumentöpfe und Lichterketten sind als Zierde an ihr angebracht, die Katze, die vorhin über das Dach gestreunt ist, schlängelt sich vorsichtig durch den Stacheldraht. Pat hat sich auf einen der Liegestühle ausgestreckt, sein Blick ist unter einer schwarzen Sonnenbrille auf mich gerichtet, er lächelt, fragt, ob ich für heute Pläne hätte.
Ich habe keine Pläne, habe ich nie, seitdem ich bei Pat eingezogen bin, bin Stunden in meinem Zimmer im ersten Stock, das an seines grenzt, höre dem Draußen zu, den Papageien, dem Wind und dem Motorenrauschen, auch dem Nebenan, wenn Pat am Telefon ist oder mit dem Mädchen schläft, das ihm kocht und die Zimmer und den Garten reinigt. Still, beinahe geisterhaft bewegt es sich durchs Haus, ist frühmorgens da, verschwindet abends wieder.
Dass ich in die Stadt möchte, sage ich, werde durch die engen Gassen, vorbei an den bemalten Fassaden in Richtung Sonnenuntergang ziehen, gezogen werden vom Ozean und den Wellen. Pat dreht sich weg, sein Desinteresse kränkt mich, und ich frage, before I leave, can I come closer?
Ich setze mich auf den Boden, lehne mich an den Liegestuhl, ziehe meine Beine an, Pat hat sich aufgerichtet. Ich sage, er solle seine Beine um mich schließen und seine Hände auf meine Schultern legen, fest, fester. Ich rieche seinen Schweiß und die Sonnencreme, die er aufgetragen hat, lasse den Kopf in den Nacken fallen, sage, fester. Seine Hände umfassen meinen Hals, drücken zu, und ich kann seine Erregung spüren, auch die meine, mein Atem beschleunigt und stockt zugleich, Pat sagt, I like how you do things, how you move, hell, I even like how you’retrying to avoid me. Kaum noch kann ich schlucken, kaum noch bekomme ich Luft, I like you too much to sleep with you, sagt Pat und lässt ab von mir.
Stimmen drängen mich in die Menge, die Menge drängt an mir und mich mit sich wie eine Welle, die einen unerwartet packt, verwächst sich wie ein Dickicht, hat man sich in der Dämmerung verirrt und weiß, der Nacht ausgeliefert zu sein. Tränengas nimmt mir den Atem, brennt in den Augen und auf der Haut, ich rieche es, schmecke es, huste, weil ich nicht möchte, dass es in meinen Organismus dringt. Ich halte inne, krümme mich, ein vermummter Mann greift meinen Arm und zieht mich weiter, Schreie, Schüsse, wir können nicht entkommen, und beide fallen wir auf die Knie. Meine Kraft hat mich verlassen, mein Ungeheuer, ich kann es nicht mehr spüren, nur seine Ohnmacht, verbrannte Federn, verbrannte Schuppen. Wieder Schüsse, wieder Schreie, wieder zerrt der vermummte Mann an meinem Arm, von einer Kugel getroffen sucht er sich an mich zu klammern, sein Blut an mir, ich rieche es, schmecke es. Ich sehe Militärs, die in die Menge stürmen, mit Schlagstöcken und Gewehrkolben verschaffen sie sich Platz, und schützend versuche ich mich klein und kompakt zu machen. Ich spüre einen Schlag in meiner Seite, sogleich einen nächsten, der mich hart an der Schulter trifft, verpuppen will ich mich, in einem Kokon verschwinden, will nicht schlüpfen, nicht in diese Welt, die mir alle Welten vor ihr spiegelt, solange, bis der Spiegel bricht. Ein Schrei in mir, dann ein Schlag, er trifft mich an der Schläfe, ich spüre den Schmerz als Stechen, kurz nur, kurz.
Dann ist Dunkelheit.
Die Aufrechterhaltung der Normalität, el estado de normalidad,wie Toni und ich es nennen, zwingt mich in meine täglichen Pflichten. Jedes der Zimmer des Gästehauses soll sauber und bezugsfertig sein, und in den Arkaden müsse ich den Boden schrubben und die Pflanzen versorgen, Alejandra zwingt mich in den Tag, spricht bedacht mit mir, will sichergehen, dass ich ihre Anweisungen verstehe, und sie hat sich hübsch gemacht. Dass nachmittags Gäste kommen, sagt sie, und dass das ein gutes Zeichen sei. Und Toni?, frage ich, und Alejandra sagt, sie habe ihn nach Santa Marta geschickt. Sorge packt mich und Wut, dort ist es seit Wochen nicht mehr sicher.
Die Sorge um Toni begleitet mich von Zimmer zu Zimmer, ich kehre die Böden, klopfe die kleinen Teppiche aus, beziehe jedes Bett mit frisch gewaschenen Laken, schüttle Polster und Decke auf, richte das Moskitonetz zu einem Dreieck, reinige Waschbecken und Dusche, die sich in einer Nische befinden, der Putzmittelgeruch kitzelt in der Nase. Ich wische den Staub von den Kommoden und den bunt bemalten Holzschmetterlingen, die sich über die Wand hinter dem Kopfende des Bettes verteilen, die Landschaftsbilder in ihren schlichten Rahmen rücke ich gerade. In jedem Bild finde ich den Fluss verharmlost eingebettet in das Dickicht, das unaufhörlich wächst.
In einem der Zimmer lebe ich, Alejandra und Toni außerhalb des Gästehauses, Alejandra an der Hauptstraße in einer Wohnung oberhalb eines Geschäfts, Toni am anderen Ende des Ortes in einem Haus, das an den Dschungel grenzt. Manchmal, wollen sie ihrer Einsamkeit entgegentreten, bleiben auch sie über Nacht.
Ich trage die abgezogene Bettwäsche zur Waschmaschine in die Küche, gehe wortlos an Alejandra vorbei, die im Haupthaus die Tische dekoriert. Sie hat den Zuckersirup in drei Krügen angesetzt. Ich sehe aus dem Fenster, die Plastikbehälter sind leer gesaugt, kein Schwirrflug mehr, sein Fehlen lässt den Dschungel näher rücken.
A veces yo soy un colibrí, flüstert es.
Meine Stimme, meine Erinnerung an etwas,
das noch nicht geschehen ist, ein Ort,
der mir fremd ist und der dennoch mein Inneres besetzt, ein Dschungel, der sich weitet,
der sich den Ort greifen und in mich greifen will
und immer schon dagewesen ist.
La selva flüstert, ihr Atem ist es, der mich atmen lässt.
A veces, yo soy.
Schatten liegt in den schmalen Gassen, die von der catedralde Santa Marta zum malecón führen, er kleidet die Fassaden ein und beschützt die Farben davor zu verblassen. Die Türen, die in die Häuser und in die Innenhöfe zeigen, sind verschlossen, vor den meisten Fenstern sind Gitter angebracht.
Wie eine zur Gänze aufgeblühte Pfingstrose liegt la catedral auf dem nach ihr benannten Platz. Das makellose Weiß wird mit jedem Lichtstrahl, den es in sich fängt, zu einem Ungetüm, das alles andere überragt und dem man entkommen möchte.
Ich biege nach rechts, dann nach links, gehe an den gemalten Geschichten der murales vorbei, ein Jaguar, ein Kolibri, der Dschungel, Ahnengeschichte hinter Farbe gebannt. Verlangen wächst in mir, kaum habe ich in meinen Schritten innegehalten, drängt es mich weiterzuziehen. Etwas drängt in mir, will aus mir wachsen, über mich hinaus, Federn, Schuppen, ich kenne dieses Etwas, dann die Klauen, habe nur lange nicht daran gedacht.
Dass ich bleiben könne, solange ich wolle, sagte Pat, es war der Morgen nach der ersten Nacht, die ich in seinem Haus verbracht hatte, Windstille unter dem Wellblechdach, das Papageiengeschrei, das Mädchen, das uns Kaffee, Toast und Eier brachte, ich sei nicht die Erste, die mit ihm gestrandet sei.
In jeder Bewegung drückt Hitze auf mich und will mir den Atem nehmen. Versäumnisse spüre ich in ihr, Hingabe, Aufgabe und Schmerz, der war. Die Stimmen derer, die an mir vorüberziehen, legen sich auf meine Haut, derer, die sich ein schattiges Plätzchen gesucht haben, sie setzen sich in mir fest, werden eins mit dem Fieber meiner Gedanken.
Ich hätte mit Pat schlafen sollen, hätte ihm die Beine spreizen oder meinen Arsch entgegenstrecken sollen, fester, hätte ich sagen sollen, I like it when it hurts