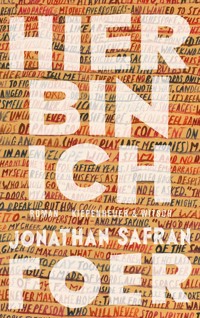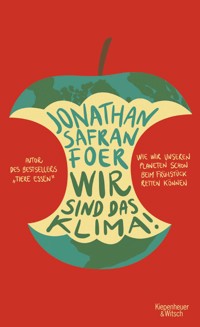
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Jonathan Safran Foer schafft es erneut, uns ein komplexes Thema wie die Klimakrise so nahe zu bringen wie niemand sonst. Und das Beste: Einen Lösungsansatz liefert er gleich mit. Mit seinem Bestseller »Tiere essen« hat Jonathan Safran Foer weltweit Furore gemacht: Viele seiner Leser wurden nach der Lektüre Vegetarier oder haben zumindest ihre Ernährung überdacht. Nun nimmt Foer sich des größten Themas unserer Zeit an: dem Klimawandel. Der Klimawandel ist zu abstrakt, deshalb lässt er uns kalt. Foer erinnert an die Kraft und Notwendigkeit gemeinsamen Handelns und führt dazu anschaulich viele gelungene Beispiele an, die uns als Ansporn dienen sollen. Wir können die Welt nicht retten, ohne einem der größten CO2- und Methangas-Produzenten zu Leibe zu rücken, der Massentierhaltung. Foer zeigt einen Lösungsansatz auf, der niemandem viel abverlangt, aber extrem wirkungsvoll ist: tierische Produkte nur einmal täglich zur Hauptmahlzeit. Foer nähert sich diesem wichtigen Thema eloquent, überzeugend, sehr persönlich und mit wachem Blick und großem Herz für die menschliche Unzulänglichkeit. Und das Beste: Seinen Lösungsansatz können Sie gleich in die Tat umsetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Jonathan Safran Foer
Wir sind das Klima!
Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jonathan Safran Foer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jonathan Safran Foer
Jonathan Safran Foer gehört zu den profiliertesten amerikanischen Autoren der Gegenwart. Seine Romane »Alles ist erleuchtet«, »Extrem laut und unglaublich nah« und »Hier bin ich« wurden mehrfach ausgezeichnet und in 36 Sprachen übersetzt. Sein Sachbuch »Tiere essen« war ebenfalls ein internationaler Bestseller. Foer lebt in Brooklyn, New York.
Stefanie Jacobs hat in Düsseldorf Literaturübersetzen für die Sprachen Englisch und Französisch studiert und Autoren wie Lauren Groff, Lisa Halliday, Grégoire Hervier, Anthony Marra und Edna O’Brien ins Deutsche gebracht. Sie lebt und arbeitet in Wuppertal.
Jan Schönherr lebt in München und hat Autoren wie Charles Bukowski, Roald Dahl und Francis Spufford übersetzt. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mit seinem Bestseller »Tiere essen« hat Jonathan Safran Foer weltweit Furore gemacht: Viele seiner Leser wurden nach der Lektüre Vegetarier oder haben zumindest ihre Ernährung überdacht. Nun nimmt Foer sich des größten Themas unserer Zeit an: dem Klimawandel. Der Klimawandel ist zu abstrakt, deshalb lässt er uns kalt. Foer erinnert an die Kraft und Notwendigkeit gemeinsamen Handelns und führt dazu anschauliche Beispiele an, die uns als Ansporn dienen sollen. Wir können die Welt nicht retten, ohne einem der größten CO2- und Methangas-Produzenten zu Leibe zu rücken, der Massentierhaltung. Foer zeigt einen Lösungsansatz auf, der niemandem viel abverlangt, aber extrem wirkungsvoll ist: tierische Produkte nur einmal täglich zur Hauptmahlzeit.
Foer nähert sich diesem wichtigen Thema auf überraschende, tief persönliche und dringende Weise. Und das Beste: Seinen Lösungsansatz können Sie gleich in die Tat umsetzen.
In »Wir sind das Klima!« erforscht Jonathan Safran Foer das zentrale globale Dilemma unserer Zeit – den Klimawandel – sehr persönlich, überzeugend und mit wachem Blick und großem Herz für die menschliche Unzulänglichkeit. Denn die Aufgabe, unseren Planeten zu retten, setzt eine grundlegende Abrechnung mit uns selbst voraus, mit unserer allzu menschlichen Abneigung, Komfort für die Zukunft zu opfern. Wir haben unseren Planeten in eine Farm für den Anbau tierischer Produkte verwandelt, und die Folgen sind katastrophal. Nur gemeinsames Handeln wird unser Zuhause und unsere Lebensweise retten. Und alles beginnt mit dem, was wir zum Frühstück und zu Mittag essen oder eben nicht essen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
I Unglaublich
Das Buch der Enden
Kein Opfer
Keine gute Story
Besser Wissen vs. Besser Machen
Gehen, Glauben, Leben
Hysterisch
Auswärtsspiele
Das Wort »Faust« schreiben
Sticks
Welle
Fühlen, um zu handeln, Handeln, um zu fühlen
Wo fangen Wellen an?
Augen auf
Uns allein
Handzeichen
II Das größte Sterben verhindern
Grade des Wandels
Die erste Krise
Die erste Landwirtschaft
Unser Planet ist ein Tierhaltungsbetrieb
Unser Bevölkerungswachstum ist radikal
Unsere landwirtschaftliche Tierhaltung ist radikal
Unsere Ernährung ist radikal
Unser Klimawandel ist radikal
Welche Rolle spielen Treibhausgase?
Klimawandel ist eine Zeitbombe
Weil der Klimawandel eine Zeitbombe ist, sind nicht alle Treibhausgase gleich wichtig
Welche Rolle spielt Entwaldung?
Nicht alle Entwaldung ist gleich wichtig
Nutztierhaltung verursacht Klimawandel
Nutztierhaltung ist ein/der Hauptverursacher des Klimawandels
Die Zeitbombe lässt sich nur entschärfen, indem wir weniger Tierprodukte konsumieren
Nicht alle Maßnahmen sind gleich gut
Nicht jedes Essen ist gleich schlecht
Das größte Sterben verhindern
III Unser einziges Zuhause
Blick in die Zukunft
Zuhause ist, was man nicht wahrnimmt
Blicke auf zu Hause
Blicke auf uns selbst
Die Hypothek
Ein zweites Zuhause
Glas
Erstes Zuhause
Letztes Zuhause
IV Gespräch mit der Seele
V Mehr Leben
Begrenzte Ressourcen
Die Flut und die Arche
Das ist die Frage
Nach uns
Brief für das Leben
Anhang
14,5 Prozent/51 Prozent
Bibliografie
Danksagung
Für Sasha und Cy,
Sadie und Theo,
Leo und Bea
IUnglaublich
Das Buch der Enden
Der älteste bekannte Abschiedsbrief[1] vor einem Selbstmord wurde vor etwa viertausend Jahren im alten Ägypten verfasst. Sein erster Übersetzer betitelte ihn mit »Das Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele«. Die erste Zeile[2] lautet: »Ich öffnete meinen Mund zu meiner Seele und beantwortete, was sie gesagt hatte.« Es folgt der zwischen Prosa, Dialog und Poesie oszillierende Versuch eines Menschen, seine Seele zum Selbstmord zu überreden.
Von diesem Brief erfuhr ich aus dem Buch der Enden, einer Sammlung von Fakten und Anekdoten, die außerdem die letzten Wünsche Virgils und Houdinis, Abgesänge auf den Dodo und den Eunuchen sowie Texte über Fossilien, den elektrischen Stuhl und das Veralten von Gebrauchsgegenständen enthielt. Obwohl ich kein sonderlich morbides Kind war, trug ich das Buch jahrelang mit mir herum.
Aus ihm erfuhr ich auch, dass ich mit jedem Atemzug Moleküle aus genau derselben Luft aufnehme, die Julius Cäsar bei seinem Tod ausgeatmet hat. Der Gedanke ließ mich erschaudern: eine magische Verdichtung von Raum und Zeit, eine Brücke zwischen etwas, das mir vorkam wie ein Mythos, und meinem aus Herbstlaub und vorsintflutlichen Videospielen bestehenden Leben in Washington, D. C.
Was daraus folgte, war unglaublich: Wenn ich soeben Cäsars letzten Atemzug (»Et tu, Brute?«) in mich aufgesogen hatte, dann doch wohl auch den von Beethoven (»Im Himmel werde ich hören«) und Darwin (»Ich habe nicht die geringste Angst vor dem Sterben[3]«). Und auch die letzten Atemzüge von Franklin Delano Roosevelt, Rosa Parks und Elvis, die der Pilger und der Wampanaoag beim ersten Thanksgiving, den des Autors des ersten Abschiedsbriefs, ja sogar den meines Großvaters, den ich nicht mehr kennengelernt hatte. Als Abkömmling von Überlebenden des Holocaust malte ich mir aus, wie Hitlers letzter Atem durch drei Meter Betondecke des Führerbunkers, zehn Meter deutschen Boden und die zertrampelten Rosenbeete der Reichskanzlei aufstieg, die Westfront durchbrach, den Atlantik überquerte und vierzig Jahre später durchs Fenster meines Kinderzimmers im ersten Stock strömte, um mich aufzupusten wie einen Ballon.
Und wenn ich die letzten Atemzüge dieser Menschen in mich aufnahm, dann doch sicherlich auch ihre ersten, und alle anderen dazwischen. Jeden Atemzug von jedem Menschen, der je auf dieser Welt gelebt hat. Und auch von jedem Tier: von der Klassenzimmer-Maus, die starb, als ich sie bei uns zu Hause hatte, von den Hühnern, die meine Großmutter in Polen gerupft hatte, den letzten Atemzug der allerletzten Wandertaube. Mit jedem Einatmen sog ich alles Leben und allen Tod auf Erden in mich auf. Der Gedanke ließ mich die Geschichte quasi aus der Vogelperspektive sehen: ein riesiges Netz, aus einem Strang geflochten. Als Neil Armstrongs Stiefel auf den Mond traten und er sagte: »Ein kleiner Schritt für den Menschen …«, setzte er durchs Polykarbonat seines Visiers in eine stumme Welt einige Moleküle frei, die Archimedes ausgeatmet hatte, als dieser »Heureka!« rufend nackt durch die Straßen des alten Syrakus gerannt war, nachdem er entdeckt hatte, dass sein Körper das Badewasser entsprechend seines eigenen Gewichts verdrängte. Seinen Stiefel ließ Armstrong[4] später übrigens auf dem Mond zurück, als Ausgleich für das Gewicht des Mondgesteins, das er mit zur Erde nahm. Als der Graupapagei Alex[5], der gelernt hatte, sich auf dem Niveau eines Fünfjährigen zu unterhalten, seine letzten Worte sprach – »Sei brav, bis morgen. Hab dich lieb« –, atmete er zugleich das Schnauben der Schlittenhunde aus, die Roald Amundsen über inzwischen geschmolzene Eispanzer gezogen hatten, und setzte die Schreie all der wilden Tiere frei, die im Kolosseum von Gladiatoren niedergemetzelt worden waren. Dass ich in alldem einen Platz hatte – meinem Platz in alldem gar nicht entkommen konnte –, fand ich am erstaunlichsten.
Cäsars Ende war zugleich ein Anfang: An ihm wurde eine der ersten Autopsien der Geschichte durchgeführt, weshalb wir von den dreiundzwanzig Dolchstößen wissen. Die Dolche gibt es heute nicht mehr. Caesars blutgetränkte Toga gibt es nicht mehr. Das Theater des Pompeius, wo er ermordet wurde, steht nicht mehr, von der alten Metropole sind nur Ruinen übrig. Das Römische Reich[6], das sich einst über fünf Millionen Quadratkilometer erstreckte, mehr als zwanzig Prozent der Weltbevölkerung umfasste und so ewig schien wie die Erde selbst, gibt es nicht mehr.
Es ist schwer, sich ein vergänglicheres Kulturprodukt zu denken als einen Atemzug. Doch es ist unmöglich, sich ein beständigeres zu denken.
Obwohl ich mich so gut daran erinnere, gab es nie ein Buch der Enden. Als ich danach suchte, stieß ich stattdessen auf Panati’s Extraordinary Endings of Practically Everything and Everybody, das herauskam, als ich zwölf war. Es enthält Houdini, die Fossilien und vieles andere, an das ich mich erinnerte, aber nicht Caesars letzten Atemzug und kein »Gespräch mit der Seele«. Davon musste ich also woanders erfahren haben. Diese Ungereimtheiten machten mir zu schaffen – nicht, weil sie an sich so wichtig waren, sondern weil meine Erinnerung daran so deutlich war.
Noch beunruhigter war ich, als ich bei der Recherche zu dem ersten Abschiedsbrief über dessen Titel nachdachte – darüber, dass er überhaupt einen trug. Dass wir uns falsch erinnern, ist ja schon irritierend, doch die Aussicht, dass unsere Nachkommen sich falsch an uns erinnern, ist zutiefst verstörend. Man weiß nicht einmal, ob der Autor des ersten Abschiedsbriefs sich tatsächlich das Leben nahm. »Ich öffnete meinen Mund zu meiner Seele«, schreibt er zu Beginn. Doch die Seele behält das letzte Wort, drängt den Menschen, er solle sich »ans Leben klammern«. Wir wissen nicht, was der Mann darauf erwidert hat. Gut möglich, dass das »Gespräch mit der Seele« mit einer Entscheidung für das Leben endete und der Autor seinen letzten Atemzug erst später tat. Dem Tod ins Auge zu blicken, war vielleicht das beste Argument fürs Überleben. Ein Selbstmordbrief ähnelt nichts mehr als seinem Gegenteil.
Kein Opfer
Im Zweiten Weltkrieg schalteten die Menschen an der Ostküste Amerikas bei Abenddämmerung das Licht aus. Unmittelbare Gefahr[7] drohte ihnen nicht; die Verdunklung sollte nur verhindern, dass deutsche U-Boote das Hintergrundleuchten der Städte nutzten, um auslaufende Schiffe zu entdecken und zu versenken.
Im weiteren Verlauf des Kriegs verdunkelte man Städte im gesamten Land, auch weit weg von der Küste, um die Zivilisten einen Krieg spüren zu lassen, dessen Schrecken sie nicht sahen, der sich jedoch nur gemeinsam gewinnen ließ. Man musste den Menschen an der Heimatfront vermitteln, dass ihr vertrautes Leben in Gefahr war – und Dunkelheit war eine Möglichkeit, die Gefahr sichtbar zu machen. Piloten der Civil Air Patrol wurden aufgefordert, am Himmel über dem Mittleren Westen nach Feindflugzeugen Ausschau zu halten, obwohl kein deutscher Jäger so weit hätte fliegen können. Solidarität war gefragt – egal wie sinnlos, ja selbstmörderisch all das gewesen wäre, wenn man sonst nichts getan hätte.
Ohne diese Aktionen an der Heimatfront, die sowohl psychologische als auch praktische Auswirkungen hatten, ohne ganz normale Menschen, die sich für die gute Sache einsetzten, hätte man den Zweiten Weltkrieg nicht gewonnen. Während des Kriegs stieg die Produktivität um sechsundneunzig Prozent. Liberty-Frachter, die zu Kriegsbeginn acht Monate Bauzeit erforderten, waren innerhalb von Wochen fertig. Der fast sechseinhalbtausend Tonnen schwere, aus einer Viertelmillion Teilen bestehende Liberty-Frachter SS Robert E. Peary[8] wurde in viereinhalb Tagen gebaut. 1942 produzierten Firmen, die bisher Autos, Kühlschränke, Büromöbel und Waschmaschinen hergestellt hatten, bereits Rüstungsgüter. Dessous-Fabriken[9] nähten Tarnnetze, Rechenmaschinen wurden als Pistolen wiedergeboren, Staubsaugerbeutel in Gasmasken eingesetzt. Studenten, Rentner und Frauen[10] packten mit an – viele Bundesstaaten änderten ihre Gesetze, damit auch Teenager arbeiten durften. Alltagsgüter wie Gummi, Blechdosen, Alufolie und Holz wurden zur Verwertung im Krieg gesammelt. Hollywood-Studios produzierten Wochenschauen, antifaschistische Kinostreifen und patriotische Trickfilme. Prominente warben[11] für den Kauf von Kriegsanleihen und manche – Julia Childs zum Beispiel – wurden Spione.
Der Kongress erhöhte die Steuereinnahmen durch Senkung des Freibetrages und Streichung diverser Schlupflöcher und Abzüge. 1940 hatten nur zehn Prozent der Arbeitnehmer Einkommenssteuer an den Bund bezahlt. 1944 waren es fast hundert Prozent. Der Spitzensteuersatz[12] wurde auf vierundneunzig Prozent angehoben, die dafür relevante Einkommensschwelle um das Fünfundzwanzigfache gesenkt.
Der Staat legte Preise für Nylon, Fahrräder, Schuhe, Feuerholz, Seide und Kohle fest – und die Amerikaner nahmen es hin. Benzin wurde streng[13] reguliert, und man verhängte eine landesweite Höchstgeschwindigkeit von fünfunddreißig Meilen pro Stunde, um Gummi und Treibstoff zu sparen. Vom Staat ausgehängte Plakate[14] bewarben Fahrgemeinschaften mit dem Slogan: »Wer ALLEIN fährt, fährt mit Hitler!«
Bauern erhöhten ihren Ertrag, obwohl sie weniger Arbeitskräfte und Gerät zur Verfügung hatten, und Normalbürger legten »Victory-Gärten« an, Mikrofarmen hinter dem Haus oder auf Brachflächen. Essen wurde rationiert[15], besonders Grundnahrungsmittel wie Zucker, Kaffee und Butter. 1942 rief der Staat mit einer »Teilt-das-Fleisch«-Kampagne dazu auf, den wöchentlichen Fleischkonsum auf knapp über ein Kilo pro Erwachsenem zu beschränken. In England aß man[16] nur etwa die Hälfte davon. (Dieser kollektiv enger geschnallte[17] Gürtel führte übrigens sogar zu einer leichten Verbesserung der Gesundheit.) Im Juli 1942 produzierte Disney einen kurzen Trickfilm für das Landwirtschaftsministerium, der unter dem Titel »Essen bringt den Sieg« die Landwirtschaft zu einer Frage der nationalen Sicherheit erhob. Amerika hatte doppelt so viele Bauern wie die Achsenmächte Soldaten. »Ihre Waffen sind die Panzer[18] der Essensfront, die Landmaschinen: Bataillone von Mähdreschern, Regimente von Traktoren, Divisionen von Maispflückern, Kartoffelgrabern und Sämaschinen, Kolonnen von Melkanlagen.«
Am Abend des 28. April 1942, fünf Monate nach Pearl Harbor, als die Amerikaner bereits voll in den Krieg in Europa eingestiegen waren, versammelten sich Millionen Amerikaner vor ihren Radios, um Präsident Roosevelts Kamingespräch zu lauschen, in dem er sie über den Kriegsverlauf informierte und von den kommenden Herausforderungen – auch für die Bürger selbst – sprach:
Es ist uns nicht allen vergönnt[19], unsere Feinde in entfernten Winkeln der Welt zu bekämpfen. Es ist uns nicht allen vergönnt, in einer Munitionsfabrik oder auf einer Werft zu arbeiten, auf den Farmen, den Ölfeldern oder in den Minen, und die Waffen und Rohstoffe herzustellen, die unsere Truppen brauchen. Doch es gibt eine Front, an der alle Amerikaner – jeder Mann, jede Frau und jedes Kind – mitkämpfen können, und zwar während des gesamten Krieges. Diese Front verläuft hier bei uns zu Hause, in unserem Alltag, unseren täglichen Verrichtungen. Hier zu Hause ist es uns allen vergönnt, uns zu versagen, was immer nötig ist – nicht nur um unsere Männer an der Front zu versorgen, sondern auch, damit unsere Wirtschaft während des Krieges und danach stark bleibt. Dazu müssen wir freilich nicht nur auf Luxus verzichten, sondern auch auf viele kleinere Annehmlichkeiten. Jeder loyale Amerikaner kennt seine Verantwortung … Wie ich gestern dem Kongress gesagt habe, ist »Opfer« nicht ganz das rechte Wort, um diese Selbstversagung zu beschreiben. Wenn wir am Ende dieses großen Kampfes unsere freiheitliche Art zu leben gerettet haben, wird all das kein »Opfer« gewesen sein.
Es ist eine extreme Belastung, dem Staat vierundneunzig Prozent seines Einkommens überlassen zu müssen. Es ist eine echte Herausforderung, mit rationierten Grundnahrungsmitteln auszukommen. Es ist eine lästige Unannehmlichkeit, nicht schneller als fünfunddreißig Meilen pro Stunde fahren zu dürfen. Es nervt, abends das Licht auszulassen.
Obwohl so viele Amerikaner den Krieg als etwas erlebten, das »da drüben« stattfand, war ein bisschen im Dunkeln sitzen wohl nicht zu viel verlangt von Bürgern, die im Großen und Ganzen sicher »hier bei uns« waren. Wie würden wir über jemanden denken, der es inmitten eines großen Kampfs – nicht bloß um Millionen Leben, sondern um unsere »freiheitliche Lebensweise« – für ein zu großes Opfer hielte, sein Licht auszuknipsen?
Natürlich hätte der Krieg nicht allein dadurch gewonnen werden können, dass man das Licht ausließ – dafür waren sechzehn Millionen amerikanische Soldaten und Militärbedienstete, über vier Billionen Dollar[20] und die Truppen von mehr als einem Dutzend weiterer Länder nötig. Aber stellen wir uns vor, der Krieg hätte nicht ohne diese Hilfe gewonnen werden können. Stellen wir uns vor, damit keine Hakenkreuzflaggen in London, Moskau und Washington[21] wehten, sei es nötig gewesen, abends einen Schalter umzulegen. Stellen wir uns vor, man hätte die übrigen zehneinhalb Millionen Juden auf der Welt ohne diese paar Stunden Dunkelheit nicht retten können. Wie würden wir dann über die allabendliche Selbstversagung dieser Bürger denken?
Es wird kein »Opfer« gewesen sein.
Keine gute Story
Am 2. März 1955 stieg eine schwarze Amerikanerin in Montgomery, Alabama, in einen Bus und weigerte sich, ihren Platz einem Weißen zu überlassen. So gut wie jedes amerikanische Kind könnte diese Szene überzeugend nachspielen, genau wie es das erste Thanksgiving nachstellen, Teebeutel von einem Pappschiff werfen oder in einem selbst gebastelten Zylinder die Gettysburg Address aufsagen könnte – und wüsste, was all das bedeutet.
Wahrscheinlich glauben Sie, den Namen dieser ersten Frau zu kennen, die im Bus nicht hinten sitzen wollte, aber wahrscheinlich liegen Sie falsch. So ging es auch mir, bis mich kürzlich jemand aufklärte. Mit Zufall hat das allerdings nichts zu tun. In gewisser Hinsicht konnte die Bürgerrechtsbewegung nur dadurch triumphieren, dass man Claudette Colvin vergaß.
Die größte Gefahr für menschliches Leben[22] – die kombinierte Bedrohung aus immer heftigeren Superstürmen und ansteigendem Meeresspiegel, immer heftigeren Dürren und zunehmendem Wassermangel, immer größeren Totwasserzonen in den Ozeanen, massiver Verbreitung schädlicher Insekten und dem täglichen Verschwinden von Wäldern und Tierarten – ist für die meisten Leute keine gute Story. Sofern die Krise des Planeten uns überhaupt interessiert, dann als ein Krieg, der »da drüben« ausgefochten wird. Wir kennen die Dringlichkeit der Lage, wissen um die existenzielle Gefahr, doch obwohl wir wissen, dass da ein Krieg um unser Überleben tobt, geht er uns gefühlt nichts an. Dieser Abstand zwischen Bewusstsein und Gefühl macht es oft selbst klugen, engagierten Leuten, die gerne etwas tun wollen, schwer, wirklich aktiv zu werden.
Wenn die Bomber direkt über einen hinwegdröhnen wie während des Kriegs in London, löscht man das Licht ganz automatisch. Fallen die Bomben vor der Küste, sieht das schon anders aus, obwohl die Gefahr letztlich genauso groß ist. Fallen sie jenseits eines Ozeans, kann es schwierig werden, überhaupt an das Bombardement zu glauben, auch wenn man davon weiß. Wenn wir abwarten, bis wir die Krise spüren, die wir merkwürdigerweise eine der »Umwelt« nennen, so als wäre die Zerstörung unseres Planeten nichts als Kontext, werden wir irgendwann ein Problem anpacken, dass sich längst nicht mehr lösen lässt.
Noch weiter »da drüben« wirkt die Krise, weil sie unsere Vorstellungskraft übersteigt. Über Ausmaß und Komplexität dieser Bedrohung nachzudenken, ist extrem anstrengend. Wir wissen, dass der Klimawandel[23] mit Luftverschmutzung zu tun hat, mit CO2, mit der Meerestemperatur, dem Regenwald, den Polkappen … Den meisten von uns dürfte es jedoch schwerfallen zu erklären, wie unser individuelles und kollektives Verhalten Wirbelstürme um fast fünfzig Stundenkilometer beschleunigt oder zu einem Polarwirbel[24]beiträgt, durch den es in Chicago kälter wird als in der Antarktis. Und es fällt uns schwer[25], nicht zu vergessen, wie sehr die Welt sich schon verändert hat: Wir staunen gar nicht mehr über den Vorschlag, Manhattan mit einer fünfzehn Kilometer langen Hochwasserschutzmauer zu umgeben, nehmen höhere Versicherungsbeiträge hin, und extreme Wetterphänomene – Waldbrände vor den Toren von Großstädten, alljährliche »Jahrhundertfluten«, Rekord-Todeszahlen bei Rekord-Hitzewellen – sind in unseren Augen einfach nur noch Wetter.
Die Geschichte von der Krise unseres Planeten ist schwierig zu erzählen, und obendrein ist sie nicht »gut«. Nicht bloß überzeugt sie uns nicht, sie interessiert uns nicht einmal. Aufmerksamkeit fesseln und Veränderung bewirken, das ist das wichtigste Bestreben von Kunst und politischem Aktivismus. Das Thema Klimawandel schlägt sich in beiden Bereichen schlecht. Bezeichnenderweise nimmt das Schicksal unseres Planeten in der Literatur noch weniger Raum ein als im übrigen kulturellen Austausch, und das, obwohl die meisten Schriftsteller sich für besonders sensibel gegenüber den unterrepräsentierten Wahrheiten dieser Welt halten. Vielleicht liegt das daran, dass Schriftsteller außerdem besonders sensibel dafür sind, welche Geschichten »funktionieren«. Die Narrationen, die in unserer Kultur Bestand haben – Volksmärchen, religiöse Texte, Mythen, gewisse historische Berichte –, verfügen über abgeschlossene Handlungen, eindeutige Schurken und Helden, spektakuläre Action und eine klare Moral. Daher die Neigung, den Klimawandel – wenn überhaupt – als zukünftige Apokalypse darzustellen, statt als veränderbaren Prozess, und die Brennstoffindustrie als leibhaftiges Verderben, statt als einen von vielen Faktoren, die wir angehen müssen. Die Krise unseres Planeten ist so abstrakt und vielschichtig, verläuft so langsam, ermangelt so sehr symbolträchtigen Gestalten und Momenten, dass es unmöglich scheint, sie fesselnd und wahrhaftig zu beschreiben.
Claudette Colvin[26] war die erste Frau, die verhaftet wurde, weil sie in Montgomery ihren Platz im Bus nicht aufgeben wollte. Rosa Parks, deren Namen wir fast alle kennen, trat erst neun Monate später auf den Plan. Und als sie sich im Bus gegen die Rassentrennung wehrte, war sie keineswegs bloß eine erschöpfte Näherin, die nach einem langen Arbeitstag nach Hause wollte. Sie war eine gewiefte Bürgerrechtlerin (Schriftführerin ihres Ortsverbands der NAACP), hatte an Seminaren zu sozialer Gerechtigkeit teilgenommen, mit einflussreichen Anwälten zu Mittag gegessen und die Strategie der Bewegung mitgeplant. Parks war zweiundvierzig, verheiratet, kam aus gutem Hause. Colvin war fünfzehn, schwanger von einem älteren, verheirateten Mann und stammte aus armen Verhältnissen. Führende Bürgerrechtler – auch Rosa Parks selbst – empfanden ihren Lebenslauf als zu gebrochen, ihren Charakter als zu labil für eine Heldin der entstehenden Bewegung. Sie hätte einfach nicht für eine ausreichend gute Story getaugt.
Hätte das Christentum sich derart ausgebreitet, wenn man Jesus nicht gekreuzigt, sondern in der Badewanne ertränkt hätte? Würden so viele Menschen Anne Franks Tagebuch lesen, wenn sie ein mittelalter Mann gewesen wäre, der sich hinter einem Kleiderschrank versteckte, statt eines bildhübschen Mädchens hinter einem Bücherregal? In welchem Ausmaß wurde die Geschichte von Lincolns Zylinder beeinflusst, von Gandhis Lendenschurz, Hitlers Schnurrbart, van Goghs Ohr, Martin Luthers Stimme und dem Umstand, dass kein Gebäude der Welt sich leichter zeichnen ließ als die Türme des World Trade Centers?
Rosa Parks’ Story ist zugleich historische Episode und ein Märchen mit dem Zweck, Geschichte zu schreiben. Wie die symbolträchtigen Fotos[27] der Soldaten, die auf Iwojima die amerikanische Flagge hissen, des Paars in Robert Doisneaus Le baiser de l’hôtel de ville und des Milchmanns im zerbombten London war auch das Foto von Rosa Parks[28] im Bus gestellt. Der Mann auf der Bank hinter ihr ist kein wütender Verteidiger der Rassentrennung, sondern ein befreundeter Journalist. Und wie sie später einräumte[29], war die ganze Sache weniger simpel – weniger denkwürdig –, als dass eine erschöpfte Frau sich im Bus nach hinten setzten sollte. Doch weil sie die Macht von Geschichten kannte, gab Parks den Ereignissen eine möglichst ergreifende Form. Als Heldin ihrer Story war Parks mutig, als deren Co-Autorin war sie heldenhaft.
Geschichte wird im Nachhinein zu einer guten Story, und gute Storys werden zu Geschichte. Hinsichtlich des Schicksals unseres Planeten – und damit des Schicksals der Menschheit – ist das ein echtes Problem. Wie es der Meeresbiologe und Filmemacher Randy Olson[30] ausdrückte: »Klima ist sehr wahrscheinlich das langweiligste Thema, das die Wissenschaft der Öffentlichkeit je hat näherbringen müssen.« Die meisten Versuche, von der Krise zu erzählen, sind entweder Science-Fiction oder werden als solche abgetan. Kaum eine Version der Geschichte vom Klimawandel ließe sich im Kindergarten nachspielen, keine würde die Eltern dort zu Tränen rühren. Es scheint ganz unmöglich, die Katastrophe aus dem »da drüben« unserer Köpfe ins »hier bei uns« unserer Herzen zu holen. In den Worten Amitav Ghoshs, in seinem Buch Die große Verblendung: »Die Klimakrise ist auch eine Krise der Kultur[31] und deshalb eine der Imagination.« Ich würde es Glaubenskrise nennen.
Besser Wissen vs. Besser Machen
Im Jahre 1942 machte sich der achtundzwanzigjährige katholische Widerstandskämpfer Jan Karski aus dem besetzten Polen nach London und schließlich Amerika auf, um der Welt von den Verbrechen der Deutschen zu berichten. Vor seiner Abreise holte er bei verschiedenen Untergrundgruppen Informationen und Augenzeugenberichte ein, um sie in den Westen zu tragen. In seinen Memoiren erzählt er von einem Treffen mit dem Anführer des Jüdischen Arbeiterbunds:
Der Bund-Führer kam schweigend auf mich zu[32]. Er packte mich derart heftig am Arm, dass es schmerzte. Erschrocken schaute ich ihm in die Augen und war sehr bewegt von dem tiefen, unerträglichen Schmerz, den ich darin wahrnahm.
»Sagen Sie der jüdischen Führung, dass dies hier keine Sache für Politik oder Taktik ist. Sagen Sie ihnen, dass die Erde erzittern und die Welt aufgerüttelt werden muss. Vielleicht wacht sie dann ja auf und beginnt zu erkennen und zu verstehen. Sagen Sie ihnen, dass sie die Kraft und den Mut finden müssen, Opfer zu erbringen, die kein Staatsmann je erbringen musste; Opfer, die so schmerzhaft sind wie das Schicksal meines sterbenden Volkes – und ebenso einzigartig. Das ist es, was sie nicht verstehen. Die Ziele und Methoden der Deutschen sind beispiellos in der Geschichte. Die Demokratien müssen darauf in einer Weise reagieren, die ebenso beispiellos ist – und mit außergewöhnlichen Methoden antworten. (…) Sie wollen von mir wissen, welches Vorgehen ich der jüdischen Führungsspitze empfehle. Sagen Sie ihnen, sie sollen alle wichtigen englischen und amerikanischen Behörden und Ämter aufsuchen. Sie sollen von dort erst wieder weggehen, wenn man ihnen garantiert hat, dass etwas zur Rettung der Juden unternommen wird. Sie sollen weder Essen noch Trinken annehmen, sondern vor den Augen der Welt einen langsamen Tod sterben. Sterben sollen sie. Das wird vielleicht das Gewissen der Welt wachrütteln.«
Nach einer Reise, wie man sie sich gefährlicher nicht denken kann, erreichte Karski im Juni 1943 Washington, D. C. Dort traf er den Verfassungsrichter Felix Frankfurter – einer der größten amerikanischen Juristen aller Zeiten und selbst Jude. Nachdem Frankfurter Karskis Bericht von der Räumung des Warschauer Gettos und der Vernichtung in den Konzentrationslagern gehört und ihm eine Reihe immer spezifischerer Fragen gestellt hatte (»Wie hoch ist die Mauer, die das Getto vom Rest der Stadt trennt?«), ging er stumm im Zimmer auf und ab. Dann setzte er sich und erklärte: »Mr Karski, spricht ein Mann wie ich mit einem Mann wie Ihnen, muss er ganz ehrlich sein. Daher muss ich Ihnen sagen, dass ich nicht glauben kann, was Sie mir da erzählen.« Als Karskis Kollege ihm zur Seite sprang, erwiderte Frankfurter: »Ich sage ja nicht, dass der junge Mann lügt. Ich sage nur, dass ich ihm nicht glauben kann. Mein Verstand und mein Herz sind so gemacht, dass ich das nicht akzeptieren kann.«
Frankfurter bezweifelte nicht die Wahrheit von Karskis Geschichte. Er bestritt nicht, dass die Deutschen systematisch die europäischen Juden – seine Verwandten – ermordeten. Er behauptete auch nicht, er sei zwar überzeugt und schockiert, könne jedoch leider nichts tun. Stattdessen gestand er sowohl seine Unfähigkeit ein, die Wahrheit zu glauben, als auch sein Wissen um diese Unfähigkeit. Frankfurters Gewissen war nicht wachgerüttelt worden.
Unser Verstand und unser Herz sind für bestimmte Aufgaben hervorragend geeignet – und schlecht für andere. Wir sind gut darin, den Kurs eines Hurrikans zu berechnen, und schlecht darin, die nötigen Entscheidungen zu treffen – vor dem Sturm zu fliehen, beispielsweise. Weil wir uns über Hunderte Millionen Jahre in Umfeldern entwickelt haben, die mit der modernen Welt kaum etwas zu tun hatten, neigen wir häufig zu Begierden, Ängsten und blinden Flecken, die zu modernen Gegebenheiten nicht passen. Wir befriedigen nur zu gern unmittelbare Bedürfnisse, gieren nach Fett und Zucker (beide schädlich für Menschen in einer Welt, in der sie ständig verfügbar sind); wir beobachten zähneklappernd unsere Kinder auf Klettergerüsten (während wir größere Gesundheitsrisiken gar nicht beachten, wenn wir ihnen zum Beispiel zu viel Fett und Zucker zu essen geben) und ignorieren gleichzeitig die tödliche Gefahr »da drüben«.
In einer aktuellen Studie stellte der Psychologe Hal Hershfield[33] fest, dass die Hirnaktivität von Probanden, die sich selbst in der Zukunft beschreiben sollten – und sei es nur zehn Jahre später –, nicht dieselbe war, wie wenn sie über ihr gegenwärtiges Ich sprachen. Eher entsprach sie der Beschreibung von Fremden. Das änderte sich jedoch, wenn man ihnen künstlich gealterte Bilder ihrer selbst zeigte. Ja, dadurch änderte sich auch ihr Verhalten: Auf die Anweisung hin, 1000 Dollar unter vier Optionen aufzuteilen – ein Geschenk für einen lieben Menschen, eine Freizeitaktivität, ein Girokonto oder eine Altersvorsorge –, steckten Probanden, die ihre gealterten Ichs vor sich sahen, fast doppelt so viel Geld in Altersvorsorge wie die, denen man keine solchen Bilder zeigte.
Man hat ausführlich gezeigt[34], dass emotionale Reaktionen durch Anschaulichkeit verstärkt werden. Wissenschaftler haben eine Reihe »Sympathie-Verzerrer[35]« beschrieben, die Anteilnahme auslösen: der Identifizierbares-Opfer-Effekt (die Möglichkeit, sich Leid detailliert vorzustellen), der In-Group-Effekt (das Gefühl sozialer Nähe zu Leid) und der Referenzabhängige-Sympathie-Effekt (die Lage des Opfers wird nicht nur als schlimm präsentiert, sondern als schlimmer werdend). Eine Forschergruppe hat ein Experiment mit einem postalischen Spendenaufruf an etwa 200000 potenzielle Spender durchgeführt. Wurde die Armut des Begünstigten nicht als chronisch, sondern als neu entstanden dargestellt, stiegen die Spenden um 33 Prozent[36]. Gehörten Spender und Begünstigter derselben Religion an, stiegen die Spenden um 55 Prozent. Gab der Spendenaufruf den Namen einer Einzelperson an statt eine namenlose Gruppe, stiegen die Spenden um 110 Prozent. Die Kombination aller drei Taktiken führte zu einem Anstieg von 300 Prozent.
Das Dumme an der Krise unseres Planeten ist, dass ihr eine Reihe »Apathie-Verzerrer« eingebaut sind. Obwohl viele der mit dem Klimawandel zusammenhängenden Katastrophen – vor allem extreme Wetterphänomene, Hochwasser und Waldbrände, Verknappung von Ressourcen und Lebensraum – anschaulich und persönlich sind und immer schlimmer werden, fühlen sie sich nicht so an. Statt als Facetten einer immer relevanteren Geschichte werden sie als abstrakt, weit weg und isoliert[37] empfunden. Wie der Journalist Oliver Burkeman[38] es im Guardian formulierte: »Hätte eine Bande böser Psychologen in einer Geheimbasis unter dem Meer eine Krise ausgetüftelt, für deren Bewältigung die Menschheit hoffnungslos schlecht aufgestellt wäre, hätten sie nichts Besseres als den Klimawandel finden können.«
Sogenannte Klimawandelleugner[39] bestreiten das Ergebnis, zu dem 97 Prozent der Klimaforscher kamen: Der Planet erwärmt sich durch menschliche Einwirkung. Doch was ist mit uns, die wir diesen Umstand als gegeben hinnehmen? Auch wenn wir den Wissenschaftlern keine Lügen unterstellen: Können wir glauben, was sie uns erzählen? Wenn ja, würde uns das doch wohl ein ethisches Gebot aufdrängen, unser Gewissen wachrütteln und uns davon überzeugen, dass wir kleine Opfer bringen müssen, um viel größere Opfer in der Zukunft zu vermeiden.
Die Wahrheit bloß mit dem Kopf zu akzeptieren, ist noch keine Tugend. Das allein wird uns nicht retten. Wenn ich als Kind etwas tat, das ich nicht hätte tun sollen, mahnte man mich oft, ich »wisse das doch besser«. Im Wissen lag der Unterschied zwischen Fehler und Vergehen.
Wenn wir die Tatsache, dass wir den Planeten zerstören, zwar akzeptieren, sie aber nicht glauben können, sind wir nicht besser als die, die den menschengemachten Klimawandel ganz verleugnen – genau wie Felix Frankfurter nicht besser war als die, die den Holocaust bestritten. Und wenn die Zukunft über diese beiden Formen der Leugnung urteilt, welche wird dann wohl als schwerer Fehler dastehen und welche als unverzeihliches Verbrechen?
Gehen, Glauben, Leben
Ein Jahr bevor Karski Polen verließ, um der Welt vom Massaker an den europäischen Juden zu berichten, floh meine Großmutter aus ihrem polnischen Dorf, um ihr Leben zu retten. Zurück ließ sie vier Großeltern, ihre Mutter, zwei Geschwister sowie viele Verwandte und Freunde. Sie war zwanzig Jahre alt und wusste nicht mehr als alle anderen: Die Nazis rückten ins sowjetisch besetzte Polen vor und waren nur noch wenige Tage entfernt. Fragte man, wieso sie ging, sagte sie nur: »Ich hatte das Gefühl, etwas tun zu müssen.«
Meine Urgroßmutter, die mit ihrer Stieftochter im Arm am Rand eines Massengrabs erschossen werden würde, sah meiner Großmutter beim Packen zu. Sie wechselten kein Wort und sahen sich danach nie wieder. Meine Uroma wusste dasselbe wie ihre Tochter, hatte jedoch nicht das Gefühl, »etwas tun zu müssen«. Ihr Wissen war nur Wissen.
Die kleine Schwester meiner Großmutter, die erschossen werden würde, als sie versuchte, ein wertloses Schmuckstück für etwas zu essen einzutauschen, folgte meiner Großmutter vor die Tür. Sie zog ihr einziges Paar Schuhe aus und drückte es ihr in die Hand. »Du hast so ein Glück, dass du gehst«, sagte sie. Ich habe diese Geschichte oft gehört. Als Kind verstand ich statt »You’re so lucky to be leaving« immer »You’re so lucky believing«: Du hast so ein Glück, dass du glaubst.
Vielleicht war es wirklich nur Glück. Hätten die Dinge damals etwas anders gelegen, wäre meine Großmutter krank gewesen, oder frisch verliebt, sie hätte vielleicht nicht das Glück gehabt, zu gehen. Die Zurückgebliebenen waren auch nicht weniger mutig, intelligent oder tatkräftig als sie, hatten auch nicht weniger Angst vor dem Tod. Sie glaubten bloß nicht, dass ihnen etwas maßgeblich anderes bevorstünde als das, was es zuvor schon oft gegeben hatte. Zum Glauben kann man sich nicht zwingen. Und man kann ihn auch niemandem aufdrängen, nicht einmal mit besseren, lauteren und tugendhafteren Argumenten, ja nicht einmal mit unwiderlegbaren Beweisen. In seinem Prolog zu »Der Karski-Bericht« sagt Filmemacher Claude Lanzmann:
Was ist Wissen?[40] Was kann die Information über ein Grauen, ein buchstäblich unerhörtes Grauen, in einem Hirn bedeuten, das auf deren Aufnahme nicht vorbereitet ist, weil sie ein in der Geschichte der Menschheit nie da gewesenes Verbrechen betrifft? … Der nach London geflohene Raymond Aron wurde gefragt, ob er wusste, was sich damals im Osten abspielte. Er antwortete: Ich wusste es, aber ich glaubte es nicht, und weil ich es nicht glaubte, wusste ich es nicht.
Manchmal tagträume ich davon, im Schtetl meiner Großmutter von Tür zu Tür zu gehen, die Zurückbleibenden zu schütteln und zu schreien: »Ihr müsst etwas tun!« Diesen Tagtraum habe ich in einem Haus, von dem ich weiß, dass es ein Vielfaches von dem verbraucht, was mir an Energie zusteht, von dem ich weiß, dass es typisch für die unersättliche Lebensweise ist, von der ich weiß, dass sie unseren Planeten zerstört. Ich kann mir gut vorstellen, wie einer meiner Nachkommen davon träumt, mich zu schütteln und zu schreien: »Du musst etwas tun!« Aber ich kann nichts glauben, das mich dazu veranlassen würde. Also weiß ich in Wahrheit überhaupt nichts.
Neulich morgens, auf der Fahrt zur Schule, sah mein zehnjähriger Sohn von seinem Buch auf und verkündete: »Wir haben so ein Glück, dass wir am Leben sind.« We are so lucky to be living.
Eins der Dinge, die ich nicht weiß: Wie bringe ich meine Dankbarkeit für das Leben mit einem Verhalten zusammen, das wirkt, als wäre es mir eigentlich egal?
Als sie ging, nahm meine Großmutter ihren Wintermantel mit, obwohl es Juni war.
Hysterisch
Eines Sommerabends im Jahr 2006 war der achtzehnjährige Kyle Holtrust in Tucson entgegen der Fahrtrichtung auf seinem Fahrrad unterwegs. Ein Chevy Camaro fuhr ihn an und schleifte ihn fast zehn Meter über die Straße. Thomas Boyle Jr. sprang sofort vom Beifahrersitz eines nahen Trucks und lief hinüber. Vollgepumpt mit Adrenalin stemmte er den Camaro hoch und hielt die Vorderräder fünfundvierzig Sekunden in der Luft, während man Holtrust hervorzog. Auf die Frage, wieso er das getan hatte, sagte Boyle[41]: »Ich wäre doch ein furchtbarer Mensch, wenn ich zuschaue, wie jemand leidet, und nicht einmal versuche, ihm zu helfen … Ich dachte einfach nur, was, wenn das mein Sohn wäre?« Er hatte das Gefühl, irgendetwas tun zu müssen.
Wie er das getan hatte, wusste er indessen selbst nicht so genau: »Auf keinen Fall könnte ich dieses Auto jetzt noch mal hochheben.« Der Weltrekord im Kreuzheben liegt bei 500 Kilo. Ein Camaro wiegt zwischen 1500 und 1800 Kilo. Boyle war kein Gewichtheber[42], sondern zeigte sogenannte »hysterische Kraft« – eine sonst unmögliche körperliche Leistung in einer lebensbedrohlichen Situation.
Ein einziger, großartiger Mensch hob das Auto von Holtrust, doch viele andere bildeten eine Rettungsgasse, damit der Krankenwagen schneller durchkam. Ihr Handeln war genauso entscheidend dafür, das Leben des jungen Mannes zu retten, aber bemerkenswert finden wir es nicht. Ein Auto hochzustemmen, ist das Großartigste, was man tun kann. Einen Krankenwagen durchzulassen, ist das Mindeste. Kyle Holtrusts Leben hing von beidem ab.
In der Grundschule hörten wir jedes Jahr Vorträge von Polizei und Feuerwehr, die Gemeinsinn und Verantwortungsgefühl in uns wecken und uns beibringen sollten, wie man sich bei Gefahr verhält. Ich weiß noch, wie ein Feuerwehrmann sagte, immer, wenn wir einen Krankenwagen sähen, sollten wir uns vorstellen, jemand, den wir lieb haben, könnte darin liegen. Welch furchtbarer Gedanke für einen Kinderkopf! Vor allem, weil er eine falsche Verknüpfung herstellt. Wir lassen Krankenwagen nicht durch, weil ein geliebter Mensch darin liegen könnte, und auch nicht, weil das Gesetz es vorschreibt. Wir tun es, weil man das eben tut. Es ist eine dieser gesellschaftlichen Normen – wie sich an einer Schlange hinten anzustellen oder Müll in den Mülleimer zu werfen –, die kulturell so tief verankert sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken.
Normen können sich natürlich ändern, und man kann sie ignorieren. In den frühen 2010ern[43] tauchten in Moskau sogenannte »Krankenwagentaxis« auf – Minibusse, die von außen Krankenwagen glichen, innen aber luxuriös ausgestattet waren und für 200 Dollar aufwärts pro Stunde vermietet wurden, um damit dem berüchtigten Moskauer Verkehr ein Schnippchen zu schlagen. Schwer vorstellbar, dass irgendwer das gut fand, der nicht selbst in einem dieser Fahrzeuge saß. Es ist ein Affront – nicht, weil es uns persönlich übervorteilt (kaum jemand wird einem solchen Wagen je begegnen), sondern weil es unsere Bereitschaft ausnutzt, uns zum Wohle aller zurückzunehmen. Die Verdunklung im Zweiten Weltkrieg führte zu Plünderungen, die Essensrationierung zu Fälschungen und Diebstahl. Als ein Nachtclub in Piccadilly[44] von der Luftwaffe getroffen wurde, mussten die Londoner Rettungskräfte verhindern, dass man den Toten ihren Schmuck raubte.
Das sind jedoch Extremfälle. So gut wie immer sind unsere Konventionen und die durch sie geprägten Identitäten so subtil, dass man sie gar nicht wahrnimmt. Sicher, wir fahren nicht in falschen Krankenwagen herum, aber vieles, was wir heute tun, wird unseren Nachkommen mindestens genauso haarsträubend vorkommen. Auf den Motorhauben amerikanischer Krankenwagen steht das Wort »AMBULANCE« in Spiegelschrift, damit man es im Rückspiegel lesen kann. Man könnte sagen, es wurde für die Zukunft geschrieben – für Autos weiter vorne auf der Straße. Von innerhalb des Krankenwagens kann man es nicht lesen, genau wie wir die Geschichte nicht lesen können, die wir selber schaffen: Sie ist in Spiegelschrift geschrieben, kann nur von Nachgeborenen im Rückspiegel gelesen werden.
Das englische Wort »emergency«,