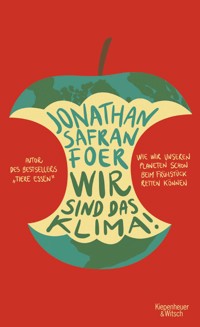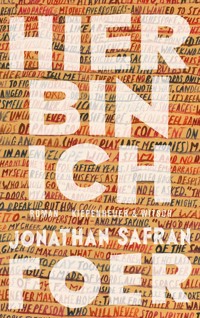9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Tiere essen« ist ein leidenschaftliches Buch über die Frage, was wir essen und warum. Der hoch gelobte amerikanische Romancier und Bestsellerautor Jonathan Safran Foer hat ein aufrüttelndes Buch über Fleischkonsum und dessen Folgen geschrieben, das weltweit Furore macht und bei uns mit Spannung erwartet wird. Wie viele junge Menschen schwankte Jonathan Safran Foer lange zwischen Fleischgenuss und Vegetarismus hin und her. Als er Vater wurde und er und seine Frau überlegten, wie sie ihr Kind ernähren würden, bekamen seine Fragen eine neue Dringlichkeit: Warum essen wir Tiere? Würden wir sie auch essen, wenn wir wüssten, wo sie herkommen? Foer stürzt sich mit Leib und Seele in sein Thema. Er recherchiert auf eigene Faust, bricht nachts in Tierfarmen ein, konsultiert einschlägige Studien und spricht mit zahlreichen Akteuren und Experten. Vor allem aber geht er der Frage auf den Grund, was Essen für den Menschen bedeutet. Auch Foer kennt die trostspendende Kraft einer fleischhaltigen Lieblingsmahlzeit, die seit Generationen in einer Familie gekocht wird. In einer brillanten Synthese aus Philosophie, Literatur, Wissenschaft und eigenen Undercover-Reportagen bricht Foer in »Tiere essen« eine Lanze für eine bewusste Wahl. Er hinterfragt die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, um unser Essverhalten zu rechtfertigen, und die dazu beitragen, dass wir der Wirklichkeit der Massentierhaltung und deren Konsequenzen nicht ins Auge sehen. »Tiere essen« besticht durch eine elegante Sprache, überraschende Denkfiguren und viel Humor. Foer zeigt ein großes Herz für menschliche Schwächen, lässt sich aber in seinem leidenschaftlichen Plädoyer für die Möglichkeiten ethischen Handelns nicht bremsen. Eine unverzichtbare Lektüre für jeden Menschen, der über sich und die Welt – und seinen Platz in ihr – nachdenkt. Mit einem eigens für die deutsche Ausgabe geschriebenen Vorwort von Jonathan Safran Foer. »Diese Geschichte begann nicht als ein Buch. Ich wollte nur wissen – für mich und für meine Familie – was Fleisch eigentlich ist. Wo kommt es her? Wie wird es produziert? Welche Folgen hat unser Fleischkonsum für die Wirtschaft, die Gesellschaft und unsere Umwelt? Gibt es Tiere, die man bedenkenlos essen kann? Gibt es Situationen, in denen der Verzicht auf Fleisch falsch ist? Warum essen wir kein Hundefleisch? Was als persönliche Untersuchung begann, wurde rasch sehr viel mehr als das …« Jonathan Safran Foer Der Titel enthält eine vom Vegetarierbund Deutschlands (VEBU) zusammengestellte Übersicht zur Sachlage der Massentierhaltung in der Bundesrepublik. »Ich liebe Würste auch, aber ich esse sie nicht.« Jonathan Safran Foer in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Jonathan Safran Foer
Tiere essen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jonathan Safran Foer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jonathan Safran Foer
Jonathan Safran Foer, geboren 1977, studierte in Princeton Philosophie. Er lebt und arbeitet in New York. Sein erster Roman Alles ist erleuchtet machte ihn mit einem Schlag bekannt.
Im September 2005 wird nach einem Libretto von Jonathan Safran Foer die Oper Seven Attempted Escapes from Silence in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin uraufgeführt. Die Verfilmung von Alles ist erleuchtet (Regie: Liev Schreiber) kommt mit Elijah Wood in der Hauptrolle im August 2005 in den USA in die Kinos.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Ich liebe Würste auch, aber ich esse sie nicht.« Jonathan Safran Foer in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
»Tiere essen« ist ein leidenschaftliches Buch über die Frage, was wir essen und warum. Der hoch gelobte amerikanische Romancier und Bestsellerautor Jonathan Safran Foer hat ein aufrüttelndes Buch über Fleischkonsum und dessen Folgen geschrieben, das weltweit Furore macht und bei uns mit Spannung erwartet wird.
Wie viele junge Menschen schwankte Jonathan Safran Foer lange zwischen Fleischgenuss und Vegetarismus hin und her. Als er Vater wurde und er und seine Frau überlegten, wie sie ihr Kind ernähren würden, bekamen seine Fragen eine neue Dringlichkeit: Warum essen wir Tiere? Würden wir sie auch essen, wenn wir wüssten, wo sie herkommen?
Foer stürzt sich mit Leib und Seele in sein Thema. Er recherchiert auf eigene Faust, bricht nachts in Tierfarmen ein, konsultiert einschlägige Studien und spricht mit zahlreichen Akteuren und Experten. Vor allem aber geht er der Frage auf den Grund, was Essen für den Menschen bedeutet. Auch Foer kennt die trostspendende Kraft einer fleischhaltigen Lieblingsmahlzeit, die seit Generationen in einer Familie gekocht wird.
In einer brillanten Synthese aus Philosophie, Literatur, Wissenschaft und eigenen Undercover-Reportagen bricht Foer in »Tiere essen« eine Lanze für eine bewusste Wahl. Er hinterfragt die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, um unser Essverhalten zu rechtfertigen, und die dazu beitragen, dass wir der Wirklichkeit der Massentierhaltung und deren Konsequenzen nicht ins Auge sehen.
»Tiere essen« besticht durch eine elegante Sprache, überraschende Denkfiguren und viel Humor. Foer zeigt ein großes Herz für menschliche Schwächen, lässt sich aber in seinem leidenschaftlichen Plädoyer für die Möglichkeiten ethischen Handelns nicht bremsen. Eine unverzichtbare Lektüre für jeden Menschen, der über sich und die Welt - und seinen Platz in ihr - nachdenkt.
Mit einem eigens für die deutsche Ausgabe geschriebenen Vorwort von Jonathan Safran Foer.
»Diese Geschichte begann nicht als ein Buch. Ich wollte nur wissen - für mich und für meine Familie - was Fleisch eigentlich ist. Wo kommt es her? Wie wird es produziert? Welche Folgen hat unser Fleischkonsum für die Wirtschaft, die Gesellschaft und unsere Umwelt? Gibt es Tiere, die man bedenkenlos essen kann? Gibt es Situationen, in denen der Verzicht auf Fleisch falsch ist? Warum essen wir kein Hundefleisch? Was als persönliche Untersuchung begann, wurde rasch sehr viel mehr als das …« Jonathan Safran Foer
Der Titel enthält eine vom Vegetarierbund Deutschlands (VEBU) zusammengestellte Übersicht zur Sachlage der Massentierhaltung in der Bundesrepublik.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Fuß- und Endnoten
Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe
Hinweis
Geschichten erzählen
Die Früchte von Stammbäumen
Wieder möglich
Tiere essen
Hör gut zu
Alles oder nichts oder etwas anderes
1. George
Ein Plädoyer für das Essen von Hunden
2. Freunde und Feinde
Krieg
3. Scham
Worte / Bedeutung
Verstecken / Suchen
1. Ich bin nicht der Typ, der mitten in der Nacht in eine Farm einsteigt
Ihre Bemühungen
Das ganze traurige Geschäft
Die Erlösung
2. Ich bin der Typ, der mitten in der Nacht in eine Farm einsteigt
3. Ich bin Fleischproduzent
4. Das erste Huhn
Der erste Mensch
Das erste Problem
Der Mythos vom Mythos
Das erste Vergessen
Die erste Tierethik
Der erste Fließbandarbeiter
Die erste Massentierhalterin
Das erste Chicken of Tomorrow
Der erste Massentierhaltungsbetrieb
5. Ich bin der letzte Geflügelfarmer
Einfluss / Sprachlosigkeit
Lam Hoi-ka
Influenza
Alle Grippearten
Leben und Tod eines Vogels
Einfluss
Weitere Einflüsse
Scheibenweise Paradies /Haufenweise Scheiße
1. Lach, lach, heul, heul
Das Schwein gibt es nicht
Nett, beunruhigend, unsinnig
2. Albträume
Unsere guten alten wohlmeinenden Versuche
3. Viele Haufen Scheiße
4. Unser neuer Sadismus
5. Unser Unterwassersadismus (Eine zentrale Nebenbemerkung)
6. Tiere essen
Tun
1. Bill und Nicolette
2. Ich bin vegetarische Viehzüchterin
Sie weiß es besser
Er weiß es besser
3. Wissen wir es besser?
4. Ich bringe einfach das Wort falsch nicht heraus
5. Tief Luft holen
6. Vorschläge
Ich bin Veganer und baue Schlachthöfe
7. Meine Wahl
Geschichten erzählen – TEIL II
1. Das letzte Thanksgiving meiner Kindheit
2. Was haben Truthähne mit Thanksgiving zu tun?
3. Die Wahrheit über das Essen von Tieren
4. Der amerikanische Tisch
5. Der globale Tisch
6. Das erste Thanksgiving seiner Kindheit
Dank
Register
Fuß- und Endnoten
Für Sam und Eleanor,
verlässliche Wegweiser
Fuß- und Endnoten
am Ende des Werkes
Fußnoten [a]
Zur Sachlage in Deutschland: eine Übersicht
Zusammengestellt vom Vegetarierbund Deutschland (VEBU)
Die folgenden Daten erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Übersicht kann nur einen ersten Einblick in den komplexen Sachverhalt der Massentierhaltung in Deutschland liefern.
Autoren: Sebastian Zösch, Dominik Schäfer (VEBU)
Endnoten [1]
Anmerkungen
Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe
Die Recherchen für dieses Buch fanden zwar in den USA statt und viele Statistiken beziehen sich auf die US-Landwirtschaft, doch im Grunde könnte man eine fast gleich lautende Geschichte über die deutsche Landwirtschaft erzählen. Deutschland ist sogar das Land, dessen landwirtschaftliche Methoden den amerikanischen am meisten ähneln. Die Massentierhaltung war eine amerikanische Erfindung. Die routinemäßige Grausamkeit und die Umweltzerstörung, die mit der Massentierhaltung einhergehen, sind heute jedoch ein weltweites Phänomen.
Etwa 98 Prozent aller Hühner und Schweine, die für den Verzehr bestimmt sind, stammen in Deutschland aus Massentierhaltung – das sind über 500 Millionen Tiere im Jahr. Würde man auch die Rinder und Fische hinzurechnen – die aus verschiedenen Gründen schwieriger zu quantifizieren sind –, wäre die Zahl noch bedeutend höher. Anders ausgedrückt: Ein deutschsprachiger Leser, der sich mit den in diesem Buch angesprochenen Problemen beschäftigt, kann leider sicher sein, dass sie so auch vor seiner Tür existieren.
Dieses Buch ist das Ergebnis einer sehr persönlichen Untersuchung. Als ich Vater wurde, wollte ich fundierte Entscheidungen darüber treffen, was ich meinem Sohn zu essen gebe. Am Schluss des Buches schreibe ich an einer Stelle, dass ich zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort womöglich andere Entscheidungen hinsichtlich des Essens von Tieren getroffen hätte. Deutschland ist jedoch nicht der andere Ort, den ich mir dabei vorgestellt habe.
Jonathan Safran Foer
HINWEIS DES VERLAGES:
Eine Übersicht über die Sachlage in Deutschland befindet sich am Ende des Werkes.
Amerikaner essen weniger als 0,25 Prozent der bekannten essbaren Nahrungsmittel auf dem Planeten.[1]
Die Früchte von Stammbäumen
ALS ICH KLEIN WAR, verbrachte ich das Wochenende oft bei meiner Großmutter. Wenn ich freitagabends ankam, hob sie mich vom Boden hoch und drückte mich so fest, dass mir fast die Luft wegblieb. Und wenn ich am Sonntagnachmittag fuhr, wurde ich wieder in die Luft gehievt. Erst Jahre später wurde mir klar, dass sie mein Gewicht kontrollierte.
Meine Großmutter überlebte den Krieg, weil sie barfuß in den Abfällen anderer Leute nach Nahrung suchte: nach vergammelten Kartoffeln, weggeworfenen Fleischstücken, Schalen und den Resten, die an Knochen und Obstkernen hingen. Deshalb störte es sie nie, wenn ich über die Ränder malte, solange ich nur Gutscheine entlang den gestrichelten Linien ausschnitt. Wenn wir uns am Hotelfrühstück labten, schmierte sie ein Sandwich ums andere, wickelte sie in Servietten und verstaute sie als Mittagessen in ihrer Tasche. Von meiner Großmutter lernte ich, dass ein Teebeutel so viele Tassen Tee ergibt, wie man braucht, und dass alles am Apfel essbar ist.
Um Geld ging es dabei nicht. (Viele der von mir ausgeschnittenen Gutscheine waren für Lebensmittel, die sie nie kaufte.)
Um Gesundheit ging es dabei auch nicht. (Sie wollte immer, dass ich Cola trinke.)
Meine Großmutter deckte nie für sich auf, wenn die ganze Familie zusammen aß. Selbst wenn es nichts mehr zu tun gab – keine Suppe mehr verteilt, kein Topf mehr gerührt und kein Herd im Auge behalten werden musste –, blieb sie wie ein Wachposten (oder eine Gefangene) in der Küche. Für mich sah es so aus, als ob sie schon vom Zubereiten der Speisen satt würde und deshalb nicht mehr essen musste.
In den Wäldern Europas aß sie, um lange genug am Leben zu bleiben, bis sie wieder Gelegenheit hatte zu essen, um am Leben zu bleiben. 50 Jahre später in Amerika aßen wir alles, was uns schmeckte. Unsere Schränke waren voll mit nach Lust und Laune gekauften Lebensmitteln, überteuerte Feinschmeckerkost, Essen, das wir nicht brauchten. Und wenn das Verfallsdatum abgelaufen war, warfen wir es weg, ohne daran zu riechen. Essen war etwas Sorgenfreies. Meine Großmutter hatte uns dieses Leben ermöglicht. Sie selbst konnte die Verzweiflung allerdings nicht abschütteln.
Als Kinder hielten meine Brüder und ich unsere Großmutter für die tollste Köchin aller Zeiten. Wir sagten es ihr, wenn das Essen auf den Tisch kam, und wieder nach dem ersten Bissen, und noch einmal am Ende: »Du bist die tollste Köchin aller Zeiten.« Dabei waren wir klug genug, um zu wissen, dass die tollste Köchin aller Zeiten vermutlich mehr als nur ein Rezept (Hühnchen mit Möhren) beherrschen sollte und dass zu den meisten tollen Rezepten mehr als zwei Zutaten gehörten.
Und warum fragten wir nicht nach, als sie uns sagte, dass dunkle Lebensmittel grundsätzlich gesünder seien als helle oder dass sich die meisten Nährstoffe in der Schale oder Kruste befänden? (Die Sandwiches bei unseren Wochenendbesuchen bestanden aus aufbewahrten Pumpernickelenden.) Sie brachte uns bei, dass Tiere, die größer sind als wir, sehr gut für uns sind, Tiere, die kleiner sind als wir, auch gut für uns sind, dann kommen Fische (die keine Tiere sind), dann Thunfisch (der kein Fisch ist), dann Gemüse, Obst, Kuchen, Kekse und Limonade. Kein Nahrungsmittel schadet. Fette sind gesund – alle Fette, immer, in jeder Menge. Zucker ist sehr gesund. Je dicker ein Kind, umso gesünder – vor allem, wenn es ein Junge ist. Das Mittagessen besteht nicht aus einer, sondern aus drei Mahlzeiten, die um 11.00, 12.30 und 15.00 Uhr gegessen werden. Hunger hat man immer.
Ihr Hühnchen mit Möhren gehört vermutlich wirklich zum Köstlichsten, was ich je gegessen habe. Doch das hatte nichts mit der Art der Zubereitung zu tun oder gar damit, wie es schmeckte. Ihr Essen war köstlich, weil wir glaubten, dass es köstlich war. Wir glaubten glühender an die Kochkünste unserer Großmutter als an Gott. Ihr kulinarisches Können war eine unserer frühesten Geschichten, genau wie die Schläue des Großvaters, den ich nie kennengelernt hatte, oder der einzige Streit in der Ehe meiner Eltern. Wir hielten an diesen Geschichten fest und brauchten sie, um uns zu definieren. Wir waren eine Familie, die sich ihre Kämpfe mit Bedacht aussuchte, die sich mit Geschick aus der Klemme zog und die das Essen ihrer Matriarchin liebte.
Es war einmal eine Person, deren Leben war so gut, dass sich darüber keine Geschichte erzählen ließ. Über meine Großmutter könnte ich mehr Geschichten erzählen als über jeden anderen Menschen, den ich kenne – ihre weltferne Kindheit, ihr knappes Überleben, der alles umfassende Verlust, ihre Immigration in die USA und noch mehr Verlust, der Triumph und die Tragödie ihrer Assimilation –, und auch wenn ich eines Tages versuchen werde, all diese Geschichten meinen Kindern zu erzählen, haben wir sie uns untereinander nie erzählt. Ebenso wenig, wie wir meine Großmutter so angeredet haben, wie es naheliegend und passend gewesen wäre. Wir nannten sie die tollste Köchin.
Ihre anderen Geschichten waren vielleicht zu schwer, um erzählt zu werden. Oder vielleicht hatte sie ihre Geschichte so gewählt, weil sie die Versorgerin und nicht die Überlebende sein wollte. Oder vielleicht beinhaltet ihr Versorgen auch ihr Überleben: Die Geschichte ihrer Beziehung zu Essen umfasst alle anderen Geschichten, die sich über sie erzählen ließen. Für sie ist Essen nicht gleich Essen, sondern Schrecken, Würde, Dankbarkeit, Rache, Fröhlichkeit, Demütigung, Religion, Geschichte und natürlich Liebe. Als wären die Früchte, die sie uns immer anbot, von den zerstörten Ästen unseres Stammbaums gepflückt.
Wieder möglich
ALS ICH ERFUHR, dass ich Vater werde, regten sich unerwartete Impulse in mir. Ich fing an, das Haus aufzuräumen, tauschte längst kaputte Glühbirnen aus, putzte Fenster und ordnete Papiere. Ich ließ meine Brille richten, kaufte mir ein Dutzend Paar weiße Socken, montierte einen Dachgepäckträger aufs Auto und innen ein Trenngitter für den Hund, ließ mich zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder gründlich untersuchen … und beschloss, ein Buch über das Essen von Tieren zu schreiben.
Meine Vaterschaft war der unmittelbare Anstoß für die Reise, die dieses Buch werden sollte, aber die Koffer dafür hatte ich schon fast mein ganzes Leben lang gepackt. Als ich zwei war, waren alle Helden in meinen Gutenachtgeschichten Tiere. Als ich vier war, hüteten wir einen Sommer lang den Hund eines Cousins. Ich trat ihn. Mein Vater erklärte mir, dass man Hunde nicht tritt. Als ich sieben war, betrauerte ich den Tod meines Goldfischs. Ich erfuhr, dass mein Vater ihn die Toilette hinuntergespült hatte. Ich erklärte ihm – mit anderen, weniger höflichen Worten –, dass man Fische nicht die Toilette hinunterspült. Als ich neun war, hatte ich eine Babysitterin, die niemandem wehtun wollte. Sie sagte das einfach so, als ich sie fragte, ob sie nicht mit meinem älteren Bruder und mir Hühnchen essen wollte: »Ich möchte niemandem wehtun.«
»Wehtun?«, fragte ich.
»Du weißt doch, ein Huhn ist ein Huhn, oder?«
Frank warf mir einen Blick zu: Und dieser dummen Frau vertrauen Mum und Dad ihren kostbaren Nachwuchs an?
Ob sie uns bekehren wollte, sei dahingestellt – nur weil Vegetarier sich bei Gesprächen über Fleisch leicht in die Enge gedrängt fühlen, müssen sie nicht alle Missionare sein. Aber da sie ein Teenager war, nahm sie kein Blatt vor den Mund, was sonst oft verhindert, dass etwas so erzählt wird, wie es wirklich ist. Sie sagte ohne Umschweife, was sie wusste.
Mein Bruder und ich sahen uns an, den Mund voll mit Hühnchen, dem wir wehtaten, und dachten beide gleichzeitig: Wie kommt es, dass ich daran noch nie gedacht habe, und warum hat mir das noch nie jemand gesagt? Ich legte meine Gabel auf den Tisch. Frank aß alles auf und isst vermutlich gerade ein Hühnchen, während ich diese Zeilen schreibe.
Was unsere Babysitterin sagte, leuchtete mir nicht nur ein, weil es richtig schien, sondern weil es alles, was meine Eltern mir beigebracht hatten, auf Essen übertrug. Wir tun Familienangehörigen nicht weh. Wir tun Freunden oder Fremden nicht weh. Wir tun nicht einmal Polstermöbeln weh. Nur weil ich nicht daran gedacht hatte, Tiere in diese Liste aufzunehmen, hieß dies nicht, dass sie davon ausgenommen waren. Es hieß nur, dass ich ein Kind war, das nicht wusste, wie die Welt funktioniert. Bis ich es dann wusste. An diesem Punkt musste ich mein Leben ändern.
Und änderte es nicht. Mein anfangs so vehementer und unnachgiebiger Vegetarismus dauerte ein paar Jahre, flackerte auf und verging dann leise. Ich hatte dem Grundsatz unserer Babysitterin nichts entgegenzusetzen, aber ich fand Wege, ihn zu verwischen, herunterzuspielen und zu vergessen. Eigentlich verursachte ich ja kein Leid. Eigentlich bemühte ich mich, das Richtige zu tun. Eigentlich hatte ich ein reines Gewissen. Gib mir das Hühnchen, ich sterbe vor Hunger.
Mark Twain sagte, das Rauchen aufzugeben sei eine der leichtesten Übungen, er täte es ständig. Ich würde auch den Vegetarismus auf die Liste der leichten Übungen setzen. Während meiner Highschoolzeit wurde ich öfter Vegetarier, als ich mich heute erinnern kann, meistens, um mich abzugrenzen in einer Welt voller Menschen, denen eine Identität offenbar mühelos zuflog. Ich wollte ein Motto, das ich vor mir hertragen konnte, ein Thema, um die peinliche halbstündige Schulpause zu überbrücken, eine Gelegenheit, um den Brüsten von Aktivistinnen näher zu kommen. (Und ich fand es immer noch falsch, Tieren wehzutun.) Was mich nicht davon abhielt, Fleisch zu essen. Nur in der Öffentlichkeit hielt es mich davon ab. Zu Hause ging es weiter hin und her. Viele Abendessen in jenen Jahren begannen mit der Frage meines Vaters: »Gibt es heute irgendwelche kulinarischen Einschränkungen, von denen ich wissen sollte?«
Am College begann ich, viel Fleisch zu essen. Nicht, dass ich davon überzeugt war – was immer das bedeutete –, aber ich verbannte die Zweifel bewusst aus meinem Kopf. Ich hatte keine Lust, mich über ein Thema zu definieren. Und da mich in meinem Umfeld niemand als Vegetarier kannte, musste ich in der Öffentlichkeit nicht so tun als ob oder eine veränderte Haltung erklären. Vielleicht war es sogar der an der Uni weitverbreitete Vegetarismus, der meinen eigenen verhinderte – einem Straßenmusiker, dessen Koffer von Geldscheinen überquillt, gibt man schließlich auch eher kein Geld.
Als ich jedoch im zweiten Studienjahr Philosophie als Hauptfach wählte und zum ersten Mal ernsthaft dachte, wurde ich wieder Vegetarier. Das bewusste Verdrängen, das meiner Ansicht nach mit dem Essen von Fleisch verbunden war, stand im Widerspruch zu dem intellektuellen Flair, mit dem ich mich umgeben wollte. Ich fand, das Leben konnte, sollte und musste vernunftgesteuert sein. Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie unausstehlich ich war.
Als ich mit dem Studium fertig war, aß ich ungefähr zwei Jahre lang Fleisch – jede Menge unterschiedlichstes Fleisch. Warum? Weil es gut schmeckte. Und weil für das Ausbilden von Gewohnheiten die Geschichten, die wir uns und anderen erzählen, wichtiger sind als die Vernunft. Also erzählte ich mir selbst eine Geschichte über das Verzeihen.
Dann arrangierte jemand für mich ein Blind Date mit der Frau, die ich später heiratete. Und nur wenige Wochen später stellten wir verwundert fest, dass wir uns über zwei Themen unterhielten: Ehe und Vegetarismus.
Ihre Fleisch-Geschichte war meiner verblüffend ähnlich: Wenn sie abends im Bett lag, war sie von bestimmten Dingen überzeugt, und am Frühstückstisch am nächsten Morgen wurden Entscheidungen umgesetzt. Da war die nagende (wenn auch nur gelegentlich und kurzfristig vorhandene) Angst, dass sie etwas sehr Falsches mitmachte, und gleichzeitig wusste sie um die verwirrende Vielschichtigkeit des Themas und die verzeihliche Fehlbarkeit des Menschen. Wie ich hatte sie strenge Ansichten, aber sie waren offenbar nicht streng genug.
Menschen heiraten aus vielen verschiedenen Gründen. Wir entschlossen uns zu diesem Schritt, weil wir hofften, völlig neu anfangen zu können. Die jüdischen Rituale und Symbole unterstützen diesen Gedanken einer scharfen Abgrenzung von allem, was vorher war – das bekannteste Beispiel ist das Zerschlagen des Glases am Ende der Heiratszeremonie. Früher war es so, aber jetzt wird alles anders. Alles wird besser. Wir werden besser.
Klingt wirklich gut, aber in welcher Hinsicht besser? Ich hatte viele Ideen, auf welchem Gebiet ich besser werden konnte (fremde Sprachen lernen, geduldiger werden, härter arbeiten), aber ich hatte schon zu viele solcher Vorsätze gefasst, um noch an sie zu glauben. Ich hatte auch viele Ideen, auf welchem Gebiet wir besser werden konnten, aber in einer Beziehung gibt es nur wenige wichtige Dinge, auf die man sich einigen und die man verändern kann. Selbst in Augenblicken, in denen vieles möglich scheint, ist in Wirklichkeit nur wenig möglich.
Das Essen von Tieren, ein Thema, das uns beide bewegte und das wir beide vergessen hatten, schien ein guter Ansatzpunkt zu sein. Es hatte mit so vielem zu tun, und so vieles konnte sich daraus ergeben. Wir verlobten uns noch in derselben Woche und wurden Vegetarier.
Unsere Hochzeit war natürlich nicht vegetarisch. Wir redeten uns ein, dass wir unseren Gästen, von denen einige große Entfernungen zurückgelegt hatten, um mit uns zu feiern, unbedingt tierisches Eiweiß anbieten mussten. (Finden Sie das nicht auch logisch?) Auf unserer Hochzeitsreise aßen wir Fisch, aber wir waren ja auch in Japan, und wenn man in Japan ist … In unserem neuen Zuhause aßen wir manchmal Burger und Hühnersuppe und geräucherten Lachs und Thunfischsteak. Aber nur hin und wieder. Nur wenn uns danach war.
Das, dachte ich, reichte. Und ich dachte, das sei auch gut so. Ich stellte mir vor, wir würden nach einem bewusst inkonsequenten Speiseplan leben. Warum sollte sich Essen von anderen ethischen Bereichen unseres Lebens unterscheiden? Wir waren ehrliche Menschen, die manchmal logen, umsichtige Freunde, die manchmal ungeschickt vorgingen. Wir waren Vegetarier, die ab und zu Fleisch aßen.
Und ich war mir nicht einmal sicher, ob meine Erkenntnisse nicht nur sentimentale Überbleibsel aus meiner Kindheit waren oder ob ich nicht, wenn ich tief in mich hineinhorchte, auf Gleichgültigkeit stoßen würde. Ich wusste nicht, was Tiere waren, oder auch nur annähernd, wie sie gehalten oder getötet wurden. Die ganze Sache war mir unangenehm, doch das hieß nicht, dass es anderen ähnlich gehen oder dass es mir so gehen musste. Und ich sah auch keine Notwendigkeit, all diese Fragen schnell zu beantworten.
Doch dann wünschten wir uns ein Kind, und das war eine andere Geschichte, die nach einer anderen Geschichte verlangte.
Ungefähr eine halbe Stunde nach der Geburt meines Sohnes ging ich ins Wartezimmer, um der versammelten Familie die gute Nachricht zu überbringen.
»Du sagst er! Dann ist es ein Junge?«
»Wie soll er heißen?«
»Wem sieht er ähnlich?«
»Erzähl schon!«
Ich beantwortete ihre Fragen so schnell ich konnte, dann zog ich mich in eine Ecke zurück und schaltete mein Handy ein.
»Oma«, sagte ich, »wir haben ein Baby.«
Ihr einziges Telefon steht in der Küche. Sie hob gleich nach dem ersten Klingeln ab, was hieß, dass sie am Tisch gesessen und auf meinen Anruf gewartet hatte. Es war kurz nach Mitternacht. Ob sie gerade Gutscheine ausschnitt? Oder hatte sie Hühnchen mit Möhren zum Einfrieren vorbereitet, damit es jemand bei einem künftigen Besuch aß? Ich hatte sie nicht ein einziges Mal weinen sehen, doch jetzt waren die Tränen in ihrer Stimme nicht zu überhören, als sie fragte: »Wie schwer ist es?«
Ein paar Tage später, nach unserer Rückkehr aus dem Krankenhaus, schickte ich einem Freund ein Foto von meinem Sohn und beschrieb einige erste Eindrücke als Vater. Er antwortete schlicht: »Alles ist wieder möglich.« Es war die perfekte Antwort, denn sie traf genau meine Stimmung. Wir konnten unsere Geschichten neu erzählen und sie besser, bedeutungsvoller und eindringlicher machen. Oder wir konnten andere Geschichten erzählen. Die Welt war voller Möglichkeiten.
Tiere essen
DER ERSTE WUNSCH meines Sohnes war, ohne Worte und ohne schon darüber nachgedacht zu haben, der Wunsch zu essen. Nur Sekunden nach seiner Geburt trank er an der Brust. Ich beobachtete ihn mit einer Ehrfurcht, wie ich sie noch nie in meinem Leben empfunden hatte. Ohne Erklärung oder Erfahrung wusste er, was zu tun war. Millionen Jahre Evolution hatten dieses Wissen in ihm verankert, ebenso wie sie sein winziges Herz zum Schlagen brachten und das Ausdehnen und Zusammenziehen seiner gerade erst getrockneten Lungen bewirkten.
Diese Ehrfurcht, die ich so noch nie empfunden hatte, verband mich über Generationen hinweg mit anderen Menschen. Ich sah die Verästelungen meines Stammbaums: meine Eltern, die mir beim Essen zusahen, meine Großmutter, die meiner Mutter beim Essen zusah, meine Urgroßeltern, die meiner Großmutter zusahen … Er aß genauso wie die Kinder der Höhlenmaler.
Als mein Sohn sein Leben begann und ich dieses Buch, schien sich bei ihm fast alles ums Essen zu drehen. Er wurde gestillt, er schlief nach dem Stillen, er war quengelig, bevor er gestillt wurde, oder er gab die Milch von sich, die er getrunken hatte. Während ich dieses Buch zu Ende schreibe, ist er in der Lage, recht komplexe Unterhaltungen zu führen, und das Essen, das er zu sich nimmt, wird immer häufiger zusammen mit Geschichten verdaut, die wir ihm erzählen. Mein Kind zu ernähren ist anders, als mich zu ernähren: Es ist wichtiger. Es ist wichtig, weil Essen wichtig ist (seine Gesundheit ist wichtig, die Freude am Essen ist wichtig) und weil die Geschichten, die wir mit dem Essen servieren, wichtig sind. Diese Geschichten verbinden unsere Familie untereinander und mit anderen. Geschichten über Essen sind Geschichten über uns – unsere Vergangenheit und unsere Werte. Die jüdische Tradition meiner Familie hat mich gelehrt, dass Essen zwei parallele Zwecke erfüllt: Es ist nahrhaft und hilft beim Erinnern. Essen und Geschichten erzählen sind untrennbar miteinander verbunden – Salzwasser steht auch für Tränen; Honig schmeckt nicht nur süß, sondern lässt uns auch an Süße denken; die Matze ist das Brot unserer Not.
Es gibt Tausende von Nahrungsmitteln auf dem Planeten, und zu erklären, warum wir nur eine relativ kleine Auswahl essen, bedarf einiger Worte. Wir müssen erklären, dass die Petersilie auf dem Teller der Dekoration dient, dass man Pasta nicht zum Frühstück isst, warum wir Flügel essen, aber keine Augen, Rinder, aber keine Hunde. Geschichten erzählen uns etwas, und Geschichten legen Regeln fest.
Ich habe oft in meinem Leben vergessen, dass ich Geschichten über Essen erzählen kann. Ich aß einfach, was vorhanden oder lecker war, was mir natürlich, vernünftig oder gesund erschien – was gab es da zu erklären? Die Art von Elternschaft jedoch, wie ich sie immer leben wollte, verbietet ein solches Vergessen.
Diese Geschichte fing nicht als Buch an. Ich wollte einfach wissen – für mich und meine Familie –, was Fleisch ist. Ich wollte das so konkret wie nur möglich wissen. Wo kommt es her? Wie wird es produziert? Wie werden die Tiere behandelt, und inwieweit ist das wichtig? Welche ökonomischen, gesellschaftlichen und umweltrelevanten Auswirkungen hat das Essen von Tieren? Meine persönliche Suche war an diesem Punkt nicht zu Ende. Als Vater eines Kindes wurde ich mit Realitäten konfrontiert, die ich als Bürger nicht ignorieren und als Schriftsteller nicht für mich behalten konnte. Doch mit diesen Realitäten konfrontiert zu werden und verantwortungsbewusst darüber zu schreiben ist nicht dasselbe.
Ich wollte diese Fragen umfassend beantworten. Denn obwohl über 99 Prozent aller in diesem Land verzehrten Tiere aus »Massentierhaltungsbetrieben« stammen[a][2] – ich werde in einem Großteil des Buches erklären, was das heißt und warum es von Bedeutung ist –, ist das verbleibende eine Prozent der Nutztierhaltung auch ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Der unverhältnismäßig große Anteil des Buches, in dem es um die besten bäuerlichen Familienbetriebe geht, spiegelt wider, für wie wichtig ich sie halte, gleichzeitig aber auch, wie unwichtig: Ausnahmen bestätigen die Regel.
Um ganz ehrlich zu sein (und trotz des Risikos, meine Glaubwürdigkeit schon auf Seite 23 zu verlieren), glaubte ich schon vor Beginn meiner Recherchen zu wissen, was ich herausfinden würde – nicht in Einzelheiten, sondern als Gesamtbild. Andere schienen es ebenfalls zu wissen. Fast immer, wenn ich erzählte, dass ich ein Buch über »Tiere essen« schreibe, wurde angenommen – ohne meine Ansichten zu kennen –, dass es ein Plädoyer für den Vegetarismus werden würde. Eine aufschlussreiche Vermutung, die nicht nur impliziert, dass eine gründliche Erforschung landwirtschaftlicher Nutztierhaltung unweigerlich vom Fleischessen wegführt, sondern auch, dass die meisten Menschen bereits wissen, dass dies der Fall ist. (Was dachten Sie, als Sie den Titel dieses Buches lasen?)
Auch ich ging davon aus, dass mein Buch über das Essen von Tieren ein aufrichtiges Plädoyer für den Vegetarismus würde. Aber das ist es nicht. Ein aufrichtiges Plädoyer für den Vegetarismus wäre sicherlich ein wichtiges Sujet, aber ich habe hier etwas anderes geschrieben.
Landwirtschaftliche Nutztierhaltung ist ein enorm kompliziertes Thema. Weder zwei Tiere, Tierrassen, Farmen, Farmer noch Esser gleichen sich. Abgesehen von der enormen Recherchearbeit – lesen, interviewen, besichtigen –, die notwendig war, um überhaupt qualifiziert über diese Dinge nachzudenken, musste ich mich fragen, ob sich über eine so unterschiedlich gehandhabte Praxis überhaupt etwas Zusammenhängendes und Wichtiges sagen lässt. Vielleicht gibt es gar kein »Fleisch« als solches. Vielleicht gibt es nur dieses Tier, aufgewachsen auf dieser Farm, geschlachtet in diesem Betrieb, verkauft auf diesem Weg und gegessen von dieser Person – und jedes ist in einer Weise anders, dass es unmöglich ist, sie als Gesamtheit zu betrachten.
Und das Essen von Tieren gehört, ähnlich wie Abtreibung, zu den Themen, bei denen sich einige der wichtigsten Details unmöglich klären lassen (Wann ist ein Fötus ein Mensch, im Gegensatz zu einem potenziellen Menschen? Wie empfindet ein Tier wirklich?). All das löst ein tief sitzendes Unbehagen in uns aus und führt oft zu Aggressionen und Abwehr. Es ist ein strittiges, frustrierendes und nachklingendes Thema. Jede Frage löst die nächste aus, und man gerät leicht in eine radikalere Position, als man sie eigentlich vertreten will oder leben möchte. Oder noch schlimmer, man findet nichts, wofür es sich lohnen würde zu kämpfen oder wonach man leben könnte.
Dann gibt es die Schwierigkeit, zwischen Gefühl und Wirklichkeit zu unterscheiden. Viel zu oft sind Diskussionen über das Essen von Tieren keine Diskussionen, sondern Äußerungen über unsere Vorlieben. Und wo es Fakten gibt – so viel Schweinefleisch essen wir, so viele Mangrovensümpfe sind durch Aquakultur zerstört worden, so wird ein Rind getötet –, stellt sich die Frage, was wir eigentlich mit ihnen anfangen können. Sollen sie aus ethischer, gesellschaftlicher oder rechtlicher Sicht überzeugen? Oder sollen es nur weitere Informationen sein, die jeder Esser so verdauen kann, wie er es für richtig hält?
Dieses Buch basiert auf einer Vielzahl von Recherchen und ist so objektiv, wie ein journalistisches Werk nur sein kann – ich habe die konservativsten Statistiken verwendet, die es gab (fast immer staatliche und von Fachleuten geprüfte Quellen aus Wissenschaft und Industrie), und zwei unabhängige Experten engagiert, um sie zu bestätigen. Trotzdem ist das Buch für mich eine Geschichte. Es gibt jede Menge Daten, aber sie sind oft wenig aussagekräftig. Fakten sind wichtig, bedürfen aber einer Interpretation, um einen Sinn zu ergeben. Was bedeutet »exakt erfasste Schmerzreaktion bei Hühnern«? Sagt sie etwas über den Schmerz aus? Was bedeutet »Schmerz«? Auch wenn wir noch so viel über die physiologische Seite von Schmerz wissen – wie lange er andauert, die Symptome, die er hervorruft, und so fort –, sagt nichts davon etwas Maßgebliches aus. Bringt man aber Fakten in einer Geschichte unter, die von Mitgefühl oder Herrschaft erzählt oder vielleicht von beidem – bringt man sie in einer Geschichte über die Welt unter, in der wir leben, und darüber, wer wir sind und wer wir sein möchten –, dann kann man anfangen, sinnvoll über das Essen von Tieren zu reden.
Wir bestehen aus Geschichten. Ich denke an die Samstagnachmittage am Küchentisch meiner Großmutter, nur wir zwei – Brot röstete im Toaster, ein summender Kühlschrank, der vor lauter Familienfotos nicht zu sehen war. Über Pumpernickelenden und Cola erzählte sie mir von ihrer Flucht aus Europa, davon, was sie essen musste, und davon, was sie nicht aß. Es war ihre Lebensgeschichte – »Hör gut zu«, beschwor sie mich –, und ich wusste, mir wurde eine grundlegende Lektion vermittelt, auch wenn ich als Kind nicht wusste, worin sie bestand.
Heute weiß ich es. Und obwohl sich die Bedingungen grundlegend verändert haben, will und werde ich versuchen, meinem Sohn ihre Lektion zu vermitteln. Und zwar mit diesem Buch. Jetzt zu Beginn fühle ich mich sehr unruhig, weil die Tragweite des Themas so enorm ist. Abgesehen von den über zehn Milliarden Landtieren, die in Amerika jedes Jahr zum Verzehr geschlachtet werden, und abgesehen von der Umwelt und den Arbeitern und unmittelbar damit einhergehenden Themen wie Welthunger, Grippeepidemien und Biodiversität, bleibt immer noch die Frage, wie wir uns und andere sehen. Wir sind nicht nur die Erzähler unserer Geschichten, wir sind auch der Inhalt der Geschichten. Wenn meine Frau und ich unseren Sohn als Vegetarier erziehen, wird er nicht das einzige Gericht seiner Urgroßmutter essen, wird er nie in den Genuss dieses einzigartigen und direktesten Ausdrucks ihrer Liebe kommen, wird er vielleicht nie von ihr als tollster Köchin aller Zeiten sprechen. Ihre erste Geschichte, die erste Geschichte unserer Familie, wird sich ändern müssen.[b]
Als meine Großmutter meinen Sohn zum ersten Mal sah, sagte sie: »Meine Revanche.« Sie hätte unendlich viel sagen können, aber sie entschied sich dafür, oder es wurde für sie entschieden.
Hör gut zu:
»WIR WAREN NICHT REICH, aber wir hatten immer genug. Donnerstags haben wir Brot gebacken und Challa und Brötchen, und das reichte für die ganze Woche. Freitags gab es Pfannkuchen. Am Schabbat gab es immer Hühnchen und Nudelsuppe. Man ging zum Schlachter und fragte nach etwas mehr Fett. Das fetteste Stück war das beste Stück. Nicht so wie heute. Wir hatten keine Kühlschränke, aber wir hatten Milch und Käse. Wir hatten nicht alle Gemüsesorten, aber wir hatten genug. Was ihr heute alles habt und als selbstverständlich voraussetzt … Aber wir waren glücklich. Wir wussten es nicht besser. Und auch wir setzten das, was wir hatten, als selbstverständlich voraus.
Dann wurde alles anders. Der Krieg war die Hölle auf Erden, ich hatte nichts. Ich verließ meine Familie. Ich bin immer gerannt, Tag und Nacht, weil die Deutschen mir immer auf den Fersen waren. Wenn man stehen blieb, war man tot. Es gab nie genug zu essen. Ich wurde immer kränker vom Nichtessen. Ich war nur noch Haut und Knochen und hatte überall am Körper Wunden. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Es machte mir nichts aus, aus Mülltonnen zu essen. Ich aß das, was andere übrig gelassen hatten. Wenn man sich selbst half, konnte man überleben. Ich nahm, was ich finden konnte. Ich aß Sachen, die ich dir lieber nicht beschreibe.
Selbst in den schlimmsten Zeiten traf ich auch gute Menschen. Jemand gab mir den Tipp, meine Hosen unten zuzubinden, um die Hosenbeine mit möglichst vielen gestohlenen Kartoffeln zu füllen. Damit lief ich Kilometer um Kilometer, man wusste ja nie, wann man wieder Glück hatte. Einmal schenkte mir jemand ein bisschen Reis, und ich war zwei Tage zu einem Markt unterwegs und tauschte den Reis gegen etwas Suppe, dann ging ich zu einem anderen Markt und tauschte die Suppe gegen ein paar Bohnen. Man musste Glück haben und erfinderisch sein.
Am schlimmsten war es gegen Kriegsende. Viele Menschen starben noch am Ende, und ich wusste nicht, ob ich noch einen Tag überleben konnte. Ein Bauer, ein Russe, Gott schütze ihn, sah, wie es um mich bestellt war, ging in sein Haus und kam mit einem Stück Fleisch für mich zurück.«
»Er hat dir das Leben gerettet.«
»Ich habe es nicht gegessen.«
»Du hast es nicht gegessen?«
»Es war Schwein. Ich würde nie Schwein essen.«
»Warum nicht?«
»Was meinst du wohl, warum nicht?«
»Doch nicht, weil es nicht koscher war?«
»Natürlich.«
»Auch nicht, um dein Leben zu retten?«
»Wenn nichts mehr wichtig ist, gibt es nichts zu retten.«
Moderne Angelschnüre können bis zu 120 Kilometer lang sein – die gleiche Entfernung wie vom Meeresspiegel bis zum Weltraum.[3]
1.George
DIE ERSTEN 26 JAHRE meines Lebens mochte ich keine Tiere. Ich fand sie lästig, schmutzig, vollkommen unzugänglich, furchtbar unberechenbar, schlicht und ergreifend überflüssig. Vor allem für Hunde konnte ich mich nicht erwärmen, was größtenteils auf eine Angst zurückzuführen war, die ich von meiner Mutter geerbt hatte und sie von meiner Großmutter. Als Kind ging ich nur zu Freunden, wenn sie ihre Hunde wegsperrten. Wenn mir im Park ein Hund näher kam, wurde ich so hysterisch, dass mich mein Vater auf die Schultern hob. Ich sah mir nicht gerne Fernsehfilme an, in denen Hunde vorkamen. Ich konnte Leute nicht verstehen – ich mochte sie nicht –, die sich für Hunde begeisterten. Vielleicht hatte ich sogar ein unterschwelliges Vorurteil gegen Blinde.
Und dann wurde ich eines Tages jemand, der Hunde liebte. Ich wurde ein Hunde-Typ.
George kam im Grunde aus dem Nichts. Meine Frau und ich hatten nicht darüber nachgedacht, einen Hund anzuschaffen, geschweige denn, uns nach einem umzusehen. (Warum sollten wir? Ich mochte keine Hunde.) Der erste Tag vom Anfang meines neuen Lebens war ein Samstag. Wir gingen in Brooklyn, wo wir wohnten, die Seventh Avenue entlang und stießen auf einen winzigen schwarzen Welpen. Wie ein Fragezeichen lag er schlafend am Bordstein, in seine Adoptier-mich-Weste eingerollt. Ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick oder an Schicksal, aber ich liebte diesen verdammten Hund sofort, es sollte einfach so sein. Auch wenn ich ihn nicht anfassen mochte.
Der Vorschlag, den Welpen mitzunehmen, war vielleicht das Unvorhersehbarste, was jemals von mir kam. Aber diesem wunderschönen kleinen Tier konnte selbst ich als hartherziger Hundeskeptiker nicht widerstehen. Natürlich kann man auch etwas anderes als feuchte Schnauzen schön finden. Aber sich in Tiere zu verlieben ist etwas ganz Besonderes. Alle haben sie ihre ergebenen Fans: riesige Hunde und klitzekleine Hunde und langhaarige und seidig glänzende Hunde, schnarchende Bernhardiner, asthmatische Möpse, faltige Shar-Peis und melancholisch dreinblickende Bassets. Vogelfreunde suchen in aller Frühe in der Kälte Himmel und Unterholz nach den gefiederten Liebesobjekten ab. Katzenfreunde legen in ihren Liebesbekundungen eine Heftigkeit an den Tag, die in den meisten menschlichen Beziehungen – Gott sei Dank – fehlt. Kinderbücher sind voll von Kaninchen, Mäusen, Bären und Raupen, ganz zu schweigen von Spinnen, Grillen und Krokodilen. Plüschspielzeug in Steinform will niemand haben, und wenn ein begeisterter Briefmarkensammler von seiner Liebe zu Briefmarken spricht, ist das eine völlig andere Art von Zuneigung.
Wir nahmen den Welpen mit nach Hause. Ich umarmte ihn – sie – von der anderen Zimmerseite aus. Dann, weil er – sie – mir Grund zu der Annahme gab, dass ich keine Finger verlieren würde, durfte sie mir aus der Hand fressen. Dann durfte sie mir die Hand lecken. Und dann das Gesicht. Und dann leckte ich ihr das Gesicht. Heute liebe ich alle Hunde und werde bis an mein Lebensende glücklich und zufrieden sein.
63 Prozent aller amerikanischen Haushalte haben mindestens ein Haustier.[4] Dieser hohe Prozentsatz beeindruckt vor allem, weil das Phänomen relativ neu ist. Das Halten von Haustieren ging mit dem Erstarken der Mittelschicht und der Urbanisierung einher,[5] vielleicht weil infolgedessen der Kontakt zu anderen Tieren verloren ging oder schlicht weil Haustiere Geld kosten und deshalb ein Symbol für Wohlstand sind (Amerikaner geben jährlich 34 Milliarden Dollar für ihre Haustiere aus).[6] Der in Oxford lehrende Historiker Sir Keith Thomas, dessen umfassendes Werk Man and the Natural World heute als Klassiker gilt, sagt dazu:
die Verbreitung der Haustierhaltung unter den städtischen Mittelschichten in der frühen Moderne … ist eine Entwicklung von sozialer, psychologischer und sogar kommerzieller Bedeutung … Sie hatte auch auf geistiger Ebene Folgen, denn sie animierte die Mittelschichten zu positiven Urteilen über tierische Intelligenz; sie führte zu zahllosen Anekdoten über tierische Klugheit; sie förderte die Vorstellung, dass Tiere Charakter und individuelle Persönlichkeit besitzen können; und sie schuf die psychologische Basis für die Auffassung, dass zumindest einige Tiere ein Recht darauf haben, in moralischer Hinsicht betrachtet zu werden.[7]
Es wäre falsch zu sagen, dass meine Beziehung zu George mir die »Klugheit« von Tieren offenbart hätte. Abgesehen von ihren grundlegenden Bedürfnissen habe ich nicht die leiseste Ahnung, was in ihrem Kopf vorgeht. (Obwohl ich mittlerweile überzeugt bin, dass, abgesehen von grundlegenden Bedürfnissen, sehr viel darin vorgeht.) Ihre mangelnde Intelligenz überrascht mich genauso oft wie ihre Intelligenz. Die Unterschiede zwischen uns sind immer präsenter als die Ähnlichkeiten.
George ist kein Schoßhündchen, das nur gehätschelt werden und kuscheln möchte. Sie kann einem ziemlich oft höllisch auf die Nerven gehen. Sie befriedigt sich ständig vor Gästen, knabbert meine Schuhe und die Spielsachen meines Sohnes an, tötet mit Begeisterung Eichhörnchen, hat die einzigartige Fähigkeit, sich bei jedem Foto, das in ihrer Nähe gemacht wird, vor die Linse zu setzen, stürzt sich auf Skateboarder und chassidische Juden, demütigt menstruierende Frauen (und ist der schlimmste Albtraum menstruierender chassidischer Jüdinnen), presst ihren stinkenden Hintern an den am wenigsten interessierten Menschen im Raum, gräbt frisch Gepflanztes aus, zerkratzt neu Angeschafftes, schleckt an Essen, das aufgetragen werden soll, und rächt sich manchmal (nur wofür?), indem sie ins Haus kackt.
Unsere diversen Kämpfe – zu kommunizieren, die Wünsche des anderen wahrzunehmen und darauf einzugehen, miteinander zu leben – zwingen mich, mit etwas, oder besser, jemand völlig Fremdem umzugehen und zu interagieren. George ist in der Lage, auf eine gewisse Anzahl Wörter zu reagieren (und zieht es vor, eine etwas größere Anzahl zu überhören), aber unsere Beziehung findet fast gänzlich auf der außersprachlichen Ebene statt. Sie scheint Gedanken und Gefühle zu haben. Manchmal meine ich, sie zu verstehen, oft aber auch nicht. Wie ein Foto kann sie mir nicht sagen, was sie mir zeigt. Sie ist ein Gestalt gewordenes Rätsel. Und für sie bin ich vermutlich auch ein Foto.
Erst gestern Abend blickte ich von meinem Buch hoch und sah, dass George mich aus einer Zimmerecke anstarrte. »Wann bist du denn hier reingekommen?«, fragte ich. Sie senkte ihren Blick und trottete durch den Flur davon – nicht so sehr als Silhouette, sondern eher als negativer Raum, als aus unserem häuslichen Leben herausgeschnittene Form. Trotz unserer Verhaltensmuster, die eingespielter sind als alles, was ich mit einem anderen Menschen teile, empfinde ich sie immer noch als unberechenbar. Und trotz unserer Nähe ist ihre Andersartigkeit für mich manchmal überwältigend und macht mir sogar ein bisschen Angst. Durch unser Kind hat sich dieses Gefühl noch verstärkt, denn es gibt absolut keine Garantie – außer meiner absoluten Gewissheit, dass sie es nicht tun wird –, dass sie das Baby nicht zerfleischen würde.
Die Liste unserer Unterschiede könnte ein Buch füllen, doch wie ich fürchtet George Schmerz, sucht Vergnügen und sehnt sich nicht nur nach Futter und Spiel, sondern auch nach Kameradschaft. Ich muss ihre Stimmungen und Vorlieben nicht im Einzelnen kennen, um zu wissen, dass sie welche hat. Unsere Eigenarten sind nicht die gleichen oder auch nur ähnlich, aber jeder von uns hat seine spezifische und einzigartige Sicht und Art, wie er die Welt gestaltet und erlebt.
Ich würde George nicht essen, weil sie mir gehört. Aber warum würde ich auch keinen Hund essen, dem ich nie begegnet bin? Oder anders gefragt, wie kann ich rechtfertigen, dass ich Hunde verschone, andere Tiere aber nicht?
Ein Plädoyer für das Essen von Hunden
TATSACHE IST, dass es in 44 Staaten völlig legal ist, den »besten Freund des Menschen« zu essen, und trotzdem ist es in den Köpfen ebenso tabu wie die Vorstellung, dass ein Mensch seinen besten Freund isst. Kein noch so leidenschaftlicher Fleischesser verspeist Hunde. Der TV-Unterhalter und Manchmal-Koch Gordon Ramsay kann ziemlich gnadenlos mit jungen Tieren umgehen, wenn er für eines seiner Produkte Werbung macht, aber man wird nie einen Welpen aus einem seiner Kochtöpfe lugen sehen. Und auch wenn er einmal sagte, er würde seine Kinder mit elektrischem Strom töten, wenn sie Vegetarier würden[8], frage ich mich, wie er wohl reagierte, wenn jemand das Hündchen der Familie pochieren würde.
Hunde sind wundervoll, und in vielerlei Hinsicht einzigartig. Aber wenn es um ihren Intellekt und ihr Erfahrungswissen geht, sind sie bemerkenswert unbemerkenswert. Schweine sind in jeder Hinsicht mindestens genauso intelligent und empfindsam. Sie können nicht hinten in einen Volvo springen, aber sie können holen, rennen und spielen, böse sein und Zuneigung erwidern. Warum also dürfen sie nicht gemütlich vor dem Kamin liegen? Warum kann man ihnen nicht wenigstens ersparen, gegrillt zu werden?
Unser Tabu, Hund zu essen, sagt etwas über Hunde und sehr viel über uns aus.
Die Franzosen, die ihre Hunde lieben, essen manchmal ihre Pferde.
Die Spanier, die ihre Pferde lieben, essen manchmal ihre Kühe.
Die Inder, die ihre Kühe lieben, essen manchmal ihre Hunde.[9]
Obwohl sie in einem völlig anderen Kontext geschrieben sind, haben George Orwells Worte (aus Farm der Tiere) hier durchaus Gültigkeit: »Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher.« Der Beschützerinstinkt, den wir manchen Tieren gegenüber empfinden, ist kein Naturgesetz, vielmehr rührt er von den Geschichten, die wir über die Natur erzählen.
Wer hat also recht? Welches könnten die Gründe sein, warum Hundefleisch nicht auf der Speisekarte steht? Der wählerische Fleischesser schlägt vor:
Man isst keine Haustiere. Aber Hunde werden dort, wo sie gegessen werden, nicht als Haustiere gehalten. Und was ist mit unseren Nachbarn, die keine Haustiere haben? Hätten wir das Recht zu protestieren, wenn es bei ihnen Hund zum Abendessen gibt?
Gut, dann vielleicht so:
Man isst keine Tiere mit ausgeprägten geistigen Fähigkeiten. Wenn wir mit »ausgeprägten geistigen Fähigkeiten« das meinen, was ein Hund hat, dann schön und gut für den Hund. Aber eine solche Definition würde auch Schweine, Kühe, Hühner und viele Meerestierarten einschließen. Und sie würde schwerbehinderte Menschen ausschließen.
Dann eben:
Aus gutem Grund gelten die ewigen Tabus – Spielen mit Exkrementen, Küssen der eigenen Schwester, Essen der eigenen Haustiere. In evolutionärer Hinsicht ist ein solches Verhalten schlecht für uns. Aber das Essen von Hunden war und ist vielerorts nicht tabu, und es ist keineswegs schlecht für uns. Richtig durchgegart, stellt Hundefleisch weder ein größeres Gesundheitsrisiko als jedes andere Fleisch dar, noch führt eine nährstoffreiche Hundefleischmahlzeit zu Widerstand bei unseren selbstsüchtigen Genen.
Der Verzehr von Hunden hat eine stolze Tradition. Grabstätten aus dem 4. Jahrhundert nach Christus enthalten Darstellungen, wo Hunde zusammen mit anderen Tieren geschlachtet werden[10]. Es war ein derart bedeutender Brauch, dass er in die Sprache einging: Das sinokoreanische Zeichen für »gut und angemessen« (yeon) heißt wörtlich übersetzt »gekochtes Hundefleisch ist lecker«.[11] Hippokrates pries Hundefleisch als einen Quell von Stärke. Die Römer aßen »gesäugte Welpen«,[12] die Dakota-Indianer liebten Hundeleber,[13] und noch vor gar nicht langer Zeit verzehrten Hawaiianer Hundehirn und -blut.[14] Der mexikanische Nackthund war die wichtigste Fleischsorte der Azteken.[15] Captain Cook aß Hundefleisch.[16] Roald Amundsen verspeiste bekanntermaßen seine Schlittenhunde. (Er war aber auch wirklich hungrig.) Und auf den Philippinen isst man immer noch Hunde, um Pechsträhnen zu überwinden;[17] in China und Korea als Medizin;[18] in Nigeria zur Steigerung der Libido[19] und in vielen Gegenden auf jedem Kontinent, weil sie gut schmecken. Die Chinesen haben jahrhundertelang spezielle Hunderassen wie den blauzüngigen Chow-Chow gezüchtet (»chow-chow« bedeutet auf Chinesisch »gut gebraten«),[20] und in vielen europäischen Ländern gibt es noch immer gesetzliche Regelungen über die Fleischbeschau von Hunden zum menschlichen Verzehr.[21]
Nur weil etwas fast überall und fast immer so gemacht wurde, rechtfertigt dies natürlich nicht, es heute zu tun. Aber im Gegensatz zu Mastfleisch, für das Tiere gezüchtet und gehalten werden müssen, bieten Hunde sich geradewegs zum Verzehr an. Drei bis vier Millionen Hunde und Katzen werden jährlich eingeschläfert.[22] Das sind Millionen Kilos Fleisch, die jedes Jahr weggeworfen werden. Allein die Entsorgung der eingeschläferten Hunde ist ein enormes ökologisches und wirtschaftliches Problem. Es wäre unsinnig, Haustiere aus ihren Familien zu reißen. Aber Streuner, Ausreißer, Hunde, die nicht niedlich genug sind, um von jemandem aufgenommen zu werden, Hunde, die sich nicht zähmen lassen – sie zu verzehren wäre eine ernsthaft zu bedenkende Alternative.
In gewisser Weise tun wir das ja schon. In Tierverarbeitungsbetrieben, wo aus für den menschlichen Verzehr ungeeignetem tierischem Eiweiß Futter für Nutz- und Haustiere produziert wird, werden etwa nutzlose tote Hunde in produktive Teile der Nahrungskette verwandelt. In Amerika werden Abermillionen Hunde und Katzen, die in Tierheimen eingeschläfert werden, Futter für unsere Nahrung. (Es werden doppelt so viele Hunde und Katzen eingeschläfert wie adoptiert.)[23] Doch vergessen wir einfach diesen uneffizienten und grotesken Zwischenschritt.
Dadurch werden wir keine Barbaren. Wir lassen sie ja nicht länger leiden als unbedingt nötig. Trotz der weitverbreiteten Meinung, dass Adrenalin Hundefleisch geschmacklich verbessert – daher die traditionellen Schlachtmethoden: aufhängen, bei lebendigem Leib in heißem Wasser brühen, totschlagen –, sind wir uns alle einig, dass, wenn wir sie schon essen, wir sie schnell und schmerzlos töten sollten, oder? Die traditionelle hawaiianische Methode zum Beispiel – dem Hund wird die Nase zugehalten, damit er kein Blut verliert – sollte ein gesellschaftliches Tabu sein, wenn nicht gar gesetzlich verboten werden. Vielleicht könnten wir Hunde in die amerikanische Tierschutzschlachtverordnung (Humane Methods of Slaughter Act) mit aufnehmen. Dieses Gesetz sagt zwar nichts darüber aus, wie die Tiere zu Lebzeiten behandelt werden sollen, und es gibt auch keine entsprechende effektive Kontrolle, aber wir können uns ja darauf verlassen, dass die Industrie sich »selbst reguliert«, wie wir das bei anderen Tieren, die wir essen, auch tun.
Nur die wenigsten Menschen machen sich klar, was für eine kolossale Aufgabe es ist, eine Welt von Milliarden von Fleischessern zu ernähren, die zu ihren Kartoffeln ein Stück Fleisch wollen. Der ineffiziente Umgang mit Hunden – die doch günstigerweise bereits in stark besiedelten Gebieten leben (Verfechter regional erzeugter Lebensmittel: aufgepasst) – sollte jedem Ökologen die Schamesröte ins Gesicht treiben.
Man könnte manchen Tierschutzgruppen schlimmste Heuchelei vorwerfen, weil sie Unmengen Geld und Energie in den unnützen Versuch stecken, die Zahl ungewollter Hunde zu verringern, während sie gleichzeitig das unverantwortliche Hundefleischtabu propagieren. Ließen wir Hunde Hunde sein und ihrer Vermehrung freien Lauf, würden wir einen nachhaltigen, lokalen Fleischvorrat schaffen, der wenig Aufwand erfordert und noch die effizienteste auf Beweidung basierende Viehhaltung in den Schatten stellen würde. Für die ökologisch Gesinnten wird es Zeit anzuerkennen, dass Hundefleisch ein realistisches Nahrungsmittel für realistische Umweltschützer ist.
Seien wir nicht so sentimental. Hunde gibt es massenhaft, sie schaden uns nicht, sind leicht zu kochen und schmackhaft; sie zu essen ist bei Weitem vernünftiger, als sich die Mühe zu machen, sie zu Futter für andere Tierarten zu verarbeiten, die uns als Nahrung dienen.
Für alle, die schon jetzt überzeugt sind, hier ein klassisches Rezept von den Philippinen. Ich selbst habe es noch nicht probiert, aber manchmal liest man nur ein Rezept und weiß schon, wie es schmecken wird.
Töten Sie einen Hund mittlerer Größe und brennen Sie ihm über einem heißen Feuer das Fell weg. Entfernen Sie in noch warmem Zustand vorsichtig die Haut und legen Sie sie für später beiseite (kann noch für andere Rezepte verwendet werden). Schneiden Sie das Fleisch in 2 Zentimeter große Würfel und legen Sie diese 2 Stunden lang in eine Marinade aus Essig, Pfefferkörnern, Salz und Knoblauch. Braten Sie das Fleisch in einem Wok mit etwas Öl über einem offenen Feuer an, fügen Sie Zwiebeln und klein geschnittene Ananas hinzu und lassen Sie alles zusammen kurz schmoren. Gießen Sie Tomatensoße und kochendes Wasser dazu, schmecken Sie mit grünem Pfeffer, Lorbeer und Tabasco ab. Mit Deckel so lange köcheln lassen, bis das Fleisch zart ist. Mischen Sie pürierte Hundeleber unter und lassen alles noch weitere 5 bis 7 Minuten kochen.
Ein simpler Trick vom Hobbyastronomen: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, etwas richtig zu sehen, schauen Sie knapp daran vorbei. Die lichtempfindlichsten Teile unserer Augen (die wir zum Sehen schemenhafter Gegenstände brauchen) befinden sich am Rand des Bereichs, den wir normalerweise zum Scharfsehen benutzen.
Tiere essen hat etwas Unsichtbares. Über Hunde nachzudenken und über ihre Beziehung zu den Tieren, die wir essen, hat etwas von diesem Vorbeischauen, um so das Unsichtbare sichtbar zu machen.
2.Freunde und Feinde
HUNDE UND FISCHE passen nicht zusammen. Hunde passen zu Katzen, Kindern und Feuerwehrmännern. Wir teilen Essen und Bett mit ihnen, nehmen sie mit ins Flugzeug und bringen sie zum Arzt, erfreuen uns an ihrer Freude und betrauern ihren Tod. Fische passen zu Aquarien oder Remouladensoße, sie gehören zwischen Essstäbchen und spielen für uns keine große Rolle. Die Wasseroberfläche und ihre Schweigsamkeit trennen sie von uns.
Die Unterschiede zwischen Hunden und Fischen könnten nicht größer sein. Immer wenn wir das Wort Fischverwenden, denken wir an eine unvorstellbare Menge, ein Meer von über 31000 verschiedenen Arten[25]. Hunde dagegen sehen wir entschieden in der Einzahl: eine Art, die uns oft durch einen persönlichen Namen bekannt ist wie etwa George. Ich gehöre zu den 95 Prozent männlichen Hundebesitzern, die mit ihren Hunden sprechen – wenn auch nicht unbedingt zu den 87 Prozent, die glauben, dass ihre Hunde antworten[26]. Man kann sich allerdings nur schwer vorstellen, wie ein Fisch seine Wahrnehmungen innerlich verarbeitet, und noch viel weniger, mit ihm eine enge Beziehung einzugehen. Fische nehmen kleinste Veränderungen des Wasserdrucks wahr, erkennen unterschiedlichste chemische Stoffe, die andere Meerestiere absondern, und reagieren auf Geräusche, die bis zu 19 Kilometer von ihnen entfernt entstanden sind.[27] Hunde sind hier, sie tapsen mit dreckigen Pfoten durch unsere Wohnzimmer und schnarchen unter unseren Schreibtischen. Fische leben immer in einem anderen Element, stumm und ernst, beinlos und langweilig. Laut Bibel wurden sie an einem anderen Tag erschaffen als der Mensch, und so werden sie als wenig schmeichelhafte frühe Sackgasse in der Entwicklung des Tierreichs in Richtung Mensch wahrgenommen.
Früher wurde Thunfisch – ich beziehe mich hier auf Thunfisch als den meistverzehrten Fisch in den Vereinigten Staaten – mit einzelnen Haken und Leinen gefangen, die von einzelnen Fischern ausgeworfen wurden. Sobald ein Fisch am Haken hing, verblutete oder ertrank er (Fische ertrinken, wenn sie sich nicht bewegen können) und konnte dann an Bord gezogen werden. Größere Fische (zu denen neben Thunfisch auch Schwertfisch und Marlin gehören) wurden durch den Haken oft nur verletzt, sie waren aber in diesem Zustand aufgrund ihrer kolossalen Kraft durchaus noch in der Lage, sich dem Zug der Leine stunden- oder tagelang zu widersetzen.[28] Zwei und manchmal drei Männer waren erforderlich, um ein einziges Tier einzuholen. Um große Fische ins Boot zu ziehen, wenn sie in Reichweite kamen, benutzte und benutzt man ein pickelähnliches Werkzeug, das Gaff. Man schlägt es in eine Flanke, Flosse oder gar in ein Auge und hat so einen effektiven, wenn auch blutigen »Griff«. Besonders effektiv scheint es auch zu sein, den Haken des Gaffs unter der Wirbelsäule zu platzieren. Andere – wie die Autoren eines Angelhandbuchs der Vereinten Nationen – empfehlen: »Wenn möglich, am Kopf gaffen.«[29]
Früher mussten Fischer die Thunfischschwärme mühsam ausfindig machen und hievten dann mit viel Muskeleinsatz einen Fisch nach dem anderen mit Angel und Gaff ins Boot. Der Thunfisch, der heute auf unseren Tellern landet, wird praktisch nie mit einer einfachen Angel gefangen, sondern mit Ringwadennetzen (auch Taschennetze genannt) oder Langleinen. Da ich über die üblichsten Fangtechniken der am häufigsten gegessenen Meerestiere Bescheid wissen wollte, konzentrierte sich meine Recherche auf die modernen Methoden des Thunfischfangs – doch dazu später.[30]
Im Internet wimmelt es von Filmchen über das Angeln. Schlechter B-Rock untermalt Großtaten von Anglern, die sich aufführen, als hätten sie gerade jemandem das Leben gerettet, nachdem sie einen erschöpften Marlin oder Blauflossenthunfisch an Bord gezogen haben. Es gibt auch Frauen im Bikini beim Gaffen eines Fisches, kleine Kinder beim Gaffen eines Fisches, Anfänger beim Gaffen eines Fisches. Jenseits dieses grotesken Ritualismus sah ich immer wieder die Fische auf den Videos vor mir, in dem Augenblick, als sich das Gaff in der Hand des Anglers auf das Fischauge zubewegte …
Kein Leser dieses Buches würde es dulden, wenn jemand mit einem Pickel auf das Gesicht eines Hundes losginge. Nichts ist naheliegender oder weniger erklärungsbedürftig. Ist diese moralische Betroffenheit unangebracht, wenn wir sie auf Fische übertragen, oder ist unsere bedingungslose Sorge um Hunde einfach nur albern? Ist es grausam, Tiere langwierigen Todesqualen auszusetzen, oder ist das nur bei manchen Tieren grausam?
Kann uns die Vertrautheit mit unseren Haustieren nicht als Leitfaden dienen, wenn wir über Tiere nachdenken, die wir essen? Wie weit sind Fische (oder Rinder, Schweine und Hühner) in der Ordnung des Lebens eigentlich von uns entfernt? Trennt uns ein Abgrund, oder sind wir nur zwei verschiedene Äste eines Baums? Sind Nähe und Distanz überhaupt wichtig? Träte uns eines Tages eine stärkere und intelligentere Lebensform als unsere eigene gegenüber und würde uns so sehen, wie wir Fische sehen, was könnten wir dann als Argument anführen, dass man uns nicht isst?
Jedes Jahr hängen das Leben von Milliarden Tieren und die Stabilität der größten Ökosysteme auf unserem Planeten von den dürftigen Antworten ab, die wir auf diese Fragen geben. Natürlich sind solche globalen Belange sehr abstrakt. Wir kümmern uns am meisten um das, was uns nah ist, und es fällt uns bemerkenswert leicht, alles andere zu vergessen. Zudem leitet uns der starke Impuls, immer zu tun, was andere um uns herum tun, vor allem, wenn es um Essen geht. Die Ethik des Essens ist so komplex, weil Essen mit Geschmacksknospen und Geschmack zu tun hat, mit individuellen Biografien und Gesellschaftsgeschichte. Der so sehr auf Vielfalt bedachte Westen ist Menschen mit anderen Essgewohnheiten gegenüber vermutlich toleranter, als es bisher jede andere Kultur gewesen ist. Ironischerweise gilt aber oft der überhaupt nicht wählerische Allesesser – »Ich bin umkompliziert«, »Ich esse alles« – gesellschaftlich als wesentlich sensibler als jemand, der versucht, sich so zu ernähren, dass es für die Gesellschaft gut ist. Ernährungsentscheidungen hängen von vielen Faktoren ab, Ratio (oder womöglich Bewusstheit) steht dabei normalerweise nicht weit oben auf der Liste.
Das Essen von Tieren hat etwas Polarisierendes: Iss sie nie oder stelle nie ernsthaft infrage, ob du sie essen sollst; werde Aktivist oder verachte Aktivisten. Diese gegensätzlichen Positionen – und der eng damit zusammenhängende Widerwille, Position zu beziehen – überschneiden sich an dem Punkt, dass Tiereessen von Bedeutung ist. Ob und wie wir Tiere essen, berührt etwas Tiefsitzendes. Fleisch ist verbunden mit der Frage, wer wir sind und wer wir sein möchten, vom Buch Genesis bis zum neuesten Agrargesetz. Es wirft wichtige philosophische Fragen auf und ist eine über 140 Milliarden Dollar schwere Industrie[31], die fast ein Drittel der Landfläche auf dem Planeten einnimmt,[32] marine Ökosysteme formt[33] und womöglich über die Zukunft des Weltklimas entscheidet[34]. Und dennoch scheinen sich unsere Gedanken immer nur entlang der Randzonen der Auseinandersetzung zu bewegen – der logischen Extreme – und weniger entlang der praktischen Realitäten. Meine Großmutter wollte kein Schwein essen, um ihr Leben zu retten, und auch wenn der Kontext ihrer Geschichte radikaler nicht sein könnte, scheinen viele Menschen auf ein solches Alles-oder-nichts-Bezugssystem zurückzugreifen, wenn sie über ihre täglichen Ernährungsentscheidungen diskutieren. Diese Art zu denken würden wir nie auf andere ethische Bereiche anwenden. (Stellen Sie sich vor, immer oder nie zu lügen.) Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich schon jemandem erzählt habe, dass ich Vegetarier bin, und der- oder diejenige dann auf eine Inkonsequenz in meiner Lebensführung hingewiesen oder versucht hat, in einem Argument, das ich nie angeführt habe, einen Fehler zu finden. (Ich hatte nicht selten den Eindruck, dass mein Vegetarismus solchen Leuten wichtiger ist als mir.)
Wir brauchen eine bessere Gesprächskultur, wenn wir über das Essen von Tieren reden. Fleisch muss genauso oft im Mittelpunkt der Diskussion stehen, wie es mitten auf unserem Teller liegt. Das heißt nicht, dass wir so tun müssen, als wären wir uns in allem einig. Auch wenn wir uns vielleicht ziemlich sicher sind, was für uns persönlich richtig ist und sogar für andere, wissen wir doch alle von vornherein, dass unsere Positionen mit denen unserer Nachbarn im Widerspruch stehen. Wie gehen wir mit dieser unumstößlichen Wahrheit um? Lassen wir die Diskussion darüber zu, oder suchen wir einen Weg, sie neu zu führen?
Krieg
AUF ZEHN THUNFISCHE, Haie und andere große Raubfische, die vor 50 bis 100 Jahren in unseren Meeren schwammen, kommt heute nur noch einer.[35] Viele Wissenschaftler sagen die völlige Auslöschung aller gefischten Arten in weniger als 50 Jahren voraus – und trotzdem wird alles getan, um noch mehr Meerestiere zu fangen, zu töten und zu essen.[36] Unsere Lage ist so ernst, dass Forscher vom Fisheries Centre der University of British Columbia behaupten, dass »unser Umgehen mit Fischereiressourcen [auch Fisch genannt] inzwischen einem Vernichtungskrieg gleicht«.[37]
Mir wurde klar, dass Krieg genau das richtige Wort ist, um unsere Beziehung zu Fischen zu beschreiben – es beinhaltet die Methoden und Technologien, die wir gegen sie einsetzen, und unseren Herrschergeist. Je mehr ich über die landwirtschaftliche Nutztierhaltung wusste, umso mehr begriff ich, dass die radikalen Veränderungen im Fischfang der letzten 50 Jahre für etwas weitaus Größeres stehen. Wir führen einen Krieg gegen alle Tiere, die wir essen, oder genauer gesagt, wir lassen einen Krieg gegen sie führen. Dieser Krieg ist neu und hat einen Namen: »Massentierhaltung«.
Die Massentierhaltung ist, ähnlich wie Pornografie, schwer zu erklären, aber leicht zu erkennen. Im engeren Sinn handelt es sich dabei um ein System der intensiven und industriellen Landwirtschaft, in dem Tiere – oft zu Zehn- oder Hunderttausenden –, genetisch optimiert, in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt werden und unnatürliches Futter erhalten (dem fast immer verschiedene Medikamente wie zum Beispiel Antibiotika zugesetzt sind). Weltweit stammen heutzutage jährlich etwa 450 Milliarden Landtiere aus Massentierhaltung. (Für Fische gibt es keine Zahlen.)[38] In Amerika werden 99 Prozent aller Landtiere, die gegessen werden oder Milch und Eier produzieren, in Massentierhaltung gezüchtet. Wenn wir also heute über das Essen von Tieren sprechen, müssen wir – auch wenn es bedeutende Ausnahmen gibt – über Massentierhaltung sprechen.[39]
Massentierhaltung ist weniger von einem Maßnahmenkatalog als von einer Geisteshaltung bestimmt: Die Produktionskosten werden auf das absolute Minimum gedrückt, und Kosten wie Umweltzerstörung, Krankheiten beim Menschen und das Leiden der Tiere werden systematisch ignoriert oder nach außen verlagert. Jahrtausendelang orientierten die Landwirte sich an den Zyklen der Natur. In der Massentierhaltung gilt die Natur als etwas zu Überwindendes.